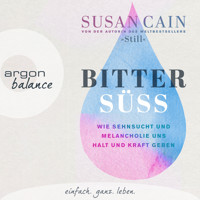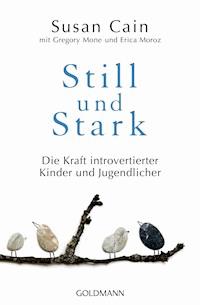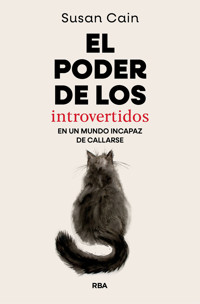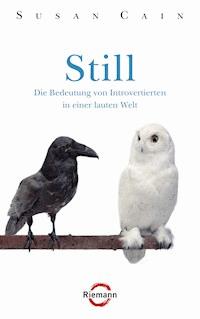
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
Selbstsicheres Auftreten und die Beherrschung von Small Talk sind nicht alles. Susan Cains glänzendes Plädoyer für die Qualitäten der Stillen.
„Ein leerer Topf klappert am lautesten“. Aber wer der Welt etwas Bedeutendes schenken will, benötigt Zeit und Sorgfalt, um es in Stille reifen zu lassen. „Still“ ist ein Plädoyer für die Ruhe, die in unserer Welt des Marktgeschreis und der Klingeltöne zu verschwinden droht. Und für leise Menschen, die lernen sollten, zu ihrem „So-Sein“ zu stehen. Ohne sie hätten wir heute keine Relativitätstheorie, keinen „Harry Potter“, keine Klavierstücke Chopins, und auch die Suchmaschine „Google“ wäre nie entwickelt worden. „Still“ baut eine Brücke zwischen den Welten, kritisiert aber das gesellschaftliche Ungleichgewicht zugunsten der Partylöwen und Dampfplauderer. Es herrscht eine „extrovertierte Ethik“, die stille Wasser zwingt, sich anzupassen oder unterzugehen. Ihre Eigenschaften – Ernsthaftigkeit, Sensibilität und Scheu – gelten eher als Krankheitssymptome denn als Qualitäten. Zu unrecht, sagt Susan Cain, und stellt sich gegen den Trend, der „selbstbewusstes Auftreten“ verherrlicht. „Still“ ist das Kultbuch für Introvertierte, hilft aber auch Extrovertierten, ihre Mitmenschen besser zu verstehen.
Entdecke auch das Arbeitsbuch Still – So entdecken introvertierte Menschen Schritt für Schritt ihre Stärken von Susan Cain.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Ähnliche
Buch
»Ein leerer Topf klappert am lautesten.« Aber wer der Welt etwas Bedeutendes schenken will, benötigt Zeit und Sorgfalt, um es in Stille reifen zu lassen. Mehr als ein Drittel aller Menschen sind introvertiert. Ihre Eigenschaften wie Ernsthaftigkeit, Sensibilität und Scheu gelten heute eher als Krankheitssymptome denn als Qualitäten. Zu Unrecht, sagt Susan Cain, und argumentiert gegen den Trend vieler Ratgeber, die »selbstbewusstes Auftreten« verherrlichen.
Susan Cain arbeitet als Trainerin für Verhandlungstechniken. Sie weiß um die Probleme der Introvertierten, hat aber auch erfahren, welches Potenzial in ihnen steckt. Denn gerade sie können mit ihren Stärken punkten, zu denen Sorgfalt, Rücksicht und die Fähigkeit zuzuhören zählen. Still ist ein Werk der Ermutigung für Menschen, die bisher noch mit ihrem ruhigen Wesen hadern – und wirbt zugleich bei den Extravertierten um mehr Toleranz.
Autorin
Susan Cain studierte an der Harvard Law School und der Princeton University und arbeitete danach als Anwältin für Körperschaftsrecht in einem Wall-Street-Unternehmen, wo sie u.a. Goldman Sachs und GE Capital vertrat und die Verhandlungen für Milliarden-Dollar-Geschäfte führte. Seit über zehn Jahren ist sie als Trainerin für Verhandlungsführung tätig und hat eine eigene Beratungsfirma, The Negotiation Company. Zu ihren Kunden gehören Microsoft und Google. Humanistisch-ethische Prinzipien sind ihr wichtig in ihrer Arbeit, und sie geht davon aus, dass das Gelingen von Verhandlungen Selbsterkenntnis voraussetzt.
Susan Cain
Still
Die Kraft der Introvertierten
Aus dem Amerikanischen von Franchita Mirella Cattani und Margarethe Randow-Tesch
Aktualisierte und erweiterte Ausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Aktualisierte und erweiterte Ausgabe August 2013 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München Copyright © der Originalausgabe 2011 by Susan Cain Originaltitel: »Quiet. The Power of Introverts in a World that can’t stop talking« Originalverlag: The Crown Publishing Group, New York Lektorat: Gerhard Juckoff Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München, in Anlehnung an die Gestaltung der HC-Ausgabe (Büro Jorge Schmidt) Coverabbildung: © plainpicture/Maskot DF · Herstellung: Str.
ISBN 978-3-641-10621-8V006
www.goldmann-verlag.de
Die deutschsprachige Ausgabe ist zuerst im Riemann Verlag unter dem Titel »Still. Die Bedeutung von Introvertierten in einer lauten Welt« erschienen.
Für die Familie meiner Kindheit
Eine Gattung, in der jeder ein General Patton wäre, wäre ebenso wenig erfolgreich wie ein Volk, das nur aus van Goghs bestünde. Ich denke eher, dass die Erde Sportler, Philosophen, Sexsymbole, Maler und Wissenschaftler braucht; sie braucht die Warmherzigen, die Kaltherzigen und die Kleinherzigen. Sie braucht Menschen, die ihr Leben der Fragestellung widmen, wie viele Wassertröpfchen die Speicheldrüsen von Hunden unter bestimmten Umständen absondern, und sie braucht Menschen, die die flüchtige Impression von Kirschblüten in einem 17-silbigen Gedicht einfangen oder eine 25-seitige Analyse über die Gefühle eines kleinen Jungen verfassen können, der im Dunkeln im Bett liegt und darauf wartet, dass seine Mutter ihm einen Gutenachtkuss gibt … Wenn jemand außergewöhnliche Talente besitzt, setzt das voraus, dass die für andere Gebiete benötigte Energie von diesen abgezogen wurde.
Allen Shawn
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Ich habe an der Niederschrift dieses Buches seit 2005 gearbeitet und an seinem Inhalt, seitdem ich erwachsen bin. Ich habe mit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen über die im Buch behandelten Themen gesprochen oder korrespondiert und ebenso viele Bücher, wissenschaftliche Aufsätze, Zeitschriftenartikel, Diskussionen in Internetforen und Blogbeiträge gelesen. Einige dieser Menschen und Schriften werden im Buch explizit erwähnt, andere sind geistig an fast jedem Satz beteiligt, den ich geschrieben habe. Das Buch verdankt seine Einsichten all diesen Menschen, besonders den Wissenschaftlern und Forschern, die mich so viel gelehrt haben. In einer perfekten Welt hätte ich jeden und alle namentlich erwähnt. Doch aus Gründen der Lesbarkeit erscheinen einige Namen nur in den Anmerkungen und in der Danksagung.
Aus denselben Gründen habe ich in einigen Zitaten auf Auslassungspunkte oder eckige Klammern verzichtet, aber darauf geachtet, dass die Einfügungen oder Auslassungen nicht den Sinn der Aussagen verfälschen. Wenn Sie eine der schriftlichen Quellen im Original zitieren möchten, finden Sie die Anmerkungen mit den Stellenangaben im Anhang.
Bei einem Teil der Personen, deren Geschichte ich erzähle, habe ich die Namen und andere Erkennungsmerkmale geändert. Das gilt vor allem für die Geschichten aus meiner eigenen Arbeit als Rechtsanwältin und Beraterin. Um die Privatsphäre der Teilnehmer in Charles di Cagnos Rhetorikseminar (Kapitel 5) zu wahren, die bei der Anmeldung für das Seminar nicht vorhatten, Gegenstand eines Buches zu werden, ist die Darstellung meiner ersten Seminarsitzung eine aus mehreren Abenden zusammengesetzte Schilderung. Dasselbe gilt für die Geschichte von Greg und Emily; sie basiert auf vielen Gesprächen mit ähnlichen Paaren. Unter Vorbehalt meines beschränkten Gedächtnisses werden alle anderen Geschichten so wiedergegeben, wie sie sich ereignet haben oder mir erzählt wurden. Ich habe die Geschichten, die meine Gesprächspartner von sich erzählt haben, nicht nachgeprüft, aber nur solche aufgenommen, die ich für wahr hielt.
TEIL I
Das Ideal der Extraversion
KAPITEL 1
Der Aufstieg des »wirklich netten Kerls«
Wie die Extraversion zum gesellschaftlichenIdeal wurde
Fremde Blicke sind scharf und kritisch. Können Sie ihnen stolz, selbstbewusst und ohne Angst begegnen?
Aus einer Anzeige für Woodbury-Seife, 1922
Das Jahr: 1902. Der Ort: eine Kleinstadt in einer Flussniederung in Missouri, ein winziger Punkt auf der Landkarte etwa 150 Kilometer von Kansas City entfernt. Unser junger Protagonist: ein gutmütiger, aber unsicherer Highschool-Schüler namens Dale.1
Dale, dünn, unsportlich und nervös, ist der Sohn eines anständigen, aber chronisch bankrotten Schweinebauern, dessen Land im Winter gefroren und zur Erntezeit überschwemmt ist. Er achtet seine Eltern, aber ihm graut davor, ebenso wie sie in der Armutsfalle zu landen. Dale fürchtet sich noch vor anderen Dingen: vor Donner und Blitz, vor dem Gedanken, in die Hölle zu kommen, und davor, im entscheidenden Augenblick kein Wort herauszubringen. Er hat sogar Angst vor dem Tag seiner Hochzeit: Was, wenn ihm nichts einfällt, was er seiner Braut sagen kann?
Eines Tages kommt ein Redner der Chautauqua-Bewegung in die Stadt. Diese Bewegung, gegründet 1873 mit Sitz in Upstate New York, schickt talentierte Redner durchs ganze Land, um Vorträge über Literatur, Wissenschaft und Religion zu halten. Die amerikanische Landbevölkerung schätzt sie, weil sie den Duft der großen weiten Welt mitbringen und es schaffen, das Publikum mitzureißen. Dieser Redner fesselt den jungen Dale mit einem Bericht über seinen Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär: Ehemals ein armer Farmjunge mit einer trostlosen Zukunft, hat er es mithilfe seines Rednertalents in die Chautauqua-Bewegung geschafft. Dale hängt an seinen Lippen.
Einige Jahre später ist Dale wieder einmal beeindruckt vom Nutzen, den es hat, reden zu können. Seine Familie zieht auf eine Farm in der Nähe von Warrensburg in Missouri, wo er das College besuchen kann, ohne Kost und Logis bezahlen zu müssen. Dale beobachtet, dass die Studenten, die Rhetorik-Wettbewerbe auf dem Campus gewinnen, als Führungspersönlichkeiten gelten, und beschließt, einer von ihnen zu werden. Er schreibt sich für jeden Rhetorik-Wettbewerb ein und eilt abends nach Hause, um zu üben. Immer wieder verliert er – Dale ist hartnäckig, aber kein großer Redner –, doch nach und nach machen sich seine Bemühungen bezahlt. Er verwandelt sich in einen Meisterredner und Held auf dem Campus. Andere Studenten suchen ihn auf, um bei ihm Rhetorikunterricht zu nehmen. Er gibt ihnen Stunden, und auch sie haben Erfolg bei den Wettbewerben.
Als Dale 1908 das College abschließt, sind seine Eltern noch immer arm, doch die amerikanischen Unternehmen florieren. Henry Ford verkauft sein Modell T wie warme Semmeln mit dem Slogan »FÜRS GESCHÄFT UND FÜRS VERGNÜGEN«. J. C. Penney, Woolworth, Sears and Roebuck, A & P und Remington sind inzwischen in aller Munde. In die Häuser der Mittelschicht hat das elektrische Licht Einzug gehalten, und Toiletten im Haus ersparen den mitternächtlichen Gang aufs Plumpsklo.
Der Wirtschaftsaufschwung ruft nach einer neuen Art Mensch – einem kontaktfreudigen Vertreter mit einem gewinnenden Lächeln und festen Händedruck, der gut mit seinen Kollegen auskommt und sie gleichzeitig in den Schatten stellt. Dale schließt sich dem wachsenden Heer der Vertreter und Verkäufer an mit nicht viel mehr im Gepäck als seiner Sprachgewandtheit.
Dales Nachname lautet Carnegie (eigentlich Carnagey; in Anklang an den großen Industriellen Andrew Carnegie lässt er ihn später in Carnegie umändern). Nach mehreren zermürbenden Jahren als Vertreter eines Rindfleischproduzenten macht er sich als Rhetoriklehrer selbstständig. Er gibt seine erste Stunde in der Abendschule des Christlichen Vereins Junger Männer in New York. Er fordert die damals für Abendschullehrer übliche Entlohnung von zwei Dollar pro Unterrichtsstunde, doch der Direktor des CVJM bezweifelt, dass sein Rhetorikunterricht auf großes Interesse stoßen wird, und weigert sich, so viel zu zahlen.
Aber der Unterricht wird über Nacht zur Sensation, und Dale gründet als Nächstes das Dale-Carnegie-Institut, das Geschäftsleuten helfen will, genau die Unsicherheiten zu überwinden, die ihn als jungen Mann gebremst haben. Im Jahre 1913 veröffentlicht er sein erstes Buch Besser miteinander reden. »In der Zeit, als Klaviere und Badezimmer noch Luxus waren«, schreibt er, »hielten die Leute das Redetalent für eine besondere Gabe, die nur Anwälte, Priester oder Politiker brauchten. Heutzutage ist uns klar geworden, dass es die unentbehrliche Waffe all jener ist, die im unerbittlichen Wettbewerb der Geschäftswelt vorankommen wollen.«2
Carnegies Metamorphose vom Farmjungen zum Verkäufer und schließlich zur Rhetorik-Ikone ist auch ein Symbol für den Aufstieg des »Ideals der Extraversion«. Carnegies Werdegang reflektiert eine kulturelle Entwicklung, die mit Beginn des 20. Jahrhunderts eine Trendwende eingeläutet und eine dauerhafte Veränderung darin bewirkt hat, wer wir sind und wen wir bewundern, wie wir uns bei Vorstellungsgesprächen verhalten und was wir von Angestellten erwarten, wie wir Partner umwerben und Kinder erziehen. Amerika verwandelte sich von einer »Charakterkultur«, wie der einflussreiche Kulturhistoriker Warren Susman es nannte, in eine »Persönlichkeitskultur«.3 Damit öffnete sich eine Büchse der Pandora mit persönlichen Ängsten, von denen wir uns nie ganz erholt haben.
In der Charakterkultur war der Idealmensch ernsthaft, diszipliniert und ehrbar. Was zählte, war nicht so sehr der Eindruck, den man in der Öffentlichkeit hinterließ, sondern wie man sich verhielt, wenn niemand zugegen war. Das Wort personality (Persönlichkeit) hält erst mit dem 18. Jahrhundert Einzug in die englische Sprache,4 und die Vorstellung von »einer guten Persönlichkeit« war vor dem 20. Jahrhundert nicht verbreitet.
Doch mit dem Wechsel zur Persönlichkeitskultur fingen die Amerikaner an, vor allem darauf zu schauen, wie andere sie wahrnahmen. Sie waren fasziniert von Menschen, die forsch und unterhaltsam waren. Susman schrieb den berühmten Satz: »Die gesellschaftliche Rolle, die jedem in der neuen Persönlichkeitskultur abverlangt wurde, war die eines Darstellers. Jeder Amerikaner sollte sich selber darstellen können.«
Die zunehmende Industrialisierung war eine wichtige Triebfeder hinter dieser kulturellen Entwicklung. Das Land entwickelte sich rasch von einer Agrargesellschaft mit ländlicher Besiedlung zu einer urbanen Wirtschaftsmacht, deren Devise hieß: THE BUSINESS OF AMERICA IS BUSINESS (»Amerikas Geschäft ist das Geschäft«). Anfänglich lebten die meisten Amerikaner wie die Carnegies noch auf einer Farm oder in kleinen Städten und pflegten Umgang mit Leuten, die sie von Kindheit an kannten. Doch mit Beginn des 20. Jahrhunderts brach ein regelrechter Sturm los – es kam zur Gründung von Großunternehmen, zur Urbanisierung und Masseneinwanderung –, und die Bevölkerung strömte in die Städte. 1790 lebten 3 Prozent und 1840 erst 8 Prozent der amerikanischen Bevölkerung in der Stadt, doch schon 1920 waren mehr als ein Drittel der Menschen Städter.5 »Wir können nicht alle in der Stadt wohnen«, schrieb der Redakteur Horace Greeley 1867, »aber fast alle scheinen es unbedingt zu wollen.«6
Nun waren die Amerikaner bei der Arbeit nicht mehr mit Nachbarn, sondern mit Fremden konfrontiert. »Staatsbürger« wurden zu »Angestellten«, die sich Mühe geben mussten, einen guten Eindruck auf Menschen zu machen, mit denen sie weder staatsbürgerliche noch familiäre Bande hatten. »Warum ein Mann befördert oder eine Frau gesellschaftlich geschnitten wurde«, erläutert der Historiker Roland Marchand, »ließ sich nun weniger durch jahrelange familiäre Bande oder alte Familienfehden erklären. Bei den zunehmend anonymen geschäftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen der Zeit konnte alles Mögliche – einschließlich des ersten Eindrucks – die entscheidende Rolle spielen.«7 Die Amerikaner reagierten auf diesen Druck, indem sie sich bemühten, Verkäufer zu werden, die nicht nur das neueste Produkt ihrer Firma, sondern auch sich selbst gut vermarkteten.
An der Selbsthilfe-Bewegung, in der Dale Carnegie eine so herausragende Rolle spielte, lässt sich besonders gut ablesen, wie sich der Wandel von der Charakter- zur Persönlichkeitskultur vollzog. Selbsthilferatgeber haben für die amerikanische Psyche schon immer eine große Rolle gespielt. Die ersten Ratgeber dieser Art waren meist religiöse Parabeln, wie die 1678 veröffentlichte Pilgerreise zur ewigen Seligkeit von John Bunyan, in der die Leser ermahnt wurden, sich zu zügeln, wenn sie in den Himmel kommen wollten. Die Ratgeber des 19. Jahrhunderts waren bereits weniger religiös, predigten jedoch immer noch den Wert eines edlen Charakters. Sie kreisten um geschichtliche Helden, wie Abraham Lincoln, der nicht nur als begabter Redner, sondern auch als bescheidener Mensch verehrt wurde, jemand, der nicht »durch Überlegenheit beleidigte«, wie Ralph Waldo Emerson sagte. Es wurden auch normale Leute gepriesen, die ein sehr moralisches Leben führten. In einem beliebten Ratgeber von 1899, Charakter – eine Macht,8 wurde eine schüchterne Verkäuferin beschrieben, die ihren ärmlichen Lohn einem frierenden Bettler schenkte und davoneilte, bevor jemand ihr gutes Werk beobachten konnte. Ihre Tugend, so begriff der Leser, zeigte sich nicht nur in ihrer Großzügigkeit, sondern auch in ihrem Wunsch, anonym zu bleiben.
Doch schon 1920 befassten sich die beliebten Selbsthilfebücher nicht mehr mit innerer Tugend, sondern mit dem äußeren Eindruck, mit dem Wissen, »was man sagt und wie man es sagt«, wie es in einem dieser Bücher hieß. In einem anderen stand: »Die Entwicklung der Persönlichkeit macht souverän.« Und ein drittes riet: »Versuchen Sie unbedingt, sich Manieren zuzulegen, die anderen den Eindruck vermitteln, dass Sie ›ein wirklich netter Kerl‹ sind. Damit legen Sie den Keim für den Ruf, eine Persönlichkeit zu sein.«9 Die Zeitschrift Success und die Saturday Evening Post richteten Ressorts ein, die sich damit befassten, Leser in die Kunst der Konversation einzuführen. Orison Swett Marden, derselbe Autor, der 1899 Charakter – eine Macht geschrieben hatte, veröffentlichte 1922 ein weiteres beliebtes Buch: Masterful Personality.
Viele dieser Ratgeber waren für Geschäftsleute gedacht, doch auch den Frauen wurde dringend empfohlen, an einer geheimnisvollen Eigenschaft namens »Faszination« zu arbeiten. In den 1920er Jahren aufzuwachsen war für Frauen, wie es in einem Schönheitsratgeber warnend hieß, mit einem solchen Konkurrenzkampf verbunden im Vergleich zu dem, was ihre Großmütter gekannt hatten, dass sie eine sichtbare Ausstrahlung haben mussten. »Die Menschen, die auf der Straße an uns vorübergehen, können nicht wissen, dass wir intelligent und charmant sind, wenn wir nicht danach aussehen.«
Solche Ratschläge, die angeblich dazu dienen sollten, das Leben der Menschen zu verbessern, mussten sogar verhältnismäßig selbstbewussten Menschen ein Gefühl der Unsicherheit vermitteln. Warren Susman zählte die Wörter, die in den vom Persönlichkeitskult motivierten Ratgebern zu Beginn des 20. Jahrhunderts am häufigsten vorkamen, und verglich sie mit den Charakter-Ratgebern des 19. Jahrhunderts. Letztere hatten Tugenden hervorgehoben, an deren Verbesserung jeder arbeiten konnte, zum Beispiel:
bürgerliches Engagement Pflichtbewusstsein Fleiß Hilfsbereitschaft Ehre Ruf Moral Manieren Integrität
In den neuen Ratgebern hingegen wurden Eigenschaften angepriesen, die man sich ungeachtet der Behauptungen Dale Carnegies nur schwer aneignen konnte. Entweder besaß man sie oder nicht. Man war wünschenswerterweise:
unwiderstehlich faszinierend atemberaubend attraktiv strahlend dominant kraftvoll energiegeladen
Es war kein Zufall, dass die Amerikaner in den 1920er und 1930er Jahren anfingen, sich für Kinostars zu begeistern.10 Wer konnte besser als ein Leinwandheld oder eine Leinwandheldin persönliche Unwiderstehlichkeit verkörpern?
Auch von der Werbebranche erhielten die Amerikaner Ratschläge zur Selbstdarstellung, ob es ihnen passte oder nicht. Während die ersten Anzeigen in Zeitschriften ein Produkt einfach nur ankündigten – »EATON’S HIGHLAND LEINENPAPIER: DAS NEUESTE UND FEINSTE SCHREIBPAPIER«11 –, gab die neue Werbung im Rahmen der Persönlichkeitskultur den Konsumenten die Rolle von Schauspielern mit Lampenfieber, von dem sie nur das Produkt des Anbieters befreien konnte. Diese Werbung konzentrierte sich zwanghaft auf die abschätzigen Blicke der Umgebung. »DIE MENSCHEN IN IHRER UMGEBUNG BEURTEILEN SIE STUMM«, warnte 1922 eine Werbung für Woodbury-Seife.12 »SIE WERDEN GERADE VON KRITISCHEN BLICKEN DURCHBOHRT«, lautete der Werbeslogan für Williams-Rasiercreme.13
Man sprach direkt die Ängste von Verkäufern, Vertretern und Angestellten an. In einer Werbung für Zahnbürsten von Dr. West fragte ein erfolgreich aussehender Mann hinter einem Schreibtisch, den Arm selbstbewusst in die Taille gestemmt: »HABEN SIE SCHON MAL PROBIERT, SICH AN SICH SELBST ZU VERKAUFEN? EIN GUTER ERSTER EINDRUCK IST FÜR DEN ERFOLG IM GESCHÄFTSLEBEN ODER BEI ANDEREN MENSCHEN DAS ALLERWICHTIGSTE.«14 Auf einer weiteren Werbung für Williams-Rasiercreme war ein Mann mit glattem Haar und Schnurrbart zu sehen, der den Lesern eindringlich empfahl: »SCHAUEN SIE SELBSTBEWUSST IN DIE WELT, NICHT SORGENVOLL! AM HÄUFIGSTEN WERDEN SIE NACH IHRER MIENE BEURTEILT.«15
Andere Werbekampagnen erinnerten Frauen daran, dass ihr Erfolg bei der Partnersuche nicht nur vom Aussehen, sondern auch von der Persönlichkeit abhing. 1924 zeigte eine Anzeige für Woodbury-Seife eine niedergeschlagene junge Frau, die nach einem enttäuschenden Rendezvous allein nach Hause kam. Sie hatte »davon geträumt, erfolgreich, fröhlich und hinreißend« zu sein, lautete der mitfühlende Text.16 Doch ohne die richtige Seife war die Frau beim anderen Geschlecht zum Scheitern verurteilt.
Von der Firma Lux gab es eine Waschmittelwerbung, in der eine Frau einen verzweifelten Brief an Dorothy Dix, die damalige Zeitungs-Ratgebertante, richtete, in dem es hieß: »Liebe Miss Dix, was kann ich tun, um beliebter zu werden? Ich bin hübsch und nicht dumm, aber so schüchtern und befangen im Umgang mit anderen … ich glaube immer, dass niemand mich mag. Joan G.«17
Miss Dix’ Antwort war eindeutig: Mit dem richtigen Waschmittel für ihre Wäsche, Vorhänge und Sofakissen würde Joan G. schon bald »tief und fest von ihrer Anziehungskraft überzeugt sein«.
In der Darstellung der Partnersuche als risikoreichem Spiel spiegelten sich die kühnen neuen Sitten der Persönlichkeitskultur. Unter den restriktiven (manchmal repressiven) sozialen Vorschriften der Charakterkultur hatten beide Geschlechter ein gewisses Maß an Reserviertheit an den Tag gelegt, wenn es um das Paarungsverhalten ging. Frauen, die zu laut waren oder ungebührlichen Augenkontakt mit Fremden aufnahmen, wurden für schamlos gehalten. In den gehobeneren Schichten war es Frauen eher gestattet zu sprechen als in den unteren Schichten, und teilweise galt ihr Talent für geistreiche Erwiderungen sogar als Beurteilungsmaßstab, aber selbst ihnen wurde geraten, öfter mal zu erröten und die Augen niederzuschlagen. In Benimmbüchern hieß es: »Die kühlste Zurückhaltung an einer Frau, die ein Mann ehelichen will, ist bewundernswerter als der geringste Anflug ungehöriger Vertraulichkeit.« Auch Männer konnten im Allgemeinen ein ruhiges Auftreten haben, das Selbstbeherrschung und eine Souveränität demonstrierte, die sich nicht zur Schau zu stellen brauchte. Schüchternheit an sich war zwar inakzeptabel, aber Zurückhaltung ein Zeichen guter Erziehung.
Doch mit dem Aufkommen der Persönlichkeitskultur bröckelte der Wert guter Sitten sowohl für Frauen als auch für Männer. Statt förmlicher Besuche und ernsthafter Absichtserklärungen mussten die Männer nun eine wortgewandte Werbung inszenieren, in der sie die Frau »um den Finger wickelten«. War ein Mann in der Gesellschaft von Frauen allzu wortkarg, lief er Gefahr, für homosexuell gehalten zu werden. Ein verbreiteter Sexualratgeber aus dem Jahre 1926 bescheinigte Homosexuellen, »ausnahmslos schüchtern, ängstlich und zurückgezogen« zu sein. Auch von Frauen erwartete man eine Gratwanderung zwischen Schicklichkeit und Kühnheit. Waren sie zu schüchtern, besonders in puncto Sexualität, so nannte man sie manchmal »frigide«.
Auch auf dem Gebiet der Psychologie begann man, sich mit dem Druck, Selbstvertrauen ausstrahlen zu müssen, auseinanderzusetzen. In den 1920er Jahren entwickelte der einflussreiche Psychologe Gordon Allport einen diagnostischen Test zum Thema »Vormachtstellung und Unterordnung«, um soziale Dominanz zu messen. »In der heutigen Zivilisation«, sagte Allport, der selbst schüchtern und zurückhaltend war, »scheint der aggressive Tatmensch hoch im Kurs zu stehen«.18 1921 beschrieb C. G. Jung die mittlerweile prekäre »Introversion«. Jung selbst betrachtete die Introvertierten als »Kulturförderer und Erzieher«, die den »Reichtum der inneren Anschauung« vor Augen führten, »die unsere Kultur schmerzlicherweise vermissen lässt«. Aber er gab auch zu, dass ihre »Zurückhaltung und anscheinend unbegründete Verlegenheit … natürlich ein Vorurteil der Umgebung gegen diesen Typ« wecken.19
Nirgendwo zeigte sich die Notwendigkeit, selbstsicher zu erscheinen, deutlicher als in einem neuen psychologischen Konzept, das als »Minderwertigkeitskomplex« bezeichnet wurde. Der Begriff wurde in den 1920er Jahren vom Wiener Psychoanalytiker Alfred Adler geprägt, um Unzulänglichkeitsgefühle und ihre Folgen zu beschreiben. »Fühlen Sie sich unsicher? Sind Sie kleinmütig? Sind Sie unterwürfig?«, stand auf dem Einband der amerikanischen Ausgabe von Adlers Bestseller Menschenkenntnis.20 Adler zufolge haben alle Säuglinge und Kleinkinder Gefühle der Unzulänglichkeit, leben sie doch in einer Welt der Erwachsenen und älteren Geschwister. Im Prozess des Aufwachsens lernen sie normalerweise, diese Gefühle für ihre Ziele nutzbar zu machen. Doch wenn es in der Kindheit falsch läuft, kann ihnen der gefürchtete Minderwertigkeitskomplex drohen, und das ist ein gravierender Nachteil in einer Gesellschaft zunehmender Konkurrenz.
Die Vorstellung, ihre sozialen Ängste ordentlich in einen psychologischen Komplex verpacken zu können, sprach viele Amerikaner an. Der Minderwertigkeitskomplex wurde zur Allzweck-Erklärung für Probleme in vielen Lebensbereichen, von der Liebe über die Kindererziehung bis hin zur Karriere. 1924 stand in der Zeitschrift Collier’s ein Artikel über eine Frau, die Angst hatte, den Mann zu heiraten, den sie liebte, weil sie glaubte, er habe einen Minderwertigkeitskomplex und würde es nicht sehr weit bringen. In einer anderen beliebten Zeitschrift erklärte ein Artikel unter dem Titel »Ihr Kind und dieser moderne Komplex« Müttern, was bei Kindern einen Minderwertigkeitskomplex auslösen konnte und wie man dies verhinderte oder kurierte.
Jeder hatte anscheinend einen Minderwertigkeitskomplex, und paradoxerweise war er für einige eine Auszeichnung. Abraham Lincoln, Napoleon, Teddy Roosevelt, Edison und Shakespeare – sie alle litten laut einem Artikel in Collier’s von 1939 unter Minderwertigkeitskomplexen. »Wenn Sie also«, schloss der Artikel »einen dicken, fetten, ausgewachsenen Minderwertigkeitskomplex haben, können Sie sich glücklich schätzen, vorausgesetzt, Sie haben das dafür nötige Rückgrat.«21
Trotz des optimistischen Tenors dieses Artikels begannen Erziehungsberater in den 1920er Jahren Kindern beizubringen, wie man eine gewinnende Persönlichkeit entwickelt. Bis dahin hatten sich die Experten hauptsächlich über frühreife Mädchen und straffällige Jungen Sorgen gemacht, doch nun konzentrierten sich Psychologen, Sozialarbeiter und Ärzte auf das durchschnittliche Kind mit der »fehlangepassten Persönlichkeit«, insbesondere das schüchterne Kind. Schüchternheit könne schwerwiegende Folgen haben, mahnten sie, von Trunksucht bis hin zu Selbstmord, während eine kontaktfreudige Persönlichkeit Vorbedingung für gesellschaftlichen und finanziellen Erfolg sei. Den Eltern rieten sie, ihre Kinder gut zu sozialisieren, und den Schulen, ihr Hauptaugenmerk von Bücherwissen auf »die Unterstützung und Lenkung der heranreifenden Persönlichkeit« zu richten. Die Erzieher übernahmen diese Rolle mit Begeisterung. 1950 lautete das Motto der im Zuge der Jahrhundertmitte abgehaltenen Konferenz über Kinder und Jugendliche im Weißen Haus: »Eine gesunde Persönlichkeit für jedes Kind.«22
Wohlmeinende Eltern begannen sich der Meinung anzuschließen, Zurückgezogenheit sei inakzeptabel und Gruppenzugehörigkeit sowohl für Mädchen als auch für Jungen das erstrebenswerte Ideal. Sie rieten ihren Kindern von einsamen und ernsthaften Hobbys wie klassischer Musik ab, die sie unbeliebt machen könnten. Kinder wurden immer früher zur Schule geschickt, hauptsächlich, damit sie den Umgang mit anderen lernten. Introvertierte Kinder galten als Problemfälle (was heutigen Eltern von introvertierten Kindern nicht unbekannt sein dürfte).
William Whytes Buch Herr und Opfer der Organisation, das 1956 ein Bestseller in den USA war, stellt dar, wie Eltern und Lehrer sich zusammentaten, um die Persönlichkeit von introvertierten Kindern umzugestalten. »Johnny kam in der Schule nicht gut klar«, erzählte eine Mutter Whyte. »Der Lehrer erklärte mir, dass er im Unterricht gut mitkam, aber sein Sozialverhalten zu wünschen übrig ließ. Er spielte nur mit ein oder zwei Freunden, und manchmal blieb er auch ganz für sich.« Die Eltern waren mit entsprechenden Maßnahmen einverstanden, schrieb Whyte. »Mit Ausnahme von ein paar Einzelfällen sind die meisten Eltern dankbar, dass die Schulen sich solche Mühe geben, der Neigung zur Introversion und anderen lebensfernen Abnormalitäten entgegenzuwirken.«23
Die Eltern, die unter dem Einfluss dieses Wertesystems standen, waren weder unfreundlich noch unsensibel. Sie bereiteten ihre Kinder nur auf »das Leben« vor. Als diese Kinder groß waren und sich um einen Platz im College und später um ihre erste Stelle bewarben, waren sie mit denselben Normen der Gruppenzugehörigkeit konfrontiert.
Die Aufnahmegremien an den Universitäten suchten nicht nach den außergewöhnlichsten, sondern nach den extravertiertesten Bewerbern. Der damalige Rektor von Harvard Paul Buck erklärte Ende der 1940er Jahre, dass Harvard »sensible, neurotische« und »intellektuell überstimulierte« Kandidaten zugunsten von »gesunden, extravertierten jungen Männern« ablehnen sollte. 1950 ließ der Präsident von Yale Alfred W. Griswold verlauten, der ideale Yale-Student sei kein »düster blickender, hoch spezialisierter Intellektueller, sondern ein vielseitiger Mensch«.24 Ein anderer Dekan sagte zu Whyte, bei der Sichtung der Bewerbungen von Schulabgängern riete einem der gesunde Menschenverstand, nicht nur in Betracht zu ziehen, was das College wollte, sondern auch, was vier Jahre später die Personalbüros der Unternehmen wollten. »Sie mögen einen ziemlich geselligen, aktiven Typ«, sagte er. »Unserer Meinung nach ist der beste Kandidat jemand, der in der Schule relativ gut abgeschnitten hat und viele außerschulische Aktivitäten vorweisen kann. Mit ›brillanten‹ Introvertierten können wir wenig anfangen.«25