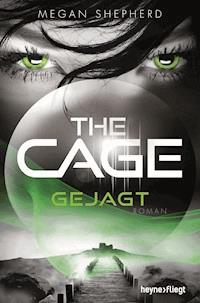9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: The Cage-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die 16-jährige Cora erwacht mitten in einer Wüste. Sie wurde offensichtlich entführt! Aber von wem? Und wo um Himmels willen ist sie gelandet? Denn an die Wüste grenzen eine arktische Tundra und das Meer, dahinter liegt eine filmkulissenartige Stadt. Fünf weitere Jugendliche irren durch die merkwürdige und, wie sich bald zeigt, sehr gefährliche Szenerie. Und dann tritt Cassian auf: ein unglaublich schöner junger Mann, der sich als ihr Wächter vorstellt. Ihr Wächter in einem Zoo, Millionen Kilometer von zu Hause entfernt. Eine Flucht scheint unmöglich zu sein. Bis sich zwischen Cora und Cassian eine verbotene Anziehung entwickelt. Doch kann Cora ihm genug vertrauen, um zu fliehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Ähnliche
MEGAN SHEPHERD
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Beate Brammertz
Das Buch
Die sechzehnjährige Cora wird entführt – und findet sich ohne irgendeine Erinnerung an das, was geschehen ist, in einer Wüste wieder. Und sie ist nicht allein: Ein Mädchen und drei Jungen teilen ihr Schicksal. Als sie die Umgebung erkunden, stellen sie fest, dass direkt an die Wüste die gegensätzlichsten Klimazonen angrenzen. Schlagartig begreifen sie, dass sie sich in einer künstlich angelegten Welt befinden. Doch warum? Und wer hat sie hierher gebracht? Auf der Suche nach Antworten stoßen sie auf den übermenschlich schönen Cassian, der sich als ihr Wächter zu erkennen gibt. Ein Blick in seine tiefschwarzen Augen, und Cora fürchtet, ihren Verstand zu verlieren. Doch den braucht sie mehr denn je. Denn die Hintergründe ihrer Entführung sind furchtbarer, als die Jugendlichen es sich je ausgemalt hätten. Sie werden beobachtet. Ihre gesamte Umgebung ist ein riesiger Käfig, aus dem es kein Entrinnen gibt. Sie sind die unfreiwilligen Teilnehmer eines gigantischen Experiments, unendlich weit von zu Hause entfernt …
Die Autorin
Megan Shepherd ist in den Bergen von North Carolina aufgewachsen. Die meiste Zeit verbrachte sie bereits als Kind in der Buchhandlung ihrer Eltern. Nach ihrem Studium (Kulturwissenschaften und Sprachen) ging sie für zwei Jahre in den Senegal, wo sie Kinder in Dorfschulen unterrichtete. Dabei entdeckte sie ihr großes Talent zum Geschichtenerzählen. Megan Shepherd lebt mit ihrem Mann auf einer Farm in North Carolina.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel The Cage bei
Balzer + Bray, HarperCollins Publishers, New York
Copyright © 2015 by Megan Shepherd
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkterstr. 28, 81673 München
Alle Rechte sind vorbehalten.
Redaktion: Babette Mock
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von © bigstock,
© Getty Images/Westend61 und © deposit photos/tanel
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-12256-0V002
www.heyne-fliegt.de
Für Jesse.
Für dich würde ich zu weit entfernten Planeten reisen –
und noch viel weiter.
1 – Cora
Es gibt Dinge, die der Verstand nicht erfassen kann. Tag für Tag sind die Menschen in immer gleichen Denkmustern gefangen: Wirf einen Apfel hoch, und er fällt zu Boden. Pflück eine Blume, und sie vertrocknet. Schlaf in deinem Bett ein, und du wachst am nächsten Morgen wieder darin auf.
Und jetzt das. Es war, als würde man einen Apfel hochwerfen und er sauste weiter in Richtung Sonne.
Cora Mason presste die Hände an die Schläfen, um das tosende Rauschen in ihren Ohren zu dämpfen. Völlig benommen war sie vor ein paar Minuten – oder waren es Stunden? – in einer scheinbar endlosen Wüste erwacht. Ihre Schlafzimmerfenster waren nun rostrote Dünen, die sich neben ihr zu zwanzig Meter hohen Bergen auftürmten. Ihre Decke war ein wolkenloser Himmel. Die Nachttischlampe war eine heiß glühende Sonne, die ihr die Haut versengte.
Wo auch immer sie sein mochte, in Virginia war sie definitiv nicht.
Und die Wüste war anders als jede, von der sie jemals gehört hatte. Hier gab es weder Kakteen noch verdorrte Erdklumpen mit trockenem Gras. Das hier war ein unvorstellbar riesiger Fleck Rot, der sich erstreckte, so weit das Auge reichte.
Träumte sie etwa? In ihren Träumen hatte sich ihr Mund allerdings nie so trocken angefühlt. Als ihr Vater damals zum Senator gewählt worden war, hatten seine Bodyguards Cora und ihrem Bruder Charlie beigebracht, was sie im Fall einer Entführung tun sollten – an Ort und Stelle bleiben, sich nicht wehren, auf Hilfe warten. Aber das war schon über zehn Jahre her. Damals war sie im Kindergarten gewesen. Galten dieselben Regeln noch für eine Sechzehnjährige? Es gab keine Fußspuren im Sand, keine Reifenspuren, kein Anzeichen, wie sie überhaupt hierhergekommen war.
Stechender Schmerz durchzuckte ihren Kopf. Mit einem Stöhnen presste sie die Finger fester auf die Schläfen. Noch vor wenigen Augenblicken hatte sie mit Charlie im Auto gesessen, den gefütterten Parka gegen die Kälte fest um sich geschlungen, während sie zu einem Wintersportort fuhren, an dem sie ihre Eltern treffen würden. Sie hatte die Füße auf das Armaturenbrett gelegt und Songtexte in ein Notizbuch gekritzelt.
»Was hältst du davon?«, hatte sie gefragt. »›Eine Fremde in meinem eigenen Leben, ein Geist hinter meinem Lächeln, nicht zu Hause im Paradies, nicht zu Hause in der Hölle‹?«
Charlie hatte gegrinst, als er nach links Richtung Skiort abgebogen war. »Nicht schlecht«, hatte er gesagt, »aber die Tochter eines Senators sollte keine Lieder über die Hölle singen.«
Jetzt, nur von Sand umgeben, spürte Cora, wie Panik in ihr aufstieg. Eigentlich müsste sie in diesem Jeep sitzen. Sie hatte fast zwei Jahre auf diesen Moment gewartet: wieder zu viert als Familie zusammen zu sein. Keine Sorgerechtsstreitigkeiten. Keine Politik und Reporter. Nur Winter in Virginia. Nur Anoraks und Schnee. Ihre Eltern, die mit heißer Schokolade auf sie warteten, zwar kein Paar mehr, aber auch keine erbitterten Feinde. Charlie und sie waren bereits nah genug gewesen, um das Skiresort hinter der nächsten Kurve auszumachen. Waren ihre Eltern dort, warteten sehnsüchtig auf sie und fragten sich, wie sie verschwunden sein konnte? Waren sie in Sicherheit?
Die Brise brannte ihr in den Augen und trug einen sonderbaren Geruch heran – Granit und Ozon. Als sie mit den Zähnen über ihre Zunge schabte, schmeckte sie ihn hinten am Gaumen. Er löste eine weitere Erinnerung aus. Einen Traum. Verschwommene Bilder eines wunderschönen Männergesichts – bronzefarbene Haut, dichte Brauen, geschlossene Augen –, die wie Irrlichter in ihrem Unterbewusstsein umherhuschten. Der Traum lockte sie zu sich, aber je mehr sie nach ihm greifen wollte, desto weiter schwebte er fort, immer frustrierend knapp außerhalb ihrer Reichweite. War dieser Mann ein realer Mensch? Oder war sie so lange bewusstlos gewesen, dass sie von einem Engel geträumt hatte?
Oder …
Bin ich tot?
Sie zog die Beine fest an die Brust. Tote schwitzten nicht – und sie war schweißgebadet. Sie war am Leben, sie musste nur herausfinden, wo sie war. Bleib, wo du bist, hatte der Bodyguard ihr eingebläut. Warte auf Hilfe. Aber falls sie hierbliebe, würde sie verdursten oder verbrennen. Sie schlang die Arme noch fester um die Beine, kämpfte gegen die stärker werdende Panik an und erinnerte sich an den Ratschlag, den ihre Mutter ihr erteilt hatte, wenn die Dinge sie zu überwältigen drohten.
Zähl rückwärts. Zehn. Neun. Acht …
Sie zwang sich aufzustehen. Sie würde Schatten suchen oder Wasser oder eine Stadt und dort auf Hilfe warten.
Sieben. Sechs …
Taumelnd setzte sie sich in Bewegung. Ein Schritt nach dem anderen. Eine Düne nach der anderen.
Panik packte sie, sie spürte kaum mehr ihre Beine, während sie immer weiter lief. Die brennende Sonne trocknete ihre Tränen zu salzigen Krusten, die sie jedes Mal spürte, wenn sie sich über die Lippen leckte. Sie beschattete die Augen und spähte blinzelnd zum Himmel in der Hoffnung auf einen Hubschrauber, aber da war nichts außer dieser unheimlichen Stille.
Wo waren die Entführer? Was hatte es für einen Sinn, sie mitten im Nirgendwo zurückzulassen?
Fünf …
Vor ihr stieg das Wüstental jäh zu einer steil aufragenden Düne an, höher als alle anderen. Sie starrte erschrocken zu der Sandwand, und ihr Körper geriet leicht ins Schwanken, als sie zu klettern begann. Hoch, immer höher, mehr kriechend als gehend, einen Schritt zurück für zwei Schritte nach vorne. Sie wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß vom Gesicht, da erstarrte sie.
Die Kleidung, in der sie steckte, gehörte nicht ihr.
Ihr Daunenanorak und ihre Skistiefel waren fort. Sie war barfuß, trug eine schwarze Skinny Jeans und ein zu großes T-Shirt mit dem Aufdruck einer Band, von der sie nie zuvor gehört hatte. Um die Handgelenke hatte sie dicke schwarze Armbänder. Punk-Style? Sie war mehr der Typ Spitzenröckchen und Baumwollkleid. Das einzige Konzert, das sie jemals besucht hatte, war die Garagenband ihres Nachbarn gewesen, und nach zehn Minuten hatte sie, die Hände auf die Ohren gepresst, die Flucht ergriffen.
Jetzt fuhr sie mit den Fingern über den weichen Stoff, unter dem ein weißer Streifen aufblitzte. Sie spähte in den Ausschnitt, und Angst schnürte ihr die Kehle zu. Unter der Kleidung trug sie ein weißes Tanktop und eine weiße Unterhose. Die nicht ihr gehörten. Wer auch immer sie hierhergebracht hatte, hatte sie zuerst wie eine Papierpuppe umgezogen und dann zum Sterben zurückgelassen. Bei dem Gedanken an fremde Hände überall auf ihrem Körper verkrampfte sich ihr Magen. Aber wessen Hände? Wer würde so etwas tun?
Keine Panik. Weiterzählen. Vier …
Soweit sie es beurteilen konnte, war sie abgesehen von dem Sonnenbrand unverletzt. Aber würde das so bleiben? Sie brauchte die Bodyguards ihres Vaters. Oder Charlie. All die Jahre während ihrer Kindheit, als ihr Dad in Washington gearbeitet und ihre Mutter den lieben langen Tag geschlafen hatte, hatte sich Charlie um sie gekümmert. Er war der einzige Mensch, auf den sie sich immer hatte verlassen können – Sadie ausgenommen, die wohl nicht zählte, weil sie ein Hund war. Charlie hatte ihr alte Folgen von Twilight Zone als Gutenachtgeschichte erzählt. Er hatte ihr gezeigt, wo sie ihr Notizbuch mit den Songtexten vor den neugierigen Augen ihrer Mutter verstecken konnte. Und vor einem halben Jahr hatte er sie abgeholt, als sie aus der Bay-Pines-Jugendstrafanstalt entlassen worden war. Er hatte sogar einen Reporter geschlagen, der ihr ein Mikrofon ins Gesicht gehalten und sie gefragt hatte, wie die Tochter eines ehrenwerten Senators, einst Klassenbeste, zu achtzehn Monaten Gefängnis wegen Totschlags verurteilt worden sein konnte.
Drei. Zwei …
Einer Rettungsleine gleich griff sie nach ihrer Kette. Für jedes Familienmitglied gab es einen Anhänger: eine Theatermaske für ihre Mom, einen Golfschläger für ihren Dad, ein winziges Flugzeug für Charlie, der Pilot werden wollte. Sie wünschte sich nichts weiter, als wieder bei ihnen zu sein, so nah wie die klimpernden Anhänger an ihrer Kette. Sie hatten das Skiresort fast erreicht, wo sie alle heiße Schokolade schlürfen würden, als wären sie wieder eine Familie –, doch ihre Finger griffen ins Leere.
Die Kette war verschwunden.
Ein Schauder jagte ihr den Rücken hinab. Erschrocken warf sie einen Blick über die Schulter, denn mit einem Mal hatte sie das Gefühl, als würde sie verfolgt werden. In den Dünen war niemand. Schwer atmend kletterte sie die letzten paar Meter zur höchsten Düne hinauf. Bitte, lass dort eine Straße sein. Ein Telefon. Einen Esel. Das Einzige, was sie keinesfalls sehen wollte, war eine weitere Düne und noch eine und noch eine, bis in alle Ewigkeit.
Mit brennenden Lungen erreichte sie den Gipfel, klopfte sich den Sand von den Händen und kniff die Augen zu. Sie holte tief Atem und beendete das Rückwärtszählen.
Eins.
Dann schlug sie die Augen auf.
2 – Cora
Von ihrem Aussichtspunkt aus hatte Cora einen perfekten Rundblick. Die Wüste erstreckte sich in unsteten Wellen hinter ihr, aber zu ihrer Linken war ein Fleck üppige schwarze Erde mit Obstbäumen zu sehen, die ihre Äste der Sonne entgegenstreckten, und Reihen an Gemüse in allen Regenbogenfarben: lilafarbene Auberginen, gelbe Kürbisse, rote Tomaten, goldener Mais.
Eine Farm?
Cora sackte zu Boden, als sich Schmerzen in ihren Schädel bohrten. Sie stieß einen Schrei aus, presste sich die Finger an die Schläfen. War sie mit Drogen vollgepumpt worden? War es das, was ihr Traum von ihrem wunderschönen Engel gewesen war, eine Halluzination? Sie blinzelte heftig, aber die Farm verschwand nicht.
Zähl rückwärts.
Zehn …
Sie zwang sich, nach rechts zu sehen, und wäre beinahe erstickt. Jenseits der Farm wand sich eine felsige, mit meergrünen Flechten überzogene Landzunge in ein Tal voller windgepeitschter Bäume. Riesige Eichen und Tannen und andere Nadelbäume, allesamt mit einer Schicht Weiß bestäubt. Nicht wie die kahlen Winterwälder von Virginia, sondern eine arktische Tundra. Eine kalte Brise wehte ihr ins Gesicht und trug eine Schneeflocke herbei, die auf Coras sonnenverbrannte Handfläche fiel. Mit aller Gewalt stemmte sie sich auf die Beine.
Scheiß aufs Zählen.
Nervös ging sie auf und ab und schüttelte heftig die Hand aus. Noch unwahrscheinlicher als alles andere war der Ausschnitt Wasser direkt vor ihr. Sanft plätschernde Wellen rollten auf eine Meeresbucht zu, was ihren Magen verkrampfen und nach unten sacken ließ, als würde sie aus großer Höhe herabstürzen. Sie spuckte den Phantomgeschmack von Salzwasser aus. Ein Ozean gehörte nicht hierher. Sie gehörte nicht hierher.
Trotz des Tundrawindes rann ihr Schweiß an den Schläfen hinunter. Auf der anderen Seite der Bucht zeichneten sich Berge ab und sogar etwas, das wie die Silhouette einer Stadt aussah. Eine Wüste, eine Farm, ein Ozean, ein Wald – Lebensräume, die so dicht nebeneinander nicht existieren konnten. Es musste sich um ein geheimes Biosphärenexperiment der Regierung handeln. Oder die Laune eines reichen Verrückten. Oder eine virtuelle Realität.
Der Granit- und Ozon-Geruch verstopfte ihr die Nase, und sie hätte fast das Gleichgewicht verloren. Sie war kein kleines Mädchen mehr – sie würde die Sache regeln. Sie musste die Sache regeln. Während sie allmählich ruhiger atmete, tauchte ein dunkler Fleck am Fuß des Hügels auf, wo das Meer gegen den Rand der Farm plätscherte.
Als sie die Augen zusammenkniff, verwandelte sich der Fleck in einen Menschen.
»Hallo!« Sie stolperte den Weg die Düne hinab. Ihre Füße verhedderten sich in den Grasballen, die den Boden bedeckten, während sich der Pfad zwischen Reihen von vollreifen Paprika hindurchschlängelte.
»Hallo! Ich brauche Hilfe!«
Der Weg endete an einem schmalen Strand. Die Person – ein dunkelhaariges Mädchen in einem weißen Sommerkleid – musste in Panik geraten sein, denn sie hatte sich im Sand zusammengerollt, starr vor Angst.
»Hallo!« Cora blieb wie angewurzelt am Ufer stehen, als das tiefschwarze Wasser und die Realität sie mit einem Mal trafen. Das Mädchen hatte sich nicht vor Panik zusammengerollt. Sie lag mit dem Gesicht nach unten in der Brandung, das Haar platt gedrückt. Wasser wogte um ihre reglosen Beine.
»O nein!« Cora kniff die Augen zu. »Steh auf! Bitte!«
Als sie die Augen wieder öffnete, lag das Mädchen immer noch reglos da. Cora zwang sich, in die Gischt zu treten, und zuckte zusammen, als das Wasser ihre Fußknöchel umspülte. Sie sank auf die Knie. In Bay Pines hatte sich eine der Insassinnen mit einer Plastiktüte erstickt. Cora hatte im Korridor Songtexte geschrieben, während die Polizei den Leichnam weggekarrt hatte: glasige Augen, blaue Lippen.
Genau wie bei diesem Mädchen.
Außer dass dieses Mädchen schlimme Blutergüsse an der Schulter hatte, als hätte jemand sie fest gepackt. Ein paar Sekunden hörte Cora nichts weiter als ihr eigenes Blut, das in ihren Ohren rauschte. Eine Tätowierung blitzte am Nacken des Mädchens über den blauen Flecken auf, ein Muster aus schwarzen Punkten, die Cora nichts sagten und die ihr auch nie etwas sagen würden, da sie das Mädchen nicht mehr befragen konnte. Hinter ihr lag der Wald vollkommen still da, und nur das leise Rieseln des Schnees bezeugte, dass die Welt nicht stehen geblieben war.
Sie rappelte sich auf. Mit einem Mal wirkte das Wasser kälter. Tiefer. Vielleicht bedeuteten diese Blutergüsse, dass das Mädchen ermordet worden war. Vielleicht war es auf der Flucht vor jemandem ertrunken. Egal, was geschehen sein mochte, Cora wollte nicht die Nächste sein.
Sie hastete aus dem Wasser. Bleib, wo du bist. Wehr dich nicht. Das war der Ratschlag, den sie als Kindergartenkind erhalten hatte. Aber wie könnte sie an dem Ort bleiben, an dem eine Leiche lag?
Schritte durchbrachen die Stille. Sie wirbelte herum, suchte die Bäume mit den Augen ab.
Dort.
Weiße Kleidung blitzte zwischen den Ästen auf. Zwei Beine. Ein Mensch. Coras Muskeln spannten sich an, um die Flucht zu ergreifen – oder zu kämpfen.
Ein Junge trottete aus dem Wald.
Er war ungefähr in ihrem Alter. Er trug Jeans und ein zerknittertes weißes Hemd unter einer Lederjacke und sah aus, als würde er nach einer durchzechten Nacht aus einem Billardsalon torkeln. Eine Fliegerbrille war in seine Jeanstasche gestopft. Er wirkte genauso fehl am Platz wie Cora – und war ebenfalls barfuß, so wie sie. Süß, auf eine zerzauste Art. Seine dunklen Haare fielen ihm in die braunen Augen. Er schien genauso überrascht, sie zu sehen, wie sie bei seinem Anblick war. Einen Moment lang starrten sie sich fassungslos an.
Er durchbrach die Anspannung als Erster. »Bist du …« Seine Worte erstarben, als er den Leichnam sah. »Ist sie tot?«
Er machte einen Schritt auf sie zu. Erschrocken wich Cora zurück, allzeit bereit zu fliehen. Er ließ einen Knöchel in seiner linken Hand knacken. Kräftige Hände, bemerkte Cora. Hände, die ein Mädchen unter Wasser drücken konnten.
»Zurück«, drohte sie ihm. »Wenn du mich anfasst, kratz ich dir die Augen aus!«
Und tatsächlich, er blieb sofort stehen. Dann strich er sich mit der Hand über den Mund, die Augen leicht glasig. »Warte mal. Du denkst, ich hätte sie umgebracht?«
»Sie hat Blutergüsse am Arm. Sie hat mit jemandem gekämpft.«
»Das war ich nicht! Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich habe niemanden umgebracht!« Er schritt zum Rand der Brandung, wo das Wasser an seinen Zehen leckte – im Gegensatz zu ihr hatte der Junge keine Angst vor den Fluten. »Sieh mal, meine Kleidung ist trocken. Hätte ich ihr etwas angetan, wäre ich klitschnass.« Er rieb sich die Schläfen. »Sie ist fünfundzwanzig Kilo schwerer als du, also hast du sie auch nicht umgebracht, aber irgendjemand hat es getan. Wir sollten von hier verschwinden, bevor sie zurückkommen. Ein Telefon oder ein Radio suchen. Wir könnten es in der Scheune versuchen.«
Ein Telefon. Sie sehnte sich nach der Stimme ihres Vaters am anderen Ende der Leitung, der ihr versichern würde, dass alles ein Missverständnis war … aber ein Mädchen war tot. Wer auch immer das Mädchen war, diese Blutergüsse waren definitiv mehr als nur ein Missverständnis.
»Ich schaue fern«, sagte Cora. »Ich weiß, wie das abläuft. Du tust so, als wärst du der nette Kerl von nebenan, und dann erdrosselst du mich hinter der Scheune. Ich gehe nirgendwo mit dir hin.«
Er rieb sich mit der Hand übers Gesicht und presste sie fest auf seinen Schädel, als würde auch sein Kopf vor Schmerz zerplatzen. »Für den Fall, dass du es nicht bemerkt hast, das hier ist kein Film. Hier ist niemand außer mir und einem Mörder, weshalb ich vorschlage, dass wir uns gegenseitig helfen.«
Cora beäugte ihn argwöhnisch. An ihrem ersten Tag im Jugendknast hatte ihr ein Mädchen mit einer Zahnlücke eine geschmuggelte Cola angeboten – ein Willkommensgeschenk, hatte das Mädchen gesagt, um ihr die Eingewöhnung zu erleichtern. Zwei Tage später hatte genau dieses Mädchen sie verprügelt und ihr Sudoku-Buch gestohlen.
Du bist vielleicht in einer Reiche-Mädchen-Seifenblase aufgewachsen, hatte das Mädchen mit der Zahnlücke zu ihr gesagt, aber hier drinnen musst du die Regeln der realen Welt lernen. Nummer eins: Trau keinem Fremden – insbesondere niemandem, der dir seine Hilfe anbietet.
3 – Lucky
Nachdem Lucky mit bohrenden Kopfschmerzen in einer Schneewehe erwacht war, die Kleidung eines Fremden am Körper und ohne die Uhr seines Großvaters, überdachte er die möglichen Erklärungen: Entweder hatte er den Verstand verloren, oder jemand in der Autowerkstatt hatte ihm mit einem Schraubenschlüssel eins übergezogen, und das hier war sein abgedrehtes Leben nach dem Tod. Aber nun, da er diesem Mädchen mit strohblonden Haaren gegenüberstand, wusste er es.
Er war definitiv tot. Und nicht bloß tot – er war in der Hölle.
Das war die einzige Erklärung für Cora Mason.
Es hatte ein paar Sekunden gedauert, bis er sie erkannte. Seit seinem Erwachen war es eine Herausforderung gewesen, auch nur einen Fuß vor den anderen zu setzen, während er gegen den gleißenden Schmerz in seinem Kopf ankämpfte. Dann, auf einmal, war ein wunderschönes Mädchen aufgetaucht, mit Haaren so hell wie Sand. Sie hätte eine Fata Morgana sein können, nur dass Fata Morganas nicht gekleidet waren, als würden sie zu einem Rave gehen.
Im nächsten Moment hatte sie aufgeblickt, ihre Gesichtszüge hatten Gestalt angenommen und verdammt – er kannte sie. Die Tochter des Senators, die wegen Totschlags verurteilt worden war. Er hatte ihre Geschichte im Lauf der vergangenen zwei Jahre gebannt verfolgt, ihr quälend hübsches Gesicht stets präsent im Fernsehen, und die Reportagen verschlungen, wie der Unfall eine der anerkanntesten politischen Familien des Landes zerstört hatte.
Es hatte auch ihn zerstört. Es spielte keine Rolle, dass er Cora nie persönlich begegnet war. Er war dafür verantwortlich, dass ihr Leben verpfuscht war. Nur zwei Menschen wussten davon: er und ihr Dad – ein Mann, an den Lucky kaum denken konnte, ohne sofort mit der Faust auf etwas einschlagen zu wollen.
»Wer bist du?«, fragte sie.
Er rieb sich mit der Hand über die Brust, wo seine Schuld selbst nach zwei Jahren immer noch heftig pulsierte wie ein unerwarteter Hieb. »Nenn mich Lucky. Ich komme aus einer Kleinstadt in Montana, die Whitefish heißt. Bin vor ein paar Stunden mitten in einer Schneewehe drüben im Wald aufgewacht. Davor habe ich an dem klemmenden Gaspedal meines Motorrads herumgeschraubt. Das ist alles, woran ich mich erinnere.«
Er verstummte und schluckte seine nächsten Worte hinunter, während der Schmerz in seinem Kopf heftig pochte. Erinnerungen an sein Zuhause durchfuhren ihn. Das sonnengegerbte Gesicht seines Großvaters. Der Geruch von Hühnerfutter. Motoröl in den Rillen seiner Handfläche, das so schwer wegzurubbeln war. Er hatte sein Motorrad repariert, um zum Rekrutierungsbüro der Armee in Missoula zu fahren. Bei deinen Noten ist das College keine echte Option, hatte sein Beratungslehrer gesagt und ihm eine Broschüre über den Schreibtisch geschoben: rote, weiße und blaue Schrift, die ihm befahl, das Richtige zu tun.
Es spielte keine Rolle, ob die Armee das Richtige war. Es spielte aber eine Rolle, dass sein Dad und sein Großvater auf demselben Stuhl gesessen und dieselbe verdammte Broschüre bekommen hatten. Es spielte eine Rolle, dass Afghanistan weit weg von dem Unfall war, der seine Hand zertrümmert hatte, und weit weg von dem Grabstein seiner Mutter mit den Plastikblumen und weit weg von Cora Masons Gesicht in der Zeitung.
Eine Welle zog den Leichnam des Mädchens hinaus aufs Meer. Lucky stürzte vor, um sie zu packen. »Mist! Hilf mir, sie rauszuholen, bevor sie davontreibt. Die Polizei wird den Leichnam untersuchen wollen.«
Cora beäugte das Wasser, als würde sie lieber in Treibsand treten.
»Okay«, fuhr Lucky fort, »dann eben Plan B. Du bleibst dort stehen und siehst hübsch aus, und ich ziehe die Tote aus dem Wasser.«
Er näherte sich langsam und hielt ausreichend Abstand von Cora, während er durch die Brandung watete. Er hatte noch nie einen Leichnam gesehen. Würde sie warm sein? Klamm? Das tote Mädchen sah fremdländisch aus, war vielleicht aus dem Nahen Osten und fast einen Meter achtzig groß. Es hatte eine alte Narbe in Form eines schiefen Herzens am Kinn.
Er ließ die Knöchel in seiner linken Hand knacken. Nach dem Aufwachen war sie immer besonders steif.
»Hast du das schon mal getan?«, fragte Cora.
»Einen Leichnam aus dem Meer gezogen? Kann ich nicht von mir behaupten.« Er packte das Mädchen unter den Armen und hievte sie zum Ufer. Sobald er aus dem Wasser war, kam ihm Cora zu Hilfe. Sie legten die Tote auf den Sand, und er untersuchte sie oberflächlich.
»Keine Geldbörse. Kein Ausweis.«
Der Spaghettiträger des Kleids war dem toten Mädchen über die Schulter gerutscht. Lucky starrte ihn an und wünschte, seine Hände würden nicht zittern. Er stand auf, wischte sich Sand von den Handflächen, als könnte er damit den Nachgeschmack des Todes von sich abschütteln, und sah Cora zum ersten Mal direkt in die Augen. Im echten Leben lagen dort dunkle Ringe um die Iris. Die Fotografen in den Zeitungen hatten dieses Detail nicht eingefangen.
»Ich bin Cora«, sagte sie.
Jetzt wäre der passende Zeitpunkt, ihr zu erklären, dass er ihren Namen bereits kannte und noch viel mehr. Er könnte ihr von dem 3. September erzählen – dem Tag, an dem er versucht hatte, ihren Vater umzubringen. Es war zwei Wochen nach dem Unfall gewesen. Er hatte den Waffenschrank seines Vaters aufgebrochen, war zu dem Flugplatz gefahren, wo der Sohn von Senator Mason lernte, eine Cessna 172 zu fliegen. Er hatte das Auto geparkt und sich eingeredet, er könnte es tun. Er müsste es tun. Seine Mutter war begraben, und Senator Mason klopfte seinem Sohn anerkennend auf die Schulter. Sorglos. Reuelos. Er hatte versucht, die Autotür zu öffnen, nur um zwei Männer in schwarzen Anzügen zu beiden Seiten vorzufinden. Sie hatten ihn herausgezogen und ihm die Waffe entwendet. Dann hatten sie ihm ein Angebot unterbreitet.
»Freut mich, dich kennenzulernen, Cora.« Er sah weg, wischte sich über den Mund. »Ich werde in der Scheune nach einem Telefon suchen. Du solltest mitkommen. Es ist sicherer, wenn wir zusammenbleiben.«
Sie warf einen Blick über die Schulter zur Silhouette der Stadt. »Ja, aber … nicht zu nah.«
In gespielter Kapitulation hob er die Hände und marschierte den Pfad hinauf. Der Weg wand sich durch einen Obstgarten, in dem ein Bach zwischen den Bäumen hindurchfloss und eine unheimliche Ruhe verströmte. Lucky duckte sich unter einem herabhängenden Apfel hindurch. Sein Magen knurrte. Wann hatte er wohl das letzte Mal etwas gegessen?
»Wie lautet deine Theorie?«, fragte er.
»Theorie?« Sie hatte die Arme fest vor der Brust verschränkt.
»Wo wir sind. Wie wir hierhergekommen sind.« Er machte eine Pause. Er müsste ihr unbedingt von dem Tag auf dem Flugplatz erzählen. Aber sie sah ihn fragend an, mit ihren großen blauen Augen, und seine Entschlossenheit bröckelte. »Ich meine … in fünfzig Meter Entfernung schneit es, und hier hat es zwanzig Grad. Dort drüben ist eine Wüste, die sich meilenweit erstreckt. Und ich schwöre, die Sonne hat sich kein bisschen bewegt, seit ich vor ein paar Stunden aufgewacht bin. Die Kleidung, die du trägst … gehört die dir?«
Sie zupfte an dem Träger ihres Tanktops. »Nein.«
»Dasselbe trifft auf mich zu. Warum sollte sich jemand die Mühe machen, uns umzuziehen? Und uns in eine so sonderbare Umgebung bringen?« Er kratzte sich mit den Fingernägeln über den Schädel, um besser nachdenken zu können. »Ich habe jede mögliche Erklärung durchgespielt: Es ist ein Witz. Ein Experiment. Aber dass man uns umgezogen hat, ist so seltsam. Das kostet Zeit und muss gut geplant sein. Wer auch immer dahintersteckt, spielt absichtlich mit uns. Ich verstehe nur nicht, warum er das tut.«
»Das Warum interessiert mich nicht«, sagte Cora. »Ich will bloß nach Hause.«
Ihre Stimme brach, was Lucky mitten ins Herz traf. Er blieb stehen. »Hey. Das ist okay. Ich meine, Angst zu haben.« Er bedachte sie mit einem verhaltenen Lächeln, nur ein leichtes Zucken um die Mundwinkel. »Die hab ich auch.«
Die Scheune war nur noch wenige Meter entfernt. Er wollte schon hineingehen, da packte sie ihn am Arm. Er zuckte zusammen, überrascht von ihrer Berührung. Ihre Finger waren kleiner, als er gedacht hatte. So schwach. Wer würde das einem Mädchen antun, das so viel durchgemacht hatte?
»Dieses Mal an deinem Hals«, sagte sie. »Diese schwarzen Punkte. Was bedeuten die?«
Lucky blinzelte. Er hatte nicht den blassesten Schimmer, wovon sie sprach, aber ihre Augen starrten auf eine Stelle genau unter seinem linken Ohr. Er hob die Hand und strich über kleine Knoten, wie Sandkörner, die unter seiner Haut steckten.
Überrascht ließ er die Hand sinken.
Jahrelang hatte er an ihr die Uhr seines Großvaters getragen, selbst damals, als das Armband noch viel zu groß gewesen war, aber nach seinem Aufwachen war die Uhr verschwunden gewesen. Ohne ihr Gewicht fühlte er sich verloren.
»Keine Ahnung.« Seine Augen glitten zu ihrem Hals. »Aber du hast auch welche.«
4 – Cora
Cora betastete ihren Hals. Kleine Erhebungen wie bei einem Von-Punkt-zu-Punkt-Spiel.
Pochender Schmerz hämmerte in ihrem Kopf, und sie krümmte sich in dem Sonnenblumenbeet neben der Scheune. Niemals hätte sie geglaubt, dass etwas noch beängstigender sein könnte als ihr erster Tag in Bay Pines. Charlie hatte sie mit dem Anwalt der Familie hingefahren, damit die Presse keine Fotos von Senator Mason schießen konnte, der seine Tochter in die Jugendstrafanstalt brachte. Die Wärter hatten sie nach Schmuggelware abgeklopft und ihr khakifarbene Kleidung gegeben, die roch, als wäre sie mit Rattengift gewaschen worden. Anschließend hatten sie ihr die Zelle gezeigt, die sie mit einer Venezolanerin mit Rastalocken teilen würde, und sie dann den Löwen in der Cafeteria zum Fraß vorgeworfen. Sie war eine der jüngsten Insassinnen gewesen und die reichste. Genauso gut hätten sie ihr eine Zielscheibe mit Ketchup und Mayonnaise auf den Rücken malen können.
Als sie nun die kleinen Knoten spürte, hatte sie eine klarere Vorstellung, was das Wort »entsetzlich« in Wirklichkeit bedeutete.
»Das tote Mädchen hatte sie auch«, sagte sie leise.
Lucky stieß ein freudloses Lachen aus. »Wie beruhigend.« Er rüttelte am Türgriff der Scheune. »Abgeschlossen. Vielleicht kann ich die Tür aus den Angeln heben, wenn ich etwas finde, das ich zu einem Schraubenzieher umfunktionieren kann.«
»Ich sehe mich um, ob es noch einen anderen Weg hinein gibt.« Cora umrundete die Scheune, bis sie ein großes schwarzes Fenster erreichte, zwei Meter breit und einen Meter hoch. Die Angst, beobachtet zu werden, fühlte sich wie Nägel an, die über ihre Haut kratzten. Das Fenster wirkte neu, was angesichts des verwitterten Zustands der restlichen Scheune befremdlich war. Sie klopfte gegen das Glas. Ein dumpfes Pochen ohne jegliches Echo ertönte. Etwas stimmte da überhaupt nicht.
Sie presste das Gesicht ans Glas, aber ein gleißender Schmerz durchzuckte ihren Kopf, und sie fuhr gepeinigt zusammen. Es war sowieso zu düster, um hindurchzusehen. Mehr ein Bildschirm als ein Fenster. Auf einmal konnte sie eine Bewegung ausmachen, nur ein undeutliches Flackern, und sie wich taumelnd zurück. Das Kribbeln an ihrem Rücken verstärkte sich, und sie drehte sich hastig um, halb in Erwartung, einen messerschwingenden Fremden zu sehen, der sich von hinten auf sie stürzte.
Nichts. Nicht einmal die kleinste Brise.
Kopfschüttelnd kam Lucky um die Ecke und musterte das Fenster, als würde es ihm ebenfalls Angst einjagen. »Hör mal … die Tür ist nicht echt. Die ganze Scheune ist nicht real, wie eine Filmkulisse. Wir müssen zur Stadt gehen.«
Cora blickte zum Meer, wo die weit entfernte Silhouette der Stadt am anderen Ende der Bucht zu erahnen war. Was, wenn ihre Entführer dort wohnten? Würden sie der Gefahr nicht direkt in die Arme laufen?
Sie rieb sich die Augen. Erschöpfung überkam sie. »Nein. Wir sollten hierbleiben und auf Hilfe warten. Mein Dad ist Politiker. Sobald er bemerkt hat, dass ich verschwunden bin, wird er Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um mich zu finden.«
»Es interessiert mich nicht, ob dein Dad der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Mein Dad ist Sergeant in Afghanistan. Glaubst du, er dreht einfach Däumchen, wenn Aufständische auf ihn schießen?«
Hinter dem schwarzen Fenster bewegte sich der Schatten leicht nach links. Cora wich einen weiteren Schritt zurück.
Luckys Gesicht wurde weicher. Er knackte mit den Knöcheln, aber diesmal beunruhigte sie das Geräusch nicht mehr. »Wenn wir ein Telefon finden, ist dein Dad der Erste, den wir anrufen. Versprochen. Hier ist Plan C: Wir halten uns von diesen schwarzen Fenstern fern. Und falls du jemanden siehst – oder hörst –, läufst du weg. Keiner von uns wird wie dieses Mädchen im Wasser enden.«
Sie nickte. »Plan C hört sich gut an.«
Gemeinsam machten sie sich auf den Weg und marschierten neben einer Wiese aus hohem Gras einen Pfad entlang, der aus einem Material bestand, das wie ein Bürgersteig aussah, aber viel weicher war, fast schwammig. Alles war von einer unheimlichen Schönheit, aber das machte die beiden nur noch nervöser. Schönheit hatte die Fähigkeit, etwas Dunkles zu kaschieren.
Der Pfad schlängelte sich einen Hügel hinauf, von dessen Gipfel sie die weit entfernte Stadt sehen konnten, nur dass sie mit einem Mal viel näher war. Die Gebäude verschwammen auf bizarre Art ineinander, und Cora rieb sich die Augen und fragte sich, ob die Wahrnehmung ihr einen Streich spielte, da sie so erschöpft war. Während sie weitergingen, konnte sie allmählich Details ausmachen. Erst die Dächer, dann einen flüchtigen Blick auf Fenster und eine Straße und das Aufblitzen von Farbe in Blumentöpfen.
Sie blieb stehen.
Es war nicht nur die Erschöpfung, die sie um ihren Verstand brachte. Die Gebäude waren real, aber wohl kaum die Wolkenkratzer, die sie aus der Ferne gesehen hatten. Es handelte sich um ein- und zweigeschossige Häuser, nicht mehr als zehn. Es wirkte, als wären die Gebäude geschickt angeordnet worden, sodass die Dächer aus der Ferne eine durchgehende Linie ergaben und den Anschein vermittelten, als wären sie viel höher.
Luckys Miene verdüsterte sich. »Ich schwöre, von weit weg hat es wie eine Stadt ausgesehen. Denkst du, es ist in unseren Köpfen, eine Art virtuelle Realität?«
»Das glaube ich nicht. Mein Dad investiert in Hightech, und es gibt keine virtuelle Realität, die dem hier auch nur annähernd das Wasser reichen könnte.« Ihre Gedanken wirbelten umher, und sie rief sich Gespräche mit ihrem Vater ins Gedächtnis, ohne eine Antwort zu finden. »Das hier muss real sein. So gebaut, dass bestimmte Gefühle aufkommen und wir an bestimmte Orte gehen, ähnlich wie optische Illusionen. Dasselbe gilt für die Entfernungen. Es hätte uns Stunden kosten müssen, hierherzugelangen, und wie lange haben wir gebraucht, eine halbe Stunde?« Schweiß tropfte von ihrer Stirn, obwohl es nicht wärmer als achtzehn Grad sein konnte.
Lucky bedeutete ihr, ihm zu dem Gebäude zu folgen, das ihnen am nächsten war. Als sie es umrundet hatten, ging ein leuchtendes Neonschild über der Eingangstür an.
SÜSSWARENLADEN.
Innerlich hatte Cora mit allem gerechnet – Panzern und Waffen und Terroristen –, aber nicht mit einem Geschäft, das Toffee verkaufte. Könnte Lucky recht haben, dass dies eine aufwendige Filmkulisse war?
Ein Dutzend Geschäfte waren kreisförmig um einen schrecklich idyllischen Marktplatz angeordnet, allesamt in unterschiedlichen architektonischen Stilen erbaut, mit Schildern über den Türen. Der Drugstore hatte verschlungene nahöstliche Muster über den Fenstern. Der Friseur war das Abbild eines altmodischen französischen Barbiergeschäfts. Die Blinklichter der Spielhalle sahen aus, als kämen sie direkt aus dem Tokio der 1980er-Jahre. Ein riesiger Kirschbaum mit herabhängenden Ästen stand in voller Blütenpracht im Zentrum, wie eine Stecknadel, die in die Mitte einer Landkarte gepinnt war. Keine Autos. Keine Menschen. Das einzige Lebenszeichen war ein hohes viktorianisches Haus, das eine Seite des Marktplatzes einnahm, mit hellen Lichtern in den oberen Fenstern.
»Wie der Epcot-Vergnügungspark«, murmelte Cora. »All die Kulturen und Epochen, die dort zur Schau gestellt sind.«
Lucky hob eine Augenbraue. »In Disney World werden keine toten Mädchen an den Strand gespült.«
»Zumindest normalerweise nicht.«
Er deutete mit dem Kinn zum Haus. »Wenn die Lichter an sind, gibt es dort vielleicht ein Telefon. Vielleicht sogar ein …«
Ihm blieben die Worte im Hals stecken, als ein Schrei aus einem der Geschäfte gellte. Das Kreischen wiederholte sich, schrill und verängstigt, gefolgt von einem tiefen Brüllen.
Die saloonartigen Doppeltüren eines Gebäudes mit der Aufschrift TOY STOP flogen krachend auf, und zwei Jungen stürzten ins Freie.
5 – Cora
Unbewusst griff Cora nach ihrer Halskette. Sie hatte vergessen, dass sie nicht mehr da war, und spürte ihr Herz, das unter einer zu dünnen Schicht Haut pochte. Zwei Jungen. Beide Fremde. Einer – der größte Junge, den Cora jemals gesehen hatte – wollte den anderen gerade totprügeln.
Sie drehte sich zu Lucky. »Was sollen wir tun?«
Er deutete mit dem Kopf zum Kirschbaum. »Bleib hier. Falls irgendetwas passiert, lauf weg.« Er schlang ihre Finger um einen Ast, um ihr zu bedeuten, dort auf ihn zu warten, und sprintete los. Ein Windstoß hob einen Zweig des Kirschbaums an, der Coras Wange streichelte, als wollte er Anspruch auf sie erheben.
Empört riss sie sich weg. »Das glaubst du wohl selbst nicht.«
Sie folgte Lucky. Der breitere der beiden Jungen – ein Polynesier, der wie ein Schrank gebaut war und einen anthrazitfarbenen Dreiteiler trug – hatte die Hände um den Hals des anderen Jungen gelegt, eines zappeligen Rothaarigen mit blasser Haut, der aus einem unerklärlichen Grund etwas anhatte, das wie die Jacke eines französischen Revolutionärs aussah.
Lucky sprang auf die Veranda. Cora verzog das Gesicht. Bei Teenagern, die kämpften, war es dasselbe wie bei Hunden, die kämpften: Es gab nichts Schlimmeres, als sich einzumischen.
»Hör auf!«, schrie er und legte dem Hünen eine Hand auf die Schulter.
Er war mutiger als Cora, oder er hatte nicht so viele Schlägereien miterlebt wie sie. Die Mädchen in Bay Pines hatten sich ständig geprügelt, und nachdem Cora am ersten Tag diesen unerwarteten Schlag abbekommen hatte, hatte sie ihre Lektion gelernt, nämlich dass es am klügsten war, sich in der Toilette zu verstecken und auf das Wachpersonal zu warten, das den Streit beendete. Nur dass es hier keine Wärter gab – bloß einen Jungen in einer Lederjacke.
Der Hüne drehte sich hastig zu Lucky um und schlug seine Hand weg. Tätowierte schwarze Linien bedeckten die rechte Seite seiner Stirn und sein Auge, ein Anblick, der gleichzeitig altertümlich und bedrohlich war – und im krassen Gegensatz zu seinem maßgeschneiderten Anzug stand. Trotz seiner Größe lag etwas Weiches um seine Augen, das darauf hindeutete, dass er nicht viel älter als sie selbst sein konnte.
»Pfoten weg, okay?«, spuckte er Lucky mit einem harten Akzent entgegen. Der rothaarige Junge nutzte die Ablenkung und huschte in das Spielzeuggeschäft, wahrscheinlich in der Hoffnung auf einen Hinterausgang.
»Komm zurück!« Der Hüne drückte, mit Lucky auf den Fersen, die Saloontüren auf.
Cora stieg die Veranda hinauf und sah in den Laden hinein. Im Innern sah er wie ein altmodischer Gemischtwarenladen aus, der direkt aus einem Western hätte entsprungen sein können. Es roch sogar alt, nach Getreide in groben Jutesäcken und Kaffee und Wolle, obwohl sich nichts von diesen Dingen in den Regalen stapelte, nur knallbuntes Spielzeug in allen Größen und Formen. Der Hüne presste den anderen Jungen gegen eine Glasvitrine, die Hände um seinen Hals. In der Ecke wiegte sich ein dunkelhaariges Mädchen in einem schwarzen Kleid vor und zurück und stieß ein schrilles Wimmern aus.
Cora drückte die Schwingtüren auf und kniete sich neben das Mädchen. »Hey, bei dir alles okay?«
Ein ersticktes Geräusch drang aus der Kehle des Mädchens, einer Asiatin. Ihre vollen Lippen waren fest zusammengepresst, dunkelbraune Haare mit einer pinkfarbenen Strähne fielen ihr über das linke Auge. Wunderschön – die Art Mädchen, die es im echten Leben eigentlich nicht gab. Cora beugte sich schützend über sie und warf einen Blick über die Schulter.
Lucky war es gelungen, die beiden Jungen voneinander zu trennen. »Was soll das alles?«, wollte er wissen.
Der Hüne spuckte auf den Boden. »Ich stelle hier die Fragen, Kleiner. Und ich würde mich lieber mit deiner hübschen blonden Freundin unterhalten.«
Coras Kopf schnellte hoch. Ihre Muskeln reagierten schneller als ihr Verstand, und sie war sofort auf den Beinen, als der Hüne in ihre Richtung kam.
Ein Flirren von Bewegungen blitzte auf, gefolgt von einem Knacks. Cora schreckte zusammen, als sich eine Blutfontäne über den Boden ergoss. Sie sprang zurück und starrte auf das Blut, bis alles Sinn ergab. Lucky hatte dem Riesen die Faust in die Nase gerammt.
Der tätowierte Junge taumelte rückwärts, bis er gegen eines dieser unheimlichen schwarzen Fenster knallte. Das Glas zersprang nicht. Es knirschte nicht einmal. Der Riese fuhr sich achtlos mit dem Unterarm über die blutige Nase.
»Wie wäre es, wenn ich die Fragen stelle?« Lucky ballte die Hand zur Faust. »Fangen wir mit euren Namen an und hören damit auf, was zum Teufel hier los ist.«
Der rothaarige Junge in der Militärjacke rieb sich über den Hals. Seine Augen waren blaugrün, mit dichten Wimpern, was ihm das Aussehen eines kleinen Kindes verlieh, das bloß Verkleiden spielte. Ein Muster aus schwarzen Punkten, denen von Lucky nicht unähnlich, ragte unter seinem Ohr aus der Haut. Der Hüne hatte sie ebenfalls. Cora blickte zu dem Mädchen in der Ecke – ihre glatten Haare verdeckten ihren Hals.
»Es ist völlig sinnlos, die zwei da irgendwas zu fragen.« Der Riese deutete mit dem Kinn in Richtung der anderen. »Ich versuche schon seit einer guten Stunde, Antworten aus ihnen rauszubekommen. Sie schluchzt die ganze Zeit, und er kriegt den Mund nicht auf.« Kopfschüttelnd rieb er sich das Kinn.
»Übrigens, ich heiße Leon. Aus Neuseeland.« Er spuckte eine Salve Blut auf den Boden, die nur wenige Zentimeter vor dem Fuß des asiatischen Mädchens landete. Sie wiegte sich heftiger hin und her, die Hände fest auf den Kopf gepresst, die Finger so krampfhaft in die Haare gekrallt, dass Cora besorgt war, sie würde sie sich ausreißen.
»Ganz ruhig.« Cora streichelte über die ausgemergelten Schultern des Mädchens, ohne auf ihre eigene Anspannung und Erschöpfung zu achten.
»Ihr Name ist Nok«, sagte der rothaarige Junge, der immer noch über die fleckigen roten Fingerabdrücke an seinem Hals strich. Seine Stimme war tiefer, als man sie von einem so dünnen Jungen erwartet hätte. »Ich bin Rolf. Aus Oslo, Norwegen. Sie und ich haben uns vor ein paar Stunden kennengelernt, als wir in verschiedenen Geschäften aufgewacht sind. Sie ist Thailänderin, aber sie spricht gut Englisch. Lebt jetzt wohl in London. Abgesehen von schlimmen Kopfschmerzen ging es ihr ganz gut, bis wir diesem Neandertaler in die Arme gelaufen sind und er wissen wollte, was hier los ist.«
»Weißt du, was hier los ist?«, fragte Cora.
Rolf schüttelte den Kopf. »Ich kann auch nur raten. Nok weiß von nichts. Vor ihrer Panikattacke hat sie mir erzählt, dass sie ein Model war, Haute Couture samt großen Zeitschriftenkampagnen. Ich glaube, sie ist berühmt. Die Leute suchen sicher längst nach ihr.« Er ging neben Nok in die Hocke und flüsterte: »Er wird dir nicht wehtun. Er ist bloß ein blöder bølle, der auf jedem herumhackt, den er in die Finger bekommt.«
Nok spähte unter ihrer pinken Haarsträhne hervor und drängte sich näher an Rolf.
Cora erhob sich. »Ich bin Cora, das hier ist Lucky.« Sie besah sich die Spielwaren in dem Laden. »Ich finde, wir sollten ein Leuchtfeuer entzünden oder mit einem Teil des Zeugs hier ein Zeichen machen, das man von einem Flugzeug aus sehen kann.«
»Das hier ist verdammt noch mal nicht Robinson Crusoe«, sagte Leon. »Es gibt eine Spielhalle und ein Kino, und du willst ein SOS aus Steinen bauen.«
»Nein … sie hat recht.« Lucky lehnte sich gegen die Ladentheke. »Wir müssen einen Weg finden, um mit jemandem Kontakt aufzunehmen, und wir sollten die Stadt durchsuchen. Außer uns könnten noch andere hier sein.«
»Keine anderen«, sagte Rolf. »Außer einer.«
Cora drehte sich um und rieb sich über die pochenden Schläfen. Mit dem hohen Kragen und den Schulterklappen verlieh ihm seine Militärjacke den Anschein von Autorität, die überhaupt nicht zu seinem neurotischen Blinzeln passte. Seine Finger fanden eine Art metallenes Nummernschloss, das am Rand der Glasplatte der Ladentheke eingelassen war. Es bestand aus mehreren Zahnrädern, die er nun abwesend drehte, woraufhin ein tiefes, fast bedrohliches Grollen durch den Raum tönte. »Noch ein Mädchen, denke ich. Drei Mädchen und drei Jungen. Zusammen sechs.«
Knatter, knatter, knatter.
»Drei und drei macht sechs, ja?«, grunzte Leon. »Du bist ein Genie!«
Rolf räusperte sich umständlich. »Wohl kaum. Ich habe nur eine Begabung für deduktives Denken. Das ist auch, was ich in Oxford studiere. Nun ja, das und Robotertechnik. Und griechische Philosophie.«
Cora runzelte die Stirn. »Wow. Wie alt bist du?«
Knatter.
Seine Wangen flammten rot auf. »Fünfzehn.« Er schüttelte rasch den Kopf. »Aber das spielt keine Rolle. Deduktives Denken ist im Grunde dasselbe wie Schlussfolgerungen ziehen. Und jeder von uns kann Schlussfolgerungen ziehen. Nok und ich haben jedes Geschäft durchsucht, nachdem wir aufgewacht sind. Im Diner gibt es sechs Stühle. Sechs Sonnenschirme auf der Strandpromenade. Sechs Puppen in der Auslage.« Er nickte zu dem Glaskasten hinter der Ladentheke, in dem die besagten Puppen und ein Malkasten und ein Kricketspiel lagen. »Wir haben auch das Haus erkundet. Oben gibt es mehrere Schlafzimmer, unten ein Wohnzimmer. In den Schlafzimmern stehen sechs Kleiderschränke mit sechs Garnituren Kleidung. Der Kleidung nach zu urteilen fehlt ein Mädchen. Sie trägt ein weißes Sommerkleid.«
Cora drehte ihren Kopf zu Lucky. Sein Mund war zu einem grimmigen Strich geworden. »Ja. Apropos …« Er rieb sich über den Nacken. »Wir haben sie gefunden. Sie ist tot. Im Meer ertrunken, gleich hinter dem nächsten Hügel.«
Rolf blickte überrascht auf und fuhr sich über den Nasenrücken, eine Geste, die man normalerweise nur von Brillenträgern kannte. Selbst Nok hörte auf, sich vor und zurück zu wiegen. Ihre Augen waren immer noch feucht, aber für den Bruchteil einer Sekunde erkannte Cora dort etwas anderes. Nok kniff die Lippen zusammen. Ihre Augen verengten sich kaum merklich. Und dann, im nächsten Moment, war wieder ihr Wehklagen zu hören, und sie lehnte sich an Rolf, noch heftiger weinend.
Cora hatte in Bay Pines viele Mädchen gesehen, die für die Wärter eine Show abzogen, um ihr Mitleid zu erregen. Sie wusste, wann jemand schauspielerte. Aber warum tat Nok das?
»Tot?«, flüsterte Nok mit zitternder Stimme. »Ein Unfall, oder?«
»Sie hatte Prellungen am Hals«, sagte Lucky.
Leon erschauderte mit einem Mal wie ein Hund, der Wasser von sich schüttelte. Zögerlich stakste er zur Tür, während er sich über den Nacken rieb. Er versuchte, so zu tun, als hätte er keine Angst, aber er schwitzte stark.
Cora holte tief Atem. »Wir müssen Ruhe bewahren und auf Hilfe warten. Wir werden gerettet.«
Beim Klang ihrer Stimme wandten sich alle zu ihr um. Rolf drehte wieder an den Rädchen, sodass erneut das unheilvolle metallische Rumoren einsetzte.
»Wer soll uns denn befreien?«, fragte Nok. »Wir wissen nicht einmal, wo wir sind oder warum sie uns sechs geholt haben.« Sie begann, mit der Hand eine Haarsträhne zu zwirbeln.
Knatter. Knatter. Knatter.
Cora maß jeden von ihnen der Reihe nach. Nok war ein berühmtes Model, Rolf musste ein Genie sein, wenn er in seinem Alter in Oxford studierte. Cora war zwar keine Berühmtheit, aber ihr Vater war es. Ging es um Erpressung? Sie musterte Lucky. Steckte unter dieser Lederjacke eine bekannte Persönlichkeit? Er war süß, gewiss, aber nicht Filmstar-süß – keine perlweißen Zähne oder ein einstudiertes Lächeln. Als wollte er ihr recht geben, trat er mit dem Fuß gegen eine Reihe von schweren Glasgefäßen und krümmte sich dann fluchend vor Schmerz, da er vergessen hatte, dass er barfuß war.
Leon schnaubte. »Du vergeudest deine Zeit mit Theorien. Mir ist das alles scheißegal. Ich für meinen Teil verschwinde von hier, und jeder, der will, kann gern mitkommen.«
Rolf drehte langsamer an den Rädchen, sodass sie kaum mehr ein Geräusch von sich gaben. »Wir können nicht verschwinden.«
»Und ob ich das kann! Ich suche eine Richtung aus und gehe los. Die Straßen dort müssen irgendwohin führen.«
Rolf schüttelte den Kopf. »Sie enden genau hinter den Gebäuden. Ich habe sie schon ausprobiert.« Er blickte auf seine Zehen. »Nun, sie enden nicht direkt. Ich bin eine Straße hinuntergegangen, die vom Marktplatz wegführt. Drei Blocks später hat sie mich hierher zurückgebracht. Ich bin kein einziges Mal abgebogen, aber die Straße hat mich trotzdem wieder zu meinem Ausgangspunkt geführt. Ich habe eine andere genommen, und es war dasselbe. Es ist egal, welche Richtung du einschlägst. Du landest genau dort, wo du angefangen hast.«
Es wurde still im Spielwarenladen. Nur das Geräusch der sich drehenden Rädchen und das Surren des schwarzen Fensters durchbrachen die Ruhe. Ein sich langsam bewegender Schatten war hinter dem Fenster aufgetaucht. Er wirkte nicht wie ein Mensch, dafür war er zu groß und steif.
»Das ist unmöglich«, stieß Nok aus.
Rolfs Finger erstarrten. Ohne das Geräusch der brummenden Rädchen war der Raum – die Stadt – von einer noch unheimlicheren Stille erfüllt. »Laut den Regeln der Physik ist es das nicht.«
6 – Rolf
Rolf konzentrierte sich auf die Ringelblumen, die vor den Türen des Spielzeuggeschäfts blühten. Calendula officinalis. Es war leichter, über Pflanzen nachzudenken als über die Jugendlichen, die ihn anstarrten. Als er sein Studium in Oxford aufgenommen hatte, vier Jahre jünger als alle anderen Studenten und der einzige Rothaarige in seinem Wohnheim, hatten sie ihn ununterbrochen aufgezogen. Jetzt hatte er nicht einmal mehr seine Brille, hinter der er sich verstecken konnte. Ihre Entführer hatten sie ihm weggenommen – und dennoch, dachte er blinzelnd, konnte er aus irgendeinem unerklärlichen Grund gut sehen.
»Ich muss dich zu fest getroffen haben, Kleiner«, sagte Leon. »Das ist verrückt.«
Ein Blick in Leons tätowiertes Gesicht genügte, dass Rolfs Finger die Rädchen auf dem Zahlenschloss schneller drehten. Seine Nervosität war eine schlechte Angewohnheit, das wusste er, aber er konnte sie einfach nicht ablegen. »Man nennt es Paradox der Unendlichkeit. Es existiert, aber nur in der Theorie. Ich wette, egal welche dieser Straßen man entlanggeht, man landet schließlich wieder dort, wo man angefangen hat. Es ist unmöglich zu sagen, wie weit die Grenzen entfernt sind, oder ob es überhaupt Grenzen gibt. Es ist ein hoch theoretisches Konstrukt.«
»Wir sind also gefangen?« Noks Augen waren tränennass. »Obwohl es keine Wände oder Gitterstäbe gibt?«
Rolf erstarrte. Er konnte nicht anders, als Nok anzustarren. Die pinke Haarsträhne rahmte ihre linke Gesichtshälfte perfekt ein, ein geometrisches Wunder. Zum ersten Mal hatte er sie dort mit windzerzausten Haaren auf der Uferpromenade gesehen. Ihr Gesicht hatte trotzig gewirkt – aber er hatte sich geirrt. Sobald sie den Kopf gedreht und ihn erblickt hatte, hatte sich Überraschung in ihre Gesichtszüge gegraben, und dann waren Tränen geflossen. Große, kullernde Tränen. Sie hatte die Arme um ihn geworfen, obwohl er ein Fremder war.
Er schob eine Brille hoch, die nicht mehr existierte. »Äh … ja. Gefangen. Ich glaube auch, dass das Paradox der Unendlichkeit für die Kopfschmerzen verantwortlich ist, die wir alle haben. Unser Verstand erträgt so viel Unvorhersehbarkeit nicht.«
Er glaubte, seine logische Erklärung würde sie beruhigen, aber Nok erbleichte. Dumm. In Gegenwart von Mädchen, insbesondere hübschen Mädchen, war er nie selbstsicher gewesen. Er stammte von Wikingern ab, sollte er dann nicht seine Feinde mit Säbeln bezwingen und Bäume entwurzeln können? Doch alles, was die Wikinger ihm mit auf den Weg gegeben hatten, war seine wenig männliche rotblonde Haarfarbe.
Cora zupfte an seiner Militärjacke und zog seine Aufmerksamkeit auf sich. »Was ist mit dem Meer? Im Wasser gibt es keine Straße, die einen Menschen wie in einer Schlaufe zurückbefördern könnte. Vielleicht muss nur jemand weit genug hinausschwimmen, um dem Paradox der Unendlichkeit zu entkommen.«
Rolf hielt inne, um diesen Vorschlag zu durchdenken. Es würde gewiss nicht funktionieren, aber zumindest hatte sie einen kreativen Gedankengang, was mehr war, als er von den anderen behaupten konnte. »Vielleicht, aber eingedenk der Tatsache, dass ein Mädchen bereits ertrunken ist, bin ich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist.«
Seine Finger fanden wieder die tröstliche Geborgenheit des Zahlenschlosses und ließen es kreisen. Er hasste es, in Verlegenheit gebracht zu werden. Damals in Oslo hatte er nichts weiter gewollt, als im Blumengarten in Tøyen zu wohnen, ganz in der Nähe der Arbeitsstätte seiner Eltern. Stundenlang hatte er die Rosa berberifolia und Bellis perennis gestutzt. Erde hatte unter dem Weiß seiner Fingernägel geklebt, braunschwarz und beständig, als wäre er tätowiert. Du kannst nicht in der Erde spielen, min skatt, hatte seine Mutter gesagt, als sie ihm den Dreck wegwusch. Du bist dazu geboren, dein Gehirn zu benutzen, nicht die Hände.
Er seufzte und beäugte blinzelnd die kleinen eingravierten Zahlen auf dem Nummernschloss, immer noch verwirrt über seine neu gewonnene Sehkraft. Die Zahlen auf den Rädchen hatte er schon einmal gesehen. Es waren die Zahlen der Fibonacci-Folge, die selbst der einfältigste Mathestudent kannte: eins, eins, zwei, drei, fünf, acht, dreizehn und eine Leerstelle für die letzte Zahl.
Aus einem Impuls heraus drehte er das letzte Rädchen, bis die Zahl – einundzwanzig – mit einem zufriedenen Klick einhakte. Ein kupferroter Chip rollte aus einer Rille ganz unten an der Ladentheke. Auf beiden Seiten des Chips waren sonderbare Muster eingraviert … eine fremde Sprache oder Symbole. Er steckte den Chip in den Schlitz über der Rille, um zu sehen, was geschehen würde.
Eine Glastür schwang auf. Hunderte von Pfefferminzbonbons regneten herab.
Fluchend hüpfte Rolf zur Seite, als ein Bonbon ihn am Fuß traf. Die anderen fuhren ebenfalls auf. Die herabfallenden Süßigkeiten waren das einzige Geräusch im Zimmer, zusammen mit dem süßlichen Geruch, der ihm vor Augen führte, wie ausgehungert er war.
Es schien eine Ewigkeit her zu sein, seit er das letzte Mal etwas gegessen hatte. In Oxford hatte er jeden Mittag in dem indischen Schnellimbiss genau unter seinem Wohnheim gegessen … jetzt würde er für ein Curry oder den panierten Kabeljau seiner Mutter mit Fladenbrot oder selbst einen von Snadderkioskens angekokelten Burgern töten.
Cora ging in die Hocke, um die Süßigkeiten zu begutachten. »Wie hast du das gemacht?«
»Die Zahlen auf dem Nummernschloss sind eine simple Zahlenfolge.«
»Simpel? Vielleicht für dich.« Sie musterte die Rädchen. »Sieh mal, die Zahlen haben sich bereits in eine neue Reihenfolge gebracht. Ich glaube nicht, dass es ein Schloss ist. Ich denke, es ist ein Rätsel. Lös die Zahlenfolge, und du bekommst einen Chip.«
Räuspernd beugte sich Rolf vor. »Das ist möglich. Wissenschaftler benutzen diese Art Rätsel, um die Intelligenz von Labormäusen und Schimpansen zu messen.« Er blickte zu den surrenden schwarzen Fenstern. »Diese Fenster könnten Einwegspiegel sein. Unsere Entführer sehen uns womöglich gerade zu, stoppen die Zeit, wie schnell wir diese Zahlenrätsel lösen und vielleicht das größte Rätsel von allen – warum wir hier sind.«
Fast um zu beweisen, dass Rolf recht hatte, bewegte sich einer der schattenhaften Umrisse nach rechts.
Nok schreckte zurück. »Sind das sie?« Sie brach an Rolfs Schulter zusammen. »Aber diese Schatten sind zu groß für Menschen, oder?«
Er versuchte zu verdrängen, wie gut sie roch, wie der Frühling in Tøyens Gärten. »Wir können nichts mit Gewissheit sagen. Ich kann mir vorstellen, dass derjenige, der uns hierhergebracht hat, eine Gruppe Teenager wollte, die alle Englisch sprechen, obwohl sie aus verschiedenen Ländern stammen. Nok ist Thailänderin, aber sie wohnt in London, ich bin Norweger und lebe auch dort. Leon ist aus Neuseeland. Lucky kommt aus …« Er hielt inne. Normalerweise traute er cool aussehenden Amerikanern in Lederjacken nicht über den Weg, aber ihm gefiel, wie Lucky redete, ruhig und selbstsicher, und vor allem hatte ihm gefallen, dass Lucky Leon ins Gesicht geschlagen hatte. »Ihr zwei – Lucky und Cora – seid beide aus Amerika. Das kann nicht stimmen. Das passt nicht ins Muster.«
»Ich bin in Kolumbien geboren«, sagte Lucky. »Meine Mom ist in die Staaten gezogen, als ich zwei war, und hat dort meinen Stiefvater geheiratet.«
Rolf lächelte schwach – seine Theorie hatte sich bestätigt. »Also wollen sie uns vielleicht wegen unserer unterschiedlichen Ethnien, nicht wegen unserer Nationalitäten. Und ich vermute, sie wollen, dass wir alle des Englischen mächtig sind, weil auch sie Englisch sprechen, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich Amerikaner oder Briten oder Australier sind.«
»Es interessiert mich nicht, wer sie sind«, sagte Leon mit einem trotzigen Blick in Richtung des dunklen Fensters. »Solange sie dafür bezahlen.«
»Denkst du, das ist der Grund, weshalb dieser Ort so sonderbar ist?«, fragte Cora. »Mit all diesen komischen Perspektiven und zusammengewürfelten Epochen? Vielleicht ist das eine Art psychologischer Test, um herauszufinden, wie viel Stress wir ertragen?«
»Falls das ein psychologisches Experiment ist«, sagte Rolf, »dann werden sie uns ihr Ziel nicht verraten. Es würde sonst die Daten verzerren, die sie sammeln. Aber da ist etwas, worüber wir nachdenken sollten. Bei jedem Experiment gibt es eine Kontrollgruppe. Eine Testperson, die nicht manipuliert ist, damit sie wissen, dass ihre Ergebnisse korrekt sind. Jemand innerhalb des Experiments. Ein Maulwurf. Was bedeutet, dass die dringlichere Frage lautet … können wir uns gegenseitig vertrauen?«
Keiner von ihnen sagte ein Wort. Cora und Leon rieben sich beide die Schläfen, als wären ihre Kopfschmerzen schlimmer geworden. Zu spät erkannte Rolf seinen Fehler. Er hatte keinesfalls beabsichtigt, Zweifel zu säen … es war nur ein vollkommen logischer Gedankengang gewesen. Aber jetzt konnte er geradezu spüren, wie ihre Augen verunsichert hin- und herhuschten, um die anderen zu beurteilen. Er blickte zu Nok … einem Mädchen, das ihn brauchte. Und Lucky … der ihn verteidigt hatte. Hatte er bereits seine Chance auf Freundschaft vertan?
Wie dumm.
Beim nächsten Mal würde er einfach die Calendula officinalis betrachten und die Klappe halten.
7 – Cora
»Ein Spitzel?« Coras Stimme schnitt durch die Stille.
Nok presste sich die Finger auf den Schädel, schluchzte wieder. Selbst Leon, der so abgebrüht tat, schritt nervös über die Pfefferminzbonbons und zermalmte sie zu einer klebrigen Masse. Cora spürte die Panik der anderen – und zugleich ihre eigene. Aber Panik würde ihnen nicht weiterhelfen.
Sie sah zu ihrem Spiegelbild in dem schwarzen Fenster und zwang sich, die verkrampften Muskeln in ihrem Gesicht zu entspannen – ihre zusammengebissenen Zähne, ihre gerunzelte Stirn –, bis sie äußerlich ruhig wirkte. Das war etwas, worin sie Übung hatte.
Bei einer politischen Kundgebung ihres Vaters draußen in Virginia Beach, lange vor der Scheidung ihrer Eltern, hatte es eine Bombendrohung gegeben. Die Sicherheitsleute hatten sie hastig zu einem Zelt gebracht. Ihr Vater war eine Stunde später unversehrt nachgekommen und hatte ihr die Tränen aus den Augen gewischt. Eine Mason lässt niemals zu, dass die Welt sie weinen sieht, hatte er gesagt. Egal, wie groß ihre Angst ist, sie lächelt.
Cora konnte sich zwar zu keinem Lächeln durchringen, aber zumindest war ihre Stimme ruhig. »Keiner von uns ist ein Spitzel«, sagte sie.
»Oh, ja?«, fragte Leon. »Und wie oft ist einem hübschen Mädchen wie dir schon mal ein Spitzel über den Weg gelaufen?«
Cora drehte sich von ihrem Spiegelbild weg und kämpfte den Drang nieder, ihm von Bay Pines zu erzählen. »Ich sage bloß, wir sollten uns nicht schon nach fünf Minuten zerfleischen. Wir wissen nicht, was los ist. Wir wissen nicht einmal, was in den anderen Läden ist.«
Lucky schob sich vom Verkaufstresen weg. »Du hast recht. Und genau das sollten wir herausfinden.«
Cora fing seinen Blick auf. Bleib, wo du bist, flüsterte die Stimme des Bodyguards ihres Vaters – aber es wirkte nicht, als wäre Hilfe unterwegs.
Sie nickte.
Im Gänsemarsch gingen sie hinaus und marschierten in die Spielhalle, die von der Aufteilung stark an das Spielzeuggeschäft erinnerte: ein Glastresen an der einen Seite, ein schwarzes Fenster und mehrere Spielkonsolen an der gegenüberliegenden Wand. Die Dunkelheit im Innern wurde nur von zuckenden Blinklichtern durchbrochen, bei denen Cora die Augen zukneifen musste, während piepsende Geräusche zu hören waren, die sie an die Spielhalle in Richmond erinnerten, die sie als Kind geliebt hatte. Nach der Schule hatte ihre Mutter sie zusammen mit ein paar ihrer Freundinnen im Einkaufszentrum abgesetzt, und während die anderen Mädchen nach billigen Ohrringen shoppten, hatte Cora mit dem gelangweilten Kaufhausdetektiv am Krallen-Automaten gespielt.
Sie fingerte nach ihrer Kette, von der sie vergessen hatte, dass sie nicht mehr da war.
»Sieht ganz so aus, als hättest du recht, Rolf«, sagte Lucky und zeigte zu dem Glastresen, in dem es einen kupfernen Schlitz für Spielmarken gab und der einen rotierenden Ring mit knallbunten Preisen beherbergte: eine Gitarre, einen Bumerang, ein kleines rotes Radio, bei dem Cora sogleich der Gedanke kam, ob sie es umbauen könnten, um ein Notsignal auszusenden. »Alle Videospiele sind Rätsel. Wahrscheinlich testen sie unsere Hand-Augen-Koordination oder etwas in der Art.«
Als Nächstes betraten sie den Schönheitssalon, der in farbenprächtigem französischem Dekor gehalten war. Nok sank in einen der Sessel und strich über das Samtpolster. »Schick.«
Cora sah sie von der Seite an. Für ein angebliches Supermodel hatte sie einen grässlichen Geschmack.
Lucky kratzte sich am Hals. »Und wo sind die Rätsel?«
Rolfs Finger tippten zuckend gegen seine Beine, während sein Blick von den Fotografien an der Wand zum Boden huschte. Cora beugte sich vor. »Du weißt es, nicht wahr?«
»Ja, aber ich wollte … euch allen die Möglichkeit geben, es selbst herauszufinden. Seht euch die Fotografien an den Wänden an. Es sind Pärchen. Eine Art Memory-Spiel.« Er schob die Bilder paarweise zusammen, und ein Chip rollte aus einer metallenen Schiene in der Ladentheke, die völlig identisch mit der in den anderen Geschäften war. Er steckte den Chip in den Schlitz, und ein roter Nagellack fiel trudelnd zu Boden. Nok stupste das Fläschchen mit der Zehenspitze an, als könnte es beißen. Als nichts geschah, steckte sie es sich trotz der merkwürdigen Blicke der anderen in die Tasche.
»Was? Das ist meine Lieblingsfarbe.«
Wie von Geisterhand erschienen an der Wand neue Fotografien. Jetzt waren es berühmte Sehenswürdigkeiten aus aller Welt: der Eiffelturm, das Taj Mahal, zusammen mit den Umrissen verschiedener Länder. Coras Kopf war immer noch benebelt, aber sie berührte das ihr am nächsten gelegene Bild, den Eiffelturm, und drehte an dem darunter, bis Frankreich zu sehen war.