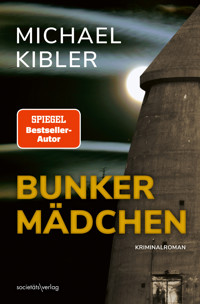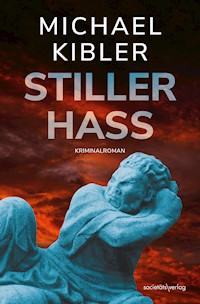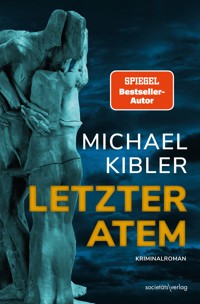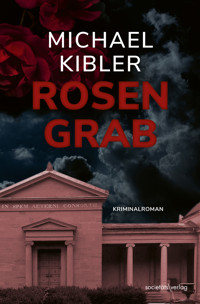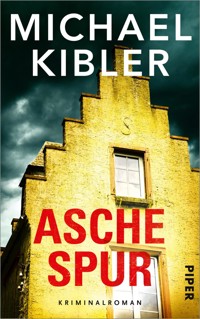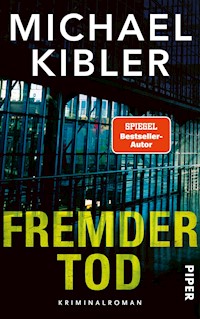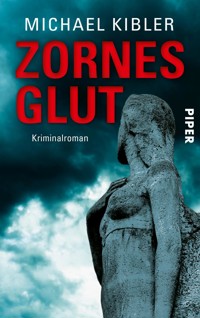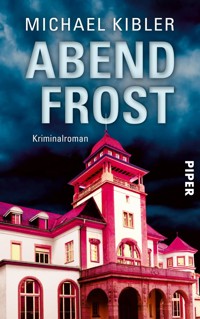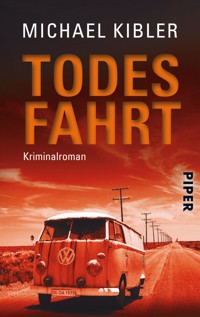
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als in einem Wald bei Darmstadt die Leiche des Amerikaners William Fishkin auftaucht, stehen die Kommissare Steffen Horndeich und Margot Hesgart vor einem Rätsel: Warum wurde der Mann erschlagen? Und weshalb hielt er sich überhaupt in Deutschland auf? Bald stellt sich heraus, dass Fishkin als Privatdetektiv arbeitete, sein letzter Aufenthalt in Hessen jedoch war rein privater Natur – er war auf der Suche nach seinem Erzeuger. Obwohl dieser seine Vaterschaft gleich anerkannte, schien irgendetwas nicht zu stimmen. Denn warum hat Fishkin sich sonst bei der amerikanischen Polizei nach mysteriösen Todesfällen vor vierzig Jahren erkundigt? Allmählich kommen Horndeich und Hesgart einem düsteren Geheimnis auf die Spur, dessen Kenntnis fatale Auswirkungen hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meine Eltern
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage Dezember 2011
ISBN 978-3-492-95391-7 © Piper Verlag GmbH 2011 Umschlagkonzept und -gestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: Christof R. Schmidt / f1online, Elizabeth Pratt / Funk Zone Studios / Corbis
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
PROLOG
Er sah auf den Boden, konnte kaum begreifen, was er soeben getan hatte.
Jetzt bloß keine Panik!
Er hatte den Mann erschlagen.
Einfach so.
Nein, natürlich nicht einfach so.
Wie viel Demütigung kann man ertragen, bevor die Sicherungen durchbrennen, alle auf einmal? Wie viel Geschmacklosigkeit, wie viel …?
Müßig, jetzt darüber nachzudenken, denn der Mann würde nie wieder ein Wort zu ihm sagen.
Er spürte keine Reue. Auch keine Erleichterung. Im Moment spürte er gar nichts.
Und wenn die beiden anderen gleich wieder zurückkämen? Dann hätte er ein Problem. Wie sollte er ihnen erklären, was er sich selbst nicht genau erklären konnte? Wie sollte er die Notwehr erklären? Rein rechtlich gesehen war es keine Notwehr gewesen. Es sei denn, man akzeptierte es als adäquate Reaktion auf seelische Grausamkeit, wenn man einen Menschen erschlug. Totschlag war es auf jeden Fall. Tötung ohne Tötungsabsicht. Was so auch nicht stimmte, denn in dem Moment, als er zugeschlagen hatte, hatte er genau das gewollt: den Mann töten. Aber das musste ja niemand wissen.
Auf einmal blitzte ein anderes Wort in seinem Kopf auf: Gefängnis.
Das hier würde Konsequenzen haben. Er würde in den Knast wandern. Ob für kurz oder lang – darüber würde ein Heer von Menschen entscheiden, die allesamt keine Ahnung hatten. Der Mann vor ihm war tot und würde ihn damit in den Bau schicken. Er verhöhnte ihn, ließ über sein Ableben hinaus sozusagen noch die Muskeln spielen, zeigte, wer nach wie vor am längeren Hebel saß.
Ihm blieb nicht mehr viel Zeit, um zu verschwinden. Auch wenn ihm klar war, dass die Polizei ohnehin früher oder später auch an seine Tür klopfen würde.
Wie hatte er sich selbst nur so reinreiten können? Er, der sonst so besonnen war, so akkurat, intelligent, der immer eine rationale Lösung hatte. Er, ein Vorbild für Familie und Gesellschaft.
Er musste abhauen. Sofort. Noch bevor die beiden zurückkamen und die Leiche fanden.
Obwohl …
Vielleicht war es ja gar nicht so schlecht, wenn ausgerechnet sie über den Toten stolperten. Genau genommen konnte ihm das sogar recht sein. Er dachte kurz nach. Dann erkannte er: Das war die Lösung für sein Problem! Es war sogar brillant!
Und während er sich vorsichtig vom Tatort entfernte, nahm der Plan, durch den er seine Haut würde retten können, in seinem Kopf Gestalt an. Binnen weniger Sekunden wusste er genau, was er zu tun hatte. Er würde nicht in den Bau gehen. Niemals. Wenn alles gutginge, würde gar niemand in den Bau gehen.
Alle wären zufrieden.
Vielleicht sogar glücklich.
Diesmal saß endlich einmal er am längeren Hebel.
DONNERSTAG, 9. DEZEMBER
16.00 Uhr
Der Tisch war festlich gedeckt. Die Kerzen im silbernen Leuchter verströmten warmes Licht.
Das war’s dann aber auch schon mit der Wärme, dachte Margot Hesgart, während sie lächelnd sagte: »Danke.« Evelyn hatte ihr gerade Kaffee nachgeschenkt.
Evelyn Hartmann, nein, ProfessorDr. Evelyn Hartmann feierte an diesem zehnten Dezember ihren sechzigsten Geburtstag. Und sie hatte eine bescheidene Tafel gedeckt. Für sich und ihren Freund Freddy. Für Margot und Rainer. Und für Sebastian Rossberg, Margots Vater. Seit dreieinhalb Jahren war der nun schon mit Dr. Evelyn liiert.
Margot Hesgart, achtundvierzig Jahre alt, Hauptkommissarin bei der Darmstädter Mordkommission, wollte sich nicht in das Privatleben ihres Vaters einmischen. Aber seitdem er mit seiner ehemaligen Lateinlehrerin verbandelt war, war das Band zwischen Margot und ihrem Vater etwas ausgeleiert.
Margots Mann Rainer schien mit der Dame keinerlei Probleme zu haben. Sie schenkte ihm ebenfalls Kaffee ein, er parierte mit einem Bonmot, das weit über Margots simples »Danke« hinausging, und Evelyn schenkte ihnen allen eine weitere Kostprobe ihres perlenden Lachens.
Hilfe, dachte Margot Hesgart, kann mich hier nicht irgendwer rausholen?
Aus den Boxen klang die Stimme von Sofia Karlsson, der neuesten musikalischen Entdeckung ihres Vaters. Sie sang auf Schwedisch. Das Lied, hatte ihr Vater ihr vor Kurzem erklärt, sei die Vertonung eines Gedichts von Dan Andersson, einem bekannten schwedischen Dichter. Der besang darin, wie er auf die Frau seiner Träume wartete.
»Und du?«
Margot hatte keine Ahnung, was Rainer von ihr wollte, dann registrierte sie, dass alle am Tisch Sitzenden sie erwartungsvoll ansahen. Nur hatte sie keine Ahnung, worüber die gerade gesprochen hatten. Kann nicht jemand irgendwo in der Stadt einen Mord begehen?, dachte sie. Als Hauptkommissarin der Darmstädter Mordkommission wäre sie dann unabkömmlich.
»Nun, so und so«, sagte sie. Damit konnte sie nicht grundsätzlich falschliegen.
»Das meinst du nicht ernst, oder?«, fragte ihr Vater. Und Margot spürte Aggression in sich aufsteigen. Sie hatte keine Ahnung, worüber sich die Meute gerade austauschte. Sie wollte es auch gar nicht wissen. An diesem Tag war der Sechzigste von Fräulein Oberschlau. Aber gestern war der Geburtstag von Margots Mutter gewesen. Nicht der sechzigste, sondern der siebzigste. Den sie leider nicht mehr feiern konnte, weil sie bereits seit mehr als fünfzehn Jahren tot war. Aber das schien keinen außer ihr zu kümmern. Auch ihren Vater nicht, der nach drei Jahren immer noch den devot verliebten Gockel gab.
»Doch, das meine ich verdammt ernst«, fauchte sie, obwohl sie überhaupt nicht wusste, worüber gesprochen wurde.
Daraufhin sah auch Rainer sie entsetzt an.
Verdammt, wie kam sie aus der Nummer nur wieder raus?
Der rettende Engel machte sich mit dem Klingelton ihres Handys bemerkbar. »Cool Cops« ertönte – aus dem Album »Culture Vultures« von Orson, eine Melodie, die sie ausschließlich ihrem Assistenten Steffen Horndeich zugewiesen hatte.
»Sorry«, murmelte sie. »Dienstlich.« Sie verließ den Raum.
»Margot, entschuldige, dass ich dich beim Geburtstagskaffee störe«, hörte sie Horndeich sagen, nachdem sie den Anruf entgegengenommen und sich gemeldet hatte.
»Kein Problem«, sagte sie. »Was gibt’s?«
»Wir haben hier einen Mord. Du solltest herkommen, wenn du es irgendwie einrichten kannst.«
»Schon gut, ich bin gleich da und … Äh, wo soll ich hinkommen?«
»Kennst du das Traisaer Hüttchen? Im Wald zwischen Lichtwiese und Traisa. An der Eisenbahnbrücke.«
»Bin schon unterwegs.«
»Prima. Ist verzwickt. Denn der Tote ist nicht aus Darmstadt. Also, eigentlich schon.«
Margot verstand nur Bahnhof.
»Nicht unser Darmstadt«, erläuterte Horndeich, »sondern eins in den USA. Wusstest du, dass die uns den Namen geklaut haben?«
Wusste Margot nicht. War ihr aber im Moment auch völlig egal. Viele Leichenfunde hatten sie in ihrem Leben schon aus dem Alltag gerissen. Sie war mitten in der Nacht zu Tatorten gerufen worden, wenn sie sich gerade mit Rainer geliebt hatte. Oder sonntags, nach einer Runde Badminton mit ihrer Freundin Cora, während sie unter der Dusche stand. Nett, dass sich dieser Tote ausnahmsweise mal hatte finden lassen, als sie es sich geradezu herbeigesehnt hatte, zu einem Tatort gerufen zu werden.
»Ich bin in zehn Minuten da«, versprach sie und beendete das Gespräch.
Sie ging zurück ins Wohnzimmer. Vier Gesichter starrten sie an. Auch Freddy, der schwule Freund von Evelyn, den die schon seit über vierzig Jahren kannte und von dem sich Margot inständig wünschte, Evelyn hätte ihn zur Heterosexualität missionieren können und wäre dann bei ihm geblieben.
»Ich muss dann mal«, sagte Margot, sich augenblicklich der unglücklichen Formulierung bewusst werdend. »Ich komme so schnell heim, wie es geht«, fügte sie noch hinzu, gab ihrem verdutzten Mann Rainer einen Kuss auf den Mund, dann huschte sie aus dem Wohnzimmer, durch den Flur und durchs Treppenhaus, und mit jedem Meter, den sie zwischen sich und Evelyn brachte, konnte sie freier atmen. Bezeichnete man die Lebensgefährtin des Vaters, wenn man die vierzig hinter sich gelassen hatte – weit hinter sich gelassen hatte –, eigentlich noch als Stiefmutter?
Niemals!, dachte Margot und lief in Richtung ihres Wagens. Fünf Minuten Fußmarsch. Die Begriffe »Parkplatz« und »Papas Wohnung« waren zwei Termini, die sich wie Nord und Süd abstießen, so weit sie nur konnten.
Margot drückte auf den Taster ihres Wagenschlüssels. Der Mini antwortete. Sie stieg ein. Gut, dass sie den BMW ihrem Sohn geschenkt hatte. Er hatte jetzt Familie und war froh um den Wagen gewesen. Sie fuhr einen feuerroten Mini-Clubman, den sie nun in Richtung Traisaer Wald lenkte.
Der kleine Platz vor dem Traisaer Hüttchen war zum Parkplatz mutiert. In stiller Eintracht standen dort zwei rote Chrysler Crossfire nebeneinander, ein untrügliches Anzeichen dafür, dass außer Horndeich auch der Gerichtsmediziner Martin Hinrich am Tatort eingetroffen war.
Margot stellte ihren Mini neben den beiden Sportwagen ab. Ein Kollege der Schutzpolizei, der sie erkannte, deutete in Richtung der Absperrung. Die war quer über die Brücke gespannt, unter der die Gleise der Odenwaldbahn verliefen.
Margot schlüpfte in einen weißen Einwegoverall und blaue Einwegüberschuhe aus Plastik, um keine falschen Spuren zu hinterlassen, dann duckte sie sich unter dem Absperrband hindurch. Die Kollegen wuselten alle in diesen weißen Overalls umher, die vor dem Schnee wie groteske Tarnkleidung wirkten. Das Zentrum der Ermittlungen war einfach auszumachen: Ein Plastikdach war über den Tatort gespannt, damit neuerlicher Schneefall nicht alle Spuren vernichtete.
Vorausschauend, dachte Margot und sah nach oben in den grauen Himmel. Die erste Flocke schmolz auf ihrer Nase, die nächste auf dem linken Augenlid. Die folgenden konnte sie nicht mehr zählen. Gleichzeitig setzte Wind ein. Wunderbar, dachte sie.
Sie entdeckte Kommissar Steffen Horndeich. Der zehn Jahre jüngere Kollege wurde von allen nur mit seinem Nachnamen gerufen. Er stand neben der Leiche. Hinrich, der Gerichtsmediziner aus Frankfurt, untersuchte sie. Auch Horndeich und Hinrich waren in weiße Overalls gehüllt, wobei Hinrich keine Bauchwölbung mehr vor sich hertrug. Seit der Kollege eine Freundin hatte, waren ein paar Pfunde gepurzelt, Opfer seiner Eitelkeit. Steht ihm aber gut, dachte Margot.
»Hi«, grüßte Horndeich seine Chefin. »Gut, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Highlight deiner Familienfeier gerissen.«
Margot winkte ab. »Passt schon. Also?«
»William Fishkin. Trug zwar keine Brieftasche und auch kein Handy bei sich, aber wenn ihm jemand die Taschen leer geräumt hat, dann hat er das Etui mit den Visitenkarten übersehen. Offenbar US-amerikanischer Staatsbürger. Kommt aus Darmstadt, Indiana.«
»Ein Darmstadt in den USA?« Margot musste schmunzeln.
Kollege Ralf Marlock, den Margot zunächst gar nicht wahrgenommen hatte, schien ihre Frage als Stichwort für seinen Einsatz anzusehen. »Darmstadt in Indiana hat ungefähr eintausenddreihundert Einwohner. Liegt am südlichen Rand von Indiana. Und hat erst sechshundertdreiundvierzig Jahre nach unserem Darmstadt die Stadtrechte erhalten.«
»Woher wissen Sie das denn?«, wunderte sich Margot.
»Aus so einem kleinen Stadtführer.«
»Und wann hat unser Darmstadt die Stadtrechte erhalten?«, fragte Margot.
Marlock zuckte die Schultern.
Tja, so ist das mit fundiertem Halbwissen, dachte Margot.
Horndeich stand seinem Kollegen bei. »Sechshundertdreiundvierzig Jahre vor dem amerikanischen Darmstadt.« Dann fuhr er fort: »Der Tote hatte sonst keinerlei Dinge bei sich, die uns etwas darüber sagen könnten, woher er kam und wo er hier in der Gegend abgestiegen ist. Keine Schlüssel, nichts.«
Margot besah sich den Toten. Die rechte Seite des Gesichts war blutverschmiert. Offensichtlich war er auf den Grenzstein gefallen, einen Wacker von der Größe eines Lastwagenrads, an dem die Gebiete von Darmstadt, Mühltal und Roßdorf endeten. Oder Ober-Ramstadt? Sie hätte näher herantreten müssen, um die Inschrift lesen zu können, aber sie wollte Hinrich nicht im Weg stehen.
Abgesehen von dem Blut sah Fishkin sehr gepflegt aus. Der Mantel war aus Kaschmir. Der Anzug schien ebenfalls kein Modell von der Stange. Sollte sich ihr Rainer mal ein Beispiel nehmen … Auch die Lederschuhe hatten sicherlich einiges gekostet. Fishkin war glatt rasiert. Das Haar zeigte bereits einige grausilberne Strähnen. Zweifelsohne war William Fishkin im Leben ein attraktiver Mann gewesen.
Heribert Zoschke, ebenfalls Mitglied der Mordkommission, trat auf Horndeich zu. »Ich hab das mit den Zuständigkeiten geklärt. Zuständig für Darmstadt ist das Vanderburgh County Sheriff’s Office. Ist nicht weit von Darmstadt entfernt. Also von deren Darmstadt.«
»Wie spät ist es bei denen jetzt?«, wollte Horndeich wissen.
Auch darauf wusste Zoschke eine Antwort. »Sieben Stunden früher. Also …«, er sah auf seine Uhr, »neun Uhr dreißig. Die haben gerade gefrühstückt.«
Hinrich, der neben der Leiche gehockt hatte, erhob sich und streifte die Handschuhe ab.
»Und?«, fragte Margot.
»Tot.«
»Geht es etwas genauer?«
»Mausetot.«
Margot setzte gerade zu einer nicht sehr freundlichen Entgegnung an, als Horndeich sagte: »Hinrich, bitte.«
Für gewöhnlich konnte Margot ganz gut mit Hinrichs Flapsigkeit umgehen, doch an diesem Tag war sie sehr dünnhäutig, als hätte jeder Satz auf dieser vermaledeiten Geburtstagsfeier eine Schicht ihres emotionalen Schutzpanzers abgeschmirgelt.
»Er hat einen Stein auf den Kopf gekriegt. Links an den Hinterkopf. Wohl mit dem Klunker dort.« Er zeigte auf einen Stein am Boden, der aufgrund seiner spitz zulaufenden Form an ein Bügeleisen erinnerte und auch die entsprechende Größe aufwies. An der Spitze klebte braune Kruste. »Den muss ihm jemand gegen den Kopf geschlagen haben, und zwar ziemlich feste. Dennoch glaube ich, das war nicht tödlich. Aber dann ist er umgekippt und auf den Grenzstein geschlagen, wobei es die rechte Seite des Hinterkopfs erwischt hat, und das war’s dann. Genaues kann ich euch natürlich erst sagen, wenn ich ihn in Frankfurt …«
»… auf dem Tisch hatte«, beendete Horndeich den von Hinrich stets rituell wiederholten Satz. »Wie lange ist er schon tot?«
»Nicht länger als drei Stunden, nicht kürzer als zwei. Grobe Schätzung. Todeszeitpunkt also zwischen vierzehn und fünfzehn Uhr.«
»Und wie alt schätzen Sie ihn?«
»In den besten Jahren. Vielleicht ein wenig jünger.« Hinrich, der eitle Fatzke, war fünfzig. Womit die besten Jahre – zumindest für ihn – eindeutig definiert waren.
»Wer hat ihn gefunden?«, wollte Margot wissen.
»Ein Joggerpärchen«, antwortete Horndeich. »Sie ist gestolpert und deshalb fast in dem Gestrüpp neben dem Stein gelandet. Und damit fast auf Fishkin. Ich habe schon mit denen gesprochen, aber sie konnten nicht viel sagen. Waren allein im Wald, bei dem Sauwetter und der Tageszeit.«
Margot sah sich um. Bäume weit und breit. Aber nirgends eine Überwachungskamera. Sie besah sich wieder den Toten, betrachtete dann den Stein. »Sieht nicht nach langfristiger Planung aus. Eher nach eskaliertem Streit.«
»Könnte sein«, meinte Horndeich. »Also ist die große Frage, mit wem der hier spazieren war. Und warum.«
»Gut«, sagte Margot, »dann verständigen wir erst mal die Kollegen in Amerika. Vielleicht ist Fishkin ja kein Unbekannter.«
Margot setzte sich an ihren Schreibtisch, griff zum Telefonhörer und wählte die Nummer, die Zoschke ihr auf einem Zettel notiert in die Hand gedrückt hatte. Doch die Nummer war besetzt.
Sie machte sich einen Kaffee am Espresso-Vollautomaten. Früher hatte an dieser Stelle die schlechteste Kaffeemaschine der Welt gestanden, von allen Kollegen verspottet und verächtlich behandelt. Den Kaffee hatten sie dennoch getrunken. Dann hatte Espresso-Queen Einzug in Margots und Horndeichs Büro gehalten, und auch sie wurde skeptisch beäugt, als wäre sie schuld daran, dass die alte Maschine nicht mehr da war.
Margot teilte solche Sentimentalitäten nicht. Sie genoss einfach nur den leckeren Bohnensud mit einem halben Löffel Zucker – gegen die Bitterkeit, wie sie immer zu sagen pflegte.
Als Horndeich im Büro eintraf, steuerte auch er schnurstracks auf die Maschine zu. »In Amiland schon jemanden erreicht?«
»Nein«, antwortete Margot. »Ich versuche es gleich noch mal.«
»Okay. Und ich versuche über die Military Police hier vor Ort was rauszubekommen. Vielleicht kennen die den Toten ja.«
Margot nickte und wählte wieder die Nummer des Vanderburgh County Sheriff’s Office. Diesmal tutete das Freizeichen.
»Vanderburgh County Sheriff’s Office, Captain Nick Peckhard speaking. How can I help you?«
»This is Margot Hesgart from the Police Department Südhessen«, stellte sie sich vor, dann kam ihr der Gedanke, dass der Amerikaner mit dem Begriff Südhessen wahrscheinlich so viel verband wie sie mit dem Namen einer chinesischen Provinz, und sie fügte erläuternd hinzu: »I mean – from the Police Department South Hessia in Germany.«
Na, wenn das mal nicht gleich viel besser zu verstehen war. Hessia – war das überhaupt die korrekte englische Form?
»Hessen heißt Hesse auf Englisch«, soufflierte Horndeich und grinste.
»I mean from the Police Department in Darmstadt, Germany.«
»Sehr angenehm«, antwortete der amerikanische Ordnungshüter auf Deutsch. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
Zwar hatte seine Aussprache einen leichten amerikanischen Akzent, doch Margot war angenehm überrascht, dass sie sich auf Deutsch mit ihm unterhalten konnte. Schon allein deswegen, damit ihr Kollege das überhebliche Grinsen einstellte.
Dessen Kinnlade folgte dem Ruf der Schwerkraft, als Margot auf Deutsch weitersprach: »Mr Peckhard, wir haben heute bei uns in Darmstadt eine Leiche gefunden. Der Mann wurde ermordet. Sie wissen, wo Darmstadt liegt? Das ist in der Mitte von Deutschland. Bei Frankfurt am Main.«
»Und rund vierzig Meilen von Heidelberg und etwa dreißig von Wiesbaden entfernt. Ich kenne Ihr Darmstadt.«
Der Mann überraschte sie ein weiteres Mal. »Also, der Mann, den wir gefunden haben, er stammt aus Ihrem Darmstadt. Wohnt wahrscheinlich in der West Wortman Road. So stand das auf seiner Visitenkarte. William Fishkin. Vielleicht ist er bei Ihnen im System.«
Am anderen Ende der Leitung herrschte Schweigen.
»Hallo? Sind Sie noch da?«
»Ja, Entschuldigung. Sagten Sie William Fishkin?«
»Ja.«
»Neununddreißig Jahre, dunkles Haar, etwas grau, keine Brille, etwa six feet tall, also etwa einen Meter und achtzig Zentimeter groß?«
»Sie kennen ihn«, sagte Margot. Das Fragezeichen konnte sie sich getrost schenken. »Ich schicke Ihnen dennoch ein Foto. Damit wir sicher sind.«
»In Ordnung«, erwiderte Peckhard und nannte Margot seine E-Mail-Adresse. »Bitte schicken Sie mir auch Ihre Telefonnummer; ich sehe Sie auf dem Display nicht. Ich melde mich gleich wieder bei Ihnen, Mrs …«
»Hesgart, Margot Hesgart.«
»Mrs Hesgart. Okay, ich erwarte Ihre E-Mail.«
»Geht sofort raus, Mr Peckhard.«
»Prima, ich melde mich dann gleich. Auf Wiederhören«, sagte Peckhard und legte auf.
»Was war denn das?«, fragte Horndeich.
»Ein Officer und Gentleman«, sagte Margot. »Der zum einen hervorragend Deutsch spricht und zum anderen Fishkin kannte, und zwar persönlich, so wie er klang.«
»Dann kann ich mir das mit der Military Police ja sparen«, meinte Horndeich, doch dann sagte er: »Na, ich ruf dort doch lieber mal an. Nicht, dass man uns hinterher nachsagt, wir hätten was übersehen.«
Margot tippte die Mail an Peckhard, hängte ein Foto an, das die Kollegen von der Spurensicherung bereits auf dem Server abgelegt hatten, und vergaß auch nicht, ihre Durchwahl anzugeben.
Währenddessen telefonierte sich Horndeich durch die verschiedenen Abteilungen der Military Police, und sie beneidete ihn um sein flüssiges Englisch. Ob es grammatisch immer korrekt war, konnte sie nicht beurteilen, aber sie war auf jeden Fall beeindruckt.
Keine zwei Minuten, nachdem sie die E-Mail verschickt hatte, klingelte ihr Telefon. »Vanderburgh County Sheriff’s Office, Captain Nick Peckard. Spreche ich mit Mrs Hesgart?«
»Am Apparat. Ist er es?«
»Ja. Der Tote, den Sie gefunden haben, ist Bill – also William Fishkin. Wenn Sie uns noch ein DNA-Profil schicken, können wir da ganz sicher sein; wir müssen es nur mit der DNA des Sohnes abgleichen. Aber ich habe keinen Zweifel. Ich kannte Bill. Ich wohne auch in Darmstadt, er ist fast mein Nachbar. Was ist passiert?«
Margot fasste kurz die wenigen Fakten zusammen, die sie schon herausgefunden hatten – was nicht wirklich viel war. »Wer ist William Fishkin? Ich meine, wer war er? Wissen Sie, was er in Deutschland wollte?«
»Fishkin ist geschieden, hat einen fünfzehnjährigen Sohn. Er hat in Evansville eine Detektei, war Privatdetektiv.«
»Evansville?«, fragte Margot.
»Das ist unsere Metropole, keine zehn Meilen südlich«, erklärte Peckhard. »Bill und ich hatten manchmal beruflich miteinander zu tun. War immer wieder mal in Deutschland, geschäftlich, weil er sehr gut Deutsch sprach. Das waren Aufträge von Unternehmen, die auch in Deutschland ansässig sind. Was er in Ihrem Darmstadt wollte, weiß ich allerdings nicht.« Er machte eine kleine Pause. »Damned, ich hatte Bill wirklich gern. Sie sind sicher, dass es Mord war, kein Unfall?«
Jedem anderen gegenüber hätte Margot eine schnippische Bemerkung gemacht, irgendwas in der Richtung von: »Nein, es war Suizid, er hat sich selbst einen Stein von hinten an den Kopf geworfen, und weil das noch nicht gereicht hat, hat er sich auf einen kleinen Felsbrocken fallen lassen.« Doch sie spürte sogar durch zigtausend Kilometer transatlantisches Telefonkabel mit einer Extraportion Rauschen, dass Peckhard einfach nur tief betroffen war von Fishkins Tod und mit seinen Worten ihre Arbeit nicht etwa hinterfragen wollte. Deshalb antwortete sie mit ruhiger, einfühlsamer Stimme: »Ja, Mr Peckhard. Es war Mord. Es tut mir leid, Sir.«
Sie verabschiedeten sich freundlich voneinander, nachdem Peckhard ihr versprochen hatte, ihr noch am selben Tag ein kurzes Dossier über Fishkin zu schicken. Er wollte auch Fishkins Exfrau und ihren Sohn informieren.
Kaum hatte Margot den Hörer aufgelegt, klingelte ihr Handy. Sie sah aufs Display und sah das Gesicht ihres Vaters. Sie mochte das Foto von ihm, das ihn freundlich lächelnd vor dem Weihnachtsbaum zeigte und das jedes Mal auf dem Display erschien, wenn er anrief. Sie hatte sogar eine halbe Stunde Computerunterricht genommen, um Dr. Evelyn, die die zweite Hälfte des Bildes eingenommen hatte, digital abzuschneiden. War wesentlich eleganter als das altmodische Durchreißen eines Fotos.
»Papa?«, fragte sie, nachdem sie den Anruf angenommen hatte.
»Margot, mein Schatz, magst du nicht um acht zum Abendessen kommen?«, legte er sofort los. »War schade, dass du vorhin so überstürzt weg musstest. Wir machen Raclette. Rainer ist auch noch da, und auch Dorothee kommt noch.«
Margot zögerte. Ihr Bedarf an Dr. Evelyn war für den Tag eigentlich gedeckt. Doch sie fühlte sich ihrem alten Herrn gegenüber verpflichtet. Es war ihm wichtig. Seit dreieinhalb Jahren versuchte er, aus Margot und seiner Lebensgefährtin Freundinnen zu machen. Er war zwar mit einem feinen Gefühlsradar ausgestattet, doch die Erkenntnis, dass Margot diese Frau einfach nicht leiden konnte, schien für ihn eine Art Tarnkappenflugzeug zu sein.
Auf einmal kam ihr ein Gedanke. »Sag mal, du bist doch das wandelnde Stadtlexikon. Kennst du ein zweites Darmstadt in den USA, in Indiana?«
Ihr Vater schwieg. Und ähnlich wie bei Peckhard befürchtete Margot schon, dass ihr Vater überhaupt nicht mehr in der Leitung war. »Hallo?«
»Äh … Ja, mein Schatz, das kenne ich. Warum? Soll euer Zuständigkeitsbereich wegen der Namensgleichheit erweitert werden?«
Seine Scherze waren auch schon mal besser gewesen. »Nein. Heute wurde ein Mann ermordet. Hier, in Darmstadt, Germany. Doch er kam aus diesem anderen Darmstadt in den USA, über das ich allerdings nichts weiß. Vielleicht kannst du uns nachher ein bisschen was zeigen, was meinst du?«
»Uns? Rainer und dir?«
»Ich meine Horndeich und mir. Auch er arbeitet an dem Fall.«
»Ja, gut, in Ordnung«, stimmte ihr Vater zu. »Bring den Kollegen mit. Wir haben immer noch einen Platz frei.«
Das wiederum mochte sie an ihrem Vater, in solchen Dingen war er unkompliziert. Hoffentlich war das auch Horndeich.
»Wohin komme ich mit?«, fragte der erstaunt.
20.00 Uhr
Das Essen glich eher einem höfischen Festmahl als einem gewöhnlichen Raclette. Evelyn Hartmann – Horndeich nahm einfach an, dass sie für die Leckereien verantwortlich war – hatte nur das Beste vom Besten eingekauft: eingelegte getrocknete Tomaten, sicher zehn verschiedene Varianten von eingelegten Oliven, von ganz mild über knoblauchlastig bis hin zu verdammt scharf, und zusätzlich zum Raclettekäse noch zwei große Teller verschiedenster Käsesorten in breitem Farbspektrum, vom weißen Hirtenkäse bis zum Gorgonzola in Blaugrün.
Auch beim Wein hatten sich die Gastgeber nicht lumpen lassen. Horndeich würde sich nachher lieber einen Benz mit gelbem Schild leihen, als sich von Margot, Rainer oder jemand anderem nach Hause kutschieren zu lassen.
Er war verwundert gewesen, dass Margot ihn zu ihrem Vater mitgenommen hatte, und dann hatte sie sich sogar noch neben ihn gesetzt.
Die Schwingungen zwischen den Anwesenden elektrisierten die Luft, und Horndeich spürte das Kribbeln, das vor allem zwischen Margot und Evelyn Hartmann knisterte, während ihr Vater sich redlich bemühte, es nicht wahrzunehmen. Margots Mann Rainer schien davon nicht viel mitzubekommen, und Rainers Tochter Dorothee, inzwischen siebzehn, war damit beschäftigt, ihren Chihuahua Che Kunststückchen vollführen zu lassen, die Evelyn und besonders diesen schrägen Typen Freddy zu affektiertem Beifall veranlassten. Na ja, vielleicht war nicht der Hund, sondern eher der Cabernet Sauvignon dafür verantwortlich.
Horndeich vertrieb sich die Zeit damit, all den aufgetischten Leckereien Respekt zu zollen, und versuchte aus Spaß, die Köstlichkeiten in alphabetischer Reihenfolge zu naschen. Nach dem R musste er allerdings übersättigt aufgeben.
»Espresso?«, fragte Sebastian Rossberg in die Runde, die den Vorschlag ohne Enthaltung annahm.
»Und dann erzählst du uns etwas über dieses andere Darmstadt, okay?« Margot strahlte ihren Vater an, und für einen kleinen Moment konnte Horndeich erahnen, wie sie ihn als kleines Mädchen um den Finger gewickelt hatte. Sie hatte als Kind sicherlich dreimal so viel Eis bekommen, wie es ihrer Mutter recht gewesen war. Heimlich natürlich. So ein Papa-Tochter-Ding. Horndeich musste schmunzeln.
Sebastian Rossberg warf Evelyn einen Blick zu, und sie deutete ein Nicken an. Gnädig, dachte Horndeich.
»Was für ein anderes Darmstadt meinst du?«, fragte Rainer seine Gattin.
Doch die Antwort kam vom Experten höchstselbst. »Darmstadt in Amerika. Dort gibt es auch eins. Es gab sogar mal zwei, eines in Illinois, ist aber inzwischen eingemeindet worden und hat damit seinen Namen verloren. Und in der Ukraine und in Russland gab’s an die sieben. Aber heute gibt’s nur noch zwei Darmstadts: unseres und das in Indiana, USA.« Sebastian Rossberg kam langsam in Fahrt. »Gebt mir einen Moment, wenn euch das interessiert, dann zeig ich euch ein paar Bilder.«
Horndeich fragte sich, wie es Sebastian Rossberg geschafft hatte, sich trotz Geburtstagsfeier so gut auf seinen Vortrag vorzubereiten. Offenbar gefiel ihm das Thema.
Rossberg stand auf, holte ein Netbook und einen kleinen Beamer, stellte beides auf den Wohnzimmertisch und richtete den Projektor auf eine Wand, von der er ein Gemälde abnahm, um dort Platz zu schaffen, irgendein modernes Gekleckse; wenn Horndeich so etwas sah, beschlich ihn immer der Verdacht, der Künstler hätte eine leere Leinwand für drei Stunden einer Kindergartengruppe überlassen, um sie später bunt bekleckst für zigtausend Euro an den Mann zu bringen.
Die Gäste gruppierten sich im Wohnzimmer auf Couch und Sessel. Dorothee nahm ihren Hund auf den Schoß, kraulte ihn gedankenverloren. Margot und Evelyn Hartmann nahmen so weit voneinander entfernt Platz, wie es die Sitzgelegenheiten zuließen. Rainer, der sich neben Evelyn gesetzt hatte und neben dem noch ein Platz frei war, winkte Margot zu sich, doch die schüttelte nur den Kopf, womit Horndeich in den Genuss kam, neben Rainer sitzen zu dürfen.
»Das ist es«, sagte Sebastian Rossberg und zeigte eine Luftaufnahme aus Google Earth: ein paar Straßenzüge, dann ein paar versprengte Gebäude – das amerikanische Darmstadt war offenbar nicht mehr als ein verschlafenes Kaff. Rossberg vergrößerte die Satellitenaufnahme. »Südlich von Darmstadt liegt Evansville. Das hat etwas weniger Einwohner als unser Darmstadt.« Nun wurde deutlich, dass Darmstadt zum Metropolgürtel der Großstadt gehörte.
Rossberg zeigte einen noch größeren Ausschnitt. »Hier ist Indiana. Evansville liegt an der südlichen Grenze, direkt am Ohio River. Oben am Michigansee liegt Chicago, knapp fünfhundert Kilometer nördlich von Darmstadt.«
»Ach, da ist das«, äußerte Horndeich, der endlich eine Vorstellung davon bekam, wo dieser Fishkin zu Hause gewesen war.
Rossberg zeigte das Foto eines großen Platzes vor einer einstöckigen Ladengalerie, die von mehreren Spitzdächern geziert wurde, eines davon ein exponiertes Uhrentürmchen. »Das ist der Marktplatz und gleichzeitig der Stadtmittelpunkt. Darmstadt hat rund tausendfünfhundert Einwohner. Eigentlich eher eine Schlafstadt, denn die meisten arbeiten in Evansville. Dennoch ist Darmstadt, USA, eine eigenständige Stadt, seit 1973 mit Brief und Siegel.«
»Waren Sie schon mal dort?«, fragte Horndeich.
Sebastian Rossberg unterdrückte, so schien es, einen Seufzer. »Nein, ich selbst noch nicht«, antwortete er dann, und seine Stimme war eine Spur leiser geworden, als hätte jemand den Lautstärkeregler zurückgedreht.
Er zeigte das nächste Bild, eine Kirche. »Die Salem Church of Darmstadt. Hat eine starke Kirchengemeinde. Machen auch Konzerte.«
»Woher weißt du das alles, wenn du noch nie dort warst?«, wollte Margot wissen.
»Internet, werte Tochter.«
»Du sammelst Informationen über dieses völlig unbedeutende Darmstadt in Indiana?«
»Es interessiert mich eben.«
Der Polizist in Horndeich registrierte sehr wohl, dass Rossberg in einem Tonfall antwortete, als wäre er der Tatverdächtige bei einer Vernehmung, der vehement eine Tat leugnet, der er schon so gut wie überführt ist. Er nahm Rossberg nicht ab, dass er nie in dem anderen Darmstadt gewesen war. Aber er konnte sich nicht erklären, weshalb Rossberg das nicht zugeben wollte.
Rossberg klickte weiter. »Das ist das ›Bauerhaus‹, der erste Veranstaltungsort am Platz. Eine ganz alte Aufnahme, aus den Fünfzigern.«
Im Vordergrund sah Horndeich einen alten Straßenkreuzer mit breiten Doppelscheinwerfern und Heckflossen, einen Plymouth Fury, und Horndeich dachte sofort an den Film »Christine«, in dem solch ein Auto dank bösem Eigenleben zahlreiche Menschen meuchelte. Neben dem Auto prangte ein Schild mit dem Schriftzug »Bauer’s Grove« an einem Baumstumpf, und daneben wiederum strahlte eine bezaubernde junge Frau mit wallendem Haar den Fotografen an.
»Was ist das für ein Auto?«, fragte Rainer.
»Plymouth Fury, Baujahr 1958«, antwortete Sebastian Rossberg.
»Wow!«, entfuhr es Rainer.
»Meint ihr nicht, es ist jetzt genug Heimatkunde unterrichtet worden?«
Horndeich konnte Evelyn nicht sehen, weil Rainer ja zwischen ihnen saß, aber ihr war deutlich anzuhören, dass sie das Thema – noch dazu an ihrem Geburtstag – langweilte.
Sebastian Rossberg eilte zum Lichtschalter, und das Bild von Bauer’s Grove, Auto und Mädchen verblasste.
»Ich würde gern noch mehr Bilder sehen«, sagte Margot.
»Schatz, wollen wir nicht langsam nach Hause«, intervenierte Rainer.
»Nein«, entgegnete Horndeichs Chefin trotzig.
»Doro muss ins Bett, sie hat morgen Frühdienst.«
»He, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann lasst mich außen vor, ja?«, fauchte die junge Dame. Ihr Hund nahm das Aufbruchsignal pragmatischer und gähnte ausgiebig.
Wie zu Beginn des Abendessens spürte Horndeich wieder das Knistern zwischen Margot, Evelyn und Dorothee. Da kein Faradaykäfig in der Nähe war, der ihn vor dem Funkenregen schützen konnte, verkündete er: »Ich rufe mir jetzt ein Taxi.« Er hatte keine Lust, Zeuge von Familienstreitigkeiten zu werden. »Noch jemand ohne Fahrschein?«
»Kann ich mitfahren?«, fragte Dorothee. »Der Zickenkrieg hier geht mir gehörig auf den Keks.«
»Dorothee!«, kam es von Rainer und Margot wie aus einem Mund. Evelyn und Sebastian Rossberg sagten nichts, bedachten Rainers Tochter aber mit Blicken, dass der Hund die Ohren aufstellte.
»Ich zahl Ihnen meinen Anteil. Und ich geh schon mal runter.« Damit war sie – und auch der Hund – verschwunden.
Horndeich verabschiedete sich und folgte den beiden.
»Ich hab gar kein Geld dabei«, gestand ihm Dorothee, während sie im Benz Richtung Dorothees Heim fuhren. Das Haus, in dem sie mit Rainer und Margot wohnte, lag im Richard-Wagner-Weg. »Aber ich kann dieses Gezicke echt nicht mehr ertragen. Schlimmer als Mädcheninternat. Ich geb Ihnen das Geld später, Herr Horndeich.«
»Mach dir da mal keinen Kopf.«
»Mein Opa«, redete sie weiter, »seine Tussi hat ihn echt an der Kandare. Also wenn das mein Freund wäre, der so kuscht – danke, das wäre nichts für mich.«
Horndeich äußerte sich nicht dazu. Wenn sich Sebastian Rossberg dabei wohlfühlte, sollte es auch für andere okay sein. Aber für solche Erkenntnisse war Dorothee vielleicht noch etwas zu jung. Obwohl er sich nicht sicher war, ob sie nicht doch ein kleines Stückchen recht hatte.
FREITAG, 10. DEZEMBER
9.00 Uhr
Nachdem Horndeich Dorothee abgesetzt hatte, war er direkt nach Hause gefahren. Als er und Sandra vor knapp einem Jahr geheiratet hatten, war er aus seiner Altbauwohnung in ihr kleines Häuschen in der Waldkolonie gezogen.
Sandra hatte schon geschlafen und war auch nicht erwacht, als er sich neben sie ins Bett gelegt hatte, hatte sich aber im Schlaf an ihn gekuschelt. Und er war zufrieden mit sich, der Welt und seinem Schicksal eingeschlafen.
Nun war er wieder im Büro und machte sich einen Kaffee, danach goss er das Bürogrünzeug.
Das Faxgerät schien in der Nacht Überstunden gemacht zu haben. Horndeich nahm die Papiere, erstaunt darüber, dass so viele Leute noch immer Faxgeräte benutzen. Aber die hatten einen entscheidenden Vorteil: So ein Fax konnte nicht so einfach im Nirwana eines Spamordners verschwinden.
Drei der Faxe stammten von großen Handyprovidern, die damit kundtaten, dass kein William Fishkin einen Handyvertrag bei ihnen unterzeichnet hatte oder eine Prepaidkarte auf einen solchen Namen lief. Das war keine große Überraschung. Horndeich wusste nicht einmal, ob ein Amerikaner in Deutschland so einen Vertrag abschließen konnte.
Unter den Faxpapieren fand sich auch ein mehrseitiger Bericht von Hinrich. Der hatte Nachtschicht eingelegt, weil er an diesem Tag in den Urlaub wollte. Nach der Obduktion hatte er das Alter des Toten etwas nach unten korrigiert, etwa auf vierzig. In dieser Hinsicht waren sie dank der Informationen aus den USA bereits schlauer. Hinrich bestätigte seine erste Einschätzung der Todesursache. Der erste Schlag war nicht todesursächlich, wie er es so schön formulierte, wäre es aber sicherlich gewesen, wäre das Opfer nicht mit dem Kopf auf den Grenzstein gestürzt; das hatte den Schädel dann gänzlich zu Bruch gehen lassen, wodurch das Gehirn eine enorme Verletzung erlitt. Exitus.
Ansonsten war Fishkin kerngesund gewesen. Keine Drogen, Nichtraucher, wenig Alkohol, trainiert, aber nicht über das gesunde Maß hinaus.
Es klopfte an der nur angelehnten Bürotür, dann trat Baader von der Spurensicherung ein. »Morgen, Horndeich.«
Horndeich grüßte zurück.
»Ich hab gestern noch eine erste Auswertung gemacht. Wir haben auch ein paar Teilabdrücke seiner Schuhe gefunden.«
»Gut, dann wissen wir jetzt, dass das Opfer am Tatort war.«
»Scherzkeks. Nein, wir wissen außerdem, dass er nicht gerannt ist, nicht mal gejoggt. Er ist in ganz normalem Tempo gelaufen. Das heißt, dass er vor niemandem weggerannt ist.«
»Das ist ja schon mal ’ne Aussage. Damit gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat sich ihm jemand von hinten genähert und ihm den Stein auf den Kopf gebrezelt, um vielleicht ein paar Kröten und ein Handy zu krallen; die Klamotten haben ja deutlich erkennen lassen, dass der Mann nicht ganz arm gewesen ist. Oder aber er kannte den Täter, und der hat ihm ganz unvermittelt eins über die Rübe gezogen. Vielleicht ging’s um Geld, oder das Opfer hat einmal den falschen Text gesagt. Habt ihr noch andere Schuhabdrücke sichern können?«
»Nein, leider war nur ein kleiner Teil des Bodens aufgeweicht, der Rest war bei den Minustemperaturen hart gefroren. Es gibt ein paar Teilabdrücke, aber nichts davon lässt sich dem Täter zuordnen; kann auch alles von ganz harmlosen Spaziergängern stammen.«
Horndeich sah aus dem Fenster. Seit Mittag des vergangenen Tages hatte es nicht mehr aufgehört zu schneien. Horndeich hatte seinem Crossfire richtig gute Winterreifen gegönnt, nachdem er im vergangenen Winter bei Kurvenfahrten dreimal mit dem Heck ausgebrochen war.
»Danke, Paul«, murmelte er. »Das hilft schon mal weiter.«
Nachdem er die Faxnachrichten und Memos durchgesehen hatte, kamen die E-Mails an die Reihe. Noch in der Nacht hatte Peckhard einen elektronischen Brief geschickt. Horndeich zauberte ihn auf den Bildschirm und las.
Peckhard kam schnell auf den Punkt. Er hatte Fishkins Exfrau vom Tod ihres Gatten unterrichtet. Die habe sofort eine Geliebte in Deutschland für den Mord verantwortlich gemacht, von deren Existenz sie wusste, deren Namen sie aber nicht kannte. Oder vielleicht nicht kennen wollte.
Im Anhang befanden sich ein Dossier, das Peckhard zusammengestellt hatte, und auch ein paar aktuelle Fotos des noch lebenden William Fishkin. Das Dossier sei nur recht kurz, schrieb Peckhard in seiner Mail, aber er habe seine Kollegen beauftragt, weitere Fakten über das Opfer zu sammeln und zu sortieren, die er dann nach Deutschland schicken würde.
Zum Schluss erklärte er, dass er und Mrs Fishkin sich noch am selben Tag in den Flieger setzen und laut Flugplan um vierzehn Uhr fünfzig in Frankfurt eintreffen würden. Dann las er die letzten Sätze: »Das bin ich meinem Freund schuldig. Und Sam möchte von ihrem Exmann persönlich Abschied nehmen, bevor er begraben wird. Ich hoffe, es kommt nicht ungelegen.«
Horndeich sah auf die Uhr. Es war inzwischen neun Uhr elf. Wo blieb Margot?
Er druckte sich gerade das kleine Dossier über William Fishkin – den Peckhard in der Mail immer nur Bill nannte – aus, als Margot das Büro betrat. »Moin«, grüßte sie ihn in einem Tonfall, der besagte: »Wage ja nicht zu fragen, wie es mir seit deinem Abgang gestern ergangen ist!«
Ganz diplomatisch antwortete Horndeich: »Moin.«
»Was Neues?«
»Einiges«, sagte Horndeich. Während sich Margot ebenfalls einen Kaffee zubereitete, brachte Horndeich seine Kollegin auf den neuesten Stand. Hätte die Kaffeemaschine über ein zartes Seelchen verfügt, sie hätte sich sicher gefragt, wodurch sie sich an diesem Morgen eine solch rüde Behandlung verdient hatte.
Margot schaufelte sich zwei Löffel Zucker in den Kaffee. Ganz schön viel Bitterkeit, dachte Horndeich.
»Hier ist das Kurzdossier von Peckhard. Hat wohl nicht allzu viel zusammentragen können, bevor er in den Flieger sprang.«
Horndeich hatte das PDF-Dokument bereits auf dem Server abgelegt, sodass auch Margot es am Bildschirm lesen konnte.
William Fishkin war am 10. März 1971 im Krankenhaus von Evansville geboren worden und auch in Evansville aufs College gegangen. Dort hatte er mit einem Stipendium Spanisch und Deutsch studiert, da er offensichtlich eine große Begabung für Fremdsprachen gehabt hatte. Danach hatte er für die Detektei »Franks & Partner« gearbeitet, die vorwiegend im Bereich der Wirtschaftskriminalität ermittelte. Vor zehn Jahren hatte sich Fishkin dann als Detektiv selbstständig gemacht, ebenfalls mit dem Spezialgebiet Wirtschaftskriminalität, allerdings bevorzugt für Unternehmen, die auch in Europa tätig waren.
1993 hatte er geheiratet, war dann mit seiner Frau Samantha nach Evansville gezogen. 1995 war der Sohn Randy geboren worden. 2005 hatte er sich scheiden lassen und war nach Darmstadt in die West Wortman Road gezogen.
Margot beendete die Lektüre zeitgleich mit Horndeich.
»Vierzehn Uhr fünfzig rauscht er an?«, vergewisserte sie sich.
»Exakt. Wie, meinst du, sollen wir weiter vorgehen?«
»Wenn dieser Peckhard hier ist, soll er dafür sorgen, dass seine Leute in Evansville in Erfahrung bringen, ob Fishkin vielleicht jemandem bei seinen Ermittlungen zu sehr auf die Füße getreten ist. Fishkins Leiche wurde an der Traisaer Hütte gefunden, da ist es sicherlich keine abwegige Hypothese, dass er in unserem Darmstadt gewohnt hat. Ich schlage vor, wir checken zuerst mal die Hotels. Gibt ja nicht so viele in Darmstadt.«
»Gut.« Horndeich betätigte ein paarmal die Computermaus, dann druckte er eine Liste der Darmstädter Hotels aus. Zweimal. »Du fängst bei A an, ich bei Z. Wer ihn findet, bekommt vom anderen einen Döner spendiert.«
Er telefonierte gerade mit einem Hotelier, dessen Hotel mit R anfing, als Margot laut »Döner!« rief. Horndeich bedankte sich bei seinem Gesprächspartner, meinte, es habe sich erledigt, und verabschiedete sich.
»Wo ist er untergekommen?«, fragte er.
»Bockshaut. Mitten in der Stadt.«
»Wunderbar. Dann mal los.«
11.00 Uhr
»Veronika Dollerz« stand auf dem Namensschildchen, welches das Kleid der Dame hinter der Rezeption zierte. Sie war Anfang fünfzig und eine aparte Erscheinung, wenn auch die buschigen Augenbrauen ihr etwas Eulenhaftes verliehen. Fehlt nur noch, dass sie den Kopf um hundertachtzig Grad dreht, wenn sie auf das Schlüsselbrett hinter sich schaut, dachte Margot.
Frau Dollerz klickte sich auf ihrem Computer durch diverse Menüs, dann sagte sie: »Da haben wir ihn. William Fishkin. Aus Darmstadt in Indiana. Lustig, ich wusste bis vor ein paar Wochen gar nicht, dass es noch ein Darmstadt gibt.«
Margot hatte der Dame vor ein paar Minuten eines der Fotos gezeigt, die Peckhard ihnen per E-Mail geschickt hatte. Die Hotelangestellte hatte Fishkin sofort erkannt. Und war sehr betroffen gewesen, als Margot ihr mitgeteilt hatte, dass Fishkin nicht mehr lebte.
»War er schon öfters hier?«, fragte die Polizistin.
Wieder klickte sie ein paarmal mit der Maus, dann hörte Margot, wie der Drucker zu arbeiten begann. »Im Oktober war er das erste Mal hier. Dann immer in zweiwöchigem Abstand. Er ist vorgestern hier angekommen. War ein angenehmer Gast. Ein Ami, der Deutsch spricht! Wow, hab ich gedacht. Und er sprach nicht schlecht. So musste ich mich nicht mit meinem mittelmäßigen Englisch blamieren. Hat auch immer gutes Trinkgeld gegeben.«
Die Hotelangestellte reichte Margot und Horndeich ein DIN-A4-Blatt, auf dem die genauen Übernachtungsdaten von William Fishkin verzeichnet waren.
»Danke, Frau Dollerz«, sagte Margot. »Hat sich Herr Fishkin bei Ihnen im Restaurant mit anderen Leuten getroffen?«
»Das weiß ich nicht genau. Ich arbeite nur selten im Service. Aber ich kann die Kollegen fragen. Ich jedoch habe ihn immer nur allein gesehen. Er war zwar freundlich, aber eher der verschlossene Typ. Wie ist er denn gestorben?« Die Dame konnte ihre Neugier nicht mehr zügeln.
»Er wurde umgebracht«, sagte Margot nur.
»Das ist ja schrecklich!« Die Frau hinter der Rezeption fragte nicht weiter nach. Offensichtlich eine regelmäßige »Tatort«- Konsumentin, die wusste, dass sich die Polizisten mit Details zurückhielten.
»Können wir sein Zimmer sehen?«, fragte Horndeich.
»Ja, natürlich. Aber der Zimmerservice war schon dort.« Auch das ein Hinweis darauf, dass sie sich mit Krimis auskannte.
»Können wir mit der Dame sprechen, die das Zimmer gereinigt hat?«, fragte Horndeich. »Und bitte, wir müssten auch den Inhalt des Papierkorbs untersuchen.«
»Der ganze Müll der Etage ist aber jetzt in einem Müllsack.«
»Dann nehmen wir den mit«, entschied Margot.
Veronika Dollerz nickte und reichte Margot einen Zimmerschlüssel.
Das Zimmer lag im zweiten Stock. Es war ein schlichter Raum mit Doppelbett, einem kleinen Tisch, einem Stuhl, einem Fernseher und einem Kleiderschrank mit antikem Flair. Eine Tür führte in ein Duschbad, und aus dem Fenster konnte man die Stadtkirche sehen, das unmittelbare Nachbargebäude.
»Alles sehr ordentlich«, meinte Horndeich, nachdem er einen Blick in den Kleiderschrank geworfen und mit den Latexhandschuhen zwischen die Kleidungsstücke gefasst hatte, um eventuell versteckte Gegenstände zu ertasten, auch wenn Margot nicht daran glaubte, dass ein Profiermittler sein Notizbuch zwischen Unterhose und Unterhemd ablegen würde.
Der leere Koffer war unters Bett geschoben, und jedes Kleidungsstück hatte seinen Platz im Schrank gefunden. Gebrauchte Wäsche hatte Fishkin in einem Plastiksack im rechten Teil des Schranks verstaut. Darüber hingen gebügelte Hemden sowie ein heller und ein dunkler Anzug. Zwei Paar klassisch schwarze Halbschuhe aus Leder standen neben dem Schrank.
»Yep. Sehr ordentlich«, bestätigte Margot. Und dachte an den kleinen Kleiderberg, der sich immer auf Rainers stummem Diener im Schlafzimmer türmte. Und an den großen, den sie selbst bisweilen auf dem Stuhl im Schlafzimmer häufte.
Auch das Bad zeugte davon, dass Fishkin ein ordentlicher Mann gewesen sein musste. Ein Reisenecessaire hing an einem Haken, der Akkurasierer stand in der Ladeschale, und Zahnbürste und Zahnpasta teilten sich den Platz auf dem kleinen Bord unter dem Spiegel.
Neben dem Tisch im Wohnraum stand ein Aktenkoffer. Margot hob ihn auf den Tisch. Zuvor streifte sie sich Latexhandschuhe über, um keine eigenen Fingerabdrücke oder DNA-Spuren darauf zu hinterlassen.
Der Koffer wurde von zwei vierstelligen Zahlenschlössern vor unbefugtem Zugriff geschützt und wirkte stabil genug, um Langfingern zumindest zehn Minuten lang Widerstand zu leisten.
»Wie kriegen wir den jetzt auf?«, fragte Horndeich und wollte bereits die eingestellten Zahlenkombinationen verdrehen.
Margot schob seine Hände beiseite, legte die Finger an die Öffnungstaster, drückte sie, und beide Schlösser schnappten auf.
»So.«
»Chapeau!«, gratulierte ihr Assistent.
Im Koffer war nicht viel untergebracht. Eine kleine Tasche, in der sich ein Netbook mit Netzteil befand. Ein Spiralheft, in dem noch nichts notiert war. Kulis, eine kleine Taschenlampe. In einer der Seitentaschen fand Margot ein Kästchen mit drei SIM-Karten. Sie pfiff durch die Zähne. »Also können wir davon ausgehen, dass er auch ein Handy hatte. Oder sogar mehrere.«
Horndeich schaute auf die Kärtchen. »Das hier ist eine Prepaidkarte vom rosa Riesen. Aber die beiden anderen?«
Margot betrachtete sie. »Ich tippe auf spanische.«
»Damit er in jedem Land kostengünstig telefonieren konnte?«
»Oder umgekehrt – damit ihn seine Kunden und Informanten kostengünstig erreichen konnten.« Margot spendierte jedem der drei Kärtchen ein neues Zuhause in einem Plastiktütchen. Dann klappte sie das Netbook auf und drückte den Einschaltknopf.
Noch bevor die Festplatte die erste Drehung aufgenommen hatte, tauchte auf dem Bildschirm die Aufforderung auf: Please enter your password!
»Okay, das ist etwas effektiver als ein mechanisches Zahlenschloss«, sagte Horndeich. »Nehmen wir mit. Irgendein inneres Stimmchen sagt mir, dass nicht nur der Rechner mit einem Passwort geschützt ist, sondern auch die Festplatte verschlüsselt ist.«
Margot grinste. »Ein Fall für Sandra.«
Horndeich nickte.
Sandra Horndeich, geborene Hillreich, war dereinst der Computercrack im Polizeipräsidium gewesen. Das Landeskriminalamt in Wiesbaden hatte sie vor eineinhalb Jahren abgeworben. Was Margot sehr bedauert hatte. Zwar hatten sie Ersatz bekommen, doch Bernd Riemenschneider war in seinem Fach bei Weitem nicht so schnell, unkompliziert und flexibel wie seine Vorgängerin. Deshalb gaben Margot und Horndeich knifflige Sachen gern nach Wiesbaden – wenn es Sandras Terminplan zuließ, mal schnell einen kleinen Sonderauftrag einzuschieben.
»Ich ruf sie mal an«, sagte Horndeich und griff zum Handy. Ein liebevolles Lächeln überzog sein Gesicht, das Margot immer wieder neidisch machte. Sandra und er strahlten eine Harmonie aus, die sie sich für ihre Ehe mit Rainer auch gewünscht hätte. Nachdem Sandra fast fünf Jahre um Horndeich herumgeschlichen war, hatte der endlich begriffen, wer wirklich zu ihm gehörte.
Margot hörte kaum hin, als ihr Assistent mit seiner Frau telefonierte, sah nur dessen verliebten Dackelblick. Sei es ihm gegönnt, dachte sie, und sie war sich sicher, dass es zwischen ihm und seiner Sandra keine solch blödsinnigen Dispute gab wie den, den sie am Morgen noch mit Rainer ausgefochten hatte. Weil der ihren Vater noch in Schutz nahm, wenn dieser sich von Prof. Dr. Evelyn bevormunden ließ wie ein kleiner Junge.
»Er ist ein erwachsener Mann und weiß, was er tut«, hatte Rainer gesagt. »Du versuchst ihn mindestens ebenso zu bevormunden, indem du ihm ständig unter die Nase hältst, dass seine Lebensgefährtin nicht zu ihm passt.« Das waren Rainers letzte Worte gewesen, bevor er das Haus verlassen hatte.
Sie erinnerte sich, wie sich ihre Eltern gestritten hatten, als sie als Zwölfjährige einen Hund hatte haben wollen. Ihr Vater hatte es nicht erlaubt, also hatte sie ihre Mutter gefragt, die es dann gestattet hatte. Danach hatten sich die beiden hinsichtlich der Verantwortung gestritten, die die kleine Margot nicht oder eben doch zu übernehmen in der Lage war. Schließlich hatten sie sich doch noch geeinigt, und so war Max ins Haus gekommen, ein Meerschweinchen, an dem Margot beweisen sollte, dass sie Verantwortung für ein Tier übernehmen konnte. Sie hatte Max sofort ins Herz geschlossen, aber Gassi gehen mit selbst gehäkelter Leine durch Flur und Wohnzimmer war ihr schnell langweilig geworden. Woran sie sich jedoch am deutlichsten erinnerte, war, dass dieser Streit zwischen den Eltern nicht leise, aber respektvoll und auf Augenhöhe ausgefochten worden war.
»Hallo, Erde an Margot!« Horndeich riss sie aus ihren Gedanken. »Sandra sagt, wir sollen das Ding gleich mit Kurier nach Wiesbaden schicken. Sie schaut sich das Teil in der Mittagspause an.«
»Geht doch nichts über gute persönliche Kontakte«, witzelte Margot.
Sie packten Netbook und SIM-Karten zusammen und verließen das Zimmer.
Im Foyer sprachen sie noch kurz mit der Reinigungskraft, die sich aber an nichts Außergewöhnliches in Fishkins Zimmer erinnern konnte. Sie meinte sogar, dass der Papierkorb leer gewesen war bis auf einen Kronenkorken und eine leere Bierflasche.
Sie wollten schon aufbrechen, da hielt Margot noch einmal inne und fragte die Frau an der Rezeption: »Frau Dollerz, hat Fishkin sein Zimmertelefon benutzt?«
Wieder erklangen hinter der Theke ein paar Mausklicks und das Klappern der Tastatur. »Ja, einmal hat er telefoniert. Gestern Morgen, noch bevor er gefrühstückt hat. Eine Nummer in Frankfurt«, erklärte Veronika Dollerz mit Blick auf den Monitor. Dann surrte wieder der Drucker, und sie gab Margot ein Blatt mit der Frankfurter Telefonnummer.
»Darf ich kurz Ihr Telefon benutzen?«, fragte Margot.
Veronika Dollerz reichte ihr ein schnurloses Telefon.
Margot wählte die Nummer auf dem Blatt. Das Freizeichen ertönte keine drei Male, dann meldete sich eine Stimme: »Detektei Mänderwitt, Sie sprechen mit Franka Mänderwitt. Was kann ich für Sie tun?«
Margot nannte ihren Namen und sagte, dass sie für die Kriminalpolizei Darmstadt arbeite. »Frau Mänderwitt, kennen Sie einen William Fishkin?«
Ein kurzes Zögern, dann antwortete die Dame, deren tiefe Stimme Margot an die Sängerin Alexandra erinnerte: »Ja. Natürlich. Darf ich fragen, warum Sie das wissen möchten?«
»Das würden wir Ihnen gern unter vier Augen verraten. Könnten wir Sie in etwa einer halben Stunde treffen?«
»Ja. Natürlich. Ist Bill etwas zugestoßen?«
Margot ignorierte die Frage, registrierte jedoch sehr wohl, dass Franka Mänderwitt die Kurzform »Bill« verwendet hatte. »Würden Sie uns bitte Ihre Adresse geben?«
Margot notierte sie, verabschiedete sich und gab Veronika Dollerz das Telefon zurück.
»Sind bei Ihnen derzeit noch zwei Einzelzimmer frei?«, fragte sie die Dame an der Rezeption.
»Nun, das Zimmer von Fishkin auf jeden Fall.« Sie traktierte wieder Maus und Tastatur. »Ja, kein Problem.«
»Prima. Wir bekommen nämlich heute noch Besuch aus Amerika.«
»Für wie lange?«
»Das werden wir sehen. Für ein paar Tage sicherlich.«
13.00 Uhr
Edel, dachte Horndeich, als er aus dem Fassadenfenster im zwanzigsten Stockwerk über Frankfurt schaute. Leider konnte er dank des Schneetreibens kaum den benachbarten Wolkenkratzer erkennen.
Horndeich und Margot standen am Empfang der Wirtschaftsdetektei Mänderwitt. Der junge Herr hinterm Empfangstresen hatte ihnen mitgeteilt, dass Franka Mänderwitt, die Geschäftsführerin, sie in wenigen Minuten empfangen würde.
Mit seinen siebenundzwanzig Stockwerken war das Japan-Center mit der roten Granitfassade eher eines der kleinen Hochhäuser Frankfurts. Horndeich und Margot hatten ihren Wagen in einem unweit gelegenen Parkhaus am Goetheplatz abgestellt. Allein der Gedanke, einen legalen, kostenfreien Parkplatz im Hochhausviertel zu finden, ließ das Pendel zwischen Optimismus und Irrsinn eindeutig in Richtung des Letzteren ausschlagen.
Margot blätterte in einer Broschüre, deren Herstellung sicher das Fünffache eines Taschenbuchs gekostet hatte. Der Umschlag war mit glänzender Silberfarbe bedruckt, und auch im Innern herrschte Hochglanz vor. Billig war anders.
Franka Mänderwitt schien auf ihren hohen Schuhen mit den Pfennigabsätzen eher zu schweben als zu gehen. Sie trug ein Businesskostüm im klassischen Schnitt, dazu teure Armreifen, Ohrringe sowie eine Perlenkette und hatte ein dezentes Parfüm aufgelegt.
Ihr Outfit und ihr Auftreten ließen keinen Zweifel daran, dass sie die Chefin war.
»Die Herrschaften von der Polizei, herzlich willkommen!«, begrüßte sie Margot und Horndeich in einem Tonfall, mit dem sie sicherlich auch den Chef der Deutschen Bahn, der Post oder der Telekom oder eine Delegation von allen drei Unternehmen begrüßt hätte. »Bitte folgen Sie mir in mein Büro. Dort können wir ungestört reden. Hans, sorgen Sie bitte für unser leibliches Wohl.«
Horndeich war sich nicht sicher, ob Franka Mänderwitt einfach nur affektiert war oder tatsächlich adligen Hintergrund hatte – oder zumindest adlige Manieren.
Franka Mänderwitts Büro war großzügig und lichtdurchflutet und zudem stilvoll eingerichtet. An einer Wand hingen gerahmte Fotografien, selbstverständlich in Schwarz-Weiß, damit sie das von Glas und Stahl dominierte Ambiente nicht störten. Einziger Kontrastpunkt war der schwere Art-déco-Schreibtisch, der sich im Raum breitmachte wie Goliaths Schuhe in Davids Schuhschrank.
»Bitte nehmen Sie doch Platz«, forderte die Geschäftsführerin die Beamten auf und deutete auf die Sitzecke, bestehend aus zwei schwarzen Ledersofas und einem passenden Sessel.
Margot und Horndeich nahmen jeweils auf einem Sofa Platz, Franka Mänderwitt ließ sich in dem Sessel nieder.
»Frau Mänderwitt«, begann Margot, »in welchem Verhältnis stehen Sie zu William Fishkin?«
»Warum wollen Sie das wissen?«
»Bitte beantworten Sie zunächst einfach unsere Fragen«, bat Horndeich.
»Gut, wenn das Ihre Spielregeln sind, werde ich mich daran halten und mitspielen.« Sie bedachte Horndeich mit einem abschätzigen Blick. »Ich kenne Bill seit sechs Jahren. Wir sind Geschäftspartner. Er hat eine Detektei in den USA, die auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist. In diesem Zusammenhang ermittelt er ab und an auch in Deutschland. Dann kooperieren wir, insbesondere wenn es um Ausrüstung und Logistik geht. Er kann ja schlecht jedes Mal sein ganzes Equipment mit nach Deutschland bringen. Und wenn Sie einmal versucht haben, Ihr Diktiergerät aufzuladen, und feststellen mussten, dass Ihr Ladegerät einen falschen Stecker hat und lieber nur hundertzehn Volt statt zweihundertzwanzig haben möchte, dann suchen Sie sich einen Logistikpartner vor Ort. Diese Geschäftsbeziehung beruht übrigens auf Gegenseitigkeit. Wenn wir in einem Fall im Mittleren Westen der USA ermitteln, sind Bill und sein Team oft unsere Partner dort.«
»Wie groß ist Ihr Unternehmen?«, fragte Margot.
»Wir beschäftigen rund zwanzig Leute fest und arbeiten auch mit Externen zusammen.«
»Und Mr Fishkin?«
»Zehn feste Mitarbeiter und mindestens noch mal so viele frei. Er hat vor zehn Jahren allein angefangen und erstaunlich schnell expandiert. Aber er ist auch ein Fuchs!« So kontrolliert Franka Mänderwitt bei ihren Ausführungen auch wirkte, bei der letzten Bemerkung huschte ein Lächeln über ihr Gesicht, scheu wie ein Reh und gleich wieder verschwunden.
»Kennen Sie Mr Fishkin auch privat?«, wollte Horndeich wissen.
»Darf ich fragen, was das für eine Rolle spielen könnte? Worum geht es hier eigentlich?«
Margot sah Horndeich an und spielte ihm mental den Ball zu. »Frau Mänderwitt«, sagte Horndeich, »Bill Fishkin ist tot.« Er wählte absichtlich die vertrauliche Form des Namens, denn er war inzwischen überzeugt davon, dass die Mänderwitt Fishkin viel besser gekannt hatte, als sie bislang zugegeben hatte.
Es klopfte an der Tür. Franka Mänderwitt hauchte ein »Herein«, wiederholte es dann mit kräftigerer Stimme. Ihr freundlich-professioneller Gesichtsausdruck hatte sich nach Horndeichs Antwort sang- und klanglos verabschiedet.
»Stellen Sie es einfach hier ab«, sagte sie zu Hans, der ein Tablett hereintrug, auf dem nicht nur drei Tassen Cappuccino und eine Flasche Mineralwasser samt Gläsern standen, sondern ebenso ein Teller mit belegten Brötchen und eine Schale mit Knabbereien. Ein Stapel Servietten lag daneben, an deren Ecke das Logo des Hauses Mänderwitt aufgedruckt war. Horndeich war angemessen beeindruckt.
»Kann ich noch etwas für Sie …?«, begann Hans.
»Gehen Sie bitte einfach.« Nachdem er verschwunden war, wandte sich Franka Mänderwitt an Horndeich. »Was ist passiert?«
»Das wissen wir noch nicht genau. Wir wissen nur, dass er gestern getötet wurde.«
»Mord? Bill ist ermordet worden? Gestern war er doch noch hier. Mein Gott.« Sie senkte den Blick, kämpfte vergebens gegen die Tränen an. Dann griff sie, ohne aufzusehen, nach einer der Servietten.
Als sie Horndeich wieder anschaute, waren ihre Augen feucht. »Bill war ein feiner Mann. Einer der feinsten, die ich kannte. Aufrichtig. Gut in seinem Job. Aber nie hinterhältig, schadenfroh oder überheblich.«
»Wie nah standen Sie sich?«
»Ist das die berühmte Frage nach der intimen Beziehung?« Mänderwitts Tonfall hatte sich vollkommen verändert. Nun sprach keine Geschäftsführerin mehr, sondern eine zutiefst erschütterte und trauernde Frau.
»Ja, genau das ist die Frage«, bestätigte Horndeich.
Ende der Leseprobe