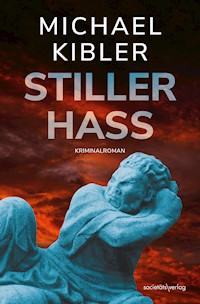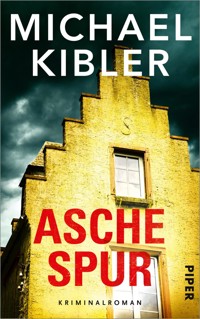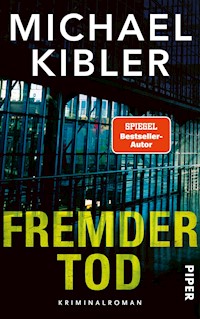
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der Tod ist ihr Beruf. Als Nachlasspflegerin kümmert sich Jana Welzer um das, was von einem Leben übrig bleibt, wenn es keine Angehörigen gibt. Hartnäckig und mit detektivischem Spürsinn arbeitet sie sich in ihre Fälle ein. Das gefällt nicht jedem, hat Jana aber schon mehrfach auf die richtige Spur gebracht. Auch ihr neuer Fall hat es in sich: Ein psychisch kranker Mann hat sich das Leben genommen. Doch warum ist der Tote in keinem Melderegister zu finden und lebte unter falscher Identität? Und warum liegen große Summen Bargeld in seiner Wohnung? Jana Welzer wittert ein Verbrechen und beginnt zu recherchieren. Der spektakuläre Auftakt einer neuen Darmstadt-Krimireihe von SPIEGEL-Bestsellerautor Michael Kibler! »Spannende Unterhaltung garantiert!« Darmstädter Echo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Fremder Tod« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für jene, die den Sternen näher ist
© Piper Verlag GmbH, München 2020
Redaktion: Christine Neumann
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: Sebastiaan Kroes / Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
CAESAR I
MITTWOCH
DONNERSTAG
CAESAR II
FREITAG
CAESAR III
SAMSTAG
SONNTAG
MONTAG
CAESAR IV
DIENSTAG
CAESAR V
MITTWOCH
CAESAR VI
DONNERSTAG
CAESAR VII
FREITAG
CAESAR VIII
SAMSTAG
CAESAR IX
MONTAG
CAESAR X
DIENSTAG
CAESAR XI
MITTWOCH
EPILOG
DANK
CAESAR I
Cory hustet. Ist so ein komischer Husten. Irgendwie trocken. Ich habe sie eingerieben. Mit der Billigversion von Pinimenthol. Kostet keine zehn Euro, sondern nur zwei Euro fünfzig. Verschreibt aber kein Arzt. Muss man selbst bezahlen.
Was soll ich machen? Seit vorgestern bellt die Kleine so, und heute kam das Fieber dazu. Die arme Maus weint die ganze Zeit. Cory liegt in meinem Bett. Die beiden Großen, Chris und Cassy, haben die Tür zu ihrem Zimmer zugemacht. Die Großen können wenigstens schlafen, ich kann es nicht, das habe ich mit Cory gemeinsam.
Ich habe gestern Bescheid gesagt im Supermarkt. Dass mein Kind krank ist. War mit Cory auch schon bei der Kinderärztin. Die hat irgendwie die Stirn gekräuselt, dann aber etwas von Grippe erzählt, Zäpfchen gegen das Fieber, wenn es kommen sollte. Ansonsten: Pinimenthol, vielleicht Nasenspray für Kleinkinder, und ansonsten: aussitzen.
Bis gestern hat sie ja nur gehustet. Jetzt bin ich froh, dass ich auch die Zäpfchen gegen das Fieber habe. Die Finger ihrer kleinen Hand umfassen meinen kleinen Finger.
Habe das alles ja schon zweimal durchgemacht. Christian, den ich nur Chris nenne, wie alle anderen auch, ist zwölf. Auch er ging durch alle frühen Krankheiten, die das Immunsystem doch stärken sollen. Cassandra, sie ist jetzt neun, sie hat das alles auch hinter sich gelassen.
Jedes Kind muss ein paar heftige Krankheiten durchleiden, damit es gestärkt ins Leben starten kann. Oder so ähnlich. Ich habe da mal einen Vortrag gehört. Der Vortrag hat neunzig Minuten gedauert. Ein toller Vortrag. Inspirierend. Ändert auch nichts daran, dass ich jetzt in dieser Nacht bereits seit dreihundert Minuten neben meiner Tochter liege, die seufzt, aufheult, hustet, für wenige Minuten einschläft, um dann für viele Minuten wieder aufzuwachen und weiterzuhusten. Überflüssig zu sagen, dass ich die ganze Zeit wach bin.
Ich muss morgen nicht arbeiten. Wenn ein Kind krank ist, dann kann ich als alleinerziehender Vater ein paar Tage bei meinem Kind bleiben. Drei werden wohl akzeptabel sein. Aber wer bringt die Mittlere und den Großen in die Schule? Mein Schwiegervater wird einspringen. Um sechs Uhr dreißig steht er auf der Matte, hier, bei uns mit seinen fünfundsiebzig Jahren. Er wird bei der Kleinen bleiben, während ich den Fahrdienst mache. Hoffentlich steckt er sich nicht an … Ich fahre Cassy und Chris in die Schule. Sehen wir es einmal positiv: Sowohl die Kinderkrippe als auch die Schule befinden sich im Nachbarort. Also nur gut vier Kilometer entfernt von meinem Haus.
Wieder zu Hause, versuche ich ein wenig zu schlafen. Mein Schwiegervater ist gegangen. »Papa«, murmelt die Kleine, und ihre Finger umfassen meinen kleinen Finger noch fester. Papa. Es war das erste Wort, das sie gesagt hat. Nicht Mama. Denn Mama gab es nicht mehr, als Cory angefangen hat zu sprechen. Ich habe keine Ahnung, wieso sie das Wort mit dem P und nicht das Wort mit dem M gewählt hat. Aber sie hat mich angesehen und hat »Papa« gesagt. So wie jetzt. Und in der Stunde davor. Und am Tag davor und in den Monaten davor. Papa. Synonym für: Fels in der Brandung.
Ich wünschte, ich könnte das sein.
MITTWOCH
Was bleibt von einem Menschen, der gesprungen ist?
Spuren seines Blutes. In den Ritzen. Denn die Stufen der Treppe vor der Haustür waren aus grobem Waschbeton gefertigt. Der Hausmeister hatte sein Bestes gegeben, die Rückstände zu beseitigen, aber wer wusste, was passiert war, konnte noch zwei Tage danach die dunklen Hinterlassenschaften zwischen den einzelnen Steinchen richtig interpretieren.
Jana Welzer hatte gehört, wie der Mensch auf dem Boden aufgeschlagen war. Einer dieser Zufälle. Sie hatte die Tür zum Balkon geöffnet, um ihre Wohnung im gegenüberliegenden Haus durchzulüften, war kurz hinausgegangen. Sie hatte aus den Augenwinkeln nur den Schatten einer Bewegung erkannt – und dann den Aufprall wahrgenommen. Es ist laut, wenn der Körper eines Menschen aus fast zwanzig Meter Höhe auf den Boden prallt. Sie meinte sogar die Erschütterung gespürt zu haben.
Das alles hatte sich vor zwei Tagen ereignet. Und jetzt setzte sie ihren Fuß auf ebenjene Treppenstufe, in deren Ritzen letzte Spuren Blut klebten. Sie schloss die Haustür auf, nahm den Aufzug, fuhr in den sechsten Stock.
Der Tote hatte inzwischen einen Namen: Rainer Hauptmann. Er war vom Balkon seiner Dreizimmerwohnung in die Tiefe gesprungen, um seinem Leben ein Ende zu bereiten. Was ihm geglückt war.
Jana öffnete die Wohnungstür, verletzte dabei das Polizeisiegel. Aber die Polizei hatte den Fall schon zu den Akten gelegt. Es hatte keinen Zweifel daran gegeben, dass der Mann aus eigenem Willen gesprungen war.
Sie betrat die Wohnung. Vielmehr wollte sie die Wohnung betreten. Doch bereits der Flur war kaum zugänglich. Eine ganze Batterie von Umzugskisten verbarg die rechte Seitenwand. Und der Bodenbelag war nicht zu erkennen unter der dicken Schicht von Prospekten und Seiten von Tageszeitungen. Jana zwängte sich seitwärts durch die Diele.
Zwei Handicaps machten ihr im Alltag zu schaffen, zumindest ab und zu: Sie litt unter Höhenangst. Und auch die Enge war so gar nicht ihr Ding. Der Türspalt am Ende des Flures schimmerte hell, quasi das Licht am Ende des Tunnels. Sie arbeitete sich voran. Und betrat das Wohnzimmer. Wenn man es denn so bezeichnen wollte. Kisten, Kisten, Kisten, Wände von Kisten, die den Raum verdunkelten. Nur der Weg zum Balkon war zugänglich. Ebenfalls gepflastert mit gefühlt zehntausend Prospekten des Darmstädter Einzelhandels, von Rewe bis Deichmann. Und wenn es dem Darmstädter Echo finanziell nicht gut ging – Rainer Hauptmann und sein Privatarchiv der Tageszeitung auf dem Boden waren daran gewiss nicht schuld.
Sie brauchte frische Luft. Schlängelte sich durch zum Balkon. Zum Glück gehörte sie nicht zu den übergewichtigen Menschen. Im Gegenteil, es gab Stimmen, die sie als dürr bezeichneten. Dem konnte sie nicht zustimmen. Zumal über dem flachen Bauch durchaus Muskeln lagen. Zierlich, so hätte sie sich selbst beschrieben, mit ihren gerade einmal 164 Zentimetern Körpergröße. Sie öffnete die Glastür. Trat hinaus. Erst einmal tief durchatmen.
Den Blick über die Brüstung ersparte sie sich, genoss jedoch die freie Sicht auf den Hochzeitsturm, das Wahrzeichen ihrer Stadt.
Jana Welzer war Nachlasspflegerin. Das Nachlassgericht schickte sie immer dann in Wohnungen oder Häuser, wenn darin Menschen gestorben waren, die offensichtlich Geld hinterlassen hatten, und es nicht klar war, ob es Erben gab. Denn Menschen starben oft einsam in Deutschland. Neunzigjährige Witwen, die bis zu ihrem Ende allein gelebt und ihr Leben ohne fremde Hilfe geregelt hatten. Mit ein bisschen Glück gab es die Nachbarin im Haus, die die Mitbewohnerin seit Tagen nicht mehr gesehen hatte und die Polizei anrief. Aber oft gab es eben keine Nachbarn oder Angehörige, denen so etwas aufgefallen wäre. Dann konnten Wochen vergehen, bevor solch ein Leichnam gefunden wurde. Und oft fanden sich Werte in der Wohnung – Schmuck, Antiquitäten, Gemälde, wertvolle Möbel –, nicht selten Belege über Immobilienbesitz und nicht zuletzt immer wieder beträchtliche Summen Bargeld. In diesem Fall betrat Jana Welzer die Bühne. Sie, die das Erbe sicherte. Und die schaute, ob es Erben gab. Wie bei Rainer Hauptmann. Beim Nachlassgericht war kein Testament von ihm hinterlegt gewesen. Ebenfalls waren keine Nachkommen bekannt.
Auf dem Sekretär im Wohnzimmer, dem einzig frei zugänglichen Möbelstück im ganzen Raum, hatte Rainer Hauptmann einen Briefumschlag hinterlassen. Dieser Briefumschlag war gefüllt mit einhundert Zweihunderteuroscheinen. Auch der Personalausweis von Rainer Hauptmann hatte auf dem Sekretär gelegen. Neben einem Schlüsselring mit zwei Schlüsseln – einen für die Haustür, einen für die Wohnungstür. Nach seinem Sprung war die Mordkommission aus dem Polizeipräsidium Südhessen angerückt. Sie hatten Geld, Perso und Schlüssel gesichert. Sie befanden sich nun in der Obhut von Jana.
Die Spurensicherung konnte keinerlei Hinweise auf einen Kampf oder auch nur eine Auseinandersetzung entdecken. Raubmord schied auch aus, sonst hätte der Täter kaum die Zwanzigtausend auf der edlen Schreibunterlage aus Mahagoni liegen lassen.
Rainer Hauptmann war gesprungen.
Warum auch immer.
Jana drehte sich um und sah durch das Fenster ins Innere der Wohnung. An der Zimmerwand konnte sie einen Holzschrank entdecken. Innerhalb des Zimmers war er nicht zu sehen gewesen, denn auch er war von einer Wand aus Kisten verdeckt. Sie holte noch einmal tief Atem, dann trat sie vom Balkon zurück in die Wohnung. Der Raum ähnelte in vielen Details dem Domizil ihrer Großmutter. Diese war ein Mensch gewesen, dem es sehr schwergefallen war, irgendetwas wegzuwerfen, ganz besonders, nachdem ihr Mann vor fünfzehn Jahren gestorben war. Es gab schlichtweg gar nichts, was man wegwerfen durfte, weil alles vielleicht ja doch noch einmal zu gebrauchen war. Nippesfiguren hatten sich gestapelt, irgendwann auch die Wochenzeitungen, dann die Tageszeitungen, und in den zwei Jahren bevor sie starb, hatte ihre Oma auch die Werbeprospekte fein säuberlich aufgeschichtet.
Jana hatte sie einmal mit einem Freund besucht, hatte keine Diskussion mehr geduldet, sondern einfach im Flur fünf Stapel Prospekte entfernt, die den Zugang zum dritten Zimmer versperrten. Nein, ihre Oma war ihr nicht dankbar gewesen. Sie hatte gejammert und gezetert, sie habe die Prospekte noch gar nicht alle studiert und man wisse doch nicht, wofür sie noch gut sein könnten. Zum Beispiel als Anzündpapier für den Kamin. Nur dass es überhaupt keinen Kamin gab, sondern nur eine zentrale Bodenheizung, die Zündeln sicher nicht durch bessere Leistung goutiert hätte.
Jana konnte den Seufzer nicht unterdrücken, als ihr Blick entlang der Kistenwände wanderte. Rainer Hauptmann hatte nicht nur nichts wegwerfen können. Er hatte seine Wohnung aktiv mit zusätzlichem Müll beladen. Die Decke der Wohnung war vom Boden zwei Meter fünfzig entfernt. Das hieß, man konnte vom Boden aus rund sieben Standard-Umzugskartons aufeinanderstapeln. Das war Rainer Hauptmann nicht gelungen. Aber auf sechs Kartons übereinander hatte er es gebracht. Möbelkisten voller Bücher, voller Schallplatten, voller Handtücher, voller Bettwäsche, voller Zettel und Blätter, zumindest in den oberen Kisten der fein säuberlich aufgetürmten Stapel, wie es die Polizei nach ein paar Stichproben im Protokoll vermerkt hatte.
Sie verließ das Wohnzimmer, um einen Blick in die anderen Räume zu werfen.
Vom Flur führte eine der Türen ins Schlafzimmer. Das Bett war ebenfalls vollgestellt mit Kisten, doch bot es noch eine vielleicht fünfzig Zentimeter breite Fläche, auf der man hätte schlafen können. Die Bettwäsche war nicht frisch, aber auch nicht seit Jahren ungewaschen. Neben dem Bett stand ein Stuhl. Darauf nur zwei Kisten.
Die Wohnung verfügte über drei Zimmer. Im dritten Raum konnte sie keine Möbel erkennen, denn auch hier stand sie direkt vor einer Wand aus Kisten. Im Juni 2011 hatte Jana in München in der Olympiahalle das Spektakel von Roger Waters miterlebt, der »The Wall« seiner ehemaligen Band Pink Floyd wieder auf die Bühne gebracht hatte. Eine Wahnsinnsshow. Jana erinnerte sich nicht mehr an den Namen ihres Begleiters, mit dem sie damals dort gewesen war. Aber sie erinnerte sich sehr genau an die Wand, die auf der Bühne aufgetürmt worden war. Und sie hatte diese Wand als sehr beklemmend erlebt. Ebenso wie diese Wand vor ihr, über der nur ein schwacher Schimmer davon kündete, dass sich hinter den Stapeln ein Fenster befinden musste.
Die Tür zur Küche ließ sich nicht ganz öffnen. Und doch vermisste Jana sofort etwas: Gestank. Nicht, dass die Küche weniger zugestellt gewesen wäre als der Rest der Wohnung. Dennoch fehlten hier die typischen Ingredienzen einer Messie-Wohnung: verschimmelte und verdorbene Lebensmittel in einer Pfanne auf dem Herd, Berge von verschmutztem Geschirr rund um die Spüle. Einzig drei leere Pizzakartons wiesen Überreste von Krümeln auf. Jana öffnete die Tür unter der Spüle. Dort stand ein Mülleimer. Mit einer frischen Mülltüte. Hatte Rainer Hauptmann vor seinem Selbstmord etwa noch den Abfall weggebracht?
Sie verließ die Küche und betrat das Bad. Die Badewanne? Nicht benutzbar. Sechs Umzugskisten aufeinandergestapelt. Der Boden, ebenso wie die anderen, ausgekleidet mit Papier von Zeitungen und Prospekten. In der Ecke des Bades zwei Stapel von jeweils sechs Kisten. Aber auch hier fehlte Jana der typische Gestank einer solchen Wohnung. Die Toilette war zwar nicht frisch geputzt, aber auch nicht dreckig. Jana betätigte die Spülung. Sie funktionierte einwandfrei. Im Waschbecken stand ein roter Plastikbehälter. Ganz automatisch griff sie danach, und tatsächlich, der Rand der Badewanne war frei, sodass sie die Kiste dort absetzen konnte, um sich die Hände zu waschen. Dabei fiel ihr Blick auf ihr Spiegelbild. Das Glas war nicht poliert, aber sie konnte sich deutlich erkennen. Das hagere, sehr dezent geschminkte Gesicht, die hohen Wangenknochen – und der Mund, dessen Lippen sie selbst immer als zu schmal erachtete. Seit nunmehr einunddreißig Jahren. Die ersten fünf Lebensjahre hatte sie dabei nicht mitgezählt …
Nein, da hing kein Handtuch neben dem Waschbecken. Aber es lag eines auf dem Fensterbrett neben der Toilette. Und auch das Handtuch wirkte nicht so, als habe es in seinem Leben noch niemals das Innere eine Waschmaschine gesehen.
Jana verließ das Bad. Und war sofort wieder gefangen in – The Wall …
Wenn sie den Job bekam, in der Wohnung eines Verstorbenen nach Hinweisen zu suchen, zum einen, wie viel Geld noch vorhanden war, und zum anderen, wer potenzielle Erben wären, dann war der Weg niemals derselbe, aber doch immer ein definierter: zunächst zum Schreibtisch. In dem meistens wichtige Dokumente aufbewahrt wurden. Nummer zwei in den Charts: der Kleiderschrank. Zwischen Unterhosen und Socken wurden oft die geheimsten Unterlagen versteckt – oder das, was man als versteckt ansah. In der Wohnung von Rainer Hauptmann gab es sicher auch irgendwo einen Kleiderschrank. Aber der stand vermutlich hinter irgendwelchen Wänden von Kisten.
Das einzige Möbelstück, das nicht von Kisten zugestellt oder selbst die Basis eines Kistenturms war: der Sekretär. Jana öffnete die Klappe, zog die Schubladen heraus. Sie entnahm Stapel um Stapel Papiere – aber auch diese erzählten mehr über die Geschichte des Darmstädter Einzelhandels als über Rainer Hauptmann. Kein Ordner mit Versicherungsscheinen, Grundbucheintragungen oder einfach nur Kontoauszügen. Nichts. Auch keine Münzsammlung, keine Smaragde, keine Waffen. Sie schloss die Klappe wieder, schob die Schubladen zurück.
Vom Lucasweg aus fuhr Jana direkt zum Amtsgericht. Den Weg dorthin legte sie, wenn es nicht gerade in Strömen regnete, immer mit dem Fahrrad zurück. Denn Parkplätze waren Mangelware im Umkreis des Gerichts.
Die Kollegen vom Gebäudeschutz grüßten freundlich. Jana steuerte auf den Lift zu. Leider hing vor der Aufzugtür ein Schild: »Wegen Reparaturarbeiten derzeit außer Betrieb.«
Ihr Seufzer war ein tiefer. Es gab noch einen zweiten Lift im Amtsgericht. Nachträglich eingebaut, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Grundsätzlich eine tolle Sache, aber nicht für sie. Denn der Aufzug war in einem Lichthof des Gebäudes installiert worden. Der Schacht bestand aus Glas. Die Außenhaut der Kabine ebenfalls. Für Jana unbenutzbar.
Das Gebäude des Amtsgerichts hatte mehr als hundert Jahre auf dem Buckel. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde es weitgehend originalgetreu wiederaufgebaut. Inklusive eines zusätzlichen Stockwerks. Das Bauwerk verfügte wahrlich über eine imposante Empfangshalle. Und auch das Treppenhaus aus Stein war optisch eine tolle Sache. Wenn man es denn nicht erklimmen musste. Das Nachlassgericht lag im dritten Stock – wobei die Deckenhöhe im Erdgeschoss allein bei rund fünf Metern lag. Jana erklomm die Stufen.
Ein wenig außer Puste erreichte sie das Büro von Lavinia Weber. Die Rechtspflegerin hatte sie am Tag zuvor angerufen. Denn sie vergab die Aufträge an Nachlasspfleger. Jana war dabei immer die Frau für die Fälle, die ein wenig abseits der Norm lagen. Und ein Selbstmörder mit zwanzigtausend Euro in der Wohnung, der dieselbe mit lauter Messie-Kisten zugestellt hatte, das war der passende Fall für Jana.
Sie war am Vortag bereits beim Nachlassgericht gewesen. Lavinia hatte ihr die sogenannte Bestallungsurkunde ausgestellt – ein Dokument, mit dem sie gegenüber allen Institutionen wie etwa dem Einwohnermeldeamt, Banken oder Versicherungsunternehmen die Rechtsgeschäfte des Verstorbenen abwickeln konnte. Also Einsicht in Konten bekam oder eventuelle Vermögenswerte auf das Treuhandkonto verschieben konnte, das sie nun verwaltete. Sie konnte auch irgendwelche Versicherungen kündigen, wie nutzlos gewordene Haftpflichtversicherungen, Hausrats- oder Lebensversicherungen.
Als Lavinia Jana gestern die Urkunde in die Hand gedrückt hatte, hatte sie noch angefügt: »Das Hamburger Einwohnermeldeamt hat da irgendwas verbockt. Rainer Hauptmann ist dort geboren, aber als ich die elektronische Abfrage zu seinem Geburtsort gestartet habe, war Hamburg nicht eingetragen.«
Inzwischen waren solche Vorgänge ja komplett automatisiert. Hatte man früher noch Briefe per Post verschickt, um solche Informationen zu bekommen, oder vor gut zehn Jahren immerhin noch E-Mails geschrieben, gab es heute ein zentrales Register, das Lavinia von ihrem Rechner aus einfach abfragen konnte.
»Ich hab denen in Hamburg jetzt eine E-Mail geschickt. Das können wir dann immer noch geradebiegen. Aber wir haben ja die Sterbeurkunde und Hauptmanns Personalausweis – Sie können also schon mal loslegen«, hatte sie gestern kundgetan. »Ich habe auch schon das Grundbuch gecheckt: Rainer Hauptmann war nicht der Eigentümer der Wohnung. Vielleicht gibt es eine Hausverwaltung, die Ihnen sagen kann, wer der Vermieter ist.«
Jana hatte bereits herausgefunden, dass es eine solche Hausverwaltung gab. Aber die zuständige Dame war krank, man würde Jana zurückrufen – das war der Stand der Dinge.
Nun schaute Lavinia Weber Jana über den Schreibtisch hinweg an und fragte nur: »Und?«
Jana zögerte kurz, dann sagte sie: »Komisch. Das ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Rainer Hauptmann hat in dieser Wohnung gehaust, ohne tatsächlich irgendeinen Platz gehabt zu haben.«
Lavinias Stirn kräuselte sich. Dann stellte sie die Frage, die aus ihrer Perspektive am wichtigsten war: »Irgendwelche Hinweise auf irgendwelche Erben?«
Jana schüttelte den Kopf. »In dem Sekretär, auf dem diese zwanzigtausend Euro gelegen haben, habe ich außer Prospekten nichts entdeckt. Wenn unter all dem Müll irgendetwas zu finden ist, wird es dauern, bis der Inhalt jeder Kiste einmal durch die Hände eines Menschen gewandert ist. Aber allein kann ich das nicht bewältigen.« In Janas Eingeweiden rumorte dieses Bauchgefühl. Nichts, was man durch irgendwelche naturwissenschaftlichen Studien belegen konnte. Aber sie war sich sicher: Wenn sie all diesen Müll von Rainer Hauptmann durchsuchen würden, dann würden sie ganz bestimmt auf mehr stoßen als nur auf zwanzigtausend Euro in bar auf dem Sekretär. Und genau das sagte sie Lavinia.
»Okay. Also was ist Ihr nächster Schritt?«, wollte Lavinia wissen. Die beiden Frauen siezten sich immer noch, obwohl sie bereits mehrere Jahre miteinander arbeiteten. Doch eines teilte Jana mit Lavinia: Sie hielten Berufliches und Privates gern strikt getrennt.
»Ich werde das Zeug aus der Wohnung in ein Lager transportieren lassen. Ich muss einen Bekannten anrufen. Der ist auf Entrümpelungen spezialisiert. Und hat auch ein Depot, wo man all das Zeug erst mal unterbringen kann. Und dann werde ich jeder Kiste auf den Grund gehen.«
Jana arbeitete freiberuflich. Und Lavinia war nicht ihre Vorgesetzte. Aber wenn Lavinia sie als Nachlasspflegerin für einen Verstorbenen berief, musste Jana alles, was sie tat, mit Lavinia absprechen.
»Gut. Dann machen Sie das so. Aber dann müssen Sie das auch selbst organisieren.«
Der zweite Satz in Lavinias Antwort beschrieb nur eine Selbstverständlichkeit. Jana musste immer selbst organisieren. Was bedeutete, dass ihr niemand reinredete. Was aber auch besagte, dass sie diese Mammutaufgabe hier aus eigener Kraft stemmen musste.
Benjamin Lorenz konnte nicht einmal mehr in eine Kneipe gehen, um sich zu besaufen. Vielmehr hockte er auf seinem Sofa. Vor ihm stand eine Pulle Bonzen-Plörre, daneben das Whisky-Nosing-Glas, mit schön geformtem Bauch, der sich nach oben elegant verjüngte. Allein, dass er dem fünfundzwanzigjährigen Bunnahabhain in Gedanken das Etikett Bonzen-Plörre aufdrückte, sagte einiges über seinen Gemütszustand aus. Die Flasche Whisky vor ihm hatte ihn zweihundertfünfzig Euro gekostet. Und Ben, wie ihn alle nannten, war ein sparsamer Mensch.
Er hatte diesen Bunnahabhain einmal vor ein paar Jahren in seiner Lieblingskneipe um die Ecke probieren dürfen. Und es hatte ihn umgehauen. Süßes Karamell mit kräftigem Sherry, gefolgt von Eiche und Leder, so hatte der Wirt das Aroma beschrieben. Dann hatte er vor zwei Jahren diese eine Flasche gekauft, nur weil ihm der Wirt eines dieser teuren Whiskygläser geschenkt hatte. Die seitdem ungeöffnet in seinem Wandschrank gestanden hatte, zwischen Korn und Chantré.
An einem ganz besonderen Tag hatte er diese Flasche öffnen wollen, an einem Tag, an dem es irgendetwas zu feiern gab.
Zu feiern gab es gar nichts. Nur vielleicht, dass sein Freund – passte diese Bezeichnung überhaupt noch? – ihn heute in der eigenen Firma überflüssig gemacht hatte.
Flüssig. Das war das Stichwort. Er goss sich den edlen Trank in das inzwischen schon wieder leere Glas. Verschloss die Flasche. Hob das Glas. Prostete der Krücke zu, die er vorher vom Sofa aus durchs Zimmer geschleudert hatte, brüllte ein Slàinte Mhath durchs Zimmer – die edle schottische Variante vom prolligen »Stößchen« – und kippte den Inhalt des Glases einfach hinunter. Fünfzehn Euro, wie ihm sein Gehirn stante pede ausrechnete, gänzlich ohne gefragt zu werden.
Diese verdammte Krücke. Ohne die er derzeit nicht mal mehr bis zum Klo kam. Der Wurf durchs Zimmer war leichtsinnig gewesen, mit ein bisschen Pech und noch einigen Gläsern Whisky würde er bis zu der Krücke robben müssen. Und für das Aufstehen, da konnte er auch noch mal locker zwei Minuten einrechnen. Aber sein linkes Bein versagte seinen Dienst. Und Krücke war besser als Rollstuhl. Dessen war er sich bewusst, aber in Momenten wie diesen war der Gedanke wenig tröstlich.
Doch all das war heute ja eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem war, dass sein Freund und Geschäftspartner Kevin ihn quasi aus dem eigenen Unternehmen gemobbt hatte. Er bedachte ihn in Gedanken mit dem »W«-Wort, das auf vulgäre Art einen Mann beschrieb, der autoerotische Handlungen vornahm …
Vor sieben Jahren hatten sie die Firma gegründet: IT-Partner. Nein, der Name war nicht originell, aber es hatte funktioniert. Anfangs war ihr Unternehmen nur ein kleiner EDV-Service. Rechner einkaufen, zusammenstöpseln, dafür sorgen, dass fünf ihrer Art in einem Firmennetzwerk miteinander kommunizierten, auch noch nach irgendwelchen Updates oder Systemveränderungen. Kevin und er, sie beide waren Informatik-Experten, die sich ihr Wissen in keinem Studium, sondern in der Praxis und im Selbststudium angeeignet hatten. Ihre Kunden waren kleine, manchmal sogar mittelständische Firmen, die inzwischen oft die gesamte EDV-Betreuung in die Hände von IT-Partner legten. Kevin löste EDV-Probleme in Porsche-Geschwindigkeit. Und er war derjenige, der die Auftraggeber immer bei Laune hielt. Aber er, Benjamin, er war die Formel-1-Waffe, wenn nichts mehr ging, und er den IT-Knoten selbst dann aufdröselte, wenn alle anderen bereits das digitale Handtuch geworfen hatten.
Ben war froh gewesen über seine Rolle in der Höhle aus Bits und Bytes, von der aus er per Fernschaltung auf die Computer der Kunden zugreifen konnte und deren Schwierigkeiten löste. Anfangs hatte Ben sich selbst eingeredet, dass er sich hinter der eigenen Tastatur wohler fühlte als in den Büros beim Kunden vor Ort. Aber die Wahrheit war, und sie sprang ihm heute so unerbittlich klar vor Augen, dass er schon damals nicht mehr in der Lage gewesen war, lange Strecken zu laufen.
Noch ein Glas Whisky. Ben lachte auf und brüllte »Stößchen!« durchs Zimmer. Während er schwungvoll mit dem Glas in Richtung Krücke prostete, schwappten sicher sechs Euro Whisky auf den Boden.
Kevin war von Anfang an auf schnelle Expansion der Firma aus gewesen. Er war es, der zwei Informatikstudenten mit ins Boot holte, dann die Bürokraft, die sich um die Verwaltung kümmerte. All das hatte Ben noch mitgetragen. Doch heute hatte Kevin ihm eröffnet, dass er einen Informatiker eingestellt habe, der zur Not auch für ihn, Ben, einspringen könne.
Er, Ben, war überflüssig geworden in seiner eigenen Firma.
Noch ein Glas.
Ein simples Prost. Und die fünfzehn Euro hinuntergekippt und keinen Cent verläppert.
Neben dem Glas lag sein Smartphone. Er sollte lieber jetzt anrufen, bevor jeder an seiner Stimme erkennen konnte, dass er mit dem Alkohol Bruderschaft getrunken hatte. Er scrollte durch seine Kontakte, landete bei Cornelia, stellte die Verbindung her.
Cornelia nahm das Gespräch nach drei Freizeichentönen an: »Ben! Lange nichts von dir gehört!«
Ben schwieg.
»Hallo? Hörst du mich?«
»Ja, Conny, klar, ich hör dich.«
Schweigen. Weder er, Ben, noch sie, Conny, waren so die Plaudertaschen.
Conny brach das Schweigen: »Nein, sie hat sich nicht angemeldet. Auch in den vergangenen zwei Tagen nicht.« Conny beantwortete Bens Frage, die er gar nicht ausgesprochen hatte.
Er und Conny kannten sich schon lange. Weshalb es manchmal überflüssig war, Anliegen hörbar zu formulieren. Sie hatte die Antwort auf die Frage gegeben, die ihm tatsächlich neben allem Selbstmitleid immer wieder an diesem Abend durch den Kopf gegangen war. Wenn auch der Inhalt der Antwort Ben nicht gefiel.
Conny leitete die Regionalstelle des Technischen Hilfswerks in Erfurt. Und auch Ben war Mitglied dieses Vereins. Seit fast zwanzig Jahren bereits. Und daher kannte er viele von ihnen, nicht nur in Berlin.
»Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst.«
Ben schwieg. Sein Blick fiel auf die Krücke. Dann auf die Whiskyflasche, in der sich immer noch circa hundertachtzig Euro befanden. Es ging um das Jubiläumstreffen. Wenn man das so nennen konnte. Vor zehn Jahren hatten sie vom Technischen Hilfswerk in Haiti, am anderen Ende der Welt, Hilfe geleistet. Ein Erdbeben der Stärke sieben. Das die ohnehin fragile Infrastruktur des Landes kollabieren ließ. Das THW, wie die offizielle Abkürzung des Technischen Hilfswerks lautete, hatte damals eine Trinkwasserversorgung aufgebaut. Nun traf man sich, genau zehn Jahre später. Sie war seinerzeit ebenfalls dabei gewesen.
»Ben, ich würde mich wirklich freuen.«
Okay. Warum nicht? Was würde er verlieren, wenn er am Wochenende nach Erfurt führe? Nichts. Dreihundert Kilometer, er hatte es bereits recherchiert. Sein Wagen hatte Automatik. Da brauchte man kein linkes Bein. Wieso also nicht? Er wusste, dass er sonst nur in seiner Wohnung versauern würde, ausschließlich in Begleitung von Selbstmitleid und Wut. »Wo übernachtet ihr alle?«
»Wir sind im Hotel am Kaisersaal. Ich meine, die Veranstaltung findet ja auch im Kaisersaal statt.«
»Würdest du mir noch ein Einzelzimmer buchen?«
Es war nur ein Telefonat. Er sah Conny nicht. Aber er kannte sie so gut, dass er ihr Grinsen förmlich spürte. »Ich kann es versuchen«, sagte sie.
Und Ben wusste genau, was das bedeutete: Betrachte das Zimmer als gebucht.
»Danke, meine Liebe.«
»Für dich immer«, erwiderte Conny, und er wusste, wie aufrichtig diese Aussage gemeint war.
Jana liebte ihren Kamin. Er trennte das Feuer durch eine Glastür vom Raum, damit man die Flammen sah, aber sie die Belege ihrer Existenz nicht auf das umliegende Parkett schleudern konnten.
Es gab Menschen, die legten sich mitten im Sommer in ihre Badewanne. Jana zündete ab und an auch ein kleines Feuer an, wenn eher die Klimaanlage gefragt war als die Heizung. Jetzt im Januar war die Auftragslage für den Job einer Klimaanlage in diesen Breitengraden eher dünn gesät.
Jana hatte sich einen Lugana eingeschenkt. Seit sie vor ein paar Jahren einmal Darmstadts Partnerstadt Brescia unweit des Gardasees besucht hatte, war sie auf den edlen Tropfen dieses Anbaugebiets gestoßen und ihm seitdem treu geblieben. Ihr Blick wanderte durch den Raum. Sie fühlte sich wohl in ihrer Wohnung im zweiten Stock. Hundert Quadratmeter, vier Zimmer, Altbau, tatsächlich noch Stuck an den Decken. Das Wohnzimmer zierte ein kleiner Erker in Richtung Straße, in den sie ihren Lesesessel gestellt hatte. Dann der winzige Steinbalkon unmittelbar neben dem Erker. Sie mochte diese im Grunde unnützen architektonischen Accessoires der Altbauten aus der Gründerzeit, die sich heute kein Baumeister mehr trauen würde zu planen.
Als sie vor vier Jahren wieder nach Darmstadt zurückgekommen war, hatte ihre Mutter darauf bestanden, dass sie in diese Wohnung zog. Es war die Wohnung der Eltern ihrer Mutter gewesen. Nicht die des Vaters. Sonst hätte sie keinen Fuß über die Schwelle gesetzt.
Sie griff zu ihrem Smartphone, dessen Bildschirm ihr mitteilte, dass es inzwischen fast zwanzig Uhr war. Sie scrollte durch die Kontaktdaten, dann wählte sie den Anschluss von Jörn Großeimer. Er war der bekannteste Schädlingsbekämpfer in der Region. Aber eben nicht nur das: Viele Schädlinge fühlen sich geradezu magisch angezogen von Verstorbenen in ihren diversen Zersetzungsstadien. Und so war er immer öfter angefragt worden, ob er neben den biologischen Hinterlassenschaften der Verstorbenen nicht auch gleich die materiellen Überbleibsel beseitigen könnte. Daher hatte sich Jörn auch auf Entrümpelung spezialisiert.
»Jana! Was für eine Überraschung!«, sagte er. Und die Tonlage seiner Stimme zeugte von aufrichtiger Freude.
Janas Blick löste sich nicht vom Spiel des Feuers hinter der Glasscheibe des Kamins. »Jörn! Wie schön, dass du um diese Uhrzeit noch an dein Diensthandy gehst.«
»Ach, Jana, wenn ich deine Nummer sehe, dann weißt du genau, dass ich an jedes Telefon gehe, das sie anzeigt!«
Jana schmunzelte. Jeder, der ihrer Unterhaltung gelauscht hätte, hätte davon ausgehen können, dass sie ein Paar waren. Oder zumindest eine Affäre hatten. Jana mochte Jörn. Er mochte sie. Doch Jörn Großeimers Ehe erinnerte Jana immer an das Gebäude in der Innenstadt, das die Krone-Kneipe beheimatete: Es war das einzige Haus der Altstadt in Darmstadt gewesen, das nach dem Feuersturm im Zweiten Weltkrieg fast unbeschädigt aus den umliegenden Trümmern herausgeragt hatte. Und genauso solide erschien Jana Jörns Ehe. Sein Ehering funkelte. Und er markierte genau jene Grenze, die Jana nie überschritt. »Jörn, ich brauche dich. Ich habe gerade einen ganz besonderen Klienten. Hat in einer Messie-Wohnung gehaust. Zumindest so was in der Art. Auf siebzig Quadratmetern Berge von Umzugskartons mit Kruscht und Möbel mit ähnlich chaotischem Inhalt. All das muss in ein Lager gebracht werden. Hast du Kapazitäten frei? Ich fürchte, wir brauchen eine große Garage, also die, in der man einen Lastwagen unterstellt, keinen VW Käfer.«
Ein Zögern in der Leitung. Kurz, aber wahrnehmbar. »Befall?«
Ein Wort, das für einen ganzen Mikrokosmos stand: Larven, Fliegen, Schaben – das weite Universum von Insekten, die sich dann am wohlsten fühlten, wenn die Menschen vor Ekel das Weite suchten.
»Nein«, sagte Jana. »Nur Plunder. Der Bewohner der Wohnung ist vom Balkon gesprungen.«
Wieder ein kurzes Zögern in der Leitung, dann die erlösende Antwort: »Klar, für dich habe ich immer Kapazitäten frei.«
»Dann treffen wir uns morgen um halb neun Uhr im Lucasweg? Die Wohnung ist in dem Haus, das meiner Wohnung gegenüberliegt.«
»Ja, so machen wir’s.«
»Und, Jörn, ich brauche deine zuverlässigen Leute.« Ein einfacher Satz. Der jedoch sehr viel bedeutete. In dieser Wohnung waren bereits zwanzigtausend Euro in bar entdeckt worden. Wer wusste, was man noch alles entdecken würde? Sie brauchte jemanden, der das Entrümpeln für sie übernahm. Und gleichzeitig benötigte sie jemanden, der, wenn er noch mal fünftausend Euro in einer Ecke fand, diese nicht einfach einsteckte.
Jana hatte inzwischen ihre eigene Praxis entwickelt. Wenn die von Jörn Beschäftigten ihren Job gut machten, bekamen sie ein Trinkgeld von hundert Euro. Bar auf die Kralle.
Natürlich zog sie den Betrag nicht von den sichergestellten Scheinen ab. Dass die Hinterlassenschaft unangetastet blieb, war ihr heilig. Aber Jana hatte für solche Zwecke im Laufe der Jahre eine schwarze Kasse mit Bargeld eingerichtet. Denn sie wusste genau: Ohne diese Schatulle würde sie ihrem Ziel, Erben zu finden und Erben auszuzahlen, mehr schaden als nützen.
Nein, Jana Welzer würde ihre Hand nicht für Jörns Mitarbeiter ins Feuer legen. Aber Jana Welzer hatte mit dieser Methode bislang gute Erfahrungen gemacht. Und das genügte ihr.
DONNERSTAG
Ein grauer Morgen. Mit dem Kaffeebecher in der Hand stand sie auf dem Balkon. Sie hatte zuvor in der Küche gesessen, gefrühstückt und dabei den ersten Becher Kaffee zu sich genommen.
Jörn war ein zuverlässiger Mensch. Und wenn er sagte, dass er um acht Uhr dreißig vor Ort wäre, durfte sie davon ausgehen, dass er eher drei Minuten früher einträfe.
Um acht Uhr sechsundzwanzig sah sie den Mercedes Sprinter. Er war unverkennbar. Zum einen durch sein Äußeres: Rote Lackierung und das skizzierte Mardergesicht, das frech neben dem Schriftzug »Großeimer GmbH« in die Welt grinste. Und dann war der Wagen über sieben Meter lang. Das Schätzchen, wie Jörn ihn nannte.
Hinter dem Sprinter folgte ein Smart – im gleichen Rot lackiert, mit dem gleichen Schriftzug und Marderantlitz daneben. Jörn war mit der großen Truppe angerückt: Vier Mitarbeiter würden die Wohnung von Rainer Hauptmann in wenigen Stunden ausgeräumt haben.
Jana trat vom Balkon, kippte den Rest des Kaffees in die Spüle, zog sich eine Jacke über und verließ ihre Wohnung.
Jörn hatte den Wagen einfach am Bürgersteig abgestellt. Halteverbot. Aber er hatte ihr mal erklärt, dass es für ihn nur zwei Kriterien für einen Platz gab, an dem er seinen Umzugswagen nicht abstellen würde: »In einer Feuerwehrzufahrt oder an einem Ort, an dem ein fetter Feuerwehrwagen nicht mehr an mir vorbeikommt. Alles andere sind 35-Euro-Parkplätze.« Zitat Ende.
»Hallo, Jana«, sagte Jörn, als er auf sie zutrat. »Habe die üppige Mannschaft mitgebracht, so wie du mir die Wohnung geschildert hast.«
Seine Mitarbeiter traten neben den Chef. Louisa kannte sie, eine stämmige und durchtrainierte Boxerin, wie Jörn ihr verraten hatte. Neben ihr drei junge Männer, wahrscheinlich Studenten, die Jörn immer wieder mal für Entrümpelungen anheuerte. »Am liebsten Biologie-Studenten. Dann lernen die gleich mal was über die Fauna«, hatte Jörn ihr feixend erklärt.
»Hast du eine Ahnung, ob die Wohnung diesem Hauptmann gehört hat oder ob er zur Miete wohnte?«, wollte Jörn von ihr wissen, als sie die Haustür öffnete.
»Er ist Mieter. Ich warte noch auf eine Rückmeldung der Hausverwaltung, wer sein Vermieter war.« Jana drückte auf den Rufknopf für den Aufzug. Sofort gaben die Türen die Kabine frei. Sie stiegen in den Fahrstuhl.
»Keine Viecher?«, fragte Jörn.
»Hab ich dir ja schon gesagt. Keine tierischen Probleme. Nur solche aus Zellulose. Außer Prospekten, Darmstädter Echo und Möbelkisten ist da nichts Persönliches. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Das werde ich alles erst rauskriegen, wenn ich den Inhalt der Kisten und die restlichen Bestandteile der Wohnung gesichtet habe.«
Sie verließen den Aufzug. Jana schloss die Wohnungstür auf.
Jörn schob sich hinter ihr durch den Flur. Sie hörte, wie er leise murmelte: »Ach du Scheiße …«
Er warf einen Blick in jeden Raum. Dafür brauchte er rund zwei Minuten. Im Wohnzimmer angekommen, nickte er ihr zu. Er war ganz bleich im Gesicht geworden.
»Was ist?«, fragte Jana.
»Unseren Sprinter können wir vergessen.«
»Warum das?«
»Das Zeug kriegen wir nie und nimmer in den Wagen. Das kriegen wir noch nicht mal in den Großen hinein!«
»Der Große«, das war der 7,5-Tonner. Ebenfalls in Rot. Ebenfalls mit dem Marder-Logo an der Seitenfläche. Eben der Wagen für die ganz fetten Entrümplungen.
»Ich habe das gerade mal kurz überschlagen«, fuhr Jörn fort. »In dieser Wohnung befinden sich rund vierhundert Umzugskartons. Und Möbel. Ein Kubikmeter Ladefläche kann rein mathematisch dreizehneinhalb Umzugskartons aufnehmen.«
»Dann kommen wir auf rund dreißig Kubikmeter. Ohne den Inhalt der Möbel. Den müsst ihr ja auch noch in Kisten verpacken.« Im Kopfrechnen war Jana schon immer fix gewesen.
»Und in den Sprinter kriege ich nur fünfzehn Kubikmeter rein. Also zweimal der Sprinter voll bis Oberkante Unterlippe. Und dann ist noch kein Möbelstück eingeladen. Ich werde auch mit dem Großen zweimal fahren müssen.«
Jörn hatte intensiv in seinen Fuhrpark investiert. Jedoch nicht in einen eigenen Möbellift. Aber er hatte eine Kooperation mit einem befreundeten Speditionsunternehmen abgeschlossen, das ihm den Lift zur Verfügung stellte. Fünfundzwanzig Meter in die Höhe – zum Glück brauchte Jörn heute nur rund zwanzig Meter. War aber auch nicht billiger.
»Es ist nur mein Instinkt«, sagte Jana, »aber der sagt mir, du musst das alles dokumentieren. Fotografiere die Kisten, auch den Ort, an dem sie stehen. Wenn ihr Möbel ausräumt, beschriftet sie und die Kisten ganz genau. Ich muss im Nachhinein eindeutig nachvollziehen können, was sich an welcher Stelle befunden hat. Zeichne am besten eine Landkarte der Kisten.«
Jana nahm die Tektonik auf Jörns Stirn wahr. Er war der Pragmatiker. Er verwandelte eine stickige, stinkende Bude voller Insekten und voller Müll binnen Stunden in eine besenreine Wohnung. Wo welcher Müll herumstand, das interessierte ihn herzlich wenig.
Sie ignorierte den Graben auf Jörns Stirn. »Und wenn ihr die Kisten abstellt, dann bitte so, dass wir zuerst die auspacken können, in denen die Sachen aus den Möbeln abgelegt sind. Wenn ich herauskriegen möchte, ob es irgendein Vermögen oder irgendwelche Erben gibt, finde ich die Unterlagen am ehesten dort«, erklärte Jana. Mehr brauchte Jörn nicht zu wissen.
Jörn nickte. Er kannte seine Auftraggeberin gut. Und außerdem arbeitete er nach dem Motto: Der Kunde ist König.
»Sag mir bitte noch, wohin ihr das ganze Zeug fahrt.«
Jörn nannte ihr die Adresse in der Heimstättensiedlung, in der er die Garage angemietet hatte.
»Wie lange werdet ihr brauchen?«, wollte Jana wissen.
»So, wie die Wohnung aussieht, auf jeden Fall sechs Stunden. Können auch acht werden. Aber heute Abend haben wir alles in der Garage gestapelt. Und ich sorge persönlich dafür, dass alles perfekt dokumentiert wird.« Jörn drückte ihr einen Schlüssel in die Hand. »Das ist der Schlüssel für die Garage. Ich hab sie jetzt erst mal für einen Monat für dich geblockt. Wenn ich das richtig sehe, können drei Viertel oder auch neun Zehntel des Wohnungsinhalts später auf den Müll. Bin ich gerne wieder behilflich. Und mit dem Rest kannst du dann auch in eine kleinere Garage umziehen.«
Jana reichte ihm die Hand, aber Jörn nahm sie kurz in den Arm.
»Danke«, sagte sie.
»Für dich immer, Prinzessin.«
Verheiratet, dachte Jana. Und das war auch gut so. Denn das enthob sie irgendwelcher Überlegungen, die sie eigentlich gar nicht denken wollte.
Mehr als ein Viertel der Einwohner Darmstadts waren Studenten. Knapp hundertsechzigtausend Bürger zählte die Stadt derzeit, mehr als vierzigtausend davon studierten.
Nicht nur für Jörn, sondern auch für Jana ein riesiger Pool an temporären Mitarbeitern. Sie war froh, dass sie auf diese engagierten jungen Menschen zugreifen konnte, die ihrerseits zufrieden waren, ein paar Euros zu verdienen. Und sie zahlte ja nicht schlecht. Sie war eine der wenigen, die den Studentinnen und Studenten einen zweistelligen Stundenlohn bot. Der Mindestlohn lag derzeit bei neun Euro fünfunddreißig. Dreizehn Euro zahlte sie.
Zum Beispiel an Katharina Hochnagel. Achtes Semester Philosophie. Aber so, wie Jana Katharina einschätzte, würde sie ihr auch die kommenden vier Jahre noch erhalten bleiben. Für Jana war die Frau eine Spitzenkraft: Sie nannte ihr die Aufgabe, den Zeitraum und die Menge an Studenten, die sie benötigte. Und Katharina schaffte Kommilitonen heran. Der Auftrag diesmal: eher außergewöhnlich.
»Heute wird eine Wohnung ausgeräumt. Es wird eine ganze Wand von Möbelkisten geben, mit unbekanntem Inhalt. Euer Job wird sein, diese Kisten auszuräumen.«
»Na, das sollten wir gerade noch so hinkriegen«, sagte Katharina. Sie saßen in der Cafeteria der Universitäts- und Landesbibliothek in der Magdalenenstraße. Jana hatte den Cappuccino ausgegeben.
»Kannst du bis morgen früh drei deiner Kommilitonen auftreiben, die morgen, Samstag und Sonntag, dieses Chaos sichten?«
Katharina nickte. »Kein Problem. Ich weiß schon, wen. Und die sind alle froh über die Kohle. Aber ein wenig Wochenendzuschlag muss drin sein.«
»Passt. Ihr kriegt alle fünfzehn Euro pro Stunde. Und, ganz wichtig: Es muss exakt dokumentiert werden, was ihr in welcher Kiste findet.« Vielleicht war Jana pingelig. Aber lieber einmal zu ausführlich dokumentiert als einmal zu wenig.
Katharinas Gesicht hatte aristokratische Züge, wenn sie lächelte. Was sie tat, als sie nickte.
»Ich muss mich also jetzt um nichts kümmern?«, wollte Jana wissen.
»Jana, du weißt doch, dass du dich auf mich verlassen kannst.«
Ja, das wusste Jana. Und trotzdem. Da war so ein leises Kribbeln im Bauch, das ihr sagte, dass dieser Fall nicht ganz so reibungslos abzuwickeln sein würde. Dennoch drückte sie Katharina den Schlüssel der Garage in der Heimstättensiedlung in die Hand.
Und wieder ein Abend.
Wieder der Blick in den Kamin.
Wieder ein Glas Lugana.
Jörn hatte Jana um siebzehn Uhr mitgeteilt, dass die Wohnung von Rainer Hauptmann geräumt wäre. Besenrein. All seine Sachen stünden nun in der Garage. Und nicht nur seine Kisten, sondern auch seine – jetzt leeren – Möbel, deren Inhalt ebenfalls in akkurat beschrifteten Pappboxen abgelegt worden wäre.
Über einen Link hatte Jörn ihr die Dokumentation des Umzugs zukommen lassen. Jana lud all die Daten auf ihr MacBook. Alle Umzugskisten waren von Jörns Mitarbeitern mit einer Zahl versehen worden, mit dickem, fettem Edding. Unübersehbar. Und sämtliche Kartons waren an Ort und Stelle fotografiert worden. Ebenso die Möbel. Und Jörn hatte es sich nicht nehmen lassen, einen richtigen Plan aufzubereiten, an welchem Platz welche Kiste und welches Möbelstück in der Wohnung platziert gewesen waren.
Er hatte es sich auch nicht nehmen lassen, eine kleine Textdatei dazu zu packen: »Lies mich.txt« Jana öffnete die Datei, die nur aus ein paar Zeilen bestand: »Liebe Jana, nach acht Stunden Arbeit schreibe ich diese Zeilen. Alle Kisten stehen in der Garage, alle Kisten sind nummeriert, und wir haben auch den Inhalt der Möbel verpackt und mit Buchstabenkombinationen gekennzeichnet, sodass du genau weißt, welche Kiste frei herumstand und was Müll aus den Möbeln ist. Ich hab beim Ausräumen meinen Mitarbeitern immer mal wieder über die Schulter geschaut – aber auf den ersten Blick unterscheidet sich der Wert des Inhalts der Möbel nicht vom Bodenbelag aus Prospekten und Zeitungen. Viel Glück damit! LG Jörn.«
Perfekt. Genau so hatte sie es sich gewünscht. Jana klickte sich durch das Fotoalbum. Mit abnehmender Möbelkistenwand wurde plötzlich auch an einigen Stellen der Boden sichtbar. Parkett! Jana hätte in einer so zugemüllten Wohnung nur billigstes Linoleum erwartet.
Morgen früh würde sie die Studenten in Empfang nehmen. Die würden dann anfangen, die Kartons zu leeren und ihr eine Dokumentation der Inhalte zukommen lassen. Vielleicht wären sie bereits am Samstag fertig oder am Sonntag. Jana war das einerlei. Die Toten hatten keine Eile. Und auch die potenziellen Erben konnten ein paar Tage warten.
Das Feuer prasselte.
Sie prostete der Kamintür zu.
Sie hatte es sich lange überlegt, ob sie übermorgen nach Erfurt fahren würde. Zu diesem doch etwas schrägen Jubiläum. Zehn Jahre Haiti. Zehn verdammte Jahre. Dass sie in einem völlig anderen Teil der Welt gewesen war. Auf der Landkarte auf dem linken Teil der Insel, auf der sich rechts die Dominikanische Republik befand. Haiti, das zehn Jahre zuvor eines der schwersten Erdbeben seiner Geschichte erleben musste. Überleben musste.
Sie hatten dort alle gemeinsam geholfen. 400 000 Liter sauberes Trinkwasser hatten sie jeden Tag produziert. Und damit 120 000 Menschen in Port-au-Prince versorgt. Sie hatten gebaut, hatten verbessert, hatten die Menschen vor Ort in die Programme eingebunden.
Dennoch erschien es Jana im Rückblick zu wenig. Und dieses Treffen, es würde sie nur erinnern an die Diskrepanz zwischen Europa und Haiti.
Mehr als zehn Jahre ihres Lebens hatte sie hauptamtlich beim Technischen Hilfswerk gearbeitet und war schon Jahre zuvor während des Studiums in Berlin ehrenamtlich dabei gewesen. Hatte es bis zur Regionalleiterin in Erfurt gebracht. Und seinerzeit ihren Einsatz in Haiti maßgeblich organisiert und koordiniert.
Und nun rief das Technische Hilfswerk seine Helfer auf, diesen zehnten Jahrestag in Erfurt gemeinsam zu feiern. Zu feiern … Was gab es da zu feiern? Ein Erdbeben?
Abermals prostete sie der Kamintür zu.
Sie würde wohl nicht nach Erfurt fahren.
CAESAR II
Cory ist wieder gesund. Es war heftig, aber es war heftig und kurz. Cassy war eifersüchtig, weil ich mich so intensiv um Cory gekümmert habe. Chris tat so, als ob ihn das alles nichts anginge. Er zeigt mir die kalte Schulter. Seit ich ihm gesagt habe, dass ich einfach nicht genug Kohle hätte, um ihm ein iPhone zu kaufen. Alle anderen hätten ein iPhone, hielt er entgegen. Ich glaube nicht, dass das wahr ist, aber es kann durchaus sein, dass es zumindest auf ein Drittel der anderen zutrifft. Und das ist natürlich die Gruppe, zu der er gehören will. Die, die ein iPhone haben.
Ich habe bei eBay geschaut. Für hundert Euro bekommt man ein älteres iPhone, habe ich meinem Sohn gesagt. »Mit so einem Teil wische ich mir noch nicht mal den Hintern ab«, hat er gebrüllt.
Ich kann es verstehen.
Aber ich kann es nicht bezahlen.
»Geht das nicht schneller?«, höre ich die Stimme einer Frau, die etwa zehn Meter von mir entfernt in der Schlange an der Kasse steht. Ich bin das Ende der Schlange. Aber nicht weil ich warten muss, sondern weil ich der Typ an der Kasse bin. »Geht das nicht schneller« – in den Top Ten der Sätze, die ich am meisten hasse, ungefähr auf Platz fünf.
Wir sind schnell. Ich bin schnell. Ich habe die Winkel raus, in denen ich die Produkte über die Scannerkasse ziehen muss, sodass sie gleich beim ersten Mal erkannt werden. Ich bin auch gut, die Centstücke wegzusortieren, wenn die alte Dame meint, die zwanzig Euro mit der Kleingeldsammlung bezahlen zu müssen.
»Ey, Alter, geht nich’ neue Kasse?« Platz vier auf der Liste. Als ob ich, der ich an der Kasse sitze, etwas dafür könnte, dass eine andere Kasse nicht besetzt ist. Hab es übers Mikro schon vor zwei Minuten kundgetan, dass die Schlangen länger werden, dass wir eine dritte Kasse brauchen. Wenn dann niemand kommt, dann bin ich der, der angeraunzt wird.
Lebe mit den Kindern auf siebzig Quadratmetern. Könnte schlimmer sein. Ich meine, die Küche funktioniert, das Bad ist intakt. Und, ja, das Klo müsste mal erneuert werden. Aber, unterm Strich: Auch das Klo funktioniert. Meistens. Es verstopft nur manchmal. Wenn Cassy wieder eine halbe Rolle Klopapier auf einmal nutzt. Eigentlich bin ich Bäcker. Inzwischen bin ich auch Teilzeitklempner.
»Ey, Caesar, dein Handy klingelt die ganze Zeit«, sagt mir Rita über das Headset ins Ohr. Eine Kollegin. Die wohl gerade im Aufenthaltsraum sitzt. Wenn mein Handy die ganze Zeit klingelt, dann kann das nur ein schlechtes Omen sein. Normalerweise ruft mich niemand an. Nur dann, wenn wieder einmal irgendwo eine Katastrophe passiert ist. Ich hoffe, dass es nicht das Krankenhaus ist, das mir sagt, dass mein Schwiegervater dort mit einem Herzinfarkt liegt.
Über Mikro funke ich in die Weite: »Kann mich hier mal jemand ablösen? Nur für fünf Minuten?«
Keine Antwort.
»Ey! Mach mal nächste Kasse!« Die Stimme kenne ich schon. Sie ist kaum näher gerückt. Und heute ist nicht mal Samstag. Es ist ein simpler, verfickter Mittwochvormittag!
»Caesar, ich kann dich in zwei Minuten ablösen.« Ritas Stimme. Die Stimme meiner Göttin in diesem Moment.
Tatsächlich kommt Rita nach nur einer Minute auf mich zu. Mit ihrer Bargeldkasse unter dem Arm, die sie jetzt einklinken muss, damit ich mich ausklinken kann.
»Ey, Alte! Machst du mal neue Kasse auf!«
Rita macht es richtig. Sie ignoriert den Einwurf.
Ich klinke mich aus, gehe in den Aufenthaltsraum. Bin damit zum Glück auch von »Ey-Alter« befreit. Ich schaue auf mein Handy. Vier Anrufe von einer unbekannten Nummer. Ich rufe zurück.
Sofort meldet sich eine Stimme: »Schubert. Polizei Groß-Umstadt. Spreche ich mit Caesar Strauß?«
Ich nicke. Bin sprachlos. Polizei. Kann ich jetzt richtig gut gebrauchen.
Der Beamte deutet mein Schweigen richtig als Ja. »Mir gegenüber sitzt ein junger Herr, Christian Strauß. Leider haben wir ihn im Bus aufgegriffen. Ohne Fahrschein. Ohne Schülerausweis. Sie können ihn hier abholen. Auf dem Polizeirevier.«
Fuck!!! Habe ich meinem Sohn nicht die Kohle für die Monatskarte in die Hand gedrückt? Hat er sich damit das Ticket gekauft? Offensichtlich nicht. »Scheiße!«, brülle ich durch den Raum.
Proteus kommt rein. Ferdinand Proteus. Chef von das Ganze. »Herr Strauß, ich bitte Sie! Was war das denn jetzt? Die Kunden können uns hören! Diese Räume sind akustisch nicht abgetrennt vom Verkaufsraum!«
Fick dich!, denke ich. »Entschuldigen Sie bitte, familiäre Probleme«, sage ich.
»Ja. Die häufen sich in letzter Zeit. Da kann ich heute wirklich keine Rücksicht drauf nehmen. Sie sehen ja selbst, was los ist.«
Habe ich gerade noch gedacht, ich könnte jetzt vorzeitig Schluss machen und meinen Sohn bei der Polizei abholen, verpufft dieser Gedanke ebenso wie »Fick dich«. Chris wird wohl noch eine Weile bei der Polizei ausharren müssen. Vielleicht ist das für Chris auch heilsam …
FREITAG
Er war gegangen.
Und das war gut so.
Nachdem sie ihrem Kamin Ade gesagt hatte, war sie noch in die Disco gegangen. Immer wieder zog es sie in den Salsa-Salon. Noch zu Zeiten in Erfurt hatte sie den lateinamerikanischen Paartanz gelernt, in mehreren Wochenendseminaren. Sowohl die Musik als auch die Bewegung hatte ihr immer Freude bereitet. Während andere ihre Dates auf Tinder suchten, zog es sie eher auf die Tanzfläche.
Bei diesem Tanz spürte sie sofort, ob die Berührung ihres Partners angenehm war oder nicht. Das war die Art von Speeddating, die ihr mit Abstand am meisten zusagte.
Auch ihn hatte sie gestern dort kennengelernt, sogar zum ersten Mal gesehen. Es kam nicht oft vor, dass alleinstehende Herren – oder zumindest Herren allein – die Disco betraten.
Er war attraktiv gewesen, groß, trainiert, kantiges Gesicht, Dreitagebart, und die kleinen Stromstöße, die die Berührung seiner Hände auf ihrem Rücken und ihrer Schulter auslösten, hatte sie in letzter Zeit nicht oft verspürt.
Sie hatte nicht lange gezögert.
Vier Lieder. Dann fünf Küsse.
Dann ab zu ihr.
Klar, es barg immer ein gewisses Risiko, die Typen mit in ihre Wohnung zu nehmen. Und trotzdem. Jana mochte es, am Morgen in ihrem eigenen Bett aufzuwachen, wenn die Herren noch in der Nacht ihre Sachen gepackt hatten und gegangen waren. Nur einigen wenigen hatte sie klarmachen müssen, dass sie an einem gemeinsamen Frühstück kein Interesse hatte.
Risiko? Ja, mochte sein.
Aber was war schon ohne Risiko im Leben? Sie hatte Haiti überlebt. Und in der Wohnung eines One-Night-Stands konnte der Bursche die Fesseln bereithalten. In ihrer Wohnung gab es keine Fesseln.
Risikominimierung.
James war sein Name, kam aus Amerika. So hatte sie nicht nur ihre Verführungskünste, sondern auch ihr Englisch reaktivieren müssen. Na ja. Zur Not hätte es auch ohne Englisch funktioniert.
Jana trat unter die Dusche, gönnte sich Zeit bei der Körperpflege – von der Spülung fürs Haar bis zu den Cremes. Dann sah sie auf die Uhr: In einer halben Stunde würde sie die Studenten treffen, die das Chaos von Rainer Hauptmann ordnen würden.
Noch einen Kaffee aus ihrer alten Gaggia-Maschine – einer treuen Seele, wenn Kaffeemaschinen über so etwas verfügten.
Guter Kaffee.
Gutes Frühstück.
Sie konnte in den Tag starten.
Die Studenten waren pünktlich gewesen. Sie hatte den Arbeitsbereich für die jungen Mitarbeiter auf Zeit bereits eingerichtet.
»Hallo, Frau Welzer, das sind Peter, Jens und Valerie«, stellte Katharina ihre Kommilitonen vor. Die hoben zur Begrüßung die Hand.
»Prima, dann kann es ja losgehen«, sagte Jana.
Vor der Wand aus Kisten standen vier nagelneue Umzugskartons. Sie waren bereits zur fertigen Kiste gefaltet und leer. Daneben hatte sie einen kleinen Klapptisch aufgestellt. In einer weiteren Möbelkiste daneben befanden sich Büroutensilien: Leitzordner, Klarsichthüllen, Papier und Marker in Schwarz, Grün und Rot.
»Ihr geht folgendermaßen vor: Jeder von euch nimmt sich eine Kiste vor und lädt den Inhalt Stück für Stück und Blatt für Blatt in eine der leeren Kisten. Wenn ihr irgendetwas findet, was nicht wie alte Zeitung, Prospekt oder Abfall aussieht, packt ihr es beiseite. Wenn einer von euch eine Kiste durchhat, kippt er den Inhalt wieder zurück in die Originalkiste, malt auf jede Seite mit dem grünen Marker einen Haken und signiert das Ganze bitte mit einem Namenskürzel, falls ich Rückfragen habe. So weit verstanden?«
Sie wusste, sie klang wie eine sechzigjährige Lehrerin mit Dutt und Hornbrille, und ihr war klar, dass auch ihr Gesichtsausdruck diesen Eindruck unterstrich. Aber sie musste diesen jungen Menschen klarmachen, dass sie keinen Fehler duldete.
»Logisch«, antwortete Jens. Für wie blöd hältst du uns eigentlich, war der Subtext seiner Antwort, unterstrichen durch ein etwas überhebliches Grinsen, wie Jana es empfand. Die anderen nickten nur. Jana ignorierte das und fuhr fort: »Wenn ihr irgendetwas gefunden habt, was auch nur halbwegs von Interesse sein könnte, packt ihr es in einen dieser Leitzordner.« Sie deutete auf die große Plastiktasche, in der sie sich befanden. »Hinein damit in eine Klarsichthülle, davor ein Trennblatt, darauf die Buchstaben- oder Zahlenkombination der Kiste.«
»Und wenn es nicht im Format DIN A4 ist?« Jens’ Tonfall war eine kleine Spur schärfer geworden.
Jana sah ihm fünf Sekunden ins Gesicht, dann antwortete sie: »Dann haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie zersägen es und packen es in eine Klarsichthülle, oder Sie falten es und packen es in eine Klarsichthülle. Ihre Wahl.«
Katharina konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Sie kannte ihre Chefin.
»Und: Seid gründlich. Das ist viel wichtiger, als dass ihr irgendeinen Geschwindigkeitsrekord brecht. Ihr werdet nicht nach Akkord bezahlt.«
Die vier schwiegen.
»Noch Fragen?«, wollte Jana wissen.
»Die Guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Und selbstverständlich haben wir auch unsere Handys dabei und dokumentieren alles, was wir tun.« Wieder Jens.
Jana sah Katharina an. »Du bist sicher, dass du hier die richtige Truppe zusammenhast?« Ihr entging nicht, wie Katharinas Blick einen kurzen Ausflug in Richtung Jens unternahm. Dennoch sagte sie: »Klar. Wir schaffen das.«
Auf eine unbestimmte und auch unangenehme Art fühlte Jana sich an einen Moment gut vier Jahre zuvor erinnert, als die Kanzlerin, die sie seinerzeit selbst gewählt hatte, ebenfalls verkündet hatte: »Wir schaffen das.« Bis heute war sie der Überzeugung, dass ihre Kanzlerin in diesem Moment richtig gehandelt hatte. Aber mit dem Schaffen war es dann doch nicht ganz so reibungslos vonstattengegangen wie erwünscht. Und irgendwie konnte Jana nicht die Überzeugung aufbringen, dass dies hier reibungslos über die Bühne gehen würde.
Von der Garage aus fuhr Jana direkt in ihr Büro. War ein Glückstreffer gewesen, als sie die Räume vor vier Jahren angemietet hatte. Sie lagen in der Pützerstraße 6 in Darmstadt, dem ehemaligen Ledigenwohnheim aus den Fünfzigerjahren. Oder der »Bullenburg«, wie die Darmstädter Bevölkerung das Gebäude liebevoll-despektierlich nannte. Nichtsdestotrotz: sechzig Quadratmeter im Erdgeschoss, direkt neben der Einfahrt zu den Garagen im Innenhof. Die jetzt auch nicht mehr als solche genutzt wurden. Denn der Innenhof diente dem Restaurant im Haus als Parkplatz.
Sie betrat das Büro. Es gab keinen Flur. Nachdem sie die Eingangstür geöffnet hatte, stand sie direkt im Hauptraum. Irina saß hinter dem Computer, wie Jana es erwartet hatte. Obwohl sie nur halbtags arbeitete, war sie die gute Seele des kleinen Unternehmens.
Die Räume waren perfekt geschnitten. Das Büro für die Mitarbeiter, in dem auch Irina saß, war großzügig bemessen mit seinen mehr als dreißig Quadratmetern. Neben der Toilette gab es noch eine kleine Küche und ein etwas größeres Kabinett für das Archiv, abschließbar. Darin befand sich auch ein kleiner Server, ungefähr so groß wie eine Schuhschachtel.
»Hallo, Jana! Gibt es schon was Neues von Dr. Wiese?«, wurde sie von der Mitarbeiterin begrüßt.
»Einen kleinen Moment bitte«, bat Jana die Sekretärin. Dann betrat sie ihr Büro, dessen Zugang sich unmittelbar links neben der Eingangstür befand.
Sie hing ihre Jacke an die kleine Garderobe, dann setzte sie sich auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch. Das Büro maß knapp sechzehn Quadratmeter. Sie hatte es luftig eingerichtet. Ein Schreibtisch mit gläserner Tischplatte stand in einer Ecke des Raumes. Die Böden der beiden Regale waren ebenfalls aus Glas gefertigt. Zwei Möbel konterkarierten das moderne Ambiente: eine Chaiselongue, die stilistisch so gar nicht dazu passte, ihr jedoch immer die Möglichkeit gewährte, ein kurzes Nickerchen zu machen. Oft nutzte sie sie abends. Schläfchen von zehn bis halb elf, dann noch mal zwei Stunden Bürokruscht, bevor das eigene Bett rief.
Ende der Leseprobe