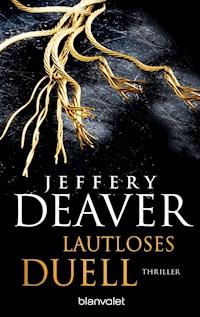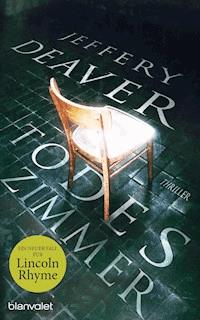
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein Scharfschütze, ein blutiger Auftragsmord, ein übermächtiger Gegner
In einer Hotelsuite auf den Bahamas bietet sich dem Ermittler Lincoln Rhyme ein Bild des Schreckens: Der regierungskritische US-Bürger Roberto Moreno wurde von einem Scharfschützen kaltblütig erschossen, sein Bodyguard und ein Reporter sind ebenfalls tot – und laut Informationen der zuständigen Staatsanwältin geschahen die Morde im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes. Die ambitionierte Nance Laurel ist fest entschlossen, die für das brutale Attentat Verantwortlichen zur Strecke zu bringen, und beauftragt Lincoln Rhyme und seine Partnerin Amelia Sachs mit den Ermittlungen. Eine Hetzjagd beginnt, die die beiden selbst ins Visier des skrupellosen Killers Jacob Swann rückt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 668
Ähnliche
Jeffery Deaver
Todeszimmer
Thriller
Ins Deutsche übertragen von Thomas Haufschild
Für Judy, Fred und Dax
»Ich missbillige, was du sagst, aber ich werde bis zum Tod dein Recht verteidigen, es zu sagen.«
Evelyn Beatrice HallThe Friends of Voltaire, 1906.
DIENSTAG, 9. MAI
I Der Poisonwood-Baum
1
Das aufblitzende Licht beunruhigte ihn.
Ein ferner Schimmer, weiß oder blassgelb.
Vom Wasser? Von dem Streifen Land auf der anderen Seite der friedlichen türkisfarbenen Bucht?
Doch es konnte eigentlich keine Gefahr drohen. Er befand sich hier an einem malerischen, entlegenen Zufluchtsort und war sowohl dem Scheinwerferlicht der Medien als auch den Blicken seiner Gegner entzogen.
Roberto Moreno spähte angestrengt aus dem Fenster. Er war zwar erst Ende dreißig, aber er hatte schlechte Augen, und so schob er seine Brille höher die Nase hinauf und ließ den Blick über das Gelände schweifen – über den Garten vor dem Fenster der Suite, den schmalen weißen Strand, die wogende blaugrüne See. Wunderschön, abgeschieden … und geschützt. Kein Boot schaukelte auf den Wellen. Und selbst wenn ein Feind von seinem Aufenthalt hier erfahren und sich mit einem Gewehr unbemerkt durch das kleine Industriegebiet geschlichen haben könnte, das auf der Landzunge anderthalb Kilometer jenseits des Wassers lag, hätten die Entfernung und der Dunst seine Sicht behindert und einen Schuss unmöglich gemacht.
Nun blitzte und schimmerte nichts mehr.
Du bist in Sicherheit. Ganz bestimmt.
Doch Moreno blieb trotzdem argwöhnisch. Für ihn bestand stets ein gewisses Risiko, genau wie damals für Martin Luther King oder Gandhi. So sah sein Leben nun mal aus. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Aber er befürchtete, sterben zu müssen, bevor er sein Werk vollenden konnte. Und jung, wie er war, blieb für ihn noch viel zu erledigen. Das außergewöhnliche Ereignis, dessen Vorbereitungen er gerade erst abgeschlossen hatte – vor einer Stunde oder so – und das beträchtliche Aufmerksamkeit erregen würde, war beispielsweise nur eines von einem ganzen Dutzend, die für das nächste Jahr geplant waren.
Gefolgt von einer potenziell vielversprechenden Zukunft.
Der stämmige Mann mit dem schlichten sandfarbenen Anzug, dem weißen Hemd und der königsblauen Krawatte – oh, wie karibisch – schenkte zwei Tassen Kaffee aus der Kanne ein, die der Zimmerservice soeben gebracht hatte. Er kehrte zum Sofa zurück und reichte eine dem Reporter, dessen Diktiergerät aufnahmebereit auf dem Tisch lag.
»Möchten Sie Milch oder Zucker, Señor de la Rua?«
»Nein, vielen Dank.«
Sie unterhielten sich auf Spanisch, das Moreno fließend beherrschte. Er hasste Englisch und nutzte seine Muttersprache nur, wenn es nicht anders ging. Es war ihm nie so ganz gelungen, den Akzent aus New Jersey loszuwerden. Wann immer er die eigene Stimme hörte, fühlte er sich in seine Jugend in den USA zurückversetzt und musste an den Vater denken, der viel gearbeitet und ein maßvolles Leben geführt hatte, während die Mutter beim Trinken jegliches Maß verlor. Trostlose Landschaften, Schikanen durch die Rüpel von der nahen Highschool. Dann die Rettung: der Umzug der Familie an einen Ort, der viel schöner war als South Hills und wo sogar die Sprache sanfter und eleganter wirkte.
»Aber nennen Sie mich doch bitte Eduardo«, sagte der Reporter nun.
»Und ich bin Roberto.«
Genau genommen hieß er »Robert«, aber das klang für ihn irgendwie nach Anwälten an der Wall Street, Politikern in Washington oder Generälen auf ausländischen Schlachtfeldern, die den Boden beiläufig mit dem Blut der einheimischen Bevölkerung tränkten.
Daher also Roberto.
»Sie leben in Argentinien«, sagte Moreno zu dem Journalisten, einem schmalen Mann mit schütterem Haar, der ein blaues Hemd ohne Krawatte sowie einen schäbigen schwarzen Anzug trug. »In Buenos Aires?«
»Ja, richtig.«
»Wissen Sie, woher der Name der Stadt kommt?«
De la Rua verneinte und sagte, er stamme nicht von dort.
»Die wörtliche Bedeutung ist natürlich ›gute Luft‹«, sagte Moreno. Er las sehr viel – mehrere Titel pro Woche, hauptsächlich lateinamerikanische Literatur und historische Sachbücher. »Aber ursprünglich gemeint war nicht die Luft Argentiniens, sondern die der italienischen Insel Sardinien. Namensgeber war ein Viertel von Cagliari, das oben auf einem Hügel lag und sich somit über dem, sagen wir ruhig: Gestank der Altstadt befand. Es hieß Buen Ayre. Die spanischen Eroberer, die das spätere Buenos Aires gründeten, benannten es nach jenem Viertel. Ich rede hier wohlgemerkt von der ersten Gründung der Stadt. Die Spanier wurden von den Eingeborenen nämlich zunächst wieder vertrieben, weil denen die Ausbeutung durch Europa ganz und gar nicht gefiel.«
»Sogar Ihre Anekdoten muten eindeutig antikolonial an«, stellte de la Rua fest.
Moreno lachte. Doch seine gelöste Stimmung verflog sogleich wieder, und er warf erneut einen schnellen Blick zum Fenster hinaus.
Dieses verdammte Licht. Doch auch jetzt vermochte Moreno nichts anderes zu erkennen als die Bäume und Pflanzen im Garten und den verschwommenen Streifen Land in anderthalb Kilometern Entfernung. Das Hotel stand an der weitgehend unbesiedelten Südwestküste von New Providence, jener Insel der Bahamas, auf der auch Nassau lag. Das Gelände war umfriedet und bewacht. Und der Garten war ausschließlich dieser Suite vorbehalten. Hohe Zäune schirmten ihn nach Norden und Süden ab, und im Westen lag der Strand.
Da war niemand. Da konnte niemand sein.
Höchstens mal ein Vogel. Ein Rascheln im Laub.
Simon hatte erst vor Kurzem alles abgesucht. Moreno schaute zu dem großen, ruhigen Brasilianer mit der dunklen Haut und dem modischen Anzug – der Leibwächter kleidete sich besser als sein Schützling, allerdings nicht auffällig. Simon war Mitte dreißig und wirkte angemessen bedrohlich, so wie es von einem Mann seiner Profession erwartet und gewünscht wurde, aber er war kein hirnloser Schläger. Vor seiner Zeit als ziviler Sicherheitsexperte hatte er als Offizier in der Armee gedient.
Er war zudem sehr gut in seinem Job. Simons Kopf fuhr herum; er hatte den Blick seines Chefs bemerkt, trat sofort ans Fenster und sah hinaus.
»Bloß irgendein Lichtblitz«, erklärte Moreno.
Der Leibwächter schlug vor, die Vorhänge zuzuziehen.
»Nicht nötig.«
Moreno hatte entschieden, dass Eduardo de la Rua, der auf eigene Kosten in der Touristenklasse aus der Stadt der guten Luft hergeflogen war, es verdiente, den herrlichen Ausblick zu genießen. Ihm war gewiss nur selten Luxus vergönnt, denn man kannte ihn als hart arbeitenden Journalisten auf der Suche nach der Wahrheit und nicht als Verfasser von Gefälligkeitsartikeln für Konzernbosse und Politiker. Moreno beschloss außerdem, den Mann zum Mittagessen in das vorzügliche Restaurant des South Cove Inn einzuladen.
Simon schaute noch einmal nach draußen, kehrte zu seinem Stuhl zurück und nahm sich eine Zeitschrift.
De la Rua schaltete das Diktiergerät ein. »Können wir anfangen?«
»Bitte.« Moreno schenkte ihm seine volle Aufmerksamkeit.
»Mr. Moreno, Ihr Bündnis für Lokale Selbstbestimmung hat soeben seine erste Zweigstelle in Argentinien eröffnet. Können Sie mir schildern, wie Sie auf die Idee gekommen sind? Und was Ihre Organisation genau macht?«
Moreno hatte diesen Vortrag bereits Dutzende Male gehalten. Der Inhalt variierte, je nach dem jeweiligen Journalisten oder Publikum. Aber die simple Kernaussage war immer gleich: Die einheimische Bevölkerung sollte in die Lage versetzt werden, sich dem Einfluss der US-amerikanischen Regierungsbehörden und Konzerne zu entziehen und unabhängig zu werden. Dies geschah vornehmlich durch Mikrokredite sowie durch die Förderung kleiner und kleinster Landwirtschaftsprojekte oder Geschäftsideen.
»Wir widersetzen uns den amerikanischen Wirtschaftsinteressen«, sagte er nun zu dem Reporter. »Ebenso den Hilfs- und Sozialprogrammen der Regierung, denn auch die wollen uns letztlich nur von ihren Werten abhängig machen. Wir werden von denen nicht als menschliche Wesen angesehen, sondern als billige Arbeitskräfte und Abnehmer amerikanischer Waren. Erkennen Sie den Teufelskreis? Erst beutet man unsere Leute in amerikanischen Fabriken aus, und dann verführt man sie dazu, die Produkte genau dieser Firmen zu kaufen.«
»Ich habe schon oft über Wirtschaftsinvestitionen in Argentinien und anderen südamerikanischen Ländern geschrieben«, sagte der Journalist. »Soweit ich weiß, nimmt auch Ihr Bündnis derartige Investitionen vor. Man könnte einwenden, dass Sie den Kapitalismus einerseits verdammen und andererseits selbst praktizieren.«
Moreno fuhr sich durch das lange schwarze Haar mit den vorzeitig ergrauten Strähnen. »Nein, ich verdamme den Missbrauch des Kapitalismus – vor allem den amerikanischen Missbrauch. Ich setze die Wirtschaft als Waffe ein. Nur Dummköpfe vertrauen darauf, dass ein Wandel sich allein durch Ideologie bewirken lässt. Die Ideen sind das Steuerruder. Das Geld ist die Schiffsschraube.«
Der Reporter lächelte. »Das wird mein Aufmacher. Manch einer nennt Sie sogar einen Revolutionär, habe ich gelesen.«
»Ha, ich bin ein Großmaul, das ist alles!« Das Lächeln schwand. »Aber glauben Sie mir, während die ganze Welt auf den Mittleren Osten geschaut hat, ist ihr die Entstehung einer weitaus größeren Macht entgangen: Lateinamerika. Dafür stehe ich. Für die neue Ordnung. Man kann uns nicht länger ignorieren.«
Roberto Moreno stand auf und trat ans Fenster.
Der Garten wurde von einem etwa zwölf Meter hohen Poisonwood-Baum überschattet. Moreno stieg häufig in dieser Suite ab und mochte den Baum sehr. Er fühlte sich ihm sogar in gewisser Weise verbunden. Poisonwood-Bäume sind stark, anpassungsfähig und von schlichter Schönheit. Außerdem sind sie giftig, wie der Name bereits vermuten lässt. Ihr Pollen oder der Rauch ihres brennenden Holzes und Laubs kann beim Einatmen heftige Lungenschmerzen verursachen. Und dennoch ernährt der Baum den prächtigen Schwalbenschwanzschmetterling der Bahamas, und Weißkopftauben fressen seine Früchte.
Ich bin wie dieser Baum, dachte Moreno. Die Metapher könnte sich für den Artikel eignen. Mal sehen, was de la Rua dazu …
Wieder dieser Schimmer.
Dann geschah alles im Bruchteil einer Sekunde: Die kargen Blätter des Baumes gerieten urplötzlich in Unordnung, und das große Fenster vor Moreno explodierte. Die Scheibe verwandelte sich in eine Wolke aus einer Million Schneekristallen, und in seiner Brust breitete sich Feuer aus.
Moreno fand sich rücklings auf dem Sofa wieder, das eben noch anderthalb Meter hinter ihm gestanden hatte.
Aber … aber was ist hier gerade passiert? Was war das? Ich bin so schwach, so müde.
Ich kriege keine Luft.
Er starrte den Baum an, der nun deutlicher zu erkennen war, so viel deutlicher, weil kein Fenster mehr den Blick filterte. Die Äste bewegten sich in der sanften Meeresbrise, ihre Blätter wogten vor und zurück. Der Baum atmete für ihn. Denn Moreno konnte nicht atmen, nicht mit dem Feuer in seiner Brust. Nicht mit den Schmerzen.
Irgendjemand rief nach Hilfe.
Überall war Blut.
Die Sonne ging unter, der Himmel wurde dunkler und dunkler. Aber ist denn nicht Vormittag? Moreno sah seine Frau vor sich, den halbwüchsigen Sohn und die Tochter. Seine Gedanken lösten sich auf, bis er nur noch eines wahrnahm: den Baum.
Gift und Stärke, Gift und Stärke.
Das Feuer in ihm ließ nach, verschwand. Tränen der Erleichterung.
Die Dunkelheit nahm zu.
Der Poisonwood-Baum.
Poisonwood …
Gift …
MONTAG, 15. MAI
II Die Sequenz
2
»Ist er nun unterwegs oder nicht?«, fragte Lincoln Rhyme und versuchte gar nicht erst, seine Verärgerung zu verbergen.
»Er muss noch etwas im Krankenhaus erledigen«, ertönte Thoms Stimme aus dem Korridor oder der Küche oder von wo immer er stecken mochte. »Er verspätet sich. Er ruft an, sobald er es einrichten kann.«
»›Etwas‹. Konkreter geht’s wohl nicht. ›Etwas im Krankenhaus‹.«
»Das hat er wörtlich zu mir gesagt.«
»Er ist Arzt. Er sollte sich gefälligst präziser ausdrücken. Und er sollte pünktlich sein.«
»Er ist Arzt«, erwiderte Thom, »was bedeutet, dass er sich um Notfälle kümmern muss.«
»Aber er hat nicht von einem ›Notfall‹ gesprochen, sondern von ›etwas‹. Die Operation ist für den sechsundzwanzigsten Mai angesetzt. Ich will nicht, dass sie verschoben wird. Das alles dauert mir sowieso schon viel zu lange. Ich begreife nicht, wieso er es nicht früher einrichten konnte.«
Rhyme fuhr mit seinem roten Rollstuhl Modell Storm Arrow zu einem Computermonitor und hielt neben dem Rattansessel, auf dem Amelia Sachs in schwarzer Jeans und ärmellosem schwarzen Oberteil saß. Ein goldener Anhänger mit einem Diamanten und einer Perle hing an einer dünnen Kette um ihren Hals. Es war noch früh am Tag. Das Licht der Frühlingssonne fiel gleißend durch die Ostfenster herein und ließ verführerisch Amelias rotes Haar aufleuchten, das sie zu einem Knoten gebunden und sorgfältig festgesteckt hatte. Rhyme wandte sich wieder dem Bildschirm zu und überflog den Tatortbericht eines Mordfalls, bei dessen Aufklärung er dem NYPD in letzter Zeit behilflich gewesen war.
»Wir sind fast fertig«, stellte Sachs fest.
Sie saßen im einstigen Salon seines Stadthauses am Central Park West in Manhattan. Was in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts vermutlich als stilles Gemach für Besucher und Bittsteller gedient hatte, fungierte heutzutage als ausgewachsenes Kriminallabor. Der Raum war voller Untersuchungsgeräte und Instrumente, Computer und Kabel, unzähliger Kabel, dank derer jede Fahrt von Rhymes Rollstuhl holprig verlief, wenngleich er das nur von den Schultern an aufwärts spüren konnte.
»Der Arzt verspätet sich«, sagte Rhyme leise zu Sachs, was überflüssig war, weil sie seinen Wortwechsel mit Thom aus drei Metern Entfernung mitgehört hatte. Doch Rhyme ärgerte sich immer noch und fühlte sich besser, wenn er etwas Dampf ablassen konnte. Er bewegte seine rechte Hand behutsam bis zum Touchpad vor und scrollte durch die letzten Absätze des Berichts. »Gut.«
»Soll ich die Datei abschicken?«
Er nickte, und sie drückte eine Taste. Die verschlüsselten fünfundsechzig Seiten jagten durch den Äther und nahmen ihren Weg zu der knapp zehn Kilometer entfernten Zentrale der NYPD-Spurensicherung in Queens, wo sie ein wesentlicher Bestandteil des Falls Das Volk gegen Williams sein würden.
»Erledigt.«
Erledigt … bis auf die Aussage während des Prozesses gegen den Drogenbaron, der Zwölf- und Dreizehnjährige auf die Straßen von East New York und Harlem geschickt hatte, damit sie dort für ihn mordeten. Es war Rhyme und Sachs gelungen, winzige Spurenpartikel und Sohlenabdrücke zu sichern und zu analysieren, die von den Schuhen eines der Jungen zum Boden eines Ladens in Manhattan führten, von da aus auf den Teppich einer Lexus-Limousine, weiter zu einem Restaurant in Brooklyn und schließlich zum Haus von Tye Williams höchstpersönlich.
Der Gangsterboss war bei der Ermordung des Zeugen nicht selbst zugegen gewesen, er hatte die Waffe nicht berührt, es gab keinen Tonbandbeweis dafür, dass er den Mord angeordnet hatte, und der junge Schütze war viel zu verängstigt, um gegen ihn auszusagen. Doch nichts davon stand einer Anklage im Wege; Rhyme und Sachs hatten eine Beweiskette geschmiedet, die sich vom Tatort direkt zu Williams’ Behausung erstreckte.
Er würde den Rest seines Lebens hinter Gittern sitzen.
Sachs legte ihre Hand auf Rhymes linken Arm, der regungslos an der Lehne des Rollstuhls fixiert war. Die Sehnen, die unter ihrer blassen Haut hervortraten, verrieten ihm, dass sie fest zudrückte. Die hochgewachsene Frau stand auf und reckte sich. Sie hatten seit dem frühen Morgen an der Fertigstellung des Berichts gearbeitet. Sachs war um fünf Uhr aufgewacht, Rhyme ein wenig später.
Er bemerkte, dass sie zusammenzuckte, als sie zu dem Tisch ging, auf dem ihre Kaffeetasse stand. Die Arthritis in Hüfte und Knien machte ihr in letzter Zeit sehr zu schaffen. Rhymes Rückenmarksverletzung, der er seine Querschnittslähmung verdankte, galt gemeinhin als verheerend. Doch sie war für ihn nie mit irgendwelchen Schmerzen verbunden.
Wer auch immer wir sein mögen, unsere Körper lassen uns früher oder später im Stich, dachte er. Auch den derzeit noch Gesunden und im Großen und Ganzen Zufriedenen drohten dunkle Wolken am Horizont. Sie taten ihm leid, all die Sportler, die Schönen und die Jungen, die dem Niedergang bereits jetzt furchtsam entgegenblickten.
Paradoxerweise galt für Lincoln Rhyme das genaue Gegenteil. Sein Zustand hatte sich vom neunten Kreis des Leidens merklich verbessert, vor allem infolge neuer Operationsmethoden und Rhymes kompromissloser Haltung hinsichtlich eines rigiden Trainingsprogramms und riskanter experimenteller Verfahren.
Was ihn wieder verärgert daran denken ließ, dass der Arzt zu spät zu dem heutigen Begutachtungstermin kam, der für den bevorstehenden Eingriff unerlässlich war.
Die zweistimmige Türglocke ertönte.
»Ich gehe schon«, rief Thom.
Das Haus war selbstverständlich behindertengerecht umgebaut, und Rhyme hätte einen Computer nutzen können, um einen Blick auf den Klingelnden zu werfen, mit ihm zu sprechen und ihn hereinzulassen. Er mochte allerdings keine unangemeldeten Aufwartungen und neigte dazu, die Leute – bisweilen schroff – wieder wegzuschicken, sofern Thom ihm nicht eiligst zuvorkam.
»Wer ist das? Sieh zuerst nach.«
Es konnte nicht Doktor Barrington sein, denn der wollte ja anrufen, sobald er das »Etwas« erledigt hatte, das ihn aufhielt. Rhyme war nicht in der Stimmung für andere Besucher.
Doch ob sein Betreuer nun zunächst nachsah oder nicht, schien keine Rolle zu spielen. Lon Sellitto betrat den Salon.
»Linc, du bist zu Hause?«
Was schwerlich überraschend war.
Der massige Detective steuerte geradewegs ein Tablett mit Kaffee und Gebäck an.
»Soll ich frischen aufsetzen?«, fragte Thom. Der schlanke Betreuer trug ein gestärktes weißes Hemd, eine geblümte blaue Krawatte und eine dunkle Stoffhose. Dazu heute außerdem Manschettenknöpfe aus Ebenholz oder Onyx.
»Nein, vielen Dank, Thom. Hallo, Amelia.«
»Hallo, Lon. Wie geht es Rachel?«
»Gut. Sie hat mit Pilates angefangen. Was für ein ulkiges Wort. Das sind irgendwelche Turnübungen.« Sellitto trug einen für ihn typischen zerknitterten braunen Anzug und ein ebenso charakteristisch faltiges taubenblaues Hemd. Seine gestreifte karmesinrote Krawatte war allerdings so glatt wie frisch gebügelt. Das sah ihm gar nicht ähnlich. Es musste sich um ein Geschenk aus jüngster Zeit handeln, folgerte Rhyme. Von seiner Freundin Rachel? Es war Mai, also kam als Anlass kein Feiertag in Betracht. Vielleicht war es ja ein Geburtstagsgeschenk. Rhyme wusste nicht, wann Sellitto Geburtstag hatte – oder irgendjemand sonst, von wenigen Ausnahmen abgesehen.
Sellitto nippte an seinem Kaffee und nahm zwei kleine Bissen von einem Stück Blätterteiggebäck. Er war eigentlich immer auf Diät.
Rhyme und der Detective hatten vor Jahren als Partner zusammengearbeitet, und es war hauptsächlich Lon Sellitto gewesen, der Rhyme nach dem Unfall gedrängt hatte, sich eine Beschäftigung zu suchen. Zu diesem Zweck hatte er ihn weder verhätschelt noch beschwatzt, sondern ihn gezwungen, seinen Hintern hochzukriegen und wieder Verbrechen aufzuklären. (Genauer gesagt, auf seinem Hintern sitzen zu bleiben und die Arbeit fortzusetzen.) Doch ungeachtet ihrer gemeinsamen Vergangenheit, kam Sellitto nie ohne direkten Anlass vorbei. Der Detective First Grade gehörte zur Abteilung für Kapitalverbrechen im Big Building an der Police Plaza Nummer eins. Für gewöhnlich war er der leitende Ermittler in all jenen Fällen, zu denen Rhyme als Berater hinzugezogen wurde. Sein Besuch versprach also einen neuen Auftrag.
»Okay.« Rhyme musterte ihn prüfend. »Hast du mir was Hübsches mitgebracht, Lon? Ein faszinierendes Verbrechen? Eine echte Herausforderung?«
Sellitto trank einen Schluck und aß einen Bissen. »Ich weiß nur, dass die Chefetage mich angerufen hat und wissen wollte, ob du Zeit hast. Ich sagte, du schließt gerade den Fall Williams ab. Dann wurde ich angewiesen, so schnell wie möglich herzukommen und hier jemanden zu treffen. Die sind schon auf dem Weg.«
»›Jemanden‹? ›Die‹?«, fragte Rhyme spöttisch. »Das ist ungefähr so konkret wie das ›Etwas‹, das meinen Arzt aufhält. Scheint ansteckend zu sein. Wie die Grippe.«
»He, Linc, mehr weiß ich auch nicht.«
Rhyme warf Sachs einen gequälten Blick zu. »Mir fällt auf, dass niemand mich deswegen angerufen hat. Hast du etwas in dieser Angelegenheit gehört, Sachs?«
»Keinen Pieps.«
»Oh, das ist wegen einer anderen Sache«, sagte Sellitto.
»Welcher anderen Sache?«
»Was auch immer da vor sich geht, es ist geheim. Und das soll es auch bleiben.«
Immerhin ein erster Schritt in Richtung faszinierend, dachte Rhyme.
3
Rhyme blickte zu den beiden Besuchern auf, die unterschiedlicher nicht hätten sein können und in diesem Moment seinen Salon betraten.
Der eine war ein Mann Mitte fünfzig mit militärisch gerader Haltung und einem marineblauen, fast schon schwarzen Anzug – von der Stange, wie die Schulterpartie verriet. Er hatte ein glatt rasiertes Gesicht mit markantem Unterkiefer, gebräunte Haut und soldatisch kurz geschorenes Haar. Irgendein hohes Tier, dachte Rhyme.
Die andere Person war eine Frau Anfang dreißig. Sie hatte eine kräftige Statur, war aber nicht übergewichtig, jedenfalls noch nicht. Ihr blondes, glanzloses Haar war zu einem anachronistischen Flip geflochten und mit viel Spray fixiert. Rhyme fiel auf, dass sie ihren blassen Teint einer dicken Schicht fleischfarbener Schminke verdankte. Er konnte keine Akne oder andere Hautprobleme erkennen, also musste die Spachtelmasse wohl modische Gründe haben. Die Frau trug weder Lidschatten noch Eyeliner, wodurch ihre tiefschwarzen Augen in dem cremefarbenen Gesicht nur umso eindringlicher wirkten. Auch ihre schmalen, trockenen Lippen waren farblos. Rhyme vermutete, dass dieser Mund sich nur selten zu einem Lächeln verzog.
Die Frau suchte sich ein Objekt des Interesses aus – ein Laborgerät, das Fenster, Rhyme – und analysierte es mit ihrem Sandstrahlblick, bis sie es entweder durchschaute oder für irrelevant erachtete. Ihr Kostüm war dunkelgrau und ebenfalls nicht teuer. Die drei Plastikknöpfe waren ordnungsgemäß geschlossen, schienen sich aber nicht hundertprozentig in einer Reihe zu befinden. Rhyme fragte sich, ob sie wohl ein perfekt sitzendes Kostüm mit unpassenden Knöpfen gefunden und diese dann eigenhändig ausgetauscht hatte. Ihre flachen schwarzen Schuhe waren ungleichmäßig abgenutzt und kürzlich mit einem flüssigen Pflegemittel behandelt worden, um die Schrammen im Leder zu verdecken.
Alles klar, dachte Rhyme. Er glaubte, ihren Arbeitgeber zu kennen. Was ihn nur umso neugieriger machte.
»Linc, das ist Bill Myers«, stellte Sellitto den Mann vor.
Der Besucher nickte. »Captain, es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Er sprach Rhyme mit dem Dienstrang an, den dieser innegehabt hatte, als er wegen seiner Invalidität aus dem Polizeidienst ausscheiden musste. Das bestätigte Rhymes Vermutung: ein ziemlich hohes Tier des NYPD.
Er fuhr mit dem Rollstuhl ein Stück vor und streckte seine rechte Hand aus. Myers registrierte die abgehackte Bewegung und zögerte kurz, bevor er einschlug. Auch Rhyme bemerkte etwas: Sachs erstarrte kurz. Es gefiel ihr nicht, wenn er den Arm und die Hand für überflüssige Gesten wie diese einsetzte. Aber Lincoln Rhyme konnte einfach nicht anders. Er hatte sich zehn Jahre lang angestrengt, um den erlittenen Schicksalsschlag zumindest teilweise wieder auszugleichen. Seine wenigen Siege erfüllten ihn mit Stolz, und er kostete sie aus.
Außerdem – wozu hatte man ein Spielzeug, wenn man es nie benutzte?
Myers stellte nun seine geheimnisvolle Begleiterin vor. Sie hieß Nance Laurel.
»Lincoln«, sagte Rhyme. Ein weiterer Händedruck, offenbar fester als der von Myers, wenngleich Rhyme es natürlich nicht spüren konnte. Das Gefühl im Arm hatte er nämlich nicht zurückerhalten.
Laurels scharfer Blick wanderte über Rhymes dichtes braunes Haar, seine fleischige Nase, die aufmerksamen dunklen Augen. »Hallo« war alles, was sie sagte.
»So«, stellte er fest. »Sie sind also eine ADA.«
Assistant District Attorney – eine stellvertretende Bezirksstaatsanwältin.
Sie ließ sich nicht anmerken, ob er mit dieser, teils geratenen, Vermutung richtiglag. Ein Zögern. Dann: »Ja, bin ich.« Ihre Stimme war forsch und akzentuiert.
Sellitto stellte den beiden Besuchern nun Sachs vor. Myers sah sie an, als wüsste er auch um ihre Reputation. Rhyme entging nicht, dass Sachs erneut zusammenzuckte, als sie vortrat und den beiden die Hand reichte. Auf dem Rückweg zu ihrem Platz hatte sie sich wieder im Griff. Niemand außer ihm, glaubte er, bekam mit, wie Sachs sich verstohlen zwei Ibuprofentabletten in den Mund schob und trocken herunterschluckte. Mochten die Schmerzen auch noch so schlimm sein, sie nahm nie etwas Stärkeres.
Wie sich herausstellte, stand auch Myers im Rang eines Captains und leitete eine anscheinend neue Abteilung des Departments, denn Rhyme hatte noch nie von ihr gehört: die Special Services Division. Myers’ selbstsicheres Auftreten und der entschlossene Blick vermittelten den Eindruck, dass er und seine Truppe innerhalb des NYPD über großes Gewicht verfügten. Womöglich strebte er eine Zukunft in der Politik an.
Rhyme selbst hatte sich nie um die internen Machtspiele des NYPD oder anderer Behörden gekümmert, ganz zu schweigen von höheren Weihen in Albany oder Washington. Ihn interessierte im Augenblick nur, dass der Mann hier war. Der Besuch des Leiters einer mysteriösen neuen Einheit in Begleitung einer scharfsinnigen ADA mit der Aura eines Bullterriers konnte einen Auftrag bedeuten, der Rhyme die gefürchtete Langeweile vom Leib halten würde, die seit dem Unfall sein schlimmster Feind geworden war.
Er spürte – an den Schläfen, nicht in seiner empfindungslosen Brust –, wie sein Herzschlag sich vor lauter Vorfreude immer mehr beschleunigte.
Bill Myers wies auf Nance Laurel. »Sie wird Ihnen die Situation schildern.«
»Captain …«, setzte Laurel nach wiederum kurzem Zögern an.
»Lincoln. Ich bin nicht mehr im aktiven Dienst.«
Eine Pause. »Lincoln, ja. Ich bereite derzeit ein Verfahren vor, und angesichts gewisser ungewöhnlicher Umstände wurde der Gedanke geäußert, dass Sie besonders geeignet sein könnten, die Ermittlungen zu leiten. Sie und Detective Sachs. Mir wurde gesagt, dass Sie beide häufig zusammenarbeiten.«
»Das stimmt.« Er fragte sich, ob ADA Laurel jemals aus sich herausging. Wohl eher nicht.
»Lassen Sie es mich erklären«, fuhr sie fort. »Letzten Dienstag, am neunten Mai, wurde in einem Luxushotel auf den Bahamas ein amerikanischer Staatsbürger ermordet. Die dortige Polizei untersucht das Verbrechen, aber ich habe Grund zu der Annahme, dass der Schütze ebenfalls Amerikaner ist und sich inzwischen wieder in den USA befindet. Genauer gesagt, im Großraum New York.«
Sie hielt vor fast jedem Satz kurz inne. Wollte sie kultiviert klingen? Oder prüfte sie jedes Wort vorab auf juristische Unbedenklichkeit?
»Nun, ich habe nicht vor, die Täter wegen Mordes anzuklagen. Ein Verbrechen, das im Ausland verübt wurde, lässt sich nur ausgesprochen schwer vor einem hiesigen Gericht verhandeln. Man könnte es zwar versuchen, aber es würde zu lange dauern, den Fall aufzubauen.« Es folgte eine etwas angespanntere Pause. »Und wir müssen unbedingt schnell vorgehen.«
Warum?, dachte Rhyme.
Faszinierend …
»Ich beabsichtige, die Verantwortlichen wegen anderer, eigenständiger Vergehen zu belangen«, erläuterte Laurel.
»Zum Beispiel wegen der Verabredung zur Verübung einer Straftat«, sprach Rhyme aus, was ihm sofort in den Sinn kam. »Gut, gut. Das gefällt mir. Vorausgesetzt, der Mord wurde hier geplant.«
»Richtig«, sagte Laurel. »Die Tat wurde von einem New Yorker Bürger hier in der Stadt angeordnet. Deshalb fällt sie in meinen Zuständigkeitsbereich.«
Wie alle früheren oder gegenwärtigen Cops kannte Rhyme das Gesetz so gut wie die meisten Anwälte. Er konnte sich noch mühelos, wenn auch nicht wortwörtlich, an den entsprechenden Abschnitt des New Yorker Strafgesetzbuches erinnern: Wenn jemand sich bewusst ist, dass eine bestimmte Handlung ein Verbrechen darstellt, dann ist es bereits eine Straftat, diese Handlung mit einer oder mehreren anderen Personen zu verabreden oder anderweitig herbeizuführen. »Da bei uns im Staat New York ein Mord als Verbrechen gilt, können Sie den Fall hier verhandeln, obwohl die eigentliche Tat außerhalb der Staatsgrenzen begangen wurde«, sagte er.
»Korrekt«, bestätigte Laurel. Gefiel es ihr, dass er den richtigen Schluss gezogen hatte? Schwer zu sagen.
»Der Mord wurde angeordnet? Reden wir hier von der organisierten Kriminalität?«, hakte Sachs nach.
Viele der schlimmsten OK-Bosse wurden für die von ihnen begangenen Erpressungen, Morde und Entführungen nie verhaftet oder gar verurteilt, weil man sie nicht mit den Tatorten in Verbindung bringen konnte. Wenn sie aber doch hinter Gitter wanderten, dann häufig wegen ihrer Rolle bei der Planung und Anordnung der Taten.
»Nein«, sagte Laurel jedoch. »Das hier ist etwas anderes.«
Rhyme kam ein Gedanke. »Werden die Behörden der Bahamas nicht auf der Auslieferung der Verschwörer oder zumindest des Schützen bestehen, sofern es uns gelingen sollte, die Verantwortlichen dingfest zu machen?«
Laurel musterte ihn eine Sekunde lang schweigend. Diese Pausen gingen ihm allmählich auf die Nerven. »Ich werde mich einer Auslieferung widersetzen«, sagte sie schließlich. »Meine Aussicht auf Erfolg dürfte bei mehr als neunzig Prozent liegen.« Für eine Frau Anfang dreißig wirkte Laurel ziemlich jung. Sie hatte was von einem unschuldigen Schulmädchen. Nein, »unschuldig« war das falsche Wort, korrigierte sich Rhyme. Zielstrebig.
Dickköpfigkeit war ein weiteres Klischee, das sie erfüllte.
»Gibt es konkrete Verdächtige?«, fragte Sellitto die beiden Besucher.
»Ja. Die Identität des Schützen kenne ich noch nicht, aber ich weiß, welche beiden Personen den Mord befohlen haben.«
Rhyme lächelte. In ihm regte sich Neugier, verbunden mit dem Gefühl, das ein Wolf verspüren musste, sobald er das erste Duftmolekül eines Beutetiers witterte. Er konnte sehen, dass Nance Laurel ebenso empfand, auch wenn ihr Eifer weitgehend durch die L’Oreal-Fassade verdeckt wurde. Rhyme ahnte, worauf das hinauslief.
Und faszinierend reichte als Beschreibung nicht mal annähernd aus.
»Es hat sich um einen gezielten Anschlag gehandelt«, sagte Laurel. »Und befohlen wurde dieses Attentat, wenn man so will, von einem amerikanischen Regierungsvertreter, nämlich dem Chef des NIOS, des National Intelligence and Operations Service, mit Sitz hier in Manhattan.«
Das war mehr oder weniger das, was Rhyme gefolgert hatte. Allerdings hatte er auf die CIA oder das Pentagon getippt.
»Mein Gott«, flüsterte Sellitto. »Sie wollen einen Bundesbeamten hochnehmen?« Er sah Myers an, der nicht darauf reagierte, dann wieder Laurel. »Ist so was überhaupt möglich?«
Ihre Pause dauerte zwei Atemzüge. »Wie meinen Sie das, Detective?« Sie klang verwirrt.
Sellitto hatte vermutlich genau das gemeint, was er gesagt hatte. »Na ja, ist er denn durch seinen Job nicht vor Strafverfolgung geschützt?«
»Die NIOS-Anwälte werden bestimmt auf Immunität plädieren, aber auf dem Gebiet kenne ich mich aus. Ich habe einen Law-Review-Artikel über die Immunität von Behördenvertretern verfasst. Die Erfolgschance in erster Instanz liegt meines Erachtens bei ungefähr neunzig Prozent und in zweiter bei achtzig. Sollte es danach tatsächlich noch bis vor den Obersten Gerichtshof gehen, haben wir so gut wie gewonnen.«
»Wie sieht denn die Gesetzeslage aus?«, fragte Sachs.
»Da kommt Artikel sechs, Absatz zwei unserer Verfassung ins Spiel«, erklärte Laurel. »Der besagt nämlich im Wesentlichen, dass im Zweifelsfall Bundesgesetze Vorrang vor denen der Einzelstaaten haben. New York kann einen Bundesbediensteten nicht vor Gericht stellen, sofern er im Rahmen seiner Befugnisse gehandelt hat, auch wenn seine Handlungen gegen New Yorker Gesetze verstoßen haben. In unserem Fall aber ist der Leiter des NIOS nach meinem Dafürhalten weit über seine Befugnisse hinausgegangen.«
Laurel sah zu Myers.
»Wir haben diesen Punkt lange erörtert«, erklärte er. »Letztlich gibt es aber genügend handfeste Indizien, die für uns darauf hindeuten, dass dieser Mann die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse, die zu dem Anschlag geführt haben, für seine eigenen Absichten manipuliert hat.«
»Und diese Absichten wären?«, fragte Rhyme.
»Da sind wir uns nicht sicher«, fuhr der Captain fort. »Er scheint davon besessen zu sein, unser Land zu schützen und jeden, der eine Bedrohung darstellt, zu eliminieren – oder sogar Leute, die er einfach nur für unpatriotisch hält. Der Mann, der in Nassau erschossen wurde, war kein Terrorist, sondern hat lediglich …«
»… unverblümt seine Meinung geäußert«, beendete Laurel den Satz.
»Eine Frage«, warf Sachs ein. »Hat der Justizminister sein Einverständnis zu den Ermittlungen gegeben?«
Diesmal benötigte Laurel die Pause eventuell, um nicht gereizt zu reagieren, weil Sachs unvermittelt ihren obersten Dienstherrn und dessen Erlaubnis ins Spiel gebracht hatte. Rhyme war unschlüssig.
Die Staatsanwältin antwortete mit kühler Stimme: »Die Nachricht von dem Mord ist in unserem Büro in Manhattan gelandet, weil der NIOS hier seinen Sitz hat und wir somit zuständig sind. Der Oberstaatsanwalt und ich haben die Angelegenheit besprochen. Ich wollte den Fall haben, weil ich mich mit Immunitätsfragen auskenne und diese Art von Verbrechen mir gewaltig gegen den Strich geht – ich persönlich bin der Ansicht, dass solche Auftragsmorde verfassungswidrig sind, weil sie gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen. Mein Chef hat mich gefragt, ob mir bewusst sei, dass dieser Fall eine potenzielle Tretmine ist. Ich habe die Frage bejaht. Daraufhin hat er mit dem Justizminister in Albany gesprochen und dessen Genehmigung eingeholt. Also ja, ich habe seinen Segen.« Ein ruhiger Blick zu Sachs, die ohne mit der Wimper zu zucken standhielt.
Rhyme wusste, dass sowohl der Oberstaatsanwalt von Manhattan als auch der Justizminister des Staates New York der politischen Partei angehörten, die in Washington derzeit nicht die Regierung stellte. War es fair, diesen Umstand mit einzukalkulieren? Er kam zu dem Schluss, dass Zynismus kein Zynismus mehr war, sobald er von Fakten gestützt wurde.
»Willkommen im Wespennest«, sagte Sellitto, was alle außer Laurel lächeln ließ.
»Das ist der Grund, weshalb ich Sie vorgeschlagen habe, als Nance zu uns gekommen ist, Captain«, sagte Myers zu Rhyme. »Sie und die Detectives Sellitto und Sachs können etwas unabhängiger agieren als die meisten regulären Ermittler, weil Sie mehr Abstand zum Geschehen haben.«
Lincoln Rhyme arbeitete als forensischer Berater für das NYPD, das FBI sowie jede andere Organisation, die bereit war, sein beträchtliches Honorar zu bezahlen, immer vorausgesetzt, der entsprechende Fall stellte eine echte Herausforderung für ihn dar.
»Wie heißt er denn, der Kopf dieser Verschwörung, der Chef des NIOS?«, fragte er nun.
»Sein Name ist Shreve Metzger.«
»Und über den Schützen wissen Sie gar nichts?«, fragte Sachs.
»Nein. Er – oder sie – könnte dem Militär angehören, was ein ziemliches Problem wäre. Mit etwas Glück ist er aber Zivilist.«
»Glück?« Das kam von Sachs.
Rhyme nahm an, Laurel meinte, dass das Rechtssystem des Militärs die Angelegenheit verkomplizieren würde, aber sie sagte: »Die Geschworenen stehen einem Soldaten wohlwollender gegenüber als einem Söldner oder einem Zivilisten aus der Sicherheitsbranche.«
»Sie haben vorhin von zwei Verschwörern außer dem Schützen gesprochen«, sagte Sellitto. »Wen außer Metzger haben Sie im Visier?«
»Ach ja«, sagte Laurel fast schon beiläufig. »Den Präsidenten.«
»Den Präsidenten wovon?«, fragte Sellitto.
Ob dies nun sorgfältiger Überlegung bedurfte oder nicht, Laurel hielt trotzdem inne. »Den der Vereinigten Staaten natürlich. Ich bin mir sicher, dass ein Attentat wie dieses vom Präsidenten autorisiert werden muss. Aber ich ermittle nicht gegen ihn.«
»Herrje, das will ich auch hoffen«, sagte Lon Sellitto mit einem Lachen, das wie ein unterdrücktes Niesen klang. »Das ist nicht nur eine politische Tretmine, das ist ein gottverdammter nuklearer Sprengsatz.«
Laurel runzelte die Stirn, als hätte sie seine Worte aus dem Isländischen übersetzen müssen. »Politik hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun, Detective. Falls der Präsident mit der Anordnung einer gezielten Tötung seine Befugnisse überschritten hat, wäre in seinem Fall ein Amtsenthebungsverfahren vonnöten. Ein solches aber liegt eindeutig nicht in meinem Zuständigkeitsbereich.«
4
Er wurde einen Moment lang abgelenkt, weil ihm der Duft von gegrilltem Fisch in die Nase stieg. Mit Limonen und Kochbananen, glaubte er. Und noch etwas, ein Gewürz. Er konnte es nicht ganz einordnen.
Er schnupperte erneut. Was war das bloß?
Der Mann mit der gedrungenen Statur und dem braunen Bürstenhaarschnitt schlenderte weiter den rissigen Gehweg entlang. Bisweilen schien es mehr ein Trampelpfad zu sein, denn stellenweise fehlten die Betonplatten vollständig. Er fächelte sich mit den Aufschlägen seines dunklen Jacketts ein wenig Luft zu und war froh, dass er bei der Hitze zumindest auf die Krawatte verzichtet hatte. Vor einem von Unkraut überwucherten Grundstück blieb er abermals stehen. Es war später Vormittag. Die Straße mit den einfachen Geschäften und pastellfarbenen Häusern, die dringend einen neuen Anstrich gebraucht hätten, war menschenleer. Nur zwei träge Mischlingshunde rekelten sich im Schatten.
Dann kam sie in Sicht.
Sie verließ einen Tauchladen namens Deep Fun und ging in Richtung West Bay, in der Hand einen Roman von Gabriel Garcia Márquez.
Die junge Frau mit der gebräunten Haut und dem von der Sonne gebleichten blonden Schopf hatte sich einen einzelnen schmalen Perlenzopf geflochten, der von ihrer Schläfe bis zur Brust reichte. Ihre Figur besaß die Form einer schmalen Sanduhr. Sie trug einen gelb-roten Bikini und hatte sich ein halb durchsichtiges, orangefarbenes und knöchellanges Tuch aufreizend um die Taille geschlungen. Sie bewegte sich geschmeidig und kraftvoll und konnte schelmisch lächeln.
So wie jetzt.
»Na, wen haben wir denn da?«, flötete sie und blieb neben ihm stehen.
Dies war eine ruhige Gegend in einiger Entfernung von Nassaus Innenstadt. Eine verschlafene Einkaufsstraße. Die Hunde blickten lethargisch drein, und ihre hängenden Ohren erinnerten irgendwie an umgeknickte Seiten in einem Buch.
»Hallo.« Jacob Swann nahm seine Sonnenbrille ab und wischte sich über das Gesicht. Setzte die Brille wieder auf. Wünschte, er hätte Sonnencreme mitgebracht. Dieser Trip auf die Bahamas war nicht geplant gewesen.
»Hm … vielleicht ist ja mein Telefon kaputt«, merkte Annette spöttisch an.
»Gut möglich«, erwiderte Swann und verzog das Gesicht. »Ich weiß. Ich hab gesagt, ich würde anrufen. Schuldig.«
Doch es handelte sich allenfalls um ein minderes Vergehen; Annette war eine Frau, für deren Gesellschaft er bezahlt hatte, und ihre spröde Bemerkung war daher nicht so ernst zu nehmen, wie es womöglich den Anschein hatte.
Andererseits war das letzte Woche mehr gewesen als ein Treffen zwischen Freier und Callgirl. Sie hatte ihm nur zwei Stunden berechnet, war aber die ganze Nacht geblieben. Natürlich nicht wie in Pretty Woman, aber sie hatten beide viel Spaß gehabt.
Die Stunden waren wie im Flug vergangen, während eine sanfte feuchtwarme Brise zum offenen Fenster hereinwehte und die Stille nur vom rhythmischen Geräusch des Ozeans begleitet wurde. Er hatte gefragt, ob sie bleiben würde, und Annette hatte eingewilligt. Sein Motelzimmer verfügte über eine Kochnische, und Jacob Swann hatte ein spätes Abendessen serviert. Nach seiner Ankunft in Nassau war er einkaufen gegangen und hatte Lebensmittel besorgt, darunter Ziegenfleisch, Zwiebeln, Kokosmilch, Öl, Reis, Chilisoße und einheimische Gewürze. Er hatte fachmännisch das Fleisch vom Knochen gelöst, es in mundgerechte Stücke zerteilt und dann in Buttermilch mariniert. Nach sechs Stunden auf kleiner Flamme war der Schmortopf um dreiundzwanzig Uhr fertig gewesen. Sie hatten gegessen und dazu einen kräftigen roten Rhône-Wein getrunken.
Dann waren sie wieder ins Bett gegangen.
»Wie läuft das Geschäft?«, fragte er nun und wies auf den Laden, um klarzumachen, welches Geschäft er meinte, wenngleich die Teilzeitstelle im Deep Fun ihr manch einen Kunden einbrachte, der wesentlich mehr als nur Tauchstunden buchte.
Annette zuckte die herrlichen Schultern. »Nicht schlecht. Die Wirtschaftskrise macht sich auch hier bemerkbar. Aber die Reichen sind immer noch ganz wild darauf, Korallen und Fische zu erleben.«
Auf dem verwilderten Grundstück lagen alte Autoreifen und Betonbrocken, dazu die verbeulten und rostigen Überreste von längst ausgeschlachteten Haushaltsgeräten. Es wurde von Minute zu Minute heißer. Überall waren greller Sonnenschein und Staub, leere Dosen, wucherndes Gestrüpp, hohes Gras. Dann die Gerüche: gegrillter Fisch, Limonen, Kochbananen und der Rauch aus einer brennenden Mülltonne.
Und dieses Gewürz. Was war das?
»Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich dir erzählt habe, wo ich arbeite.« Ein Nicken in Richtung des Ladens.
»Doch, hast du.« Er rieb sich das Haar. Den runden Schädel voller Schweißperlen. Öffnete wieder die Jacke. Die Luft fühlte sich gut an.
»Ist dir nicht viel zu warm?«
»Ich hatte heute früh einen Termin und musste seriös aussehen. Ich bin nur für einen Tag hier. Hast du zufällig Zeit?«
»Heute Abend?«, schlug Annette vor und klang nicht abgeneigt.
»Ach, da hab ich den nächsten Termin.« Jacob Swanns Gesicht blieb ausdruckslos. Er sah ihr einfach in die Augen. Ohne Bedauern, ohne jungenhaftes Flirten. »Ich hatte auf jetzt gehofft.« Er nahm an, sein Blick wirkte hungrig; so jedenfalls fühlte er sich.
»Was war das für ein Wein?«
»Den es zum Abendessen gab? Châteauneuf-du-Pape. Ich weiß aber nicht mehr, von welchem Weingut.«
»Der war lecker.«
Jacob Swann benutzte dieses Wort zwar nicht allzu häufig – nun ja, eigentlich nie –, aber wo Annette recht hatte, hatte sie recht. Und das Attribut traf auch auf sie selbst zu. Die Verschnürung ihres Bikinihöschens baumelte herab und wartete regelrecht darauf, gelöst zu werden. Ihre Flipflops ließen blau lackierte Nägel erkennen, und sie trug an beiden großen Zehen goldene Ringe, die zu ihren Ohrringen passten. Dazu ein kompliziertes Durcheinander aus goldenen Armreifen.
Auch Annette sah ihn prüfend an und würde sich an seinen nackten Körper erinnern, muskulös, mit schmaler Taille, breiter Brust und kräftigen Armen. Nicht zu vergessen den Waschbrettbauch. Der war hart erarbeitet.
»Ich hatte genau genommen schon was vor, aber …« Sie beendete den Satz nicht, sondern lächelte erneut.
Auf dem Weg zu seinem Wagen nahm sie seinen Arm. Er öffnete ihr die Beifahrertür. Als auch er eingestiegen war, beschrieb sie ihm den Weg zu ihrer Wohnung. Er ließ den Motor an, fuhr aber noch nicht los. »Ach, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich hab dich vielleicht nicht angerufen, aber ich habe ein Geschenk für dich.«
»Nein!« Sie war ganz entzückt. »Was denn?«
Er griff nach hinten und zog ein Etui aus dem Rucksack, den er als Aktenkoffer benutzte und der auf der Rückbank lag. »Du magst doch bestimmt Schmuck, oder?«
»Welches Mädchen nicht?«, fragte Annette.
»Das ist nicht anstelle deiner Bezahlung gedacht, sondern, du weißt schon, zusätzlich.«
»Oh, bitte«, wiegelte sie lächelnd ab. Dann konzentrierte sie sich darauf, das schmale Kästchen zu öffnen. Swann warf einen schnellen Blick auf die Umgebung ringsum. Die Straße war immer noch menschenleer. Er schätzte den Winkel ein, zog die linke Hand zurück – geöffnet, Daumen und Zeigefinger weit auseinander und angespannt – und schlug Annette damit auf spezielle Weise fest auf die Kehle.
Sie keuchte mit großen Augen auf, zuckte abrupt zurück und griff sich an den verletzten Hals.
Aus ihrem Mund drang nur ein leises Röcheln.
Ein solcher Hieb war gar nicht so einfach. Er musste so schwach ausfallen, dass die Luftröhre nicht vollständig zerquetscht wurde – die Frau sollte noch sprechen können –, aber gleichzeitig fest genug, um jeglichen Aufschrei zu unterbinden.
Ihre Augen starrten ihn an. Womöglich versuchte sie, seinen Namen zu sagen – zumindest den Decknamen, den er ihr letzte Woche genannt hatte. Swann besaß drei amerikanische und zwei kanadische Reisepässe, dazu Kreditkarten für jede der fünf Identitäten. Offen gesagt, er konnte sich nicht mehr entsinnen, wann er einer flüchtigen Bekanntschaft gegenüber das letzte Mal als »Jacob Swann« aufgetreten war.
Er erwiderte Annettes Blick in aller Seelenruhe und holte dann das Textilklebeband aus dem Rucksack.
Bevor Swann ein Stück davon abriss, streifte er fleischfarbene Latexhandschuhe über. Er hielt inne. Das war es. Das Gewürz, das der unbekannte Koch zu dem Fisch gegeben hatte.
Koriander.
Wieso hatte ihm das bloß solche Schwierigkeiten bereitet?
5
»Das Opfer war Robert Moreno«, teilte Laurel ihnen mit. »Achtunddreißig Jahre alt.«
»Moreno – der Name kommt mir bekannt vor«, sagte Sachs.
»Der Mann war des Öfteren in den Schlagzeilen, Detective«, erklärte Captain Bill Myers.
»Meinen Sie etwa diesen antiamerikanischen Amerikaner?«, fragte Sellitto. »So wurde er mal von irgendeiner Zeitung genannt, glaube ich.«
»Richtig«, bestätigte der Captain. »Ein echter Mistkerl.« Das schien von Herzen zu kommen.
Rhyme registrierte, dass Laurel diese Bemerkung offenbar nicht gefiel. Sie wirkte außerdem ungeduldig, als hätte sie keine Zeit für derartige Kindereien. Er erinnerte sich, dass sie schnell handeln wollte – und der Grund dafür war ihm nun klar: Sobald der NIOS erst einmal von den Ermittlungen Wind bekam, würde man dort sofort Schritte einleiten, um den Fall im Keim zu ersticken – juristische und eventuell auch andere.
Tja, auch Rhyme neigte zur Ungeduld. Der Fall schien ganz nach seinem Geschmack zu sein.
Laurel zog das Foto eines gut aussehenden Mannes mit weißem Hemd hervor, der an einem Mikrofon saß. Er hatte ein rundliches Gesicht und schütteres Haar. »Das Bild wurde vor Kurzem in einem Rundfunkstudio in Caracas aufgenommen«, sagte sie. »Er war zwar weiterhin amerikanischer Staatsbürger, wohnte aber in Venezuela. Am neunten Mai hielt er sich geschäftlich auf den Bahamas auf und wurde in seinem Hotelzimmer von einem Scharfschützen ermordet. Außer ihm gab es noch zwei weitere Todesopfer – Morenos Leibwächter und ein Reporter, der gerade dabei war, ihn zu interviewen. Der Bodyguard war Brasilianer und lebte in Venezuela. Der Journalist war Puerto Ricaner und lebte in Argentinien.«
»In den Medien wurde nicht viel Aufhebens davon gemacht«, stellte Rhyme fest. »Wenn man die Regierung gewissermaßen mit dem Finger am Abzug erwischt hätte, wäre der Teufel los gewesen. Wer steckt denn angeblich hinter dem Anschlag?«
»Drogenkartelle«, antwortete Laurel. »Moreno war der Gründer einer Organisation namens Bündnis für Lokale Selbstbestimmung, die sich an die Ureinwohner und die armen Bevölkerungsschichten Lateinamerikas wendet. Er hat sich kritisch über den Drogenhandel geäußert. Das ist in Bogotá und einigen mittelamerikanischen Ländern nicht gut angekommen. Aber ich konnte keine belastbaren Indizien dafür finden, dass ein bestimmtes Kartell seinen Tod wollte. Meiner festen Überzeugung nach haben Metzger und der NIOS diese Geschichten über die Kartelle in die Welt gesetzt, um von sich selbst abzulenken. Darüber hinaus gibt es etwas, das ich noch nicht erwähnt habe. Ich weiß mit Sicherheit, dass der Mord von einem NIOS-Schützen verübt wurde. Dafür gibt es Beweise.«
»Beweise?«, fragte Sellitto.
Laurels Körpersprache, wenngleich nicht ihre Mimik, verriet, dass sie darauf brannte, ihnen die Einzelheiten mitzuteilen. »Wir haben einen Whistleblower – aus dem Innern oder dem direkten Umfeld des NIOS. Er hat das Dokument präsentiert, mit dem der Mord an Moreno angeordnet wurde.«
»Über WikiLeaks?«, fragte Sellitto. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein, das kann nicht sein.«
»Stimmt«, pflichtete Rhyme ihm bei. »Dann wäre die Sache überall in den Nachrichten gewesen. Nein, die Information wurde der Staatsanwaltschaft direkt zugespielt. In aller Stille.«
»Das ist richtig«, sagte Myers. »Der Whistleblower hat sich sehr bedeckt gehalten.«
»Erzählen Sie uns mehr über Moreno«, forderte Rhyme die Staatsanwältin auf.
Sie hatte die Einzelheiten auswendig parat. Er und seine Eltern stammten ursprünglich aus New Jersey. Als Moreno zwölf Jahre alt war, zog die Familie nach Mittelamerika, wo der Vater als Geologe für eine US-Ölfirma arbeitete. Anfangs ging Moreno dort unten auf amerikanische Schulen, wechselte nach dem Selbstmord seiner Mutter aber in eine einheimische Klasse und kam damit gut zurecht.
»Selbstmord?«, fragte Sachs.
»Sie hatte offenbar Schwierigkeiten mit der ungewohnten Umgebung … und ihr Mann war ständig unterwegs, musste von einer Bohr- oder Explorationsstätte zur nächsten reisen. Sie hat ihn nur selten zu Gesicht bekommen.«
Laurel fuhr mit ihrem Porträt des Opfers fort: Moreno hatte schon in jungen Jahren eine tiefe Abneigung gegen den Umstand entwickelt, dass die einheimische Bevölkerung Mittel- und Südamerikas zum Vorteil nordamerikanischer Konzerne und Regierungsinteressen ausgebeutet wurde. Nach seinem Studium in Mexico City wurde er Radiomoderator und Aktivist, der in seinen Sendungen scharfe Kritik an Amerika und dessen – wie er das nannte – Imperialismus des einundzwanzigsten Jahrhunderts übte.
»Er ließ sich in Caracas nieder und gründete das Bündnis für Lokale Selbstbestimmung, um den einfachen Arbeitern eine Alternative zu bieten, damit sie Selbstvertrauen fassten und nicht bei den amerikanischen und europäischen Firmen um eine Anstellung betteln oder gar US-Entwicklungshilfe in Anspruch nehmen mussten. Mittlerweile gibt es in Süd- und Mittelamerika sowie in der Karibik ein halbes Dutzend Zweigstellen.«
Rhyme war verwirrt. »Das klingt mir kaum nach dem Lebenslauf eines Terroristen.«
»Stimmt«, sagte Laurel. »Aber Sie sollten wissen, dass Moreno sich wohlwollend über mehrere Terrororganisationen geäußert hat: al-Qaida, al-Shabaab, die Islamische Partei Ostturkestans im chinesischen Xinjiang. Und er hatte sich mit diversen Extremistengruppen in Lateinamerika arrangiert: mit der kolumbianischen ELN – der Nationalen Befreiungsarmee – und FARC ebenso wie mit den AUC – den Vereinigten Bürgerwehren Kolumbiens. Auch der Sendero Luminoso in Peru fand seine ausdrückliche Zustimmung.«
»Der Leuchtende Pfad?«, fragte Sachs.
»Ja.«
Der Feind meines Feindes ist mein Freund, dachte Rhyme. Sogar wenn er Kinder in die Luft sprengt. »Dennoch«, sagte er. »Eine gezielte Tötung? Dafür?«
»Morenos Blogs und Radiosendungen sind in letzter Zeit immer antiamerikanischer geraten«, erklärte Laurel. »Er nannte sich selbst den ›Botschafter der Wahrheit‹. Und manche seiner Äußerungen waren wirklich bösartig. Er hat dieses Land zutiefst gehasst. Es gab Gerüchte, er hätte andere Leute dazu veranlasst, amerikanische Touristen und Soldaten zu erschießen oder Bombenanschläge auf US-Botschaften oder -Firmen in Übersee zu verüben. Ich bin allerdings auf keinen einzigen Fall gestoßen, bei dem er ein konkretes Attentat auch nur gutgeheißen, geschweige denn angeordnet hätte. Jemanden zu inspirieren ist etwas anderes, als ein Komplott zu schmieden.«
Obwohl Rhyme sie erst seit einigen Minuten kannte, ging er davon aus, dass Miss Nance Laurel in diesem Punkt sehr, sehr gründlich nachgeforscht hatte.
»Der NIOS behauptet jedoch, es hätten nachrichtendienstliche Erkenntnisse für einen von Moreno geplanten Sprengstoffanschlag vorgelegen, der sich gegen die Zentrale einer Ölfirma in Miami richten sollte. Man hatte ein auf Spanisch geführtes Telefonat abgehört und eine der Stimmen als die von Moreno identifiziert.«
Sie wühlte in ihrer verschrammten Aktentasche, zog ein Dokument heraus und las vor. »Zuerst spricht Moreno. Er sagt: ›Ich will mir American Petroleum Drilling and Refining in Florida vornehmen. Am Mittwoch.‹ Darauf der unbekannte Gesprächspartner: ›Am Zehnten? Am zehnten Mai?‹ Moreno: ›Ja, und zwar mittags, wenn die Angestellten zur Pause gehen.‹ Der andere: ›Ist die Transportfrage geklärt?‹ Moreno: ›Ja, wir nehmen Lastwagen.‹ Der nächste Teil des Gesprächs war nicht zu verstehen. Dann wieder Moreno: ›Und das ist erst der Anfang. Ich habe noch viele Botschaften wie diese geplant.‹«
Sie steckte die Abschrift zurück in die Aktentasche. »Diese Firma – APDR – ist in beziehungsweise bei Florida an zwei Standorten vertreten: In Miami steht ihre Zentrale für den Südosten der USA, und vor der Küste liegt eine ihrer Bohrinseln. Da Moreno von Lastwagen gesprochen hatte, schied die Bohrinsel aus. Nach Ansicht des NIOS musste das Gebäude an der Brickell Avenue das Ziel sein.
Zur gleichen Zeit stellten die Analysten bei der Datenauswertung fest, dass mehrere Firmen, die mit Moreno in Verbindung gebracht wurden, im Laufe des letzten Monats Diesel, Dünger und Nitromethan auf die Bahamas verschifft hatten.«
Drei verbreitete Komponenten für selbst gebaute Bomben. Das Regierungsgebäude in Oklahoma City war von einem solchen Sprengsatz ausradiert worden. Und auch damals hatte ein Lastwagen als Transportmittel gedient.
»Metzger hat ganz offensichtlich geglaubt, dass Morenos Untergebene den Plan nicht ausführen würden, falls ihr Boss ums Leben käme, bevor die Bombe in die Vereinigten Staaten geschmuggelt werden könnte«, fuhr Laurel fort. »Am Tag vor dem Zwischenfall in Miami wurde er dann erschossen. Am neunten Mai.«
Bis hierhin klang es so, als hätte Metzger mit dieser Entscheidung eine Menge Leben gerettet, ob man seine Maßnahmen nun guthieß oder nicht.
Rhyme wollte darauf zu sprechen kommen, doch Laurel war schneller. Sie sagte: »Moreno hat aber gar nicht von einem Anschlag geredet. Es war eine friedliche Protestaktion. Am zehnten Mai tauchte mittags ein halbes Dutzend Lastwagen vor der APDR-Zentrale auf. Auf ihren Ladeflächen waren keine Bomben, sondern die Demonstranten. Und die vermeintlichen Bestandteile der Sprengsätze? Die waren für die Zweigstelle von Morenos Bündnis für Lokale Selbstbestimmung auf den Bahamas gedacht. Der Diesel für ein Transportunternehmen, der Dünger für landwirtschaftliche Genossenschaften und das Nitromethan zur Herstellung von Bodenbegasungsmitteln. Alles ganz legal. Der Befehl zu Morenos Ermordung listet nur diese drei Materialien auf und nicht, dass die Lieferung außerdem tonnenweise Saatgut umfasst hat, dazu Reis, Lkw-Ersatzteile, Trinkwasser in Flaschen und weitere harmlose Güter. Die hat der NIOS wohl irgendwie vergessen zu erwähnen. Wie günstig.«
»Könnte es sich um ein Versehen handeln?«, fragte Rhyme.
Die folgende Pause war länger als die meisten anderen. Schließlich sagte Laurel: »Nein, ich halte das für eine bewusste Manipulation. Metzger konnte Moreno und dessen Hetzreden nicht ausstehen. Er hat ihn nachweislich als abscheulichen Verräter bezeichnet. Ich glaube, er hat nur einen Teil der ihm bekannten Informationen an seine Vorgesetzten weitergeleitet. In Washington ging man daraufhin von einem drohenden Bombenanschlag aus und erteilte Metzger die Freigabe für seine Mission, während er es die ganze Zeit besser wusste.«
»Der NIOS hat also einen Unschuldigen getötet«, stellte Sellitto fest.
»Ja«, sagte Laurel etwas lebhafter. »Aber das ist gut.«
»Wie bitte?«, hakte Sachs mit finsterer Miene nach.
Einen Moment lang herrschte Stille. Laurel konnte mit Sachs’ offensichtlicher Bestürzung eindeutig nichts anfangen, genau wie zuvor, als Laurel gesagt hatte, mit etwas »Glück« sei der Schütze ein Zivilist, kein Soldat.
»Es geht wieder um die Geschworenen, Sachs«, erklärte Rhyme. »Die Aussicht auf einen Schuldspruch ist größer, wenn das Opfer kein hartgesottener Terrorist war, sondern ein Aktivist, der lediglich sein verfassungsmäßiges Recht auf Redefreiheit wahrgenommen hat.«
»Nach meinem moralischen Empfinden besteht zwischen den beiden kein Unterschied«, fügte Laurel hinzu. »Ohne ordentliches Gerichtsverfahren darf niemand hingerichtet werden. Niemand. Aber Lincoln hat recht, ich muss die Geschworenen berücksichtigen.«
»So, Captain«, wandte Myers sich an Rhyme. »Wenn der Fall in Gang kommen soll, brauchen wir jemanden wie Sie, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht.«
Was im Hinblick auf das hauptsächliche Fortbewegungsmittel des Kriminalisten eine eher unglückliche Metapher war.
Rhyme hätte am liebsten sofort zugesagt. Der Fall war auf vielerlei Weise faszinierend und herausfordernd. Doch ihm fiel auf, dass Sachs mit gesenktem Blick dasaß und sich am Kopf kratzte. Das war eine ihrer Angewohnheiten. Er fragte sich, was sie beunruhigte.
»Bei al-Awlaki sind Sie nicht gegen die CIA vorgegangen«, sagte sie zu der Staatsanwältin.
Anwar al-Awlaki, ein amerikanischer Staatsbürger, war radikaler moslemischer Imam und Befürworter des Dschihad, darüber hinaus hochrangiges Mitglied von al-Qaida im Jemen. Genau wie Moreno lebte er im Ausland, wurde als »Bin Laden des Internets« bezeichnet und rief in seinem Blog vehement zu Angriffen auf Amerikaner auf. Von ihm inspiriert fühlten sich unter anderem der Schütze von Fort Hood und der Unterhosen-Bomber, beide im Jahre 2009, sowie der Times-Square-Bomber im Jahre 2010.
Al-Awlaki und ein weiterer US-Bürger, sein Onlineredakteur, wurden durch einen Drohnenangriff unter Federführung der CIA getötet.
Laurel wirkte verwirrt. »Wie hätte ich daraus einen Fall konstruieren sollen? Ich bin Staatsanwältin in New York. Bei al-Awlakis Ermordung gab es keine Verbindung hierher. Doch falls Sie mich fragen, ob ich mir die Fälle aussuche, die ich glaube, gewinnen zu können, Detective Sachs, dann lautet die Antwort Ja. Eine Anklage gegen Metzger wegen der Tötung eines bekannten und gefährlichen Terroristen wäre wahrscheinlich aussichtslos. Das Gleiche würde gelten, falls der Anschlag sich gegen einen ausländischen Staatsbürger gerichtet hätte. Aber Morenos Erschießung kann ich den Geschworenen verkaufen. Und sobald ich einen Schuldspruch gegen Metzger und seinen Heckenschützen erwirkt habe, wird es mir möglich sein, einen Blick auf andere, weniger eindeutige Fälle zu werfen.« Sie hielt inne. »Womöglich überdenkt die Regierung auch einfach ihr Vorgehen und hält sich zukünftig an die Verfassung … ohne weitere Morde in Auftrag zu geben.«
Sachs warf Rhyme einen kurzen Blick zu und wandte sich dann an Laurel und Myers. »Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas fühlt sich hier komisch an.«
»Komisch?«, fragte Laurel, offenbar verblüfft wegen der Wortwahl.
Sachs rieb zwei Finger fest aneinander. »Ich weiß nicht«, sagte sie, »ich bin unschlüssig, ob das eine Aufgabe für uns ist.«
»Für Sie und Lincoln?«, hakte Laurel nach.
»Für uns alle. Es ist ein politischer Sachverhalt, kein strafrechtlicher. Sie wollen den NIOS davon abhalten, Menschen zu töten, das ist ja alles gut und schön. Aber sollte das nicht durch den Kongress geregelt werden anstatt durch die Polizei?«
Laurel schaute verstohlen zu Rhyme. Sachs’ Einwand war nicht von der Hand zu weisen – und Rhyme selbst hatte keinen Gedanken in dieser Richtung verschwendet. Wenn es um die Aufklärung eines Verbrechens ging, kümmerte er sich zumeist nicht um Fragen der Zuständigkeit. Ihm reichte es, dass Albany oder Washington oder der Stadtrat einen entsprechenden Gesetzesverstoß als gegeben ansahen. Seine Aufgabe lautete dann ganz einfach: den Täter überführen und ausreichende Beweise gegen ihn zusammentragen.
Genau wie beim Schach. War es von Bedeutung, dass die Erfinder dieses komplexen Brettspiels ausgerechnet die Dame zur stärksten Figur gemacht und den Springer zu rechtwinkligen Zügen gezwungen hatten? Nein. Aber sobald diese Regeln erst einmal eingeführt waren, hielt man sich daran.
Er ignorierte Laurel und sah weiter Sachs an.
Dann änderte sich die Körperhaltung der Staatsanwältin, nur ganz leicht, aber unverkennbar. Im ersten Moment glaubte Rhyme, sie wolle sich rechtfertigen, aber dann musste er seinen Eindruck revidieren. Sie schaltete in den Plädoyermodus um. Als wäre sie soeben von ihrem Tisch im Gerichtssaal aufgestanden und vor die Geschworenen getreten – die noch nicht von der Schuld des Angeklagten überzeugt waren.
»Amelia, ich glaube, das Rechtssystem manifestiert sich in den Kleinigkeiten«, fing Laurel an. »In den Einzelfällen. Ich stelle einen Vergewaltiger nicht deswegen vor Gericht, weil es eine Schwächung des gesellschaftlichen Gefüges bedeutet, wenn Frauen sexuelle Gewalt angetan wird. Ich klage ihn an, weil er gegen das New Yorker Strafgesetzbuch, Paragraf hundertdreißig, Abschnitt fünfunddreißig verstoßen hat. Das ist meine Aufgabe; das ist es, was wir alle hier tun.«
Nach einer Pause fügte sie hinzu: »Bitte, Amelia. Ich kenne Ihre Erfolgsbilanz. Ich hätte Sie gern mit an Bord.«
Ehrgeiz oder Ideologie?, dachte Rhyme und musterte die gedrungene Nance Laurel mit ihrem steifen Haar, den runden Fingerkuppen mit den unlackierten Nägeln, den kleinen Füßen in den schmucklosen Pumps, auf die das Pflegemittel ebenso sorgfältig aufgetragen worden war wie das Make-up auf ihr Gesicht. Er konnte wirklich nicht sagen, was von beidem ihre Triebfeder darstellte, aber eines fiel ihm auf: Der absolut leidenschaftslose Blick ihrer schwarzen Augen ließ ihn tatsächlich frösteln. Und es gehörte schon einiges dazu, Lincoln Rhyme eine Gänsehaut zu verpassen.
Es herrschte kurz Stille. Sachs und Rhyme sahen einander an. Sie schien zu spüren, wie gern er diesen Fall übernehmen wollte. Und das gab für sie den Ausschlag. Ein Nicken. »Ich bin dabei«, sagte sie.
»Ich ebenfalls.« Rhyme schaute jedoch nicht zu Myers oder Laurel, sondern weiterhin zu Sachs. Seine Miene sagte Danke.
»Und obwohl mich niemand gefragt hat«, brummte Sellitto, »bin auch ich gern bereit, mir die Karriere zu versauen, indem ich mich mit einem hohen Bundesbeamten anlege.«
»Ich nehme an, wir müssen äußerst diskret vorgehen«, sagte Rhyme.
»Unbedingt«, bestätigte Laurel. »Andernfalls werden nach und nach alle Beweise verschwinden. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir uns deswegen noch keine Sorgen zu machen. Wir haben bei uns in der Dienststelle alles getan, um den Fall unter der Decke zu halten. Ich bezweifle wirklich, dass der NIOS etwas von den Ermittlungen weiß.«
6
Während er mit dem Mietwagen zu einer kleinen Halbinsel an der Südwestküste von New Providence Island fuhr, unweit des riesigen Clifton Heritage Parks, hörte Jacob Swann, dass sein Telefon summend den Empfang einer SMS meldete. Es ging darin um die in New York eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des Todes von Robert Moreno und des Vorwurfs der kriminellen Verschwörung. Swann würde im Laufe der nächsten Stunden einen ausführlichen Bericht erhalten, einschließlich der Namen aller Beteiligten.
Das ging ja schnell. Viel schneller als erwartet.
Von hinten aus dem Kofferraum ertönte ein dumpfer Schlag. Dort lag zusammengekrümmt Annette Bodel, die unglückselige Nutte. Doch es war ein leiser Schlag, und es war niemand sonst hier, der ihn hätte hören können, keine Straßenkehrer oder Faulenzer, wie man sie auf den Bahamas oft in Gruppen beieinanderstehen sah, in der Hand ein einheimisches Bier, scherzend, plaudernd und lauthals über ihre Frauen und Vorgesetzten klagend.
Auch war weit und breit kein Fahrzeug zu sehen, weder auf der Straße noch auf dem türkisfarbenen Wasser.
Die Karibik war ja so dermaßen widersprüchlich, stellte Swann wieder einmal fest: ein schillernder Spielplatz für die Touristen, eine heruntergekommene Bühne für das Leben der Einheimischen. Alles konzentrierte sich auf den Punkt, an dem die beiden Welten sich berührten, an dem Dollars und Euros auf Dienstleistungen und Vergnügungen trafen. Der überwiegende Rest des Landes war eigentlich ziemlich banal. Wie zum Beispiel dieses heiße, von Unkraut und Müll bedeckte Fleckchen sandiger Erde in der Nähe des Strandes.
Er stieg aus und pustete sich in die Handschuhe, um die verschwitzten Hände zu kühlen. Verflucht, war das heiß hier. Letzte Woche war er schon mal an dieser Stelle gewesen. Nachdem ein überaus schwieriger, aber treffsicherer Gewehrschuss das Herz des verräterischen Mr. Robert Moreno zerfetzt hatte. Swann war hergefahren und hatte einige Kleidungsstücke und anderes Beweismaterial vergraben, und da hätte das Zeug ursprünglich auch bleiben sollen. Doch als er die seltsame und beunruhigende Nachricht erhielt, dass die New Yorker Staatsanwaltschaft Morenos Tod untersuchte, hatte er beschlossen, die Sachen wieder auszubuddeln und wirksamer zu entsorgen.
Zunächst aber musste er noch etwas anderes regeln: einen weiteren Auftrag erledigen.
Swann ging zum Kofferraum, öffnete ihn und blickte hinunter auf die in Tränen aufgelöste, schweißnasse Annette. Sie hatte immer noch Schmerzen.
Rang nach Luft.
Swann ging zur Rückbank, öffnete seinen Koffer und nahm einen seiner Schätze heraus, sein Lieblingskochmesser, ein Kai Shun Premier. Die Klinge war ungefähr zweiundzwanzig Zentimeter lang und besaß die für diesen Hersteller typische Hammerschlagoberfläche, von Hand gefertigt in der japanischen Stadt Seki. Ihr Kern bestand aus VG-10-Stahl, ummantelt von zweiunddreißig Lagen Damaszenerstahl. Der Griff war aus Walnussholz. Dieses Messer kostete zweihundertfünfzig Dollar. Swann nannte noch mehrere andere Modelle aus dieser Reihe sein Eigen, in unterschiedlichen Formen und Größen, je nach Einsatzzweck in der Küche, aber das hier war sein Favorit. Er liebte es wie ein Kind und benutzte es, um Fisch zu filetieren, um hauchdünne Scheiben Rindfleisch für ein Carpaccio abzuschneiden und um andere Leute zu motivieren.
Auf Reisen führte Swann dieses und andere Messer in einer abgenutzten Messerrolle mit sich, außerdem zwei zerfledderte Kochbücher – eines von James Beard, das andere von dem französischen Meisterkoch Michel Guérard, dem Erfinder der Cuisine minceur. Ein Satz professioneller Kochmesser, wie tödlich diese auch sein mochten, verpackt im ordnungsgemäß aufgegebenen Koffer zusammen mit einem Kochbuch erregte beim Zoll kaum Aufsehen. Zudem waren die Messer bei einem Job fern der Heimat wirklich nützlich; Jacob Swann kochte oft selbst, anstatt allein in eine Bar oder ins Kino zu gehen.