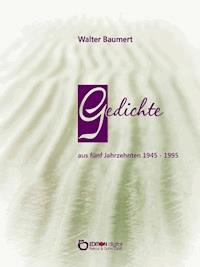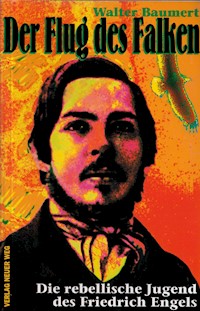Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Nehmt eine Wegstrecke, die ihr mit gutem Schuhwerk zwischen Frühstück und Mittagessen durchwandern könnt, also etwa fünf deutsche Landmeilen, einmal in der Länge und einmal in der Breite, setzt eine verschlafene Kleinstadt hinein mit knapp fünftausend evangelisch getauften Seelen, mit einem richtigen Schloss, einer Post, mehreren Kirchen, zwei Schulen und einer Handvoll prächtig herausgeputzter Soldaten - dann habt ihr das Fürstentum Lippe-Detmold, mein Vaterland. Mit diesen Worten beginnt die Erzählung über Kindheit und Jugend des Dichters Georg Weerth, von Walter Baumert so berichtet, als hätte sie der Dichter selbst geschrieben: ironisch, spritzig und engagiert. So ist ein Buch entstanden, das Weerths Dichtung wie auch ein Stückchen Vormärz-Zeit neu entdeckt. INHALT: Erinnerungen Wie meine Berufung für das Amt eines Geistlichen frühzeitig entdeckt und gefördert wurde Ich sehe den Dichter Grabbe und verliere meinen Lehrer Ich entdecke das „Buch der Lieder“ von Heinrich Heine und lese die ersten Gedichte von Ferdinand Freiligrath Schreckliche Erlebnisse in meiner Vaterstadt und Flucht in die Fremde Ich bin ein fröhlicher Kaufmannslehrling in Elberfeld, werde von einer bezaubernden Dame geküsst und erhalte eine schlimme Nachricht aus Detmold Verzweiflung, Einsamkeit, Beethoven und ein neuer Freund Wie ich im Literaturzirkel Freiligraths aufgenommen werde und schreckliche Qualen vor einem Bündel Büttenpapier erleide Ich lasse mich in der großen Freudenstadt Köln nieder und werde zum Dichterkönig aller Narren gekürt Die mütterliche Wachsamkeit greift in mein lustiges Leben ein, und ich erringe wider Willen die Gunst meines reichen Onkels zu Bonn Mein Onkel Friedrich und die große Politik. „Maikäfer“ - Romantik und wissenschaftliche Bildung Ich erhalte eine Einladung von Friedrich Engels und werde Zeuge von Triumph und Verdammnis des Freiheitsdichters Georg Herweghs Ein Winter voll Zweifel und Leid und ein Frühling voll Liebe und Glück Auf welche Art ich mir die Zuneigung meines Onkels verscherzte und einer gesicherten bürgerlichen Existenz in der Philisterstadt Bonn entrann Die Wunderstadt London und ein grauenhaftes Erlebnis bei meinem Abschiedsbesuch in Lippe-Detmold Ich verliebe mich in ein Porträt, lande in Bradford, der schrecklichsten Stadt Englands, und gerate in die Fangnetze eines lüsternen Backfisches
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Walter Baumert
Und wen der Teufel nicht peinigt ...
Die Jugend des Dichters Georg Weerth
ISBN 978-3-86394-540-4 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1975 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
Die reichlich verwandten Zitate aus Georg Weerths Lyrik, aus seinen Prosaarbeiten und seinen Briefen sind den von Bruno Kaiser 1956/57 im Aufbau-Verlag Berlin erstmals herausgegebenen Sämtlichen Werken Georg Weerths in fünf Bänden entnommen.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected]
Erinnerungen
Muss ich einst sterben - sei’s als Mann, als Greis, Nach einem Leben voller Not und Plage - Auf dann, mein Geist, erinnre du dich leis An deiner schönen Jugend schönste Tage!
Dass ich den Flor der Gärten wiederschau, Wo ich als Kind mit goldnen Blumen spielte, Wo meine Diamanten all der Tau, Wenn frisch der Wind in all den Kelchen wühlte.
Dass ich dran denke, wie zur Winterzeit Bei eines Feuers knisterndem Verglimmen Ich einst mit Bertha und mit Adelheid Gelauscht der Amme schauerlicher Stimmen.
Wie uns Sigunens Leid so still gemacht, Wie uns der Heinzelmänner Spaß erheitert, Wie bei den Märchen Tausendeiner Nacht fantastisch die Gemüter sich erweitert.
Wie ich im Traum manch Königskind befreit Und manchen fürchterlichen Drach erschlagen, Wie ich als Knabe drauf zur Weihnachtszeit Zuerst mein Nüremberger Ei getragen.
Wie ich als ehrlicher Quartaner dann, Ach, auf der Schule glatt gerittnen Bänken Gewünscht: Der Herr Magister lobesam, Er möcht am nächsten Balken sich erhenken.
Wie ich zuerst den Ranzen mir geschnallt, Der Ferienreise Wunder zu erfahren, Und an die Weser und den Rhein gewallt Mit offner Brust, mit langen Burschenhaaren.
Und wie in der Genossen froher Mitt Das Feuer dann geflammt auf offner Halde, Wie ich den Namen in die Eichen schnitt Vom Spessart bis zum Teutoburger Walde.
Wie ich des Faublas Aventüren las, Der Brust geheimstes Wünschen zu erwidern, Wie ich mein Griechisch und Latein vergaß Bei Heinrich Heines und bei Uhlands Liedern.
Wie drauf ein Sehnen meine Brust erfasst, Als ob es nimmermehr zu lindern wäre: Hätt ich der Sterne letzten auch durchrast, Als Taucher auch durchfurcht die tiefsten Meere.
Wie mir die Kraft durchtobt der Seele Bronn, Als könnt, Titanen gleich, das All ich stürmen, Den alten Ossa auf den Pelion, Den Chimborasso auf die Alpen türmen -
Bis mich dein Wort, du großer Feuerbach, Gerungen dann aus meinen letzten Zweifeln, Bis ich des Wissens schönste Blüte brach, Befreit, erlöst von Göttern und von Teufeln.
Bis endlich mir erstrahlt ein höher Glück Als Ruhmes Brausen, als des Goldes Scheinen: Da mich, o Lieb, dein seelenvoller Blick Gemacht auf ewig zu dem einen, deinen!
Drum, wenn ich sterbe - sei’s als Mann, als Greis, Nach einem Leben voller Not und Plage - Auf dann, mein Geist, erinnre du dich leis An deiner schönen Jugend schönste Tage!
Noch einmal wirst du deine Erde sehn, Der jedes Leid und jede Lust ersprossen, Und fröhlich wirst du dann zugrunde gehn In der Erinnrung, was du einst genossen.
Wie meine Berufung für das Amt eines Geistlichen frühzeitig entdeckt und gefördert wurde
Nehmt eine Wegstrecke, die ihr mit gutem Schuhwerk zwischen Frühstück und Mittagessen durchwandern könnt, also etwa fünf deutsche Landmeilen, einmal in der Länge und einmal in der Breite, setzt eine verschlafene Kleinstadt hinein mit knapp fünftausend evangelisch getauften Seelen, aber eine Residenzstadt mit einem richtigen Schloss, in dem ein richtiger Fürst mit richtigen Ministern regiert, einer Post, mehreren Kirchen, zwei Schulen und einer eigenen Armee, die aus zwei bis drei Kanonen und einer Handvoll prächtig herausgeputzter Soldaten besteht - dann habt ihr das Fürstentum Lippe-Detmold, mein Vaterland. Es ist so klein, dass unser erlauchtigster Landesherr, Seine Hoheit Fürst Paul Alexander Leopold I., von der Spitze seines Schlossturmes aus jede Maus ausmachen kann, die versucht, in sein Hoheitsgebiet einzudringen.
Aber mir schien dieses Ländchen unendlich groß, ja mindestens die Hälfte von der Welt zu sein, abgesehen vom Mond und den Sternen, wo der liebe Gott mit seinen Engeln wohnte. Denn ich war ein kleiner Junge und wusste von der Welt noch nicht mehr als ein Karpfen, der in einem trüben Dorfteich schwimmt.
Dabei besaß ich drei große Geschwister und einen lustigen dicken Vater, mit dem man die herrlichsten Sandburgen bauen und Räuber und Gendarm spielen konnte und auf dessen Schultern es sich reiten ließ wie auf einem richtigen feurigen Pferd. Dieser prächtige Spielgefährte, der mit sich und der Welt zufrieden in den Tag hineinlebte und seinen selbst gemachten Apfelwein höher schätzte als alle sonstigen geistigen Genüsse und Erbaulichkeiten des Erdballes, war nach Seiner Hoheit, unserem Fürsten, und Seiner Exzellenz, dem Staatsrat, der wichtigste Mann im ganzen Land. Er trug den Titel „Generalsuperintendent“, war höchster Pfarrherr im Land, sozusagen geistliches Staatsoberhaupt, und zugleich eine Art Kultusminister, da ihm neben der Sorge um das Seelenheil der fürstlichen Untertanen auch das Schulwesen von Lippe-Detmold unterstand.
Was Wunder, dass ich eine wichtige Stellung unter meinen Altersgenossen einnahm und dass alle Erwachsenen in der Stadt, Männlein wie Weiblein, ausgesprochen nett zu mir waren, mich stets entzückend fanden und mich reichlich mit allem versorgten, was der Mensch braucht, um glücklich zu sein, mit rotbackigen Äpfeln und saftigen Birnen, mit Knabberbrezeln und Naschwerk, mit lustigen Späßen und wundersamen Märchen, in denen lauter edelmütige Prinzen lauter wunderschöne, aber verzauberte Prinzessinnen befreiten und riesige Feuer speiende Drachen besiegten.
Und ich fand es höchst überflüssig und lästig, dass ein Mensch in meiner Lage auch noch lesen, schreiben und rechnen lernen musste. Denn diese Tätigkeit fraß eine Unmenge Zeit, die man viel besser auf der Straße mit ihren herrlichen Regenpfützen, auf den Kirschbäumen in Nachbars Garten oder in richtigen Schlammschlachten am Lippe-Ufer mit den Kindern der Umgebung zubringen konnte.
Aber in diesem Punkt vertrat meine liebe Mutter eine schrecklich eigensinnige Ansicht. Sie selbst leitete den Prozess meiner ersten Schritte auf dem Weg der Welterkenntnis ein. Und sie ließ sich durch keines meiner Argumente davon abbringen, dass ich erst meine Fibel studierte und mein Pensum an Buchstaben und Zahlenkringeln fein säuberlich heruntermalte, ehe ich mich den wichtigeren Beschäftigungen zuwenden durfte.
Ja, meine teure Mutter! Ich liebte sie trotz unserer Meinungsverschiedenheiten in Bildungsfragen über alles. Sie hatte eine so unwiderstehliche Art, mir die sauersten Dinge schmackhaft zu machen, dass ich manchmal sogar vergaß zu protestieren. Sie war trotz ihres Alters damals noch eine wunderschöne Frau, ein zartes feenhaftes Wesen, das aus einer anderen Welt zu stammen schien und wegen seiner Bildung eigentlich gar nicht so recht zu den übrigen Erwachsenen in der Stadt passte. Ausgenommen der alte Archivrat Onkel Klostermeyer, der mit ihr an den Winterabenden musizierte und lange geistreiche Disputationen führte. So manches Mal schlich ich in das Klostermeyersche Haus, das dem Unsrigen gegenüberlag, überraschte den alten Archivrat in seiner Bibliothek und betrachtete ehrfurchtsvoll die unzähligen Bücher in den Regalen. Onkel Klostermeyer nahm mich zwischen die Knie und erzählte mir, was alles in diesen Folianten zu finden war. Und wenn er dann auf die Dichter Goethe, Shakespeare oder Homer zu sprechen kam oder von den Taten Napoleons und Cäsars berichtete, vom Wirken des berühmten Komponisten Beethoven oder des großen Malers Michelangelo, dann erschienen mir diese Männer alle als Zeitgenossen einer versunkenen alten Welt, in der auch Jesus Christus fernab im Morgenlande seine Wundertaten vollbracht haben musste. Und ich war höchlichst überrascht, als Onkel Klostermeyer einmal ein Schreiben der Weimarischen Staatskanzlei mitbrachte, das von Goethes Hand persönlich unterzeichnet war, der also noch unter den Lebenden weilte und doch schon Legende war. Ich beförderte nun alle längst Totgeglaubten flugs ins Leben zurück. Onkel Klostermeyer lachte und küsste mich und erklärte, dass ich vielleicht gar nicht so unrecht habe.
Das war der alte Archivrat. Nur ihm allein traute ich zu, fast ebenso viele Bücher gelesen zu haben wie meine Mama, die ich selten ohne ein Buch sah. Ich glaube, an diesen vielen Büchern lag es, dass Mama nicht genauso zufrieden mit der Welt war, in der wir lebten, wie Vater und ich. Manchmal machte sie meinem fröhlichen Papa Vorhaltungen über seinen gänzlichen Mangel an Ehrgeiz, aus dem Ministaat hinauszukommen. Und wenn Briefe eintrafen von unserem Onkel Roß, dem berühmten Bischof in Berlin, der am königlich-preußischen Hof ein und aus ging, oder von den steinreichen Weerths aus Bonn am Rhein oder von den Tenderings, die in allen Hauptstädten Europas zu Hause waren, dann weinte sie.
Mein Gott, sie war unglücklich, während die halbe Stadt mich um eine solche Mama beneidete, zu der des Öftern sogar der Fürst schickte, um ihren Rat in heiklen Staatsgeschäften einzuholen. Der Teufel soll mich holen, wenn ich je im Leben einen anderen Wunsch verfolgt hätte, als ihr zu imponieren. Leider traf ich nicht immer das Richtige. Davon wird noch zu reden sein. Vorerst befinden wir uns in der Osterzeit des Jahres 1828, ein Tag, an dem mir dies offensichtlich auf das Allertrefflichste gelang. Leider entstanden daraus Folgen, die ich unglücklicherweise nicht vorausberechnet hatte.
An diesem Tag gab es in unserem Haus eine große prächtige Familienfeier. Jung und Alt aus der ganzen Stadt - wie mir schien - waren zu Gast, um den sechzehnten Geburtstag meines Bruders Carl und das dreißigjährige Amtsjubiläum meines alten Herrn als Geistlicher der reformierten Kirche zu begehen. Onkel Klostermeyer war natürlich mit seiner Geige und seiner Tochter, Fräulein Luise, gekommen; Pastor Althaus, der Vater meines besten Spielgefährten Theo war da, mehrere Kommerzien- und andere Räte, ein Doktor und zwei Professoren waren mit ihren Frauen erschienen, die in ihrem Seiden rauschenden Sonntagsaufputz einherwatschelten und gakelten wie eine Herde Gänse. Carl hatte seine Klassenkameraden aus dem Gymnasium eingeladen, die ich alle kannte, und ganz zum Schluss erschien noch ein mir fremder blasser Jüngling namens Ferdinand, der extra den weiten Weg aus Soest hierhergereist war, um seinem ehemaligen Schulfreund Carl zu gratulieren. Ich betrachtete diesen Menschen mit besonderer Neugier. Oft war in unserem Hause die Rede von ihm gewesen. Dieser bedauernswerte Mensch, dereinst Klassenprimus, hatte schon vor Jahren das Gymnasium verlassen müssen. Sein Vater, der arme Volksschullehrer Freiligrath, der in einer armseligen Hütte hinter unserem Garten hauste, hatte das Schulgeld nicht mehr aufbringen können. Der Sohn war in die Welt hinausgegangen, um als Kaufmannslehrling sein Glück zu versuchen.
Kurzum, als die Kuchenschlacht an dem Tisch der Gymnasiasten im Nebenzimmer, zu denen man mich gesetzt hatte, erfolgreich geschlagen war, musste jeder der Sekundaner, der ein Talent in sich fühlte, in die Flügeltür des Salons treten, wo die Alten meinen Vater feierten, und etwas zum besten geben. Da sang nun der eine ein frommes Liedchen, der andere sagte ein braves Wielandgedicht herunter oder klimperte, wie mein armes Schwesterlein Charlotte, mühsam ein Stückchen auf dem Piano. Dieser versuchte es mit lateinischen Alexandrinern, jener gar mit griechischen Jamben. Bruder Wilhelm überreichte ein recht buntes Aquarell aus eigener Hand. Zum Abschluss nun trat jener arme Kaufmannslehrling vor das Auditorium, und alle erwarteten huldvoll seine Einlage. Der fremde Bursche begann ein Gedicht vorzutragen. Eine sehr lange wundersame Versdichtung, in der unsere Stadt und ihre Bewohner auf lebendige Weise beschrieben waren. Die Gesellschaft war ganz berauscht, und meine Mutter sprang gleich auf und umarmte den Jungen und fragte: „Nun sag Er um alles in der Welt, Ferdinand, woher hat Er diese trefflichen Verse, die mir noch nie unter die Augen gekommen sind?“
Der so Bedrängte wurde über beide Ohren rot und gab schließlich zu, dass er die Verse selber verfasst habe.
Mit einem Schlag war nun alles vergessen, was die anderen geboten. Nur noch von dem großen Talent des Kaufmannslehrlings war die Rede. Der blasse Jüngling wurde an den Ehrenplatz neben meinem Vater geholt und musste nun haarklein erzählen, was er in den Jahren, seit er Detmold verließ, alles erlebt hatte.
Mich erregte dieser unerwartete Erfolg des Fremden derart, dass ich nicht mehr an mich halten konnte, in die Flügeltür trat, den Tischgong schlug und lauthals verkündete: „Jetzt bin ich dran!“
Die ganze Aufmerksamkeit wandte sich mir zu. Alle blickten mich ermunternd an, außer meiner lieben Mutter, die sich weiß Gott nicht vorstellen konnte, was ihr Knirps, der weder einen Vers auswendig konnte noch gar ein Lied zu singen imstande war, zum besten geben wollte. Ehrlich gestanden, ich selbst wusste es ebenso wenig wie sie. In dem unwiderstehlichen Drang, überhaupt aufzutreten, hatte ich diese nebensächliche Frage bis jetzt überhaupt noch nicht bedacht. Ich stand also da, krampfhaft um einen Einfall ringend, und hätte mich bestimmt unsterblich blamiert, wäre mein Blick nicht zufällig auf das Breviarium meines alten Herrn gefallen, ein kleines abgegriffenes ledergebundenes Büchlein, das er immer mit sich auf die Kanzel nahm, wenn er eine Predigt zu halten hatte. Ich holte also das Büchlein vom Büfett, kletterte auf einen Stuhl, blätterte in dem Buch, wie es Pa immer tat, wenn er auf der Kanzel stand, obwohl ich natürlich gar nichts entziffern konnte, und begann mit dem Versuch, jene Passage der Osterpredigt meines Herrn Vaters zu kopieren, die mich mächtig beeindruckt hatte, weil in ihr vom Nutzen des abscheulichen Fastens in der vorösterlichen Zeit wie überhaupt von den Wohltaten eines Lebens in weiser Beschränkung und kluger Bescheidenheit die Rede war.
„Nun, meine lieben Freunde, sagt selbst: Würden wir alle heute hier mit so freudigen, erwartungsfrohen Gesichtern sitzen, wenn wir nicht zwei Monate Enthaltsamkeit im Essen und Trinken glücklich hinter uns hätten? Ich sehe es dir doch an, Tante Rosalia, und dir, Opa Hämmerling, und euch Kindern, mit welcher Inbrunst ihr der köstlichen Gaumengenüsse gedenkt, die heute daheim auf euch warten. Schmeckst du nicht schon den knusprigen Osterbraten auf deiner Zunge, Emilie? Und läuft dir nicht das Wasser im Mund zusammen, Richard, wenn du an das erste Maß Bier denkst, das gleich nach der Morgenandacht in der Schenke deine ausgetrocknete Kehle hinunterlaufen wird? Von euch Kindern will ich gar nicht reden. Ihr könnt das Ende der Ostermesse ja kaum erwarten, um nach Hause zu stürmen und alle Winkel nach den süßen Nestern zu durchstöbern, die der Osterhase für euch versteckt hat. Siehst du, Lindenschorsch, so belohnt der Herrgott die Frommen, die seinen Fastengeboten getreulich folgten. Hättest du dir nicht jeden Tag heimlich eine Wurst oder ein Stück Speck aus dem Rauch geangelt in der verbotenen Zeit, dann würdest du heute nicht so verdrießlich hier sitzen mit Magendrücken, sondern ebenso glücklich und erwartungsfroh wie alle die Auferstehung des Herrn feiern.“
Gewiss habe ich nicht im entferntesten die ganze Tiefe dieser Gedanken in meiner kindlichen Kopie ausschöpfen können. Aber das wenige, was ich bot, reichte aus, um die Gesellschaft zu entzücken. Mein Vater hielt sich den Bauch vor Lachen. Ich wurde nun fast ebenso gefeiert wie der junge Freiligrath. Onkel Klostermeyer prophezeite mir eine Karriere als Prediger, wie man sie sich glänzender nicht denken könnte, wenn ich nur recht wacker weiterlernte. Und die Frau Mama blickte mich mit so großen nachdenklichen Augen an, dass es mir ganz feierlich zumute wurde.
Sie glaubte nun meine wirklichen Qualitäten entdeckt zu haben. Als Frau der Tat setzte sie sofort alle Hebel in Bewegung.
Noch am Nachmittag engagierte sie den knebelbärtigen Gymnasialprofessor Stockmann mit dem Auftrag, meine Bildung auf das Lateinische auszudehnen und so zu intensivieren, dass ich recht schnell den notwendigen Reifegrad für das Gymnasium erlange.
Damit war beschlossen, meiner sonnigen Kinderzeit ein jähes Ende zu setzen. Von nun ab ging es täglich durch die Modi und Tempera grässlicher Verben, die mir als schwarze Kakerlaken selbst noch im Traum erschienen, mit dem staubtrocknen Stockmann als Dompteur. Ich begann, Widerstand zu leisten, lernte nicht eine Vokabel, antwortete auf keine Frage mehr und verweigerte sogar das Essen. Meine verzweifelte Mutter versuchte, mich auf alle nur erdenkliche Art und Weise bei der Stange zu halten. Aber, ach, es war Frühling! Was weiß eine Mama schon von der Anziehungskraft der Kinderhorde auf der Straße, von den Schönheiten und Wundern unseres Waldes, die wir auf der Jagd nach Abenteuern gerade zu entdecken begannen? Stockmann kapitulierte schon nach sechs Wochen und erklärte, eher wollte er einem Esel die Bibel verständlich machen, als mich auf das Gymnasium vorzubereiten. Meine Mutter ließ sich durch diesen Misserfolg nicht von ihrem vorgefassten Entschluss abbringen. Ein neuer Lehrer wurde gesucht. Und ich glaube, ich verdankte es einer klug eingefädelten Intrige meines Vaters und meines Bruders Carl, dass die Stelle einem Lehrer ganz anderer Art zugesprochen wurde, einem freundlichen, verständnisvollen Manne, den ich schon nach wenigen Wochen lieben und verehren lernte. Es war kein anderer als Nachbar Freiligrath, der arme Vater des Kaufmannslehrlings Ferdinand.
Statt dürrer Lateinvokabeln und grammatikalischer Formen erzählte mir Papa Freiligrath von der Entstehung und Geschichte des römischen Weltreiches, erzählte von den kühnen Eroberungszügen der Legionen, von den Taten Hannibals und Cäsars und der vernichtenden Niederlage des Varus in unserem Teutoburger Wald. Des Öfteren ging er mit mir in die Natur, zeigte mir Pflanzen und Tiere, lehrte mich, in die Geheimnisse ihres Lebens einzudringen. Manchmal kam er auch auf die Welt außerhalb des Fürstentums zu sprechen, und ich bekam einen Begriff von der tatsächlichen Bedeutungslosigkeit unseres Landes, was mich sehr traurig stimmte, denn mein Herz hing an allem, wofür der alte Herr nur ein mitleidiges, ironisches Lächeln hatte. Und doch: Es waren dies die herrlichsten Nachmittage, die mir im Gedächtnis geblieben sind, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke. Ich hatte einen Freund, der mich behutsam an die Hand nahm, um mir zu helfen, die Welt zu entdecken.
Ich sehe den Dichter Grabbe und verliere meinen Lehrer
Auf einer unserer Exkursionen in die dunklen tiefen Schluchten des heimatlichen Waldes begegnete uns ein merkwürdiger bleicher Mann mit einem vogelartigen Kopf und schütterem fahlgelbem Haar auf der mächtigen Stirn, der, tief in Gedanken versunken, mit finsterem Gesicht auf uns zukam. Ich verkroch mich ängstlich hinter die Rockschöße meines Lehrers, der zur Seite getreten war, den Hut in der Hand hielt und sich tief vor dem unheimlichen Wanderer verbeugte, ohne auch nur eines Blickes gewürdigt zu werden.
„Wer war das?“, fragte ich, während ich noch gebannt auf die Stelle im Wald starrte, wo der Finstere verschwunden war.
Ehrfurchtsvoll antwortete mir Papa Freiligrath: „Das war Grabbe. Der arme, unglückselige Grabbe. Ein dramatischer Dichter, eine geniale Begabung, die größte, die einzige, die unser Ländchen hervorgebracht hat. Draußen in der Welt hat er viele Bewunderer seiner Werke. Aber die beschränkten Kleinbürger und Philister seiner Heimatstadt verachten ihn, reißen die dümmsten Witze über ihn, lachen ihn aus, verspotten ihn, weil er aus armen Verhältnissen stammt und es nicht wie ein Bierhändler oder Schweinemeister zu Wohlstand und Besitztum gebracht hat. Hätte er nicht in dem Herrn Archivrat Klostermeyer den einzigen Menschen gefunden, der sein Genie erkannte und ihm eine Stellung als Auditeur verschaffte, gewiss hätten sie ihn elendiglich verhungern lassen. Ach, diese verlogenen, engstirnigen Krämerseelen! So klein und erbärmlich ihr Land ist, so kleinlich und gehässig ist auch ihre Seele. Wäre er doch draußen in der Welt geblieben, nie zurückgekehrt zu seiner geliebten Mutter! Wäre er doch in ein Land gezogen, wo den Dichtern, den erhabenen Schöpfergenien des Volkes Ehrerbietung, Verständnis und Liebe entgegengebracht werden! Hier wird er zugrunde gehen!“
Ich deutelte lange an dem herum, was mir Papa Freiligrath da alles erzählte von diesem finsteren Mann. Schließlich sagte ich: „Vielleicht brauchen wir keinen Dichter. Es stehen doch schon so viele Bücher bei Onkel Klostermeyer.“
Papa Freiligrath lächelte. ,,Es kann gar nicht genug Bücher geben, Georg. Denn sie sind die unersetzlichen Wissensquellen und Wegweiser des Menschengeschlechts. Freilich nur für die, die sie lesen. Was wären wir Menschen viel mehr als umhertappende Tiere, begrenzt auf unser bisschen eigene Anschauung und Erfahrung, würden nicht Gelehrte und Dichter, Forscher und Künstler uns in ihren Büchern den Blick öffnen auf den Reichtum der ganzen Welt, auf die geistigen Strömungen der Jahrhunderte, auf die Geschichte ganzer Völker und auf die Erkenntnis unserer eigenen Seele?“
„Aber dein Sohn, ist er nicht auch ein Dichter?“, fragte ich.
Papa Freiligrath lächelte. „Gott gebe es, mein Kind, dass ihm dereinst etwas Großes gelingen möge!“
„Hast du ihn deswegen in die Welt hinausgeschickt?“
Der gute Herr sah mich an, wollte erst wieder lächeln, aber dann streichelte er meinen Kopf und sagte ganz ernsthaft: „Ja, vielleicht deswegen. Und hätte ich drei Söhne, mit guten Anlagen wie Ferdi, ich würde sie alle hinausschicken, damit ihre Seele nicht verkümmere in einer Stadt, die den Geist missachtet und alles Große, Neue und Unbekannte mit Misstrauen und Hass verfolgt.“
In tiefes Nachdenken versunken, kam ich zu Hause an. Ich sah meinen Vater, meine großen Geschwister, die harmlos vergnügt am Tisch saßen. Es fiel mir ein, dass auch meine Mutter des Öfteren ihre Unzufriedenheit über die Enge unserer Stadt geäußert hatte. Und ich begann, alles das, was ich bis jetzt erlebt hatte, mit neuen Augen zu betrachten.
Als Mama mich vor dem Schlafengehen examinierte, nach meinen Fortschritten im Lateinischen und in den Bibeltexten befragte, schüttelte ich den Kopf und erklärte in aller Entschiedenheit: „Ich will nicht Geistlicher werden wie Papa und Onkel Roß. Ich will Dichter werden und Bücher schreiben. Ein Dichter wie Grabbe!“
Bei dem Namen Grabbe war meine Mutter entsetzt aufgesprungen, als hätte ich die schrecklichste Gotteslästerung ausgesprochen. Oh, ich erinnere mich genau dieser Szene.
„Um Himmels willen, Georg, mein Söhnchen, wie kommst du auf diesen tollen Einfall? Wie kommst du auf diesen Namen?“
Ich berichtete von unserer Begegnung.
Da wurde Mama plötzlich ganz besorgt und närrisch, als wenn sie einen Schwerkranken vor sich hätte. Sie nahm mich in die Arme, drückte mich betulich an ihren Busen, blickte mir in die Augen und beschwor mich: „Mein Kleiner, du wirst diesen Vorfall vergessen. Den Namen dieses haltlosen, verkommenen Menschen musst du gänzlich aus deinem Gedächtnis entfernen. Er war dereinst ein junger hoffnungsvoller Abiturient, dem alle zugetan waren und alle ein gesichertes Fortkommen als Beamter, Theologe oder Jurist herzlich gönnten. Dein Vater und andere vermögende Leute haben viel Geld drangewandt, um ihm ein sorgenfreies Studium zu ermöglichen. Er aber hat unser Vertrauen arg getäuscht. Statt sich seinen Studien zu widmen und so schnell wie möglich ein Examen abzulegen, hat er sich in zweifelhafte Abenteuer gestürzt und seine Mittel sinnlos verschleudert. Das, was dein Lehrer an ihm bewundert, sein literarisches Talent, der Drang zum Theater, zum sogenannten freien Künstlerleben, ist zu seinem Verhängnis geworden, hat sein Leben zerrissen, ihn zum bejammernswertesten Individuum gemacht, das man sich vorstellen kann.“
Ich blickte meine Mutter verständnislos an, glaubte ihr zum ersten Mal im Leben kein Wort.
„Ist ein Mensch, der so viel von der Welt gesehen hat, der überall draußen Bewunderer hat, bejammernswert zu nennen?“ Meine gute Mutter rang erregt die Hände: „Ich verstehe nicht, wie ein Lehrer, dem wir einen guten Nebenverdienst zukommen lassen, damit er dich auf einem ruhigen, klaren und sicheren Weg voranbringe, dir diese Dinge in so schiefem Licht darstellen kann!“
Am anderen Tag sah ich Papa Freiligrath in unser Haus treten. Ich lief ihm freudig entgegen. Aber da kam meine Mutter hinzu mit ernstem, bitterbösem Gesicht und schickte mich in meine Kammer. Ich versteckte mich, nichts Gutes ahnend, im Flur und lauschte, was Mama mit meinem Lehrer wohl zu verhandeln habe. Ich hörte ihre erregte Stimme, sah kurz darauf meinen geliebten Lehrer betroffen aus dem Zimmer treten. Ich hörte, wie er zu meiner Mutter sagte: „Ich werde Ihnen Ihr Geld zurücksenden, gnädige Frau. Ich bin arm, ja. Aber das berechtigt Sie nicht, mein pädagogisches Gewissen in Zweifel zu ziehen. Ich möchte Sie bitten, nach einem anderen Lehrer Ausschau zu halten, der Ihren Vorstellungen eher entspricht. Ich habe die Ehre!“
Ich stürzte aus meinem Versteck heraus, rannte hinter Papa Freiligrath her, klammerte mich an seinem Arm fest und rief: „Ich will keinen anderen Lehrer!“
Der alte Herr machte sich los und gab mir einen Kuss. „Gehorch deiner Mutter! Sie ist eine kluge Frau, und alles, was sie befiehlt, geschieht nur zu deinem Besten. Leb wohl, Georg!“ Mit diesen Worten ging er schnell von dannen. Ich aber lief wortlos an meiner Mutter vorbei die Treppe hinauf, riegelte mich in meiner Kammer ein, weinte und trampelte mit den Füßen und schrie voller Zorn: „Ich werde Dichter, jawohl, Dichter! Ein Dichter wie Grabbe!“
Da aber niemand im Haus darauf einging, gab ich am Abend meine Rebellion auf und ging hungrig wie ein Wolf zum Abendbrottisch, wo alles wie gewöhnlich verlief, in heiterer Gemütsruhe und Beschaulichkeit, als hätte es nie einen Streit mit mir gegeben, keinen Grabbe und keinen Papa Freiligrath.
Einige Wochen später kam es zur letzten Begegnung mit diesem wunderbaren Mann, dem ich so viel zu verdanken hatte. Er hatte seine ganze Habe aus einem fünfundzwanzigjährigen Lehrerdasein in unserer Stadt auf einem Bauernwagen verladen und war im Begriff, das Land zu verlassen, um zu seinem Sohn nach Soest zu ziehen. Wie freute er sich, als er meine herzlichen Küsse empfing. Er kramte in seinen Kisten und förderte ein schmales Büchlein zutage, das er mir zum Abschied überreichte. Ich versteckte das teure Andenken unter meinem Pullover, lief in den Wald, denselben Weg entlang, auf dem ich so glückliche Nachmittage mit dem Schulmeister verbracht hatte, und entzifferte den Umschlag des Büchleins.
„Aus dem Leben eines Taugenichts“, las ich. Und diese schöne Novelle des Dichters Eichendorff, die alle Sehnsucht eines heranwachsenden Jungen schürt, hinaus in die Welt zu ziehen, wurde mein erstes literarisches Erlebnis. Aber ich hatte beschlossen, mit niemandem darüber zu sprechen.
Mama engagierte einen neuen Lehrer, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Alles lief seinen gewohnten Gang. Und doch hatte sich die Welt für mich verändert.
Im Jahr darauf verbreitete sich die Nachricht in der Stadt, dass der Schulmeister Freiligrath in Soest, fernab von den geliebten Wäldern seiner Heimat, verstorben sei.
Wohl nie werd ich vergessen Den stillen Feiertag, Als ich bei dir gesessen Dort am Forellenbach. Ich hing an deinem Munde, Sah in dein Aug hinein Und liebte dich zur Stunde: Du alt Schulmeisterlein!
Es rauschte hin und wieder Die Linde, dicht belaubt, Und sandte Blüten nieder Auf dein ergrautes Haupt. Bisweilen in den Zweigen Der Amsel Lied erschallt’, Auch sahn wir Falken steigen wild singend aus dem Wald.
Den Wein, den wonnelichten, Gabst du aus hohem Krug, Und lasest drauf Geschichten Aus einem großen Buch. Das war so schön gezieret Mit vieler Bilderei, Und lieblich ausgeführet In Farben mancherlei.
Ein Denkmal froher Zeiten, Wo noch die Locke kraus: Sah aus vergilbtsten Seiten Ein alter Blumenstrauß; Den hatte wohl zum Kranze Ein schönes Lieb gepflückt Und ihn beim Reigentänze Ans kleine Herz gedrückt.
Denn sieh, ein ruhig Leuchten Verklärte deinen Blick; Es kehrten die verscheuchten, Die Geister all zurück; Erinnerung umschwebte Dich leis zu dieser Stund, Ein holder Name bebte Von deinem bleichen Mund.
Und wie die braunen Flügel Ein alter Kranich dehnt, Wenn nach der Heimat Hügel Er sich hinübersehnt - So deine Arme rangen Sich jugendlich empor, Und deine Worte klangen Wie Märchen an mein Ohr!
Es sang zu goldner Leier, Als nun die Sonne schied, In wundervoller Feier Die Welt ihr Abendlied. Auf stieg die Nacht und blickte Still lächelnd durch das Land; Ich sah dich an und drückte Dir deine liebe Hand.
Ich entdecke das „Buch der Lieder“ von Heinrich Heine und lese die ersten Gedichte von Ferdinand Freiligrath
Der verachtete Dichter Grabbe hatte es über Nacht zu Anerkennung auch in seiner Vaterstadt gebracht: Eines Tages nämlich standen in der Buchhandlung am Marktplatz die ersten Bände seiner gesammelten Werke. Sein alter Gönner, Onkel Klostermeyer, kostete seinen Triumph gegenüber meiner skeptischen Frau Mama ordentlich aus. Auch ich frohlockte, ertappte meine Mutter dabei, wie sie nachdenklich im ersten Band der Grabbeschen Dichtungen blätterte, kam aber nicht mehr auf meinen kindlichen Willensakt, Dichter werden zu wollen wie Grabbe, zurück. Denn ich war jetzt Gymnasiast geworden und hatte schon einen kleinen Begriff davon, dass zwischen Wunsch und Wirklichkeit Bastionen liegen, die man - wenn überhaupt - nur mit mühseliger Plackerei und saurem Schweiß überwinden kann.
Die Jahre vergingen. In Frankreich und Belgien erhoben sich die Völker gegen die Monarchie. In den deutschen Landen blieb alles beim Alten. Aus Weimar kam die Nachricht vom Tod Goethes. Im selben Jahr starb auch der alte Archivrat. Und mit seinem Hinscheiden schien mir die kleine Welt, in der wir lebten, noch um ein gutes Stück winziger und bedeutungsloser geworden. Mein Vater verlor zusehends an Humor und begann unter Gallenbeschwerden zu leiden. Unser allergnädigster Landesherr bescherte uns als Ersatz für eine Verfassung ein niedliches Residenztheater mit Albert Lortzing als Sänger und Hofkapellmeister, und ich entdeckte in der Bibliothek meiner Mama das „Buch der Lieder“ von Heinrich Heine, das ich von diesem Zeitpunkt an nicht wieder aus der Hand gab.
In jener Zeit kam zum ersten Mal wieder eine Nachricht von Ferdinand Freiligrath. Es war an einem Samstagnachmittag, als der Postbote die Monatsausgabe des „Musenalmanachs“ brachte, den meine Mutter abonniert hatte. Ich löste die Banderole, um einen Blick in die Zeitschrift zu werfen, die noch immer das Beste enthielt, was die deutsche Literatur derzeit aufzuweisen hatte. Da fiel mein Blick auf den Namen des Lehrersohnes, und ich fand eine Reihe Gedichte von ihm. Ich las und war sogleich gefesselt von dem ganz neuartigen zupackenden Rhythmus der Sprache, den sparsam hingeworfenen Worten, die kräftige, einprägsame Bilder malten. Ein enthusiastischer Artikel des Herausgebers Adalbert von Chamisso feierte den jungen Dichter als neuen Stern am Himmel der Poesie und stellte sein Talent, ja, ich las richtig, neben den genialen Heine! Ich rannte zu Mutter und Vater, zu meinem Kameraden Althaus und überallhin, wo ich Menschen vermutete, die sich für die Dichtkunst interessierten, las ihnen vor und verkündete, dass Detmold nun einen zweiten Dichter hervorgebracht habe.
Ich traf auch Luise Klostermeyer, respektive Frau Grabbe, denn der einsame Dramatiker hatte dem späten Mädchen zu einem nicht mehr erhofften Eheglück verholfen. Sie nickte mürrisch zu meiner Verkündigung und erwiderte mit bitterbösem, galligem Gesicht: „Es wird auch Zeit, dass wir einen zweiten Poeten bekommen. Denn mit dem ersten, da geht es bergab, radikal und rapide.“
Erschrocken blickte ich der Frau nach, die hastig und ohne Gruß weitergegangen war. In meine Freude mischte sich ein Wermutstropfen. Daheim hörte ich, dass man Grabbe den Abschied aus seinem Amt als Auditeur gegeben habe. Toller triebe er es mit dem Suff als in seinen schlimmsten Jugendzeiten. Und nur zu bejammern sei das Schicksal der guten Luise an der Seite dieses Besoffenen.
Kurze Zeit darauf hatte ich jene Begegnung mit Grabbe selbst, die mir in unauslöschlicher Erinnerung geblieben ist. Das war an einem dunkel verhangenen Herbstnachmittag im Jahre vierunddreißig. Ich kehrte von einem Besuch bei meiner Schwester zurück, die den jungen Pfarrer eines Waldbauerndorfes geheiratet hatte.
Schreckliche Erlebnisse in meiner Vaterstadt und Flucht in die Fremde
Voll Schwermut und Trauer liegen die Herbsttage über meinem Heimatland, wenn die Oktoberstürme vorüber sind und der Winter sich mit ersten kalten Nächten ankündigt. Der Himmel ist mit diesigen Wolkenbergen verhangen. Die Wälder stehen starr und kahl in Fäulnis und Nebeldunst. Die Tage sind kurz geworden. Schon bald nach der Mittagszeit senkt sich die graue Dämmerung über die Erde. Noch kleidet kein Schnee die gestorbene Welt in einen lustigen weißen Mantel. Im Wald ist es still. Nur hin und wieder ist das hässliche Gekrächze der Raben zu hören, die tiefschwarz wie Geister in den Wipfeln der uralten Buchen flattern.
Ich musste am Friedhof vorbei, der am Berghang lag, der direkt in die Stadt hinabfiel. Mir graute bei dem Gedanken, dass dort der alte Archivrat, den ich noch so lebendig in Erinnerung hatte, einsam und starr in der kalten Erde lag, und ich war froh, als ich die Stadtmauer erreicht hatte. Aber auch die Gassen der Stadt lagen menschenleer und verlassen. Hier und da blakte ein trübes Licht aus den dunklen Fensterlöchern. Aus einer verrufenen Kellerschenke an der Wegkreuzung waren menschliche Stimmen zu hören. Beim Näherkommen verzerrten sich diese Stimmen zu einem schauerlichen Gegröle rauer Männerkehlen und dem schrillen Gekreisch angetrunkener Frauen. Da unterschied ich Worte: „Ruhe! Lasst ihn weiterlesen!“
Es wurde stiller. Ich blieb stehen, vernahm die Stimme eines Betrunkenen, eine heisere, wilde Stimme, die grollend und bebend aus dem Kellergewölbe drang:
„Unsel’ge Nacht, willst du denn nimmer enden? - Weh mir, sie hat erst eben angefangen - Noch schlug’s kaum elf. Zurück zur Arbeit also. - - Zur Arbeit! Zum Studieren! Schmach und Jammer! Tödlicher Durst und nie gestillt! Sandkorn Zum Sandkorn sammeln, grenzenlose Und immer grenzenlos're Wüsten um Sich her zu bauen und sodann darin Sich lagern, schmachtend und verzweifelnd! - Ha, Ein Raubtier wird man, bloß um sich zu nähren!“
Da wurde die Stimme des Rezitators von einer schrillen Weiberstimme unterbrochen, die lachend aufkreischte und schrie: „Ein Raubtier! Hahaha!“
Wie auf Kommando setzte ein infernalisches Gejohle, Gepfeife und Gelächter ein.
Ich stand wie erstarrt. Da sah ich, wie sich die Tür öffnete. Ein Mann torkelte auf die Straße. Eine aufgedunsene, geschminkte Person warf ihm Hut und Mantel hinterher: „Adieu, Schätzchen! Dichter, hahaha!“
Der Mann taumelte benommen an die Häuserwand, schlug seine Stirn gegen die Mauer und verfiel in haltloses Schluchzen.
Da begriff ich erst, dass es Grabbe war.
Ich erwachte aus meiner Erstarrung, lief über die Gasse, raffte Mantel und Hut vom Pflaster und näherte mich dem Dichter, der mich lange gar nicht wahrnahm, bis ich vorsichtig das Wort an ihn richtete: „Herr Auditeur!“
Da drehte er sich um, sah mich aus großen tränenverschwommenen Augen an und ließ sich schweigend in den Mantel helfen. „Fort hier“, sagte er gepresst, stützte sich schwer auf meinen Arm, und wir gingen stadteinwärts. Aber als ich ihn in Richtung Mohnstraße führen wollte, wo er mit Luise ein Fachwerkhäuschen bewohnte, widerstrebte er und zwang mich die Marktstraße hinauf nach Norden, wo jenseits der alten Ringbrücke die grauen hohen Mauern des Gefängnisses zu sehen waren.
Als wir an der eisernen Pforte standen, musterte er mich und fragte mit ruhiger Stimme: „Bist du nicht einer von den Weerth-Söhnen?“
Ich nickte. Ein bärtiger Wächter öffnete den Einlass und grüßte mit unbeweglichem Gesicht.
„Komm“, forderte mich Grabbe auf. Mit heimlichem Grausen betrat ich an seiner Seite den Gefängnishof. Wir kamen in eine der armseligen Behausungen des Gefängnispersonals, die in einem niedrigen Reihenhaus an der Innenseite der Mauer untergebracht waren. Grabbe führte mich in eine Stube zu ebener Erde, wies auf das alte Kanapee und sagte: „Setz dich!“