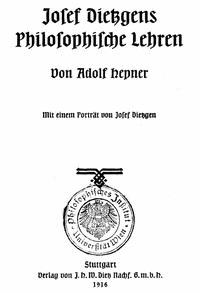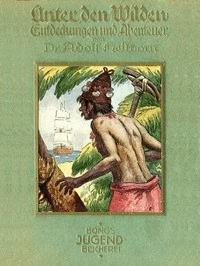
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Ähnliche
Unter den Wilden:Entdeckungen und Abenteuer
Von
Dr. Adolf Heilborn
Mit 5 bunten Beilagen und 36 Textbildern von Erich Sturtevant
VERLAG VON RICH. BONG IN BERLIN
Alle Rechte, auch das der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Copyright 1921 by Verlag von Rich. Bong in Berlin.
Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.
Inhalt
Vorwort
In jedem gesunden Kinde steckt ein gut Stück Robinsonsehnsucht. Sie ist der letzte, kulturgezähmte Rest uralter Wanderlust, uralten Abenteuerdranges der Menschheit. Wie wir uns immer wieder in Pfeil und Bogen uralte Waffen verfertigen, im Spiele Hütten bauen oder Höhlen als Schlupfwinkel wählen, wie es uns immer wieder zum Tiere zieht, es zu liebkosen und uns gefügig zu machen, so überfällt uns eines Tages quälende Robinsonsehnsucht, und mit blanken Augen und roten Wangen verschlingen wir dann alles, was sie zu stillen uns verheißt. Unsterblicher Robinson, unsterblicher Lederstrumpf, roter Freibeuter, Peter Simpel und wie ihr euch sonst noch nennt, die ihr alle etwas von einem Don Quichotte habt und Väter einer so langen und manchmal auch recht langweiligen Reihe von Nachtretern geworden seid ... wie jedes echte Kind hab ich euch immer von neuem gelesen, bis ich euch fast auswendig konnte, und bis ich eines Tages in meines lieben Vaters Bücherschrank auf andre Helden und andre Abenteuer traf, Helden von Fleisch und Blut, wirkliche Menschen, nicht nur am Schreibtisch erdachte Gestalten, und Abenteuer, die wirklich erlebt, in Not und Tod, nicht nur zur Spannung naiver Leser ersonnen. Da standen in großmächtigen, altertümlichen Lederbänden mit roten und schwarzen Schildern auf dem goldgepreßten, dicken Rücken die Entdeckungsreisen des Kapitän Cook, sechs stattliche Bände, daneben die Reisen von Wallis, von Byron, von Carteret, von Meares, Portlock ... Reisen und Abenteuer in der Südsee, an den unwirtlichen Küsten Nordamerikas, unter braunen, nackten Wilden und Indianern. Ein Buch immer spannender als das andere, immer schöner, immer seltsamer. Was waren das für unvergeßliche Stunden des Lesens und Träumens. Das blaue Südmeer lag vor meinen Blicken, von weißer Brandung umgischt tauchten Koralleninseln daraus empor, mit rauschenden Palmenhainen voll seltsam bunter Vögel. Von Eiland zu Eiland zogen in flinken Kanus mit Mattensegeln die braunen Kanaken und kämpften in Panzern und Helmen mit Haifischzahnspeeren und sangen melodisch und sprangen zur Trommel ...
Sie sind Zauberer, diese großen Entdecker, voran, allen weit voran James Cook, der einem ganzen Zeitalter den Stempel seines Naturempfindens aufprägte. Eine Weltanschauung ward aus diesen Entdeckungsfahrten geboren, eine Naturphilosophie, die in Seumes Worten »Seht, wir Wilden sind doch beßre Menschen« gipfelte, die in Rousseaus Werken ihr »Zurück zur Natur« predigte. Auch unsre Zeit, durch soviel Blut und Grauen gegangen, hat diese Sehnsucht wieder, hat nach all der Übersättigung mit raffinierter Kultur diesen gesunden Hunger nach natürlicheren Verhältnissen. Darum gerade wird ihr die Kost, die hier geboten, besonders munden, werden diese uns überlieferten Erzählungen der Entdecker wie ein erfrischender Trunk nach ermüdender Wanderung wirken. Zumal die Jugend wird sie, des bin ich gewiß, mit Jubel begrüßen: ist doch der Robinson und all das andre in ihnen gleichsam beschlossen. Aus diesen Reisen und Abenteuern sind jene ersonnenen Geschichten ja erst geboren.
Aber nicht nur dem angenehmen Zeitvertreib müßiger Stunden vermögen sie zu dienen: es läßt sich aus ihnen auch unendlich viel lernen — nicht nur Erd- und Völkerkunde, auch Kulturgeschichte. Kein Geringerer als Schiller schrieb unter ihrem Eindruck die weithin weisenden Worte: »Die Entdeckungen, welche unsere europäischen Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Küsten gemacht haben, geben uns ein ebenso lehrreiches als unterhaltendes Schauspiel. Sie zeigen uns Völkerschaften, die auf den mannigfaltigsten Stufen der Bildung um uns herum gelagert sind, wie Kinder verschiedenen Alters um einen Erwachsenen herumstehen und durch ihr Beispiel ihm in Erinnerung bringen, was er selbst vormals gewesen, und wovon er ausgegangen ist. Eine weise Hand scheint uns diese rohen Völkerstämme bis auf den Zeitpunkt aufgespart zu haben, wo wir in unserer eigenen Kultur weit genug würden fortgeschritten sein, um von dieser Entdeckung eine nützliche Anwendung auf uns selbst zu machen und den verlorenen Anfang unseres Geschlechts aus diesem Spiegel wiederherzustellen.« Ich möchte mir wohl wünschen, daß meine jungen Leser bei wiederholter Lektüre auch auf solche Dinge ein wenig achtgäben.
In noch frischem Erinnern aus doch schon so fernen Jugendtagen habe ich gemeint, den Erzählungen jenen eigenen Reiz, jenen Schmetterlingsflügelstaub belassen zu sollen, der in der bisweilen etwas altmodischen Sprache der zeitgenössischen Übersetzer liegt — u. a. eines Georg Forster, dessen »Ansichten vom Niederrhein« mit Recht ja noch heute als klassische Prosa gelten — und nur nach heutigem Sprachgebrauch völlig Veraltetes geändert. Und freilich das köstlich barocke Deutsch Groebens, dessen »Guineische Reisebeschreibung« vor rund 20 Jahren wieder entdeckt zu haben ich mich rühmen darf, habe ich wohl oder übel in die Sprache unsrer Tage übertragen müssen; aber auch so dürfte dieses in seiner humorvollen Eigenart einzig dastehende Reisewerk der Wirkung gewiß sein. Gestrichen habe ich nur weniges, das, was mir für den erwünschten Leserkreis zu langweilig oder sonstwie ungeeignet erschien: astronomische, nautische Berechnungen und dgl.
Ich will mir schließlich noch wünschen, daß meine jungen Leser an dem von Sturtevants Künstlerhand dem Buche beigegebenen Bilderschmuck so viel Freude haben, wie ich sie empfinde. Der Künstler hat mit bewunderungswürdigem Geschick hier malerische Wirkung mit wissenschaftlicher Genauigkeit zu paaren verstanden. Alle Völkertypen, alle Gerätschaften sind nach Originalaufnahmen und Gegenständen des Berliner Völkerkundemuseums und meiner eigenen Sammlungen gezeichnet, und so dürfte dieser Bilderschmuck in seiner Art etwas Besonderes darstellen.
Dr.Adolf Heilborn.
Die Entdeckung und Eroberung von TahitiVon Kapitän Samuel Wallis
Am 18. Juni 1767, etwa 2 Uhr nachmittags, — wir waren kaum eine halbe Stunde lang unter Segel — entdeckten wir ein sehr hohes Land im Westsüdwesten. Da das Wetter trübe war und wir zugleich heftige Windstöße auszustehen hatten, ließ ich den »Delphin« beilegen und gedachte, die Nacht über, oder wenigstens bis der Nebel sich zerteilen würde, zu treiben. Um 2 Uhr des Morgens wurde es ganz klar, und wir gingen daher wieder unter Segel. Bei Tagesanbruch sahen wir das Land in einer Entfernung von ungefähr fünf Seemeilen weit vor uns und steuerten gerade darauf hin; als wir uns um 8 Uhr ihm näherten, mußten wir des einsetzenden Nebels wegen wieder beilegen. Endlich zerteilte er sich wieder, und wir wunderten uns nicht wenig, als wir uns von einigen hundert Kanus umringt sahen, die sich uns unbemerkt genähert hatten. Sie waren von verschiedener Größe und faßten bald mehr, bald weniger Leute, eines bis zu zehn Mann. Auf allen mochten meiner Schätzung nach nicht weniger als 800 Mann beisammen sein.
Nachdem sie sich dem Schiffe bis auf einen Pistolenschuß genähert hatten, hielten sie stille, betrachteten und bestaunten uns und besprachen sich untereinander. Mittlerweile zeigten wir ihnen allerlei Spielsachen und luden sie ein, an Bord zu kommen. Es währte nicht lange, so vereinigten sie sich und hielten eine Art Versammlung, um unter sich eins zu werden, was zu tun sei; endlich ruderten sie um unser Schiff herum und machten uns Freundschaftskundgebungen. Einer von ihnen hielt den Zweig einer Banane empor und beehrte uns mit einer Anrede, die ungefähr eine viertel Stunde dauerte, und bei deren Schluß er den Zweig ins Meer warf. Wir fuhren noch immer fort, sie einzuladen, zu uns an Bord zu kommen.
Endlich ließ sich ein ansehnlicher, starker, munterer junger Mann dazu bewegen. Er kam an der Besanleiter am Hinterdeck herauf und sprang von der hohen Bordwand auf das über dem Verdeck ausgespannte Segeltuch herab. Wir winkten ihm, daß er auf das Verdeck herabkommen möchte, und reichten ihm einige Kleinigkeiten hinauf. Er sah vergnügt aus, wollte aber nichts annehmen, bis einige von seinen Landsleuten, die sich ganz nahe an das Schiff gewagt hatten, nach dem Herleiern vieler Worte etliche Bananenzweige uns an Bord zuwarfen. Als er dies sah, nahm er unsere Geschenke an, und gleich nachher kamen einige andere dieser Eingeborenen, der eine von hier, der andere von dort her ins Schiff; denn keiner von ihnen wußte den rechten Zugang.
Einer von den Insulanern, die eben an Bord gekommen waren, stand auf der linken Seite des Verdecks nahe am Gange, als es einer von unsern Ziegen plötzlich einfiel, ihn von hinten mit ihren Hörnern gegen die Hüften zu stoßen. Er erschrak über diesen Stoß, wandte sich eilfertig um und sah die Ziege auf ihren Hinterfüßen aufgerichtet und in Bereitschaft stehen, ihm noch eins zu versetzen. Der Anblick dieses Tieres, das von allen, die er je gesehen, ganz verschieden sein mochte, jagte ihm einen solchen Schreck ein, daß er augenblicklich über Bord sprang, und alle seine Landsleute, die diesen Vorgang mitangesehen hatten, folgten ihm mit größter Eile nach. Doch währte es nicht lange, so erholten sie sich wieder von ihrer Bestürzung und kehrten an Bord zurück.
Nachdem ich sie ein wenig an den Anblick unsrer Ziegen und Schafe gewöhnt hatte, zeigte ich ihnen unsre Schweine und unser Federvieh. Sie deuteten mir durch Zeichen an, daß sie solche Tiere wie diese selbst hätten. Ich teilte hierauf Nägel und Kleinigkeiten unter sie aus und gab ihnen durch Zeichen zu verstehen, sie möchten gehen und uns einige von ihren Schweinen samt etwas Federvieh und Früchten an Bord bringen; es schien aber, als ob sie meine Aufforderung nicht verstehen könnten. Sie lauerten dagegen fleißig auf jede Gelegenheit, irgend etwas zu stehlen, was ihnen eben in die Hand kam. Wir ertappten sie aber gewöhnlich über der Tat. Endlich kam einer von den Schiffsunteroffizieren, der von ungefähr einen neubetreßten Hut auf dem Kopfe hatte, an die Stelle, wo sie standen, und fing an, sich mit einem von ihnen durch Zeichen zu verständigen. Während er sich also unterhielt, kam ein Eingeborener, riß ihm von hinten her plötzlich den Hut vom Kopfe, sprang damit über das Heckbord in die See und schwamm davon.
Weil wir nun an der Stelle, wo wir eben lagen, keinen rechten Ankergrund hatten, steuerten wir längs der Küste hin und schickten zu gleicher Zeit die Boote aus, näher an die Küste heranzufühlen. Die Insulaner versuchten es, in ihren Kanus dem Schiffe zu folgen; da sie aber keine Segel aufzuspannen hatten, blieben sie weit zurück und ruderten daher bald wieder nach der Küste zu.
Das Land bietet den anmutigsten und romantischsten Anblick, der sich erdenken läßt. Gegen die See hin ist es flach und mit Fruchtbäumen von allerlei Arten, insbesondere mit Kokospalmen bewachsen; dazwischen liegen die Häuser der Eingeborenen, die bloß aus einem Dache auf Pfählen bestehen und von weitem einer langen Scheune nicht unähnlich sind. Innerhalb des Eilandes und ungefähr drei Kilometer weit von der See hört das flache Land auf und grenzt an hohe Berge, die mit Gehölz bewachsen sind, und von deren obersten, sehr steilen Gipfeln große Wasserfälle sich mit lautem Getöse ins Meer herabstürzen. Hier sahen wir keine Sandbänke, dagegen war die Insel mit einer Reihe von Felsen umgeben, zwischen denen jedoch oft die Einfahrt möglich ist.
Um 3 Uhr befanden wir uns einem großen Meerbusen gegenüber, und da wir deshalb Ankergrund vermuteten, legten wir bei. Die Boote wurden auch gleich zur Prüfung abgeschickt. Während ihrer Beschäftigung sah ich, wie eine große Anzahl von Kanus sich um sie her versammelte. Ich befürchtete, daß die Insulaner willens sein möchten, unsere Leute anzugreifen. Da ich nun gern allem Unheil vorbeugen wollte, so gab ich den Booten ein Zeichen, an Bord zurückzukommen, und feuerte, um den Eingeborenen ein wenig Ehrfurcht einzuflößen, zu gleicher Zeit eine neunpfündige Kugel über ihre Köpfe hinweg. Das Boot ruderte nun dem Schiffe zu. Der Donner des Neunpfünders hatte zwar die Insulaner erschreckt, doch ließen sie sich dadurch nicht abhalten, unseren Booten nachzurudern, und als sie diese nach dem Schiff zurückkehren sahen, suchten sie, einem von ihnen den Weg abzuschneiden. Da aber dieses Boot schneller segeln konnte, als die Kanus ruderten, ließ es die es umschwärmenden Eingeborenen bald hinter sich zurück. Inzwischen lauerten ihm verschiedene andere, die mit Insulanern gefüllt waren, unterwegs auf und warfen mit Steinen nach der Mannschaft, wodurch auch wirklich einige Bootsleute verwundet wurden. Der Offizier im Boot feuerte hierauf eine mit Schrot geladene Flinte auf den Mann, der den ersten Stein geworfen hatte, und verwundete ihn an der Schulter. Sobald die übrigen Kanuinsassen die Verwundung ihres Kameraden sahen, sprangen sie ins Meer, und die anderen Eingeborenen ruderten äußerst bestürzt und erschrocken hinweg. Nachdem unsere Boote wieder am Schiffe beigelegt hatten, ließ ich sie an Bord nehmen, und gerade wollten wir wieder weitersegeln, als wir ein großes Kanu uns nachsetzen sahen.
Da ich vermutete, daß sich in ihm vielleicht irgendeiner von den Anführern dieser Leute oder sonst jemand befinden könnte, der abgeschickt wäre, um mir eine Botschaft vom Oberhaupte zu bringen, hielt ich für gut, es zu erwarten. Es segelte sehr schnell und war bald an dem Schiffe, wir konnten aber unter allen Insassen keinen unterscheiden, der etwas mehr als der andere vorgestellt hätte. Jedoch stand endlich einer von ihnen auf, hielt eine Anrede, die ungefähr 5 Minuten dauerte, und warf alsdann einen Bananenzweig an Bord. Dies hielten wir für ein Friedenszeichen und erwiderten es, indem wir einen von den Zweigen, die von den vorigen Insulanern im Schiff zurückgelassen waren, dem Redner über Bord reichten. Mit diesem und einigen Kleinigkeiten, die wir ihm nachher schenkten, schien er sehr vergnügt zu sein und ruderte bald darauf mit seinem Kanu wieder weg.
Die Offiziere, die mit den Booten ausgeschickt worden waren, berichteten mir, daß sie hart an der Klippenreihe gelotet und hier ebenso tiefes Wasser wie an den andern Inseln gefunden hätten. Da ich aber auf der Seite der Insel war, die gegen den Wind hin lag, so konnte ich mit einiger Wahrscheinlichkeit erwarten, daß ich Ankergrund finden würde, wenn ich unter dem Winde hinsegelte. Ich steuerte also in dieser Richtung, fand aber, daß am südlichen Ende eine Menge Klippen sehr weit in See hinausliefen; ich faßte also den Wind näher und fuhr die ganze Nacht über fort, gegen den Wind zu steuern, um auf solche Weise längs der Ostseite der Insel hinlaufen zu können.
Um 5 Uhr morgens gingen wir wieder unter Segel. Eine merkwürdige Spitze, die einem Zuckerhute ähnlich sah, lag in Nordnordosten. Wir waren in dieser Lage ungefähr zwei Seemeilen weit vom Lande; dieses hatte hier ein sehr anmutiges Äußere und war mit Häusern der Eingeborenen weithin besät. Nahe an der Küste sahen wir verschiedene große Kanus unter Segel, sie steuerten aber nicht auf uns zu. Um Mittag waren wir zwei bis drei Kilometer von der Insel entfernt. Wir setzten unsern Lauf immer längs der Küste fort, bald kamen wir ihr auf eine halbe Seemeile nahe, bald hielten wir uns vier bis fünf Meilen von ihr entfernt, nirgends aber hatten wir bisher Ankergrund gefunden. Um 6 Uhr abends befanden wir uns einem schönen Flusse gegenüber, und da die Küste hier ein besseres Aussehen hatte, als an irgendeiner andern Stelle, beschloß ich, die ganze Nacht hindurch auf und ab zu steuern und am Morgen zu versuchen, Grund zu finden. Sobald es finster war, sahen wir sehr viele Lichter längs der ganzen Küste.
Bei Tagesanbruch schickten wir die Boote zur Prüfung aus, und bald nachher gaben sie uns durch Zeichen zu verstehen, daß sie einen 35 Meter tiefen Ankergrund gefunden hätten. Dies verursachte eine allgemeine und unbeschreiblich große Freude; wir liefen augenblicklich gegen den Strand hin und kamen in 30 Meter auf einem reinen Sandgrunde vor Anker. Wir lagen ungefähr eine Seemeile weit von der Küste und einem schönen Flusse gegenüber.
Sobald wir das Schiff gesichert hatten, schickte ich die Boote aus, um längs der Küste hin zu fahren und zugleich die Stelle, an der wir die Flußmündung sahen, in Augenschein zu nehmen. Um diese Zeit kam eine beträchtliche Anzahl von Kanus vom Lande her ans Schiff; sie brachten Schweine, Federvieh und Früchte in großer Menge mit sich und überließen uns alles gegen kleine Spielsachen und Nägel. Wir bemerkten, daß, sobald unsre Boote gegen die Küste hinruderten, die Kanus, von denen die meisten doppelt und sehr groß waren, ihnen nachsegelten. Solange sie noch in der Nähe unsres Schiffes waren, blieben die Kanus in achtungsvoller Entfernung; sobald aber die Boote von uns weg gegen die Küste liefen, wurden die Wilden kühner, und endlich rannten gar drei von ihren größten Kanus gegen eins von unsern Booten, stießen dessen Verdeck ein und rissen seine Ausleger hinweg. Die Insulaner machten sogar Miene, mit Keulen und Rudern unser Boot zu entern. Da meine Leute derart sehr ins Gedränge kamen, sahen sie sich genötigt, Feuer zu geben. Einer von den Angreifern wurde durch die Salve getötet, ein anderer schwer verwundet. Beide fielen gleich, wie sie getroffen waren, über Bord; augenblicklich sprangen ihnen alle ihre Landsleute, die in demselben Kanu gesessen waren, in die See nach, die andern beiden Kanus aber zogen sich zurück, so daß unsere Boote von nun an ungehindert weitersegelten. Sobald die in See gesprungenen Eingeborenen sahen, daß unsere Boote sich entfernten, ohne ihnen weiter Schaden zu tun, schwammen sie ihrem Kanu nach, schwangen sich hinein und hoben ihre verwundeten Landsleute an Bord. Sie stellten sie aufrecht in das Kanu, um zu sehen, ob sie stehen könnten; da aber die armen Verwundeten sich nicht aufrecht halten konnten, versuchten sie zu sitzen. Einer von ihnen war stark genug dazu und wurde in dieser Lage unterstützt; als sie jedoch hernach den andern völlig tot fanden, legten sie seinen Leichnam der Länge nach ausgestreckt in das Boot. Hierauf ruderten einige Kanus ans Land, kehrten aber wieder an das Schiff zurück, um mit uns zu handeln. Man sah also wohl, daß sie aus unserm Betragen unsre Friedfertigkeit erkannt hatten, und daß sie nichts zu befürchten hätten, solange sie uns ehrlich nahten, und sie mußten sich auch wohl bewußt sein, daß sie alle Schuld an dem Vorgefallenen einzig sich allein beizumessen hatten.
Die Boote beschäftigten sich indessen bis Mittag vor der Küste und kamen alsdann mit dem Berichte zurück, daß der Grund sehr rein sei, daß die Küste ungefähr eine viertel Meile von der See weit etwa 9 Meter tief sei, daß aber an dem Orte, wo wir den Fluß gesehen hatten, sehr hohe Brandung an den Strand schlage. Die Offiziere sagten mir, daß es an der Küste von Eingeborenen wimmle, und daß viele von ihnen an das Boot geschwommen wären und ihnen einige Früchte und auch etwas frisches Wasser gebracht hätten; dieses Wasser hatten sie in Bambusgefäßen aufbewahrt. Unsere Leute berichteten auch, die Insulaner hätten sie recht bestürmt, mit ihnen an Land zu gehen.
Des Nachmittags schickte ich die Boote wiederum an Land. Ich gab ihnen etliche kleine Fäßchen mit, die oben gefüllt werden und einen Handgriff haben, an dem man sie trägt. Ich befahl ihnen, sie sollten sich Mühe geben, ein wenig frisches Wasser zu bekommen, weil wir bereits damals anfingen, Wassermangel zu leiden. Unterdessen blieben noch immer viele Kanus um unser Schiff herum, weiter ließ ich sie jedoch nicht kommen; denn die Insulaner hatten mich schon so oft und so vielfältig betrogen und bestohlen, daß ich mir vornahm, zunächst keinen mehr an Bord zu lassen.
Um 5 Uhr nachmittags kehrten die Boote zurück, sie brachten aber nicht mehr als zwei Fäßchen Wassers mit. Diese beiden Fässer hatten die Eingeborenen für sie gefüllt, für ihre Mühe aber hatten sie sich ohne weiteres mit den übrigen Gefäßen bezahlt gemacht. Unsere Leute wollten sich nicht an Land wagen, damit das Boot nicht unbesetzt bliebe; sie ließen indes vom Boote aus kein Mittel unversucht, um die Insulaner zu bewegen, die Wassergefäße wieder zurückzugeben. Doch da war alle Mühe umsonst. Die Eingeborenen legten ihrerseits unseren Leuten dringend ans Herz, zu landen; diese folgten jedoch dem Gebote der Klugheit und lehnten ab. Als unsere Boote wegruderten, befanden sich ihrer Aussage nach viele Tausende von Eingeborenen beiderlei Geschlechts und eine große Anzahl Kinder am Strande.
Am folgenden Morgen schickte ich die Boote von neuem an Land, Wasser zu holen. Ich ließ sie Nägel, Beile und mehr dergleichen Dinge mitnehmen, durch die sie meiner Ansicht nach die Freundschaft der Eingeborenen am leichtesten erlangen könnten. Mittlerweile kam vom Lande her eine große Anzahl von Kanus an das Schiff; die Leute brachten uns Brotfrucht, Bananen, eine Frucht, die einem Apfel ähnlich sah, aber ungleich wohlschmeckender war als dieser, auch Federvieh und Schweine. Alle diese Eßwaren überließen sie uns gegen einige Glasperlen, für Nägel, Messer und dergleichen mehr, und wir bekamen gleich dieses Mal Schweinefleisch genug, daß unsere ganze Schiffsmannschaft zwei Tage lang damit gespeist werden konnte und jeder Mann ein Pfund davon bekam.
Als die Boote zurückkamen, brachten sie uns nur einige wenige Kalebassen Wassers mit; mehr hatten sie nicht bekommen können, weil die Anzahl der Leute auf dem Strande so groß war, daß sie es nicht wagen wollten, an Land zu gehen. Die Eingeborenen suchten alles hervor, um unsere Leute zum Landen zu reizen: sie brachten Früchte und Lebensmittel allerlei Art, legten diese am Strande nieder und luden unsere Leute durch Zeichen ein, ihnen diese Vorräte verzehren zu helfen. Nichtsdestoweniger blieben diese fest; sie zeigten von ihrem Boote aus den Insulanern die Wasserfäßchen und forderten sie auf, die gestern verlorengegangenen wieder zurückzubringen. Dagegen blieben die Eingeborenen ebenfalls taub; unsere Leute lichteten also ihre Anker, sondierten in der ganzen Gegend herum, um zu sehen, ob das Schiff nicht näher gegen die Küste landen könnte, daß es die Wasserholer hätte beschützen können, und hätten sich in diesem Falle nicht gescheut, der ganzen Insel zum Trotz an Land zu gehen. Als sie mit dieser Untersuchung fertig waren und sich alsdann vom Ufer entfernten, warfen die Weiber mit Äpfeln und Bananen hinter ihnen drein, lachten sie tüchtig aus und ließen alle ersinnlichen Merkmale von Verachtung und Hohn gegen sie blicken. Meine Leute meldeten mir, daß 400 Meter weit von der Küste der Grund sandig und das Wasser 7 Meter tief sei, daß es noch einige Kabeltaulängen weiter vom Strande 9 Meter Tiefe gäbe, und daß also das Schiff an einer dieser beiden Stellen gut vor Anker liegen könnte. Der Wind blies hier gerade längs der Küste und verursachte eine hohe Brandung sowohl gegen das Schiff als gegen den Strand hin.
Den folgenden Morgen lichteten wir also bei Tagesanbruch wiederum die Anker, in der Absicht, den »Delphin« nahe an der Wasserstelle festzulegen. Als wir aber zu diesem Zweck weiter gegen den Wind hinsegelten, entdeckten wir vom Mastkorbe aus über das Land hinweg einen Meerbusen, der ungefähr 6–8 Kilometer weit unter dem Winde von uns liegen mochte. Wir steuerten sogleich darauf zu und schickten die Boote mit dem Senkblei voran. Um 9 Uhr gaben die Boote das Zeichen, daß sie in einer Tiefe von 21 Meter Grund gefunden hätten; diese Gegend war von einer Reihe von Klippen umgeben, um die wir herumlaufen mußten, ehe wir an den Ort hinsteuern konnten, wo die Boote lagen. Als wir nicht mehr weit von ihnen und gleichsam mitten zwischen beiden waren, stieß das Schiff auf Grund. Das Vorderteil saß unbeweglich fest, das Hinterteil hingegen war frei; wir warfen augenblicklich das Senkblei aus und fanden, daß die Tiefe des Wassers auf den Klippen oder auf der Untiefe von 31 auf 6 Meter abnahm. Wir beschlugen also in größter Eile alle Segel und warfen alles alte Geräte, das damals an Bord war, in die See. Zu gleicher Zeit setzten wir das lange Boot auf Wasser, legten den Strom- und den kleinen Anker mit allem dazugehörigen Tauwerk hinein und ließen das Boot über die Untiefe hinauslaufen. Hier sollte die Mannschaft die Anker fallen lassen, und wenn diese nur Grund gefaßt hätten, hoffte ich, der »Delphin« würde mit Hilfe der Schiffswinde von den Klippen abgebracht werden können. Allein zum Unglück fand sich über die Untiefe hinaus kein Grund. Unser Zustand war in dieser Lage ziemlich gefährlich zu nennen. Das Schiff schlug noch immer sehr heftig gegen die Felsen, und wir waren von vielen hundert Kanus umringt, die alle vollbesetzt waren. Ihrer Menge ungeachtet versuchten sie indessen doch nicht, sich an Bord zu wagen, sondern es schien, als wollten sie ruhig unser Scheitern erwarten. Eine ganze Stunde lang brachten wir in dieser Gefahr voller Schreck und Angst zu, ohne daß wir zur Befreiung des Schiffs viel unternehmen konnten. Endlich erhob sich zum Glück ein günstiger Wind vom Lande her, und durch dessen Beihilfe kam das Vorderteil des Schiffes wieder los. Nun ließen wir sogleich alle Segel fallen, und es währte auch nicht lange, so geriet das Schiff in Bewegung, und in kurzer Zeit befanden wir uns wieder in tieferem Wasser.
Darauf entfernten wir uns schleunigst von dieser gefährlichen Stelle und schickten die Boote unter dem Winde hin, um die Untiefe gehörig untersuchen zu lassen. Sie fanden, daß der Klippenzug sich ungefähr anderthalb Kilometer weit gen Westen in die See erstreckte, und daß zwischen Land und Klippenzug ein sehr guter Hafen lag. Der Bootsmann ließ also eines unsrer Boote am Ende der Klippen stillegen und einen Anker nebst kleinen Kabeltauen und eine tüchtige Wache an Bord des langen Bootes bringen, um es gegen alle Angriffe der Insulaner verteidigen zu können. Nachdem er damit fertig war, kam er selbst an Bord zurück und führte das Schiff um die Reihe von Klippen herum in den Hafen, wo wir um 12 Uhr in 30 Meter Tiefe auf einem guten Grunde von schwarzem Sand endlich vor Anker kamen.
Bei genauer Untersuchung fand sich, daß an der Stelle, wo das Schiff auf die Klippen geraten war, sich eine Reihe schroffer Korallenfelsen erhob, und daß das Wasser innerhalb dieser Riffe sehr ungleich von 10 zu 3½ Meter tief war. Zu unserm Unglück lag diese Stelle gerade zwischen den beiden Booten, die wir vorausgeschickt hatten, um uns die Hafeneinfahrt zu weisen. Die Leute in den Booten vermuteten indessen nicht, daß zwischen ihren Standplätzen eine solche Gefahr drohen könne; denn das eine Boot gegen den Wind hin befand sich in einer Tiefe von 21 und das andere unter dem Wind in einer Tiefe von 16 Meter Wasser. Kaum waren wir von diesen Felsenklippen losgekommen, als der Wind stärker zu wehen anfing, und obgleich er sich bald wieder legte, ging doch die Brandung so hoch und brach sich so ungestüm am Felsen, daß, wenn das Schiff eine halbe Stunde länger darauf festsitzen geblieben wäre, es unvermeidlich hätte zerschellen müssen. Wir untersuchten nun den Kiel, konnten aber keinen andern Schaden daran entdecken, als daß ein kleines Stück am Vorderteil des Steuerruders fehlte und vermutlich abgebrochen sein mußte. Es schien nicht, als ob wir ein Leck bekommen hätten. Unsere Boote büßten auf der Klippenreihe ihre kleinen Anker ein; da wir indessen hoffen durften, daß das Schiff selbst keinen Schaden gelitten hätte, ließen wir uns diesen Verlust nicht sehr zu Herzen gehen. Sobald der »Delphin« gehörig gesichert war, ließ ich alle unsere Boote bewaffnen und bemannen und schickte sie mit dem Bootsmann aus, um den oberen Teil des Meerbusens zu untersuchen, damit wir, wenn wir dort einen guten Ankerplatz fänden, das Schiff vermittels seiner Anker- und Kabeltaue innerhalb des Klippenzuges weiter hinaufziehen und alsdann sicher vor Anker legen könnten. Auf dem Klippenzuge lag eine große Anzahl von Kanus, und die Küste wimmelte von Leuten. Das Wetter war endlich wieder sehr angenehm geworden.
Um 4 Uhr nachmittags kam der Bootsmann mit dem Berichte zurück, daß es in dieser Gegend überall guten Ankergrund gäbe. Ich entschloß mich daher, am folgenden Morgen den »Delphin« die Bucht hinaufziehen zu lassen, und teilte unterdessen die Mannschaft in vier Wachen, wovon allezeit eine unter Gewehr bleiben mußte. Die Kanonen ließ ich alle laden und Pulver auf die Zündlöcher streuen; in die Boote ließ ich Musketen bringen und befestigen und befahl dem Rest der Mannschaft, der nicht auf Wache war, daß sich ein jeder auf dem angewiesenen Platze einfinden sollte, sobald es befohlen würde. Längs der Küste schwärmte eine große Anzahl von Kanus umher; einige von ihnen waren sehr groß und stark bemannt, andere, die viel kleiner waren, kamen mit Schweinen, Federvieh und Früchten beladen zu uns ans Schiff. Wir handelten ihnen diese Lebensmittel immer dergestalt ab, daß wir und sie mit dem Handel zufrieden sein konnten. Bei Sonnenuntergang ruderten alle Kanus an Land zurück.
Am folgenden Morgen um 6 Uhr fingen wir an, das Schiff in den Hafen hinaufzuziehen, und bald darauf stellte sich eine große Menge von Kanus am Heck des »Delphins« ein. Da ich sah, daß sie Schweine, Federvieh und Früchte an Bord hatten, befahl ich den Offizieren, diese Vorräte gegen Messer, Nägel, Glasperlen und andere Kleinigkeiten einzutauschen, und ordnete zu gleicher Zeit an, daß außer den hierzu ernannten Personen niemand im ganzen Schiff sich auf den Handel einlassen dürfe. Um 8 Uhr hatte sich die Anzahl der Kanus sehr vermehrt, und die zuletzt herangekommenen waren große Kanus mit 12–15 Mann Besatzung. Ich sah zu meinem größten Mißvergnügen, daß sie eher zum Krieg als zum Handel ausgerüstet waren, indem sie fast nichts als runde Kieselsteine an Bord hatten. Da mein erster Leutnant noch immer sehr krank war, so ließ ich Leutnant Fourneaux holen und trug ihm auf, die zur vierten Wache beorderten Matrosen beständig unter Gewehr zu halten, indessen ich durch den Rest der Mannschaft das Schiff in den Hafen weiter hinaufziehen lassen würde. Mittlerweile kamen von der Küste her unaufhörlich neue Kanus heran, die eine ganz andere Art von Ladung an Bord hatten, nämlich eine Anzahl von Frauen. Unterdessen zogen sich die mit Kieselsteinen bewaffneten Kanus immer näher um unser Schiff zusammen; einige der Insassen sangen mit rauher Stimme, andere bliesen auf großen Muscheln, andere auf Flöten. Es währte nicht lange, so gab ein auf einer Art von Traghimmel auf einem der größten Doppelkanus sitzender Mann ein Zeichen, daß er neben unserm Schiff anlegen wolle. Ich ließ meine Einwilligung erkennen, und als er hierauf dicht an das Schiff kam, reichte er einem von unsern Matrosen ein Bündel von roten und gelben Federn und verlangte durch Zeichen, ich solle das Geschenk annehmen. Ich nahm es auch unter vielen Freundschaftsbezeigungen zu mir und hieß sogleich einige Kleinigkeiten herbeibringen, um ihm diese anzubieten. Allein zu meiner großen Verwunderung hatte er sich während dieser Zeit schon wieder vom Schiffe entfernt und warf den Zweig eines Kokosbaumes in die Luft. Dies war, wie ich sogleich erfuhr, das Zeichen zum Angriff; denn auf allen Kanus erhob sich plötzlich ein allgemeines Jauchzen. Sie ruderten schnell gegen das Schiff an und ließen von allen Seiten her einen Hagel von Steinen hineinprasseln. Da sie uns auf solche Weise förmlich angegriffen hatten und nichts als unsere Waffen uns gegen eine solche Menge schützen konnte, befahl ich der Wache zu feuern. Zwei von den auf Verdeck befindlichen Kanonen, die ich mit Kugeln hatte laden lassen, wurden ebenfalls fast zu gleicher Zeit abgefeuert, und die Eingeborenen gerieten dadurch in nicht geringe Bestürzung. Doch in einigen Minuten hatten sie sich wieder erholt und griffen uns zum zweiten Male an. Mittlerweile hatte sich ein jeder von uns auf seinem angewiesenen Platze eingefunden; ich befahl zudem, daß die großen Kanonen abgefeuert und einige davon stets auf einen gewissen Punkt an der Küste gerichtet werden sollten, wo eine große Menge von Kanus noch immer frische Mannschaft einnahm und in der größten Geschwindigkeit gegen das Schiff heransegelte. Als das schwere Geschütz anfing zu spielen, waren gewiß nicht weniger als 300 Kanus, die zusammen wohl an 2000 Mann an Bord haben mochten, um den »Delphin«. Viele Tausende waren noch an der Küste, und eine Menge anderer Kanus kam außerdem von allen Seiten auf uns los.
Das Feuer trieb endlich die Kanus, die nahe dem Schiff hielten, hinweg und schreckte auch die andern ab, näher zu kommen. Sobald ich sah, daß sie sich zurückzogen und die andern sich ruhig verhielten, ließ ich augenblicklich das Feuern einstellen in der Hoffnung, daß sie jetzt hinlänglich überzeugt wären, wie sehr wir ihnen überlegen, und daß sie daher das Gefecht nicht weiter fortsetzen würden. Hierin irrte ich mich aber zum Unglück; eine große Anzahl von Kanus, die zerstreut worden waren, stießen wieder zusammen, lagen eine kleine Zeit über stille und beobachteten das Schiff in einer Entfernung von ungefähr einer viertel Meile, steckten alsdann weiße Wimpel auf, ruderten gegen das Hinterteil des Schiffes zu und fingen wie zuvor an, aus beträchtlicher Entfernung mit großer Stärke und Geschicklichkeit Steine hineinzuschleudern. Jeder von diesen Steinen wog ungefähr zwei Pfund, und viele von unseren Leuten an Bord wurden durch sie verwundet; ohne Zweifel hätten wir noch mehr Schaden gelitten, wenn nicht ein Segeltuch zum Schutz gegen die Sonne über das ganze Verdeck aufgespannt und die Hängematten mitten im Schiff in Netzen wären aufgehängt gewesen. Zu gleicher Zeit näherten sich verschiedene, stark bemannte Kanus dem Bug des Schiffes, vermutlich weil sie bemerkt hatten, daß von diesem Teile noch kein Schuß war abgefeuert worden. Ich ließ daher einige Kanonen nach vorn bringen, genau richten und auf diese Kanus feuern. Zu gleicher Zeit ließ ich zwei Kanonen am Hinterteil herausführen und diese hauptsächlich auf die Angreifenden richten.
Unter den Kanus, die gegen den Bug angriffen, befand sich eines, das irgendeinen von ihren Anführern an Bord haben mußte, weil von diesem Kanu aus das Zeichen gegeben worden war, auf das sich die andern zurückgezogen hatten. Es traf sich, daß ein von den andern Kanonen abgefeuerter Schuß eben dieses Kanu so genau traf, daß er es mitten durchriß. Sobald die übrigen dies sahen, hielten sie nicht länger stand, sondern zerstreuten sich so geschwind, daß binnen einer halben Stunde kein einziges Kanu mehr zu sehen war. Das Volk, das sich vorher an den Strand begeben hatte, floh ebenfalls in größter Eile über das Gebirge.
Da wir nun keine begründete Besorgnis mehr zu haben brauchten, von neuem gehindert zu werden, zogen wir das Schiff vollends in den Hafen hinein, und um Mittag befanden wir uns kaum mehr eine halbe Seemeile weit von dem oberen Teile des Meerbusens, nicht ganz zwei Kabeltaulängen von einem schönen Flusse und ungefähr 90 Meter weit von der verborgenen Klippenreihe. Wir hatten auf diesem Fleck 16 Meter Wassertiefe, hart an der Küste waren es 9 Meter, so daß wir hier Anker werfen konnten. Wir brachten auch die 8 Kanonen, die ich vordem in den Schiffsraum hatte hinabschaffen lassen, wieder hinauf und an ihre Plätze. Sobald das geschehen war, schickte ich die Boote aus, daß sie ringsherum sondieren sollten, befahl ihnen auch, daß, wenn sich jemand von den Eingeborenen an der Küste sollte blicken lassen, sie so gut wie möglich die Gegend daselbst untersuchen möchten, um festzustellen, ob wir etwa einen neuen Angriff von den Eingeborenen zu befürchten hätten.
Der ganze Nachmittag und ein Teil des folgenden Morgens wurden mit diesen Arbeiten zugebracht. Um Mittag kam der Bootsmann mit einer ungefähren Karte des Meerbusens zurück. Er meldete mir, daß sich kein Kanu habe blicken lassen und daß die Landung überall bequem zu bewerkstelligen sei. Kurz nachdem mir der Bootsmann diesen Bericht abgestattet hatte, ließ ich alle unsere Boote bemannen und bewaffnen und schickte damit Herrn Fourneaux nebst einer Abteilung Seesoldaten mit dem Auftrag ab, dem Ankerplatz des Schiffes gegenüber zu landen und unter der Bedeckung der Boote und des »Delphins« an einem vorteilhaften Punkt Stellung zu beziehen.
Um 2 Uhr landeten die Boote ohne den geringsten Widerstand. Herr Fourneaux richtete alsbald einen Mast auf, ließ den Wimpel flattern, ein Stück Rasen umgraben und nahm damit von der Insel im Namen Seiner Majestät Besitz, zu deren Ehren er sie »König Georgs des Dritten Insel« nannte. Hierauf ging er an den Fluß und kostete das Wasser, das er von vortrefflichem Geschmack fand; er ließ also etwas davon schöpfen, goß ein wenig Rum dazu, und seine Leute tranken eine Runde auf die Gesundheit Seiner Majestät.
An dem Flusse, der 12 Meter breit und so seicht war, daß man hindurchwaten konnte, erblickte er jenseits zwei alte Männer, die, sobald sie sich entdeckt sahen, eine flehende Stellung annahmen und dabei sehr bestürzt und erschrocken zu sein schienen. Herr Fourneaux winkte ihnen, daß sie über den Fluß kommen sollten, was auch der eine tat. Als er diesseits ans Land stieg, kroch er auf Händen und Füßen zu Herrn Fourneaux heran. Dieser hob ihn aber sogleich auf und zeigte ihm, als er zitternd dastand, einige der ins Schiff geworfenen Steine, wobei er ihm zu verstehen gab, daß wir unsrerseits den Eingeborenen keinen Schaden tun würden, wenn sie nicht selbst versuchten, uns anzugreifen. Er ließ zwei von den Wasserfässern füllen, um zu zeigen, daß wir Wasser verlangten, und wies ihm einige Beile und andere Dinge, zum Zeichen, daß wir Lebensmittel dagegen eintauschen wollten. Während dieser pantomimischen Unterredung faßte der alte Mann wieder einigen Mut, und Herr Fourneaux schenkte ihm zur Bestätigung seiner Freundschaft ein Beil, etliche Nägel, Glasperlen und andere Kleinigkeiten. Hierauf stieg er mit seinen Leuten wieder in die Boote und ließ den Wimpel wehend am Strande zurück.
Sobald die Boote vom Lande abgestoßen waren, ging der Greis zu dem Wimpel hin und tanzte eine geraume Zeit lang um ihn herum; dann entfernte er sich, kam aber bald nachher mit einigen grünen Zweigen zurück, die er hinwarf, um sich alsbald zum zweiten Male hinwegzubegeben. Doch währte es nicht lange, so kam er in Begleitung von zwölf andern wieder zum Vorschein; alle nahmen eine demütige Haltung ein und näherten sich langsam und ehrfurchtsvoll dem Wimpel. Weil er aber zufällig im Winde stark flatterte, als sie ihm nahe kamen, flohen sie in größter Bestürzung. Nachdem sie eine kleine Zeitlang von ferne gestanden, gingen sie plötzlich davon und brachten dann zwei lebendige Schweine zurück, die sie am Fuße des Wimpelmastes niederlegten. Endlich faßten sie Mut und fingen an zu tanzen. Als diese Zeremonie beendet war, brachten sie die Schweine an den Strand hinab, stießen ein Kanu ins Wasser und legten die Schweine hinein. Der Greis, der einen langen weißen Bart hatte, setzte sich sodann ganz allein zu diesen Tieren und brachte sie ans Schiff. Als er neben dem »Delphin« anlegte, reichte er uns einige grüne Bananenblätter nacheinander herein und sprach bei jedem in einem feierlichen, langsamen Tone ein paar Worte. Nachdem er endlich damit fertig war und auch die Schweine hereingereicht hatte, drehte er sich um und wies auf das Land. Ich befahl, ihm einige Geschenke zu geben, die er aber nicht annahm. Kurz darauf stieß er sein Kanu vom Schiffe ab und fuhr ans Land zurück.
Bald nachdem es finster geworden war, hörten wir das Lärmen vieler Trommeln, großer Muscheltrompeten und anderer Blasinstrumente. Wir sahen auch eine Menge Lichter längs der ganzen Küste sich bewegen.
Um 6 Uhr des Morgens, als wir keinen von den Eingeborenen an der Küste erblickten, dagegen aber den Wimpel entfernt sahen — den die Insulaner vermutlich, wie in der Fabel die Frösche ihren königlichen Klotz, hatten verachten lernen —, befahl ich dem Leutnant, eine Wache mit an Land zu nehmen und, wenn alles ruhig wäre, es uns zu melden, damit wir mit der Füllung unserer Wasserfässer beginnen könnten. Bald darauf ließ er mir zu meiner Freude melden, daß er bereits eine Anzahl von Wasserfässern habe an Land bringen lassen; um 3 Uhr hatten wir schon 4 Tonnen voll an Bord. Während unsere Leute mit dem Füllen beschäftigt waren, erschienen einige von den Eingeborenen am jenseitigen Ufer unter Anführung des Greises, den der Offizier am Tage vorher gesehen hatte. Bald kam der alte Mann herüber und brachte einige Früchte und etwas Federvieh mit, das uns dann an Bord geschickt wurde.
Ich war um diese Zeit schon seit ungefähr 14 Tagen sehr krank und befand mich eben damals so schwach, daß ich kaum herumkriechen konnte. Da ich nun nicht selbst an Land gehen konnte, gebrauchte ich mein Fernglas, um vom Schiffe aus zu sehen, was an Land vorging. Um 9 Uhr kam eine Menge von Eingeborenen über den Berg marschiert, der ungefähr eine Meile weit von dem Strome ab liegen mochte. Zu gleicher Zeit entdeckte ich eine große Anzahl von Kanus, die um die westliche Landspitze herumliefen und längs der Küste sich näherten. Ich blickte hierauf nach der Wasserstelle und bemerkte dahinter, wo die Aussicht freilag, eine zahlreiche Schar von Eingeborenen, die unter den Gebüschen hinschlichen. Zugleich entdeckte ich eine unzählbare Menge Wilder, die in den Wäldern gegen die Wasserstelle anrückten, und noch mehrere Kanus, die sehr schnell um die andere Landspitze der Bucht gegen Osten herkamen.
Ich erschrak über diese Anstalten und fertigte sogleich ein Boot ab, um dem Offizier am Lande hinterbringen zu lassen, was ich gesehen hatte, und ihm zu befehlen, augenblicklich mit seiner Mannschaft wieder an Bord zurückzukommen, ja, im Notfall die Fässer zurückzulassen. Jedoch er hatte bereits die ihm drohende Gefahr selbst entdeckt und war ungeheißen an Bord seines Bootes gegangen, noch ehe meine Botschaft ihn erreichte. Sobald er inne ward, daß die Eingeborenen sich den Schatten des Waldes zunutze machten, um heimlich gegen ihn heranzuschleichen, schickte er sogleich den Greis an sie ab und gab ihnen durch Zeichen zu verstehen, daß sie in einer gewissen Entfernung bleiben sollten, und daß er nichts als Wasser verlange. Als sie merkten, daß sie entdeckt waren, fingen sie an, zu rufen, und rückten noch geschwinder gegen ihn an. Der Offizier zog sich augenblicklich mit seiner Mannschaft in die Boote zurück. Während seines Rückzuges waren die Eingeborenen über den Fluß gegangen und hatten unter lautem Freudengeschrei Besitz von den Wasserfässern genommen. Ihre Kanus fuhren nun aufs schnellste längs der Küste zum Wasserplatze, und alles Volk lief ebendahin. Eine Menge von Frauen und Kindern aber rannte auf einen Berg, von wo aus sie den Meerbusen und den Strand übersehen konnten, und ließ sich hier nieder. Sobald die Kanus von beiden Landspitzen der Bucht her in die Gegend kamen, wo unser Schiff vor Anker lag, stießen sie an Land und nahmen noch immer mehr Leute auf, die große Säcke trugen. Diese waren, wie sich später herausstellte, mit Steinen gefüllt. Nunmehr näherten sich alle Kanus unserem Schiffe. Ich durfte also wohl nicht mehr länger daran zweifeln, daß die Eingeborenen ihr Kriegsglück in einem neuen Angriff zu versuchen trachteten. Da nun meiner Meinung nach das sicherste Mittel zur Verminderung des Unheils war, den Kampf möglichst kurz zu gestalten, beschloß ich, ein für alle Male den Feindseligkeiten ein entschiedenes Ende zu machen.
Ich befahl daher meinen Leuten, die alle die ihnen angewiesenen Plätze eingenommen hatten, zunächst auf die Kanus zu feuern, welche schon in hellen Haufen auf dem Plan erschienen. Dies geschah auch augenblicklich mit solchem Nachdruck, daß alle Kanus im Westen der Bucht in voller Hast an den Strand eilten, während die im Osten alsbald um die Klippenreihe herumruderten, um sich der Wirkung unserer Kanonen zu entziehen. Darauf richtete ich das Feuer nach verschiedenen Gegenden des Waldes, so daß die Eingeborenen bald daraus vertrieben wurden und den Berg hinaufrannten, wo die Frauen und Kinder sich niedergesetzt hatten, um der Schlacht zuzusehen. Auf diesem Berge befanden sich nunmehr viele Tausende, die sich hier für vollkommen sicher hielten. Um sie aber vom Gegenteil zu überzeugen, befahl ich, vier Schüsse gegen sie abzufeuern. Ich dachte, wenn die Eingeborenen unsere Kugeln ungleich weiter fliegen sähen, als sie erwarteten, würden sie befürchten, wir könnten so weit schießen, wie wir überhaupt nur wollten. Zwei von den Kugeln fielen hart an einem Baume nieder, unter dem eine große Menge versammelt saß, und jagten dieser einen solchen Schrecken ein, daß nach 2 Minuten keine Seele mehr zu sehen war.
Als ich nun die Küste völlig gesäubert hatte, bemannte und bewaffnete ich die Boote, schickte unter großer Bedeckung meine Zimmerleute mit ihren Äxten ab und befahl ihnen, alle zurückgelassenen Kanus zu zerstören. Noch vor Mittag war diese Arbeit vollendet, und mehr als 50 Kanus, von denen viele wohl gegen 20 Meter lang, 1 Meter breit und zu je zweien durch Balken miteinander verbunden waren, lagen zerstückt am Strande. Man fand in ihnen nichts als Steine und Schleudern, nur an Bord zweier viel kleinerer Kanus waren einige wenige Früchte, etwas Federvieh und einige Schweine.
Um 2 Uhr nachmittags kamen gegen zehn Eingeborene aus dem Walde hervor mit grünen Zweigen in den Händen, die sie am Strande in die Erde steckten; alsdann gingen sie wieder fort. Bald nachher brachten sie Schweine, denen sie die Füße festgebunden hatten. Hierauf holten sie aus dem Walde etliche Bündel von dem Zeuge, dessen sie sich zur Kleidung bedienen, und das dem chinesischen Papier einigermaßen ähnlich sieht, legten diese gleichfalls am Strande nieder und riefen uns zu, daß wir alle Sachen abholen möchten. Da wir ungefähr 3 Kabeltaulängen von der Küste entfernt lagen, konnten wir nicht genau erkennen, woraus dieses Sühneopfer im einzelnen bestand. Daß es Schweine und auch ein ganzer Ballen von ihrem heimischen Zeuge sein mochte, errieten wir. Als wir aber auch andere Tiere, mit ihren Vorderfüßen über dem Nacken gebunden, verschiedene Male aufstehen und eine kleine Strecke auf den Hinterfüßen fortlaufen sahen, hielten wir sie für seltsame, uns unbekannte Wesen und waren daher sehr neugierig, sie näher zu betrachten. Ein Boot wurde also schnell an Land geschickt, wo natürlich die Verwunderung sich bald löste: es waren nämlich Hunde. Unsere Leute fanden außer den Hunden und dem Zeuge neun tüchtige Schweine. Diese wurden an Bord gebracht, die Hunde dagegen ließ man los, auch das Zeug blieb am Lande liegen. Für die Schweine legten unsere Leute einige Beile, Nägel und andere Dinge auf dieselbe Stelle hin und winkten einigen von den Eingeborenen, die sich sehen ließen, daß sie unsre Gegengaben nebst ihrem Zeuge abholen und behalten sollten. Bald nachdem das Boot am Schiff wieder angelegt hatte, brachten die Insulaner noch zwei Schweine und machten uns Zeichen, diese zu holen. Das Boot kehrte demnach an Land zurück und brachte die beiden Schweine mit, ließ das Zeug jedoch wieder unbeachtet liegen, obwohl uns die Eingeborenen zur Mitnahme aufforderten. Unsere Leute berichteten mir, daß die Wilden von all den Sachen, die ich für sie auf den Strand hatte hinlegen lassen, nichts angerührt hätten; einer von uns war der Meinung, daß sie die Geschenke deswegen nicht nehmen mochten, weil wir auch das Zeug abgewiesen hätten, weshalb ich befahl, nunmehr auch dieses zu holen. Der Ausgang bewies die Richtigkeit dieser Meinung. Denn sobald das Boot das Zeug eingeladen hatte, kamen die Insulaner herab und trugen alles, was ich ihnen geschickt hatte, unter den größten Freudekundgebungen mit sich in den Wald fort. Unsere Leute liefen hierauf an der Küste bis zu dem Ort hin, wo es frisches Wasser gab. Hier füllten sie alle unsere Wasserfässer, die fast 6 Tonnen hielten, und brachten diese zum Schiff. Wir fanden, daß die Fässer, während sie im Besitz der Eingeborenen gewesen waren, keinen Schaden erlitten hatten, büßten aber einige lederne Eimer und Schläuche ein, die mit den Fässern zugleich in ihre Gewalt geraten und nicht wieder zurückgegeben worden waren.