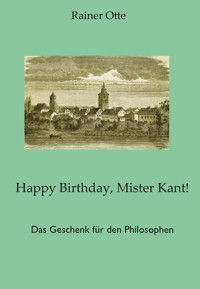Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Motorradfahren ist eine Lebensform, die das Denken in Schwung bringt und aus dem Fahren im Wind eine persönliche Philosophie jedes Motorradfahrers macht. In seinem neuen Buch will Rainer Otte – Philosoph, Publizist und seit 40 Jahren Motorradfahrer – der Frage auf den Grund gehen, was das Motorradfahren mit der Philosophie verbindet. Er hat Geschichten und Gedanken gesammelt, hervorgegangen aus den eigenen Erlebnissen im Sattel und aus Gesprächen mit anderen Bikern. Dabei geraten Dimensionen in den Blick wie • Geschwindigkeit • Augenblick • Landschaft • Historie • Soziale Identitäten des Motorradfahrers • Technikleidenschaft und nicht zuletzt die Glücksmomente der besonderen Ästhetik der Windpassagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Otte
Windpassagen
Die Philosophie des Motorradfahrens
© Parodos Verlag Berlin 2014
Rainer Otte, Dr. phil., geb. 1956, Studium der Philosophie mit den Schwerpunkten Anthropologie und Psychoanalyse in Tübingen. Wissenschaftsjournalist in den Arbeitsbereichen Medizin, Psychologie und Wirtschaft. Dokumentarfilmer (Features über Entwicklungen der Medizin und der Humangenetik sowie Portraits von Ludwig Wittgenstein und Erich Fromm). Buchpublikationen zur Wirtschafts- und zur Medizinethik sowie zu Grundfragen der psychosomatischen Medizin.
Bei Parodos bereits erschienen: Wenn weniger mehr ist. Philosophie der Bescheidenheit
Guten Tag: Hier ist das Vorwort
In einem Seminar über die Philosophie der Künste überkam mich die Lust, eine Ästhetik des Motorradfahrens vorzulegen. Mein Tübinger Lehrer und Freund, Prof. Dr. Rolf Denker, war nachsichtig, kannte er doch meine Leidenschaft für das Motorradfahren. Sie führte mich öfters bis in sein kleines Ferienhäuschen in der Toskana, in dem wir unvergessliche Tage im Kreis von Philosophen, Psychoanalytikern und Künstlern verlebten.
Mein damaliger philosophischer Versuch über das Motorradfahren kam nicht weit, wurde mir aber verziehen. Man hat immer etwas Wichtigeres vor, als sich mit solchen abwegigen Themen zu beschäftigen. Die Frage aber, was das Motorradfahren mit philosophischem Denken zu tun hat oder, vorsichtiger gesagt, möglicherweise zu tun haben könnte, begleitete mich fortan auf fast jeder Tour. Erfahrungen und Reflexionen sammelten sich über die Jahre. Mit dem ungeschriebenen Buch bin ich etwa dreißig Jahre herumgefahren. Sein fertiges Pendant hat – und das muss wohl auch so sein – erhebliche biographische Anteile. Es spannt den Bogen über gut eine Generation der Philosophie- und Sozialgeschichte.
Auf wen oder auf was stützt sich mein Versuch? Gewiss, George Orwell fuhr gern mit seiner Royal Enfield herum, wenn die Maschine freundlicherweise mal gelaufen ist. Aber Orwell war Journalist und Literat. Der schüchterne Samuel Beckett ist mit seinem AJS-Viertakt-Motorrad zum College gefahren und hat gleich, in voller Montur, den Prodekan angerempelt1; sonst ist wenig Zweirädriges überliefert. Oder der Konstruktivist Heinz von Foerster, der seine Puch 125 schlicht ein »geniales Motorrad« nannte unter dem Beifall seines Kollegen Ernst von Glasersfeld.2 Er fuhr es kurz nach dem Krieg, da hatte man ja nichts und war froh über das wenige, was sich noch bewegte oder bewegen ließ. Das alles hatte mit dem ungeschriebenen Buch, das mir im Hinterkopf rumorte, nichts zu tun.
Die Sache wäre nicht so prekär, wenn irgendeiner der zitierfähigen Philosophen sich auf ein Motorrad geschwungen und wenigstens ein paar bekritzelte Zettel dazu hinterlassen hätte. Im Sinne der berufsspezifischen Panikreaktion läge der Gang in die nächste Universitätsbibliothek nahe, um aus den aufgefundenen sensationellen Zeilen die Rechtfertigung eines solchen Buches zu basteln. Erst mal schauen, was die anderen denken, das schützt vor der Fahrt in den Graben – und kappt das eigene Denken von Beginn an.
So geht es nicht – ich sitze ja auch selber auf der Maschine und fahre ohne fremde Hilfe. Warum also nicht von der Erfahrung des Motorradfahrens selbst ausgehen? Mir geht es nicht um eine Tätigkeit, die ich wie ein distanziertes Objekt analysieren will – oder um den Ableger einer Technikphilosophie, die dann in der Frage gipfelt, was denn bloß los sei mit der Subjektivität des Menschen im Zeitalter ihrer technischen Drangsalierbarkeit. Es sind Momente guten Lebens, die Anlass zum Schreiben waren, Augenblicke eines Glücks, das man erleben kann und das mit diesem Motorradfahren zu tun hat. Es ist, wie manches Glück, eigensinnig und bisweilen auch scheu.
Das gute Leben ist, folgen wir Aristoteles, ohne Freundschaft nicht gut genug. »Freundesgut, gemeinsam Gut«3: Das gilt auch für die Philosophie selbst. Das Denken am Leitfaden des Glücks ist selten geworden in der Philosophie. Machen wir eine Ausnahme! Und: Keine Bange, die Kritik kommt beileibe nicht zu kurz. Was gibt es Kritischeres als das Glück, das seine schlechten Nachahmer sofort erkennt und eine Nichtigkeitsklage führt gegen die vielen Plagiate, die in den Schaufenstern stehen?
Kapitel 1
»Irgendeiner schrieb das Wort, dem du glaubst. Ich aber künde dir, dass die Weisheit draußen in den Straßen ruft […].«Nicolaus von Cues (1450)1
Vor dem Start oder: Vom Seemannsgarn zur Diskursmaschine
Einige Menschen lieben hohe Wellen oder den Tanz in Kurven. Sie pfeifen vor Vergnügen, wenn ihnen Wind und Wetter um die Ohren pusten. Ihr schwankendes Gefährt wird zum treuen Begleiter, vielleicht sogar zu einem Teil ihres Lebens. Manchmal hassen sie es auch, aber das geht vorbei. Unterwegs mögen sie brummig und wortkarg sein. Doch kaum angekommen, öffnen sich die Schleusen umso weiter, je mehr sie unter ihresgleichen sind: Motorradfahren produziert unendliche Geschichten, ganz wie die See.
Im Unterschied zu Seeleuten steigen die meisten Motorradfahrer nur vorübergehend aus der Sicherheit eines standfesten Alltags aus. Sie sind auf Zeit unterwegs mit voller Rückkehrgarantie, versteht sich. Im Rückspiegel wird der Alltag sofort kleiner und ist hinter der ersten Kurve verschwunden. Sie sind die Davongekommenen. Unterwegs sehen ihre Blicke anders und über vieles hinweg. Draußen erlebt man was. Wer das weiß und erfahren hat, hört zu und kommuniziert – wenn es sein muss, auch ohne Punkt und Ende. Egal, auf welchem Parkplatz man sich zufällig trifft oder ob da Menschen stehen, mit denen man auf dem Bahnsteig kein einziges Wort wechseln würde.
Es gibt Fragen, die ein vernünftiger Mensch nicht stellt – die zu erwartende Antwort könnte quälend lang und langweilig sein. Bekannte sind in irgendein südliches Betonsilo mit Sandstrand gejettet; man will ja nicht unhöflich sein und fragt, was sie gegen die Anfälle von Melancholie unternommen haben und wie das Wetter so war. Insgeheim hofft man, keinen Redemarathon loszutreten. Treffen sich aber Motorradfahrer und stellen die vielleicht dümmste Frage, nämlich »Wie war das Wetter?«, werden die Antworten uferlos sprudeln und kein Zuhörer dreht ab.
Regen adelt. Wer ist schon ein Sonntags- und Schönwetterfahrer? Das Wetter in jeder Ausführung wird zur gemeinsamen Sache. Ein schier unerschöpfliches Redereservoir tut sich auf und wird zur Grundlage mancher Verschwesterung oder Verbrüderung. Das Motorrad macht mit der Zeit einfach alle zu realitätsgeprüften Wetterfröschen oder zumindest zu Einkaufsberatern für die richtigen Klamotten, die den Ahnungslosen gern helfen. Straßen werden rezensiert, Kurven, Ausblicke oder Radarfallen wie alte Bekannte vorgestellt. An derlei Sorgfalt könnte sich jede Literaturkritik ein leuchtendes Beispiel nehmen.
Sollte man mit kritischen Ellen auch die Geschichten der Motorradfahrer rezensieren, so wie die Motorradzeitungen jedes Schräubchen der neuen Maschinen ins helle Licht genauester Messungen und Bewertungen rücken? Wie kommt man auf den Sinn und Unsinn dessen, was Menschen im Sattel suchen, erleben und denken? Ein nicht unwesentliches Resultat des Motorradfahrens scheint mit Geschichten verwoben zu sein. (In diesem Buch stehen viele.) Sie verbergen oft unausgesprochene philosophische Seiten, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennt.
Aber Philosophie: Ist das nicht der akademische Turmbau zu Babel, aufgeschichtet von emsigen Bibliotheksgängern und stets einsturzgefährdet? Geschichten geben dem philosophischen Denken ein entscheidendes Lebenselement zurück. Ihre Farben, Bilder und Metaphern sind taufrisch und noch nicht in Grund und Boden erklärt. Nelson Goodman hat den Prozess der Verknöcherung, unter der die Sprache der Philosophie wie jedes alte Gewächs leidet, als Prozess der Erstarrung beschrieben: »Seltsamerweise wird eine Metapher mit zunehmendem Verlust ihrer Kraft als Redefigur der buchstäblichen Wahrheit ähnlicher und nicht unähnlich. Nicht ihre Wahrheit schwindet dahin, sondern ihre Lebendigkeit.«2 Die Frage, ob Philosophie Sache der Stubenhocker ist, erhält mit dieser Beobachtung eine wesentliche Erweiterung: Sollen Buchstaben mit Buchstaben reden, auch wenn draußen die Sonne scheint?
Friedrich Nietzsche hatte viel gegen das »Sitz- und Wartefleisch«3 derer einzuwenden, die allein ihre Schreibfinger zu akrobatischen Höchstleistungen antreiben. Sie unterliegen allzu gern dem organisierten Grübelzwang und wissen mit dem Rest der Welt nicht mehr viel anzufangen. Was sie so artig und beflissen hinschreiben und in feinziselierte Begriffsarchitekturen einordnen, bleibt immer auch ein Reflex ihrer eigenen Misere. Dass Nietzsche das Sitzfleisch als »die eigentliche Sünde wider den heiligen Geist« brandmarkte4, ist seit über hundert Jahren so ausgiebig zitiert worden, dass die Fachwelt es ohne jede Konsequenz glatt überliest – was wiederum ein gutes Beispiel für die zum Begriff verknöcherte Metapher darstellt.
Der Philosoph auf dem Motorrad tut und erlebt etwas, was das Denken in Schwung bringt und seine eigenen Tiefen hat. Er gewinnt Erfahrungen, die ihm vielleicht einen neuen und sehr eigenwilligen Zugang zu Texten und Gedankengängen eröffnen. Nach mehrtägiger Tour ist der Motorradfahrer wieder im heimischen Hafen. Noch flimmert die lichtdurchwirkte Luft von Alpenpässen in seinen Kopf, der Körper spielt mit der Leichtigkeit der erinnerten Bewegung. Im Kopf lösen sich Bilder der letzten Tage und poetische Bruchstücke ab. Er schlägt wahllos das Buch auf, das auf seinem Schreibtisch liegt, und liest die Tagebucheintragung von Sören Kierkegaard vom 20. Juli 1839:
»Gleichwie für den Nervenschwachen Augenblicke eintreten, wo die Augennerven so mikroskopisch geschärft werden, dass er die Luft sehen kann, so dass diese nicht länger ein Medium für ihn ist, so treten auch in geistiger Hinsicht ekstatische Momente ein, wo das ganze Dasein so poetisch erscheint, so ausgespannt und durchsichtig für die Kontemplation, dass sogar die unbedeutendste Unbedeutendheit [...] und Dutzendarbeiten [...] zum mindesten allegorisch die tiefsten Wahrheiten anzudeuten scheinen [...]. Das ist überhaupt etwas, das die ganze neuere Entwicklung charakterisiert, dass sie beständig sich des Mediums bewusst wird, was nahezu mit Verrücktheit enden muss [...].«5
Nein, schwache Nerven waren es nicht, die die Luft in dem Licht sanft zittern ließ, und verrückt ist der Heimkommende auch nicht geworden. Er ist gefahren wie andere auch und hat dennoch erlebt, was sich gar nicht so leicht sagen lässt. Wie sollte er erklären, dass ihn die Passabfahrt umso ruhiger, gelassener und konzentrierter machte, je stärker sie Körper, Sinne und Nerven beanspruchte? Dass er mit der Schwerkraft gespielt und mit seinem ganzen Wesen in das Medium der Luft, die hier trocken und dort feucht, hier kühl und dort von betörendem Geruch war, aufgenommen wurde?
Die Grenzen von Körper und Umwelt wurden durchlässig; die lichtdurchflutete Transparenz erreichte jeden Winkel seines Geistes. Für einen Außenstehenden sieht das alles nicht so aus. Aber auch der, der es gerade erlebt hat, bekommt mit der Erfahrung nicht gleich das Verständnis vermittelt. Dann gesellt sich vielleicht noch die staunende Frage hinzu: Und woher wusste Kierkegaard im Jahre 1839, was mir gerade erst der Fahrtwind zugetragen hat?
Man fährt nicht um der Begriffe willen – doch spielen sie urplötzlich mit dem Erlebten. An diesem Punkt beginnt man, sich selber die Geschichten mit dem Fahrtwind zu erzählen und ihren stumm gebliebenen Gedanken Worte zu geben. Zeigen sie nicht auf ihre Weise, dass philosophisches Denken nicht erst in der heimischen Stube einsetzt, sondern schon ein heimlicher Begleiter auf der Tour war? Begriffe wirft ja ein Jedermann in die Runde oder aufs Papier. Diese Geschichten mitsamt ihren Reflexionen erzählt aber ein individueller Mensch mit einer unverwechselbaren Geschichte.
Die Geschichte wird ihren Anfang und ihr Ende haben. Irgendwo zwischen Start und Ziel wird der Fahrer etwas aufgegabelt haben – plötzliche Gedankensplitter und schnell vorüberziehende Geistesblitze, allesamt flüchtige Fragmente mit philosophischem Reiz. Wie die Teile eines größeren Puzzles haben sie Anschlussstücke. Viele findet man erst durch philosophisches Nach- und Weiterdenken. Die Geschichte, die der Fahrer erzählt, ist das erste Dach, unter dem sie zusammenfinden können und sich dem Gedächtnis fester einschreiben.
Repräsentativ für die Welt der Motorradgeschichten kann diese philosophische Sensibilität nicht sein. In ihnen, die immer ein wenig nach Benzin riechen, tritt uns eine grelle Welt entgegen. Gröbster Fetischismus und Angebertum hier, feinsinnige Naturschwärmerei und Sehnsucht nach der Ferne dort. Der eine gibt Gas und will Adrenalin produzieren, auf dass der letzte Rest von Geist aus seinem Leibe verschwindet. Der andere öffnet jede Pore, damit der ätherische Geist, herbeigeweht von Fahrtwind und Landschaft, die eigene Existenz ganz durchdringe. Er liebt den Frieden, während sich andere Motorräder zulegen, die die Fratzen der Aggressivität verkörpern wie schlechte Comicfiguren. Fürs Fahren scheinen sie gar nicht gebaut, eher dafür, andere von der Piste zu fegen.
Friedensengel und Rockergangs dichten sich ihre Identitäten und kaufen selbstredend die passenden Maschinen samt Outfit. Fällt ihnen selber nichts ein, lassen sie dichten – die Werbung oder Peer-Groups werden die Panne im Kopf sofort beheben. Manches Drehbuch für den Film im Kopf des Motorradfahrers ist für Außenstehende leicht zu erkennen. Wir finden schönste Beispiele von Slapstick und Tragik. Die Spannbreite der Geschichten ist extrem. Wie soll man sich einen einzigen Reim darauf machen?
Wo ist der rote Faden? Das Verbindende beim Seemannsgarn ist die See und das Garn. Das reicht aus, um für das Universum unterschiedlichster Erzählungen ein gemeinsames Dach zu bauen. Ein Schiff hat übrigens nicht deshalb eine Seele, weil wir an Gespenster glauben, sondern weil es in besonderer Weise in Geschichten auftaucht, die Menschen erzählen. Darin spielt es eine nicht-triviale Rolle. Folglich hat es eine narrativ geschenkte Seele, wie natürlich die meisten Motorräder auch.
Immer wieder stemmen sich die Narrative der Motorradfahrer dagegen, dass diese gehätschelten Seele ihrer Maschinen am Ende doch noch im Meer der Trivialität absäuft. Der Konflikt ist längst einer im Inneren ihrer Diskurse. Die Grenzen medialer Einflüsterung und eigener Erfahrung verschwimmen. Man packt den Tankrucksack – Vorsicht, die Magneten, die ihn auf das Blech kleben, ramponieren gern Bankkarten und die Einstellungen elektronischer Geräte! Man geht auf geprüfte Touren mit Qualitätssiegel, gecheckt von Zeitschriften, Experten oder Anbietern aller Art, kennt die zu konsumierenden Spezialitäten und die Preise der als Motorradfreunde ausgewiesenen Hoteliers. Der Navi quarkt die Route vor, die Stereo-Anlage liefert die Musik, die ein raffinierter Drehbuchautor ist.
Auf dem Parkplatz unter seinesgleichen gibt man mal laut, mal höflich-leise zum Besten, dass man sehr wohl die Stärken und Schwächen des Motorrades kennt, das nebenan parkt. Testberichte und Daten im Kopf, High-Tech-Fasern am Körper und einen echten Hingucker mit Bordcomputer unter dem Hintern: Welche Geschichten wird das ergeben? Bevor man wieder zu Hause eintrudelt, sind die Bilder längst gepostet und Sprüche in alle Regionen abgesetzt. Nicht wenige der Bilder ziehen bewusst alle Register der Werbephotographie.
Wer weiß, fühlt oder glaubt, dass früher alles besser war, kauft sich ein Retro-Bike. Die chromblitzende Ganzmetallmaschine und die original Lederklamotten sind nicht gerade billig, aber très chic und total in. Das ganze Motorrad funktioniert nach alter Art vollmechanisch. Kein Plastikteil verscheucht den Traum der wiedergefundenen Zeit. Deren Liebhaber frequentieren die zahlreichen Motorradmuseen und Oldtimer-Rundfahrten; vielleicht verirren sie sich auch einmal in alte Bücher der Technikphilosophie.
Schon im Auftaktwerk dieser bis heute anwachsenden Sparte könnten sie fündig werden: 1877 schrieb Ernst Kapp in seinen bahnbrechenden Grundlinien einer Philosophie der Technik, dass eine Maschine am besten als ein Organersatz des Menschen verstanden werden könne.6 Sie setze menschliches Wahrnehmen und Handeln in Bereiche fort, in denen der homo sapiens bislang passen musste.
Fernrohr und Mikroskop stellen einen Sprung in der Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges dar, beruhen aber auf denselben Bauprinzipien. Die Kraft der Maschine setzt Energie um wie der Muskel auch, nur dass das Gehirn nun über zuvor undenkbare Kräfte gebietet. Kapp hatte Darwin intensiv gelesen und war zutiefst davon überzeugt, die Evolutionsgeschichte ginge in der Technik des Menschen in die nächste Runde. Sie ist die Fortsetzung der Biologie mit den Mitteln des menschlichen Kopfes.
Mit seiner Theorie der technischen Organverlängerung, die viele Denker bis weit in das 20. Jahrhundert weiterführten, hat Kapp ein Phantasiebild des klassischen Motorradfahrers umrissen. Dieser spürte doch genau, wenn seine Maschine auch nur einen Tropfen Öl brauchte. Er wusste ohne Zeiger oder Display, was ihr zuzumuten war. Kaum ein Pferd hatte es so gut! Wie der treueste Freund stand die Maschine dem Fahrer zur Seite und machte das Unmögliche wahr. Für das bisschen Öl, Benzin und gutes Zureden bedankte sie sich mit heroischer Ausdauer, trotzte jeder Reparaturanfälligkeit und trug ihren guten Reiter bis ans Ende seiner Träume. All das eignete sich zum Stoff moderner Mythen und Heldentaten. Tags zuvor waren Alpen oder Nordseestrand ein Phantasiegespinst, Tags darauf hatte das Motorrad es geschafft.
Wer hatte es geschafft? Das Motorrad! Wir haben richtig gehört. Die Sprache nicht weniger Erzählungen bringt bis heute die Maschinen in die Position des eigentlich handelnden Subjekts, das geradezu menschlich-übermenschlich ausgezeichnet wird. Die gute Maschine kommt durch, die Mühle hat mich nicht im Stich gelassen: Die moderne Variante von Winnetou und seinem Schimmel, die das edle Abenteuer als die letzten ihrer umherschweifenden Art erleben.
Der Glaube, dass Motorradfahren vor allem »echte«, sprich nicht-korrumpierte Erfahrungen vermittelt, ist stark. Nicht minder groß ist die Hoffnung, sie in Geschichten packen zu können, in denen die eigene Existenz und das wirkliche Leben auf Tuchfühlung geraten. Die Diagnose, die Walter Benjamin vor fast 80 Jahren seiner Zeit stellte, wird nicht gut in den Ohren dieser Gläubigen klingen: »[...] beinahe nichts mehr, was geschieht, kommt der Erzählung, beinahe alles der Information zugute.«7
Woran das liegt? Die Erzählung trocknet aus, weil die Erfahrung besorgniserregend abmagert. Man erlebt ja nur, was andere längst erlebt und beschrieben haben. Je weniger die eigenen Erfahrungen auf ihren einmaligen Charakter pochen können, desto enger schließen sie sich an bereitstehende Redeweisen und Schablonen an. Versteht man das lateinische in-formare als ein in-Form-bringen, dann liegt die Form bereit und bedarf lediglich der Auffüllung mit passenden Inhalten. Dadurch tendiert alles zum Plagiat. Das lateinische Verb plagiare sagt es schon: Hier geht es um Gefälliges. Das ist eingängig und zieht den Beifall sicher auf seine Seite.
Wendungen, die sich diesen Narrativen allzu glatt einschleichen, korrespondieren nicht selten mit der Erfahrung aus zweiter oder dritter Hand. Nicht wenige der Geschichten leihen sich diese kleinen Münzen bei ihren Vorrednern und bringen sie neu in Umlauf. Schon unterwegs fährt man anderen Geschichten hinterher und weiß nicht so recht, was man später noch erzählen soll oder kann. Das war nicht immer so.
Blättern wir in alten Tagebüchern, so finden sich Einträge, die mit knappen Worten die atemlose Faszination des Neuen und Unerhörten ausdrücken. Im Juli 1953 sind Hans und Luise F. aus Köln mit ihrem Goggoroller gestartet. In ihrer letzten Herberge vor dem Großglockner erzählten sie den anderen Gästen von ihrem verwegenen Plan, mit dem Roller und seinen 6,7 PS nach Italien aufzubrechen. Dem Tagebuch vertrauten sie an: »Keiner der motorisierten Pensionsgäste wagte damals die Fahrt über den Großglockner. [...] Alle Gäste schüttelten den Kopf über unser Vorhaben. [...] Im ersten und zweiten Gang ging es zügig bis zur Edelweißspitze, bei den ersten Kilometern noch von allen Autofahrern belächelt. Mit zunehmender Höhe wurde die Anzahl der liegengebliebenen Autos immer größer. [...] Aber der Goggoroller, mit Luftkühlung und halbem Gas gefahren, zog mit zwei Personen besetzt an allen vorbei. Auch nach Fotopausen startete er wieder. Mit zunehmender Höhe und wolkenfreiem Himmel waren unsere Eindrücke überwältigend [...].«8
Zu einem richtigen Abenteuer gehört, dass man nicht weiß, wie es ausgeht, dennoch seinen ganzen Mut zusammennimmt und einfach startet wie Hans und Luise F. Ihr Wimpel am Roller, das »Glockner-Zeichen«, war der Orden, den nicht jeder hatte. Wer heute geschickt wohnt und plötzlich Lust auf einen Cappuccino am Lago Maggiore verspürt, sattelt seine Maschine und ist dahin. Die Motorräder sind schnell und nach dem Maßstab früherer Zeiten astronomisch stark. Ihr Tempo schreibt die Distanzen um, ihre Zuverlässigkeit lässt die abenteuerlichen Gefühle des Jahres 1953 nicht so recht aufkommen: Kein Wimpel nimmt den Fahrer und seine Maschine mehr in die Riege der verwegenen Abenteurer auf.
So frisch sich alles auch für unsere zeitgenössischen Fahrer im Sattel anfühlen mag, so abgestanden könnte ihre Geschichte für andere klingen. Das Problem besteht nicht unbedingt darin, dass andere wie Hans und Luise F. schon Jahrzehnte vorher in Italien gewesen sind. Alles ist versichert, die Übernachtung ist eben noch im Internet gecheckt worden und die Klamotten schirmen einfach alles, womit Wind oder Wetter drohen, vom Fahrer ab. Wer braucht noch Werkzeug? Die Maschinen halten – reparieren könnte man diese High-Tech-Boliden sowieso nicht. Keine Sorge, das braucht man auch nicht, denn nichts wird passieren.