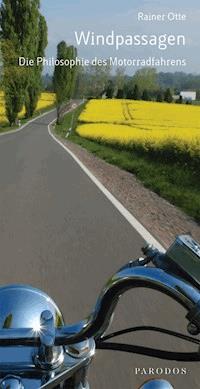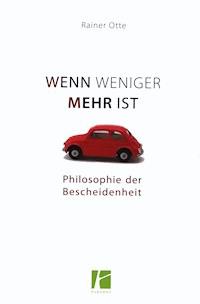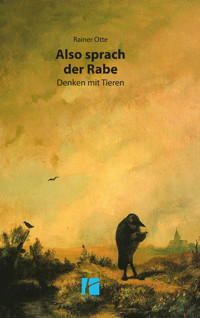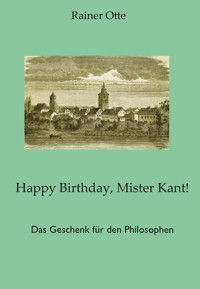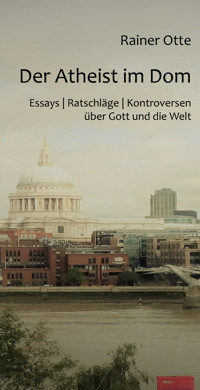
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Treffen sich Atheisten und Gläubige, dann streiten sie in der Regel gern. Der stereotype Verlauf vieler dieser Dispute langweilt. Rainer Otte fragt, was Atheisten und Gläubige heute verbindet. Lassen sich nicht viel spannendere Dialoge führen? Hat ein Atheist nichts anderes im Sinn, als Gott über die Klinge springen zu lassen? In diesem Buch lernen wir ihn ganz anders kennen – als Analytiker und Ratgeber. Für unruhige Zeiten sorgen kirchliche Missbrauchsskandale und Austrittswellen. Der interreligiöse Dialog oder der Markt der spirituellen Sonderangebote verlangen neue Positionsbestimmungen. Im Zeitalter des Narzissmus glänzt Gold noch seltener. Anlass genug, über einen neuen Dialog der kritischen Stimmen nachzudenken. Sensible Fragen, biographische Erkundungen und Meditationen gehören dazu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Otte
Der Atheist im Dom
Essays | Ratschläge | Kontroversen über Gott und die Welt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Taschenbuch: © Parodos Verlag Berlin 2022 ISBN 978-3-96824-010-7 Alle Rechte vorbehalten
E-Book: © Parodos Verlag Berlin 2023 ISBN 978-3-96024-041-9
https://parodos.de
1. VORWORT
Warnung und eine kleine Entschuldigung
Guten Tag! Lassen Sie es mich bitte so sagen: Ich will niemanden kränken. Hier und da rutschen mir gewiss einige theologische Unmöglichkeiten heraus. Worte, die ungewollt Stiche und Grobheiten verabreichen. Buchen Sie das bitte auf das Konto meiner Unwissenheit. Auch Atheisten sind nicht gern der Elefant im Porzellanladen. Einige sind direkt höfliche Menschen. Ich bin Philosoph und etwas Religionswissenschaftler. Als Philosoph ist man geübt, mit Gott kritisch umzugehen, Argumente zu prüfen oder Gedankenexperimente anzustellen. Als Religionswissenschaftler beobachtet und analysiert man mit Hilfe eines wissenschaftlichen Instrumentariums. Das entstammt etwa der Psychologie, der Soziologie, den Kultur- oder Sprachwissenschaften. Nicht nur der Glaube wird zum Thema, sondern seine Geschichte und Gegenwart in allen Facetten – von den heiligen Büchern über die Rituale und Sakramente bis in die Verästelungen des profanen Alltags. Das erfordert eine gewisse Objektivität. Einige der Frommen werden diesen distanzierten Blick als respektlos empfinden.
Damit sind wir beim Thema. Ich fühle mich manchmal unwohl als Atheist. Das liegt nicht daran, dass ich am Atheismus, der selber ja eine Schule des Zweifelns ist, zweifle. Es liegt am Kaliber der Themen und der Argumente. Gott: ja oder nein? Mein Kopf ist zu klein, um diese Frage in all ihren Dimensionen zu erfassen. Ich verstehe nicht einmal die Arbeit an den Weltformeln oder die Vereinigte Feldtheorie, mit der sich Physiker heute beschäftigen. Spin, Masse Ladung – und dann noch Gott! Auch die Sache mit dem Urknall bliebe für mich wie wohl auch für die meisten anderen völlig unverständlich, wäre sie nicht in ein so einfaches Sprachbild eingewickelt.
Erst kommt das Nichts, dann auf einmal der weltenerschaffende Knall. Ein Etwas ist da, da schau her! Wir nennen es Schöpfung. Sie beginnt, sich aus merkwürdigen Energie- und Materiewelten zu formieren und zu differenzieren. Zunächst etwas laut und theatralisch, dann chaotisch und in der Folge immer stärker selbstorganisiert. Galaxien verschwinden in Schwarzen Löchern und werden wieder ausgespuckt – auf ein Neues! Das Ganze dehnt sich ständig aus und kriegt nicht genug. Die Dimensionen des Universums sprengen jede menschliche Vorstellungskraft – so auch meine. Zur letzten Sekunde dieser Schöpfung gehören wir. Seitdem wir begreifen, wie fragil das Leben auf der Erde geworden ist, ist die letzte Sekunde nicht nur stolzer Höhepunkt der Evolution. Sondern unser aller absehbares, ruhmloses Ende. Die Wüste wächst, das Klima kippt, das Artensterben galoppiert: Wann ist der Mensch an der Reihe? Für dieses drohende Nichts tragen wir selbst Verantwortung. Kein Gott hat uns das beschert – konzediert der Atheist.
Wo ist da Gott? Als Atheist fühle ich mich jeder Verpflichtung enthoben, Adressen anzugeben oder zu recherchieren. Mit Kopfschütteln registriere ich, dass andere glauben oder verkünden, Straße und Hausnummer zu kennen.
Sollen sie! Ich lasse sie gern in Frieden, solange kein übergriffiger Fundamentalismus dabei herauskommt. Ich selbst muss nicht mit Voltaire in die Rüstung steigen gegen eine rabiat-engstirnige Religion, die in der Ausprägung seiner Lebenszeit für unsere Gegenwart zur Minderheitenmeinung geworden wäre. Wenigstens in den aufgeklärten Weltregionen. Nietzsches lebenslange Attacken gegen Gott und seine Kirche, die den Menschen zur billigen Marionette machen und ihm jede Lebendigkeit vergällen, sind mir verständlich, aber nicht unbedingt ein aktuell verpflichtendes Vorbild.
Meinerseits will ich als Atheist nicht zum Fundamentalisten werden, der weiß und ausposaunt, was in den letzten Dingen Sache ist und was für alle gilt. Ein Atheist, wie ich ihn mir vorstelle, muss nicht antreten zum Großreinemachen im Himmel wie auf Erden. Er will eigentlich in Frieden gelassen werden und keinen Kreuzzug gegen all die veranstalten, die, aus welchen Gründen auch immer, an Gott glauben. Er hat nichts zu verkünden. Nicht einmal eine kleine Anti-Verkündigung. Das alles überlässt er liebend gern den Gläubigen.
Wie kommt nun dieser Atheist auf den folgenden Seiten dazu, ausgerechnet über Gott und manchmal sogar mit Gott zu sprechen? Die Antwort ist unerwartet einfach. Weil er es schon immer getan hat. Weil nichts Außergewöhnliches daran ist. Das gehört einfach dazu – in welcher Form auch immer. Um es in einem Satz zu verdichten: Wenn Gott eine Konstante im Leben der Gläubigen ist, warum nicht auch im Leben der Atheisten? Immerhin lebt nicht jeder für sich. Sie teilen sich eine Welt.
Da wird der Fromme den Kopf schütteln und fragen, wie wohl Gott, der für den Atheisten ja gar nicht existiert, in dessen Leben eine Rolle spielen könnte. Die Antwort ist einfach und nicht einmal ausweichend: Wie Don Quixote. Wie Faust. Wie Madame Bovary. Es gibt Menschen, die mit diesen Figuren leben. Sie können leicht in Dialoge mit ihnen, ihren Welten und ihren Autoren eintreten. Eine Frau geht vorbei und ein spontaner Gedanke bringt Madame Bovary ins Spiel. Ein aufgeschnappter Gesprächsfetzen genügt, und schon buttert Faust seinen Spruch im Hinterkopf dazu. Passiert das öfters, ergibt es schon eine eigene kleine Geschichte.
Soll das nun die Wirklichkeit Gottes sein – ein Kästchen voller Zitate, Bilder und Assoziationen, dessen Deckel sich öffnet und entlässt, was gerade in die Stimmung oder in die Situation hineinpasst? Der Einwand liegt nahe, dass Gott vielleicht doch etwas anders zu verstehen ist als eine literarische Gestalt, die ab und an in einen inneren Dialog hineinquasselt. Oder als eine beliebige Verknüpfung von Gedanken. Oder als herumhüpfende Assoziation. Gewiss, das sei gern zugegeben. Gott ist nicht Goethe und keine literarische Figur. Das Beispiel soll eine Richtung zeigen und zu einem entscheidenden Gesichtspunkt hinführen.
Gott – das ist für den Atheisten zunächst ein Wort. Sowohl in der Herausbildung als auch der Selbstverständigung ganzer Kulturen entpuppt es sich als zentral. Sofern wir daran interessiert sind, auch unsere Geschichte zu kennen und zeitübergreifende Bezüge unserer Lebens- und Denkgewohnheiten zu verstehen, dürfen wir nicht so tun, als wüssten wir überhaupt nicht, was dieses Wort bedeuten mag. Als Atheisten scheinen wir natürlich nicht befugt, dessen Sinngehalte festzulegen oder ex cathedra zu verkünden. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Denn nicht überall, wo Gott drinsteckt, steht Gott auch drauf.
Das mit der Religion verknüpfte historische Erbe ist keineswegs auf den ersten Blick als solches erkennbar. Dem Religionswissenschaftler fallen gewisse Ähnlichkeiten auf, wenn einige der heutigen PR-Shows Produkteinführungen inszenieren. Kräftig bedienen sie sich in der Vorratskammer religiöser Symbole oder Rituale. Das Produkt als Offenbarung, die Deo-Frische aus dem Paradies, der neue Goldstandard des Internets als Verheißung einer goldenen Zukunft für die ganze Welt. Um Politiker werden säkularisierte Heiligenkulte gewoben, global mit erschreckend ansteigender Tendenz. Solche Inszenierungen behaupten ja nicht, dass die Kunden oder Mitläufer religiösen Glaubensüberzeugungen folgen. Sie stellen lediglich ein Feld religiös grundierter Symbole und Rituale in ihren Dienst – und das sehr erfolgreich. So gesehen müssten Religionsgemeinschaften und die großen Kirchen, die immerhin die Originale dieser wirkmächtigen Kommunikationsformen verwalten, sich vor dem Ansturm des Publikums kaum noch retten können.
So öffnet die Sprache, die sich mit und um Gott gebildet hat, den Blick auf unterschiedlichste Gedanken und Praktiken. Einige der existenziell bedeutsamen stehen in diesem Buch im Vordergrund. Sie prägen das Leben und die Orientierungen vieler Menschen. Das Wort Gott scheint selbst in Drehung geraten zu sein. Es ist zum Kaleidoskop geworden und offenbart verschiedene Gesichter. Sie können verwirren. Das liegt nicht allein an der mancherorts erfreulich anwachsenden religiösen Toleranz. Auch der je eigene Gott, noch ganz im Singular, agiert heute in einem transkulturellen Konsortium von Göttern. Traditionell sind seine Follower regional verteilt, mischen sich durch globale Mobilität aber stark. Auf der Erde hoffen Einsichtige, dieser wahrscheinlich epochale Prozess möge in Einmütigkeit und Frieden vor sich gehen.
Keine der möglichen Bedeutungen des Wortes Gott scheint auf einen stabilen Kern festlegbar, einen, der einfach erlauben würde, Gott einen Personalausweis auszustellen und besondere Merkmale zweifelsfrei einzutragen. Viele seiner Gesichter gehören zu historischen und kulturellen Dispositiven. Die gehen auch unbewusst in den Habitus und den Stil des Denkens und Sprechens ein. Deshalb denkt auch der Atheist öfter an „Gott“, als ihm lieb und geheuer ist. Das aber nicht deshalb, weil er allerorten überzeugt wäre, Gott sei eine Art von korrigierbarem Rechenfehler, den er als guter Aufklärer mit spitzem Bleistift und stichhaltigen Argumenten geraderücken will. Sondern weil Gott, der Fromme und der gar nicht Fromme eine Welt teilen und weil sie sich an jeder Ecke begegnen könnten.
Gott existiert deshalb nicht einfach als Schach- oder Schießbudenfigur im atheistischen Denken. Der Dichter Gottfried Benn – glaubte er an Gott? Er sah die im Chaos leidende Welt illusionslos, fand für die helleren Stunden unvergessliche Worte und staunte kopfschüttelnd. Die Zeile des Gedichts mit dem Titel Dennoch die Schwerter halten ist simpel und eine direkte Frage: „Warum erschufst du das?“1 Wer bitte? Gott natürlich! Man muss nicht an Gott glauben, wenn man zuweilen solche Fragen stellt.
Am liebsten rede ich unter Freunden, möglichst in weitgehender Offenheit. Da braucht man keine Geheimnisse voreinander zu haben und erspart sich wechselseitige Theaterspiele. Man sagt sich sogar unangenehme Wahrheiten – schonend, wenn es sein muss. Man spielt nicht den Überlegenen. Weder, um eigene Weisheiten herauszuputzen, noch um sich fälliges Mitleid zu ersparen. Freunde sind im Kern gleichberechtigt. Sie pokern nicht um Macht. Deshalb vertrauen sie sich, darum glückt ihr Dialog.
In diesem Sinne gibt es Atheisten, die frei mit Gott reden. Ohne Speichelleckerei und frei von jedem Reflex, sich klein zu machen. Einen Dialog könnten sie auch nur auf diese Weise akzeptieren. Die Frage, ob Gott existiert wie irgendein anderes tumbes Ding, klingt ihnen lächerlich im Ohr. Sie ist irreführend. Die Frage nach dem simplen Sein oder Nichtsein? verrät eine gewisse Blindheit. Gott ist nicht nur der große Posten in der Universalbilanz. Wer genauer hinschaut, entdeckt in vielen alltäglichen Denk- und Sprachspielen eine religiös geprägte Vorgeschichte. In der profanen Welt sind solche Zutaten beinahe unsichtbar geworden – wie wir uns ja auch kaum daran erinnern, was wir in den ersten zwei oder drei Lebensjahren erlebt haben.
Aber ist dieses Profane – unser aller Schicksal – nicht geradezu das Dumme, das Laute, allzu Vorlaute, das Hohle und Beschränkte? Mag sein. Wir leben alle profan. Wer wird schon glücklich oder klug damit? Unsere Ambitionen gehen darüber hinaus. Wo alltägliches Grau in Grau war, soll mehr Licht sein. Der belanglose Lärm der Welt möge endlich zur Ruhe kommen, und sei es nur einen winzigen Augenblick lang. Das Dickicht des Lebens soll sich wohltätig ordnen und Konturen gewinnen. Für einen kostbaren Moment möchte man einen anderen Blick, einen wirklichen Überblick. Vielleicht melden sich in solchen Ambitionen verborgene Sinngehalte, die ihre Traditionen haben.
Wer so denkt, muss beileibe keinen religiösen Vorgaben oder Motiven folgen. Der Denkweg kreuzt sich aber durchaus mit denen, die Frommere gehen oder gegangen sind. Gemeinsame Worte und Konzepte stellen sich ein, verteilen sich aber auf verschiedene Routen. Der Atheist, der sich zu seiner eigenen Überraschung in einem spontanen Dialog mit Gott findet, betet wirklich nicht. Gleichberechtigte Partner treffen sich hier, auf ein Wort. Es darf gelacht werden. Bisweilen empfindet der Atheist geradezu Mitleid mit einem Gott, den nicht wenige Gläubige ständig anjammern und mit krudesten Floskeln überhäufen; den sie für alles verantwortlich machen, um ihn bei Bedarf aus dem Schränkchen zu ziehen und mit Gesängen zu drangsalieren, die nicht allein sein himmlisches Ohr schmerzen dürften. Offen und ehrlich: Dieser Gott, ein Prügelknabe für alles, tut selbst dem Atheisten leid. Wie festgenagelt, sitzt er in der ihm zugewiesenen Position und spielt seine Rolle. Früher brannte mal ein Dornbusch und der Wind wehte, wo er wollte. Heute kann Gott aus der organisierten Religion nicht mehr weg. Und muss zudem ertragen, dass alle gläubige Welt ihm nachsagt und vorbetet, er genieße ja alle erdenkliche Freiheit in dieser und in der anderen Welt.
Der Atheist wäre möglicherweise geneigt, diesem Gott zu raten, eine letzte erklärende Note zu verfassen und sich endgültig aus der Affäre zu ziehen. Oder in Gottfried Benns Sprachduktus zu fragen: Warum erträgst du das? In dieser paradoxen Sekunde scheint der Atheist dem verballhornten Gott näher als der Fromme, der diesen Gott mit Unzähligem überschüttet, was nach Meinung des Atheisten selbst einem unbedarften Mitmenschen auf den Wecker fallen müsste.
Da sehen Sie, was bei solchen atheistischen Dialogen über und mit Gott herauskommt! Noch können Sie das Buch schließen und für alle Zeiten weglegen. Denn es kommt noch dicker. Das war erst der Anfang. Den Mutigeren, die sich auf den Dürrepfad durch die kommenden Seiten begeben, mag ein Wort Trost spenden. Atheoi nannten die Römer zur Zeit Neros die Christen, die sie gern den Löwen zum Fraß vorwarfen. Der Philosoph Ernst Bloch erinnerte daran. Und meinte gar: „Nur ein Atheist kann ein guter Christ sein, gewiss aber auch: Nur ein Christ kann ein guter Atheist sein.“2
Ist das nur ein herrlich paradoxer Spruch?
Schauen wir mal!
2. UMSCHRIFTEN
Genesis
Warum stellen wir uns nicht einfach vor:
Und Gott fürchtete sich.
Kann Gott sich überhaupt fürchten?
Vor dem Tod?
In jeder Furcht erinnert ein hartnäckiges Quäntchen an den Tod.
Wie soll Gott jemals sterben können? Woher soll der Tod ihn ereilen?
Nichts war da. In der Wüste und in der Leere lauerten die Angst und der Tod.
Wo war da der Tod, wenn Gott doch ganz allein war?
Nirgends war der Tod. Das steigerte Gottes Angst ins Unermessliche. Wohin Gott blickte, da war Wüste und Leere – dieses Nirgends.
Was sah Gott, als er die Wüste und die Leere sah?
Gott sah.
Sah er nur anderes, oder sah er sich auch selbst?
Jeder, der etwas sieht, sieht etwas anderes als das, was er selbst ist. Das liegt scheinbar hinter dem sehenden Auge. Oder: Die Ahnung, die Gewissheit dämmert, dass da etwas hinter dem Auge ist, das sich eben selbst nicht sieht. So vage es scheint, dieses Gefühl bleibt.
Was Gott sah, war ganz anders als alles, was er selber war. Vor dem Auge, hinter dem Auge – zusammen geriet nun alles ins Schwanken. Verlor seine gemeinsame Kontur. Es offenbarte bald dies, bald das.
Der Sehende bleibt nicht, wer er war. Das Gesehene ist bald dies, dann das. Alles wird ein Spiel auf Zeit. Der Sehende tritt darin ein.
Die Zeit ist da, die Zeit ist vorbei.
Was Gott im Schrecken nun dachte, es sollte den Tod in seinem Denken anzeigen.
War das der Tod, der ihm vor Augen trat? Der die Gedanken aufwühlte? Der von irgendwoher in das Denken einfällt?
Den Tod kann man sehen – bei anderen. Sie sterben. Wir sehen. Der eigene Tod bleibt unsichtbar.
Wer sieht, sieht etwas anderes als alles, was er selbst ist.
Wusste Gott, was der Tod ist? Woher der Tod kam? Ob ihn etwas überdauern werde?
Wollte Gott denn überhaupt wissen, was der Tod ist?
Es gefiel Gott, anderes zu sehen und zu denken als den Tod.
Gott erschuf, voller Glück, voller Gier; wie im Rausch, Tag nach Tag.
Es begann mit dem einzigen, einmaligen Fanfarenstoß.
Endlosigkeiten allüberall, in wirre Bewegung geraten. Kosmische Steinwüsten, Spiralnebel und Kernschmelzen fielen übereinander her. Verschwindend kleine Punkte spuckten Galaxien aus, andere fraßen sie in sich hinein.
Diese Welten sind ertragbar für den, der keine Furcht kennt.
Dem Leere nicht leer ist.
Dieses Universum kann die Furcht nicht bannen. Der Rausch der Schöpfung verebbt. Ein unerbittliches Pendel: Geburt und Tod, auf und ab.
Das Gleichmaß misst, gleichgültig, was es ist.
Aufbau und Abbau, Geburt und Ende im verschlingenden Feuersturm. Das Universum stellte Gott die Furcht vor Augen.
Fürchtete sich Gott?
Gott sah.
Der Zuschauer ist erlöst von der Gefahr. Er agiert nicht auf der gefährlichen Bühne. Er stellt sich die Furcht vor Augen. Für diesen kleinen Moment bedroht sie ihn nicht. Kaum hat er das Theater verlassen, wird sie sich in seiner ganzen Welt einnisten.
Wo? Man findet die Furcht an keinem bestimmten Ort mehr. Sie ist der Tropfen, der sich im Wasser aufgelöst hat.
Angst heißt, dass Furcht überall ist. Jederzeit wartet sie. Man weiß nicht, woher sie kommen wird.
Da bekommt es Gott mit der Angst zu tun.
Panische Furcht zittert. Sie raubt den Boden unter den Füßen. Sie löscht den aus, der einen Moment zuvor noch sicher und in Ruhe war. Das kosmische Steingeschoss kann ihn treffen. Er zieht den Kopf ein. Unruhig wandern die Augen am Firmament.