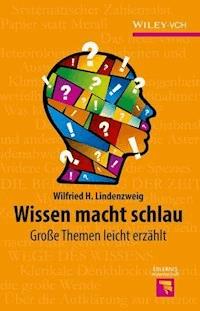
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Erlebnis Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 669
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
Vorwort
Danksagung
1 Einführung – Wissensthemen der Menschheit, früher und heute
2 Eine Frage der Dosis
3 Kleine Körner und große Zahlen
4 Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles … ach, wir Armen
5 Entscheidend ist das Klima
6 Armageddon. Irgendwann …
7 Die Bedeutung der Zeit
8 Die anderen Kinder Gottes – Unsere potenziellen Brüder und Schwestern von anderswo …
9 Wege der Wissenschaft
Farbtafeln
Abbildungsverzeichnis
Stichwort- und Namensverzeichnis
Weitere Titel aus der Reihe Erlebnis Wissenschaft
Hermans, JoIm Dunkeln hört man besser?Alltag in 78 Fragen und Antworten2014ISBN: 978-3-527-33701-9
Full, RolandVom Urknall zum Gummibärchen2014ISBN: 978-3-527-33601-2
Groß, MichaelInvasion der Waschbärenund andere Expeditionen in die wilde Natur2014ISBN: 978-3-527-33668-5
Zankl, Heinrich/Betz, KatjaTrotzdem genialDarwin, Nietzsche, Hawking und Co.2014ISBN: 978-3-527-33410-0
Hess, SiegfriedOpa, was macht ein Physiker?Physik für Jung und Alt2014ISBN: 978-3-527-41263-1
Oreskes, Naomi/Conway, Erik M.Die Machiavellis der WissenschaftDas Netzwerk des Leugnens2014ISBN: 978-3-527-41211-2
Ganteför, GerdAlles NANO oderwas?Nanotechnologie für Neugierige2013ISBN: 978-3-527-32961-8
Heering, AndreaJule und der Schrecken der Chemie2013ISBN: 978-3-527-33487-2
Schwedt, GeorgPlastisch, elastisch, fantastischOhne Kunststoffe geht es nicht2013ISBN: 978-3-527-33362-2
Synwoldt, ChristianUmdenkenClevere Lösungen für die Energiezukunft2013ISBN: 978-3-527-33392-9
Krause, MichaelWo Menschen und TeilchenaufeinanderstoßenBegegnungen am CERN2013ISBN: 978-3-527-33398-1
Autor
Wilfried H. LindenzweigPoststrasse 565553 LimburgGermany
Titelbild© esignn, fotolia.com
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 978-3-527-33750-7ePDF ISBN 978-3-527-68407-6ePub ISBN 978-3-527-68409-0Mobi ISBN 978-3-527-68408-3
Über den Autor
Wilfried H. Lindenzweig ist Physiker und Manager im produktiven Unruhestand. Nach seiner Diplomarbeit in Kernphysik an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und der GSI in Darmstadt befasst er sich privat seit Jahrzehnten mit ökonomischen, naturwissenschaftlichen und philosophischen Fragestellungen. Beruflich war er in seiner über 30 Jahre währenden Karriere in leitender Funktion eines amerikanischen Konsumgüterkonzerns als Finance Manager tätig und dabei mit nahezu allen Fragestellungen entlang der Wertschöpfungskette eines Global Players betraut. Wilfried H. Lindenzweig ist verheiratet und hat zwei studierende Kinder.
Ich widme dieses Buch dem Andenken meines Vaters, des Redakteurs Herbert Lindenzweig.
Vorwort
– Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile –
(frei nach Aristoteles)
Dieses Buch richtet sich an den bildungsinteressierten Leser jeden Alters und auch naturwissenschaftlichen Laien. Es möchte Hintergrundwissen zu einigen der aktuellen Herausforderungen unserer Zeit vermitteln, im historischen und entwicklungsgeschichtlichen Kontext. Große und in der Menschheitsgeschichte immer wiederkehrende Themen sollen populärwissenschaftlich erhellt werden, auch episodenhaft unterhaltend.
Kommt in unserer Welt naturwissenschaftliche Bildung zu kurz? Die Technik und Wissenschaft beherrschen zwar Alltagsablauf und Konsumverhalten, aber unser Verstehen der Zusammenhänge hält nicht mehr Schritt. Wir begnügen uns mit der Selbstverständlichkeit des Konsumierens, das Verstehen erstreckt sich bestenfalls auf die Peripherie von Blackboxen aber selten auf deren Prinzip und Innenleben.
Hier wird dieses Buch wenigstens etwas weiterhelfen. Es soll auch für jene Hilfestellung und Anregung sein, die unter Bildung nicht nur TalkshowEloquenz verstehen, sondern nach einem ausbalancierten Verstehen von Gesamtzusammenhängen streben.
Einige im vorliegenden Buch beschriebenen historischen oder auch fiktiven Episoden beschreiben Handlungen, von deren Nachahmung der Autor ausdrücklich abrät.
Limburg, 2014
WH. Lindenzweig
Danksagung
Das vorliegende Buch geht auf eine späte Wiederbelebung der naturwissenschaftlichen Vorlieben des Autors nach einem langen Berufsleben zurück. Das Werk beruht auf recht umfangreichen und zeitaufwendigen Recherchen. Ich danke meiner Familie für ihr Verständnis dafür, dass sich dadurch gelegentlich auch die Prioritäten im privaten Umfeld ändern mussten.
Mein Dank gebührt zudem ganz allgemein dem Physikalischen Verein Frankfurt und verschiedenen auch öffentlichen Vorlesungsprogrammen der Universitäten Mainz und Frankfurt für die Hilfe bei der – von mir zumindest angestrebten – Erweiterung meines eigenen Horizonts und für zahlreiche wertvolle Anregungen zu diesem Buch.
Dem Verlag Wiley-VCH danke ich für seine Aufgeschlossenheit, und den an diesem Projekt direkt beteiligten Mitarbeitern ausdrücklich für die gute Arbeit.
1
Einführung – Wissensthemen der Menschheit, früher und heute
Alle Menschen streben nach Wissen, lautet die optimistische Grundthese in Aristoteles’ Metaphysik.
Wenn Aristoteles wüsste, was der Durchschnittsbürger heute so alles weiß, würde er sicher staunen. Bedurfte es doch zu früheren Zeiten des ständigen Umgangs mit gescheiten Persönlichkeiten oder eines eigenen Studiums, bevor man sich zu den Wissenden zählen durfte. Heute gibt es fast weltweit eine allgemeine Schulpflicht für wenigstens die Grundausstattung an Wissen. Und wenn man die Zeit und Bereitschaft mitbringt, kann man sich heute jederzeit und allerorts zusätzliches Wissen aneignen. Wissen ist nicht mehr wie früher einigen wenigen vorbehalten, sondern nahezu frei zugänglich für alle. Das Internet mit seinen offenen Systemen hat diese Entwicklung in den letzten 30 Jahren noch gewaltig beschleunigt.
Dabei führen die reine Verfügbarkeit von Quellen und deren Gebrauch nicht gleich zu Wissen an sich. Wir können Daten sammeln oder uns komplexere Informationen aneignen. Wissen aber ist mehr. Es verbindet Kenntnisse von Details und von vielen Einzelthemen zu einem großen Ganzen. Gestützt auf Erfahrungswerte, einem regelmäßigen Austausch mit Anderen und einem Lernen aus Irrtümern wird Wissen über die Zeit zur Bildung. Und selbst bei Letzterem ist der persönliche Erfolg, etwa hierdurch schlauer geworden zu sein, noch nicht garantiert. Manches Wissen ist nicht nur unnütz, sondern falsch, politisch belastet oder führt uns in eine unerwünschte Richtung.
Trotzdem soll schon manch einer mit seinem antrainierten unnützen Wissen in einer Quizshow eine Million gewonnen haben oder vielleicht auch eine politische oder wirtschaftliche Karriere begründet haben. Dann war es anscheinend so unnütz nicht.
Der Sinn des Wissens ist also differenziert zu sehen. Da ist der allgemeine Teil, der uns bei der Befriedigung unserer Grundbedürfnisse im Alltag hilft, also um durch das Leben mit seinem Konkurrenzdruck durchzukommen. Interessant und anspruchsvoller wird es aber erst bei der Teilnahme am kulturellen Zusammenleben in der Gemeinschaft, also bei der Ausübung spezieller Fähigkeiten als Beruf, in der Forschung oder aus reiner Neigung. Erst dadurch kann die angestrebte Selbstverwirklichung in einem erfüllten Leben gelingen.
Wissen muss auch Spaß machen dürfen. Der Weg zur höheren Stufe der Bildung – etwas heute so antiquiert klingendem wie der Weisheit – ist aber nicht ohne eigene Anstrengungen zu erreichen und erfordert einen offenen und zugleich kritischen Geist. Am Ende ist es entscheidend, dass Wissen nicht nur angehäuft wurde, sondern eine Metamorphose von Quantität zur Qualität stattgefunden hat und die Zusammenhänge in einer eigenen Weltanschauung gereift sind.
Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen.
Was man nicht nützt, ist eine schwere Last;
Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen.
(J.W. von Goethe, Faust)
Bei allem, was wir heute unseren genetischen Anlagen zuschreiben, wir kommen als unbeschriebenes Blatt auf diese Welt. Allenfalls bringen wir gewisse Strukturen und Anlagen mit, die die Entwicklung von Kapazitäten und Begabungen ermöglichen und beeinflussen. Beschrieben wird dieses Blatt erst durch unsere Umwelt und sukzessive, mit zunehmendem Alter, durch uns selbst. Die Erkenntnisse über die Beschaffenheit der Welt fallen uns dabei genauso wenig in den Schoß, wie sie zu paradiesischen Zeiten in Form eines Apfels vom Baum der Erkenntnis gepflückt werden konnten. Wir müssen uns selbst darum kümmern.
Auch von Goethe stammt der vielzitierte Satz, dass es offenbar einen tiefen Drang in uns gibt, um verstehen zu wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dies unterscheidet unsere Spezies von allen anderen und war auch schon so in der Anfangszeit des Homo Sapiens, und dieser Eigenschaft verdanken wir den zivilisatorischen und kulturellen Fortschritt. Auch standen schon immer einige klassische Hauptthemen im Mittelpunkt des menschlichen Interesses.
Immer ging es um die Frage der Fragen: Woher kommen wir, wo gehen wir hin und was soll das Ganze eigentlich? Das ist die Schlüsselfrage der Erkenntnistheorie, die unmittelbar einen ganzen Haufen weiterer Einzelfragen aufwirft, mit denen sich die Menschheit seit Anbeginn beschäftigt und auch plagt. Zuweilen gleicht diese Beschäftigung einer Art Sisyphusarbeit, denn immer wenn man gerade geglaubt hat, etwas grundlegend verstanden zu haben, bringen neue Erkenntnisse wieder Zweifel auf. So wird die Wissenschafts- und Erkenntnisgeschichte des Menschen zu einem fortwährenden Prozess von Trial and Error. Irrtümer führen zu neuen Thesen, und die langjährige Überprüfung jener anhand der Realität fördert neues Wissen zutage. Wissen bleibt unvollständig und relativ, und der weise Ausspruch des Philosophen Sokrates Ich weiß, dass ich nichts weiß weiterhin gültig. Der kleinste gemeinsame Nenner aller Philosophen lautet wohl: Es ist nicht nichts, und in seinem Umkehrschluß: Irgendwo ist immer etwas. Wer sich jedoch damit begnügt, kann die Suche nach der Weltformel gleich einstellen.
Die Kernthemen der Menschheit waren immer durch das Bemühen geprägt, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Dies führt ganz automatisch zur Untersuchung des Phänomens von Raum und Zeit, und so lauteten die ersten Fragen auch: Wie kamen die Dinge in den Raum? Wann war ein Anfang? Wird ein Ende sein und wann? Ist der Raum endlich und abgeschlossen? Oder hatte gar der Raum selbst einen zeitlichen Anfang?
Die Frage nach der Zeit beinhaltet automatisch die Frage der Kausalität, denn schließlich kommt die Ursache vor der Wirkung, jedenfalls in unserer Erfahrungswelt, und damit erhält die Zeit auch eine Richtung, in die sie fließt. Tempus fugit wussten schon Griechen und Römer zu berichten, und noch heute ziert dieser Spruch die eine oder andere aus China importierte Uhr. Dagegen ist die Zeit aber nicht nur im Sinne der Relativitätstheorie relativ, sondern auch in unserer Empfindung. Die Kunst der Muße, die die alten griechischen Philosophen noch als eine von vier Kardinaltugenden formuliert haben, ist uns heutzutage völlig abhanden gekommen. Stress unter dem Diktat von selbst- und fremdauferlegten Pflichten und Zwängen ist an der Tagesordnung. Die immer schneller werdende Taktung und damit Vermessung des persönlichen Tagesablaufs nimmt keine Rücksicht auf unsere innere Uhr und führt zu Spannungen. Burn-out ist das Schlagwort aus unserer Arbeitswelt für eine neue Zivilisationskrankheit, die meist zum Time-out führt.
Dabei ist die Kunst der Vermessung unserer Umwelt eine der Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wissenschaft. Die ersten Fingerstriche im Sand oder die Zählkerben auf dem 20 000 Jahre alten Ishango-Knochen waren die Anfänge der Wissenschaft, bevor wir heute mit komplizierten Caesium-Atomuhren die Sekunde in 9 192 631 770 Einzeltakte zerlegen.
Messungen waren schon immer Bestandteil unseres Realitäts-Checks und haben aus vagen Vermutungen dokumentierte Erkenntnisse werden lassen. Auch rein grundsätzlich gehört das Quantitative zum Qualitativen dazu, und nicht erst der mittelalterliche Alchemist und Philosoph Paracelsus wusste bereits, dass alles eine Frage der Dosierung ist. Ein Zuviel des Guten kann sogar fatale Folgen haben, zumindest bei Arzneimitteln, aber bekanntlich auch im sonstigen Alltagsgeschehen.
Die Einbindung in die verschiedenen mehr oder weniger fest getakteten Abläufe unseres Lebens verschließt heute auch den Blick für weiterführende philosophische Fragen von auch praktischer Relevanz. Wenn wir schon nicht ergründen können, wie das mit dem Urknall so im Einzelnen abgelaufen ist, sollten wir uns dann nicht wenigstens die Zeit nehmen, uns mit dem zukünftigen Schicksal unserer eigenen Spezies zu beschäftigen?
Nach der Sichtweise der Paläontologen ging es mit unserer Spezies erst im Holozän nach der letzten Kaltzeit so richtig voran. Aus unserer heutigen Sicht begann die Zivilisationsentwicklung ziemlich zäh, wurde lange von Stagnation und Rückschlägen geprägt, bis endlich vor etwa 5000 Jahren mit der Herausbildung des Phänomens der Schrift in Westasien und Altägypten die Bronzezeit für einen gewissen Aufschwung sorgte.
Auch damals spielte schon das globale Klima eine wesentliche Rolle. Gutes Wetter durch eine um etwa um ein Grad gegenüber dem langjährigen Schnitt erhöhte Temperatur der Atmosphäre dürfte den menschlichen Geist und die Entwicklung begünstigt haben. Man spricht deswegen auch vom Klimaoptimum des Holozäns. Die Antike begründete dann unter den klimatisch günstigen Bedingungen der römischen Warmzeit einen vorläufigen zivilisatorischen Höhepunkt.
Im 4. Jahrhundert nach Beginn unserer Zeitrechnung wurde es wieder kälter. In Europa begannen mit dem Zerfall des weströmischen Reiches sehr schnell die dunklen Jahre mit nicht nur organisatorischem, sondern auch kulturellem Verfall. Erst nach über einem Jahrtausend später mit dem Zeitalter der geistigen Aufklärung und dem Eintritt in unsere Neuzeit mit all seiner Technisierung geht es wieder beschleunigt aufwärts.
Aufwärts geht es seitdem jedoch auch mit den technologisch bedingten Risiken. Dabei handelt es sich aber nicht mehr nur um die Gefahren durch Massenvernichtungswaffen. Vielmehr begnügen wir Menschen uns spätestens seit Beginn der Industrialisierung nicht mehr mit der Rolle eines Bewohners oder Gastes des Planeten, sondern pflügen diesen für die Landwirtschaft und auf der Suche nach Rohstoffen nach Strich und Faden um. Wir sind zu seinem nahezu hemmungslosen Umgestalter geworden, schon spricht man vom Zeitalter des Anthropozän.
Die Risiken wachsen mit den Chancen, dies selbst scheint eine Art Naturgesetz zu sein. Wer viel hat, kann auch viel verlieren, und wer viel kann, vermag auch viel zu zerstören. Lange haben sich die Astrophysiker und Astronomen darüber gewundert, warum es keine Anzeichen extraterrestrischen Lebens oder gar von Intelligenz gibt. Es ist das nach dem berühmten Physiker benannte Fermi-Paradoxon, nach dem E.T. schon längst Kontakt mit uns aufgenommen haben müsste, oder es wird niemals in der Menschheitsgeschichte ein solcher Kontakt der dritten Art stattfinden. Schließlich sollte es solche fremden Welten geben dürfen, und auch solche mit einer signifikant höheren Entwicklungsstufe als die unserer eigenen. Nun mag man die gigantischen Entfernungen des Alls und die zu ihrer Überwindung erforderlichen Zeitspannen zu bedenken geben, aber schließlich könnte E.T. ja auch schon viel länger als wir selbst unterwegs sein. Oder sollte auch dies eine Art von Prinzip sein, dass Intelligenzen dazu verdammt sind, irgendwann an ihrem eigenen speziesimmanenten Existenzrisiko zu scheitern?
Die Saurier konnten nichts für ihr Aussterben. Vielleicht hätten sie über kurz oder lang aus artbedingter Gefräßigkeit die irdische Fauna leergefressen und das ökologische Gleichgewicht zu ihrem eigenen Schaden zerstört, denn schließlich brachten sie eine gewaltige und ständig reproduktionsbedürftige Biomasse auf die Waage. Bevor dies aber geschehen konnte, stahl ihnen ein gewaltiger Asteroideneinschlag die Schau. Es war vor Millionen Jahren auf der Halbinsel Yucatán im heutigen Mexiko im Übergang vom Erdmittelalter zur Erdneuzeit. Binnen einer im paläontologischen Maßstab sehr kurzen Zeitspanne starben mit den Sauriern über die Hälfte aller Arten aus.
Asteroideneinschläge stellen oft ein fatales Ereignis für die Betroffenen dar, aber sie sind im kosmischen Geschehen an der Tagesordnung, und auch heutzutage machen sie immer wieder Schlagzeilen. Man kann darüber philosophieren, ob das Ereignis damals überhaupt erst ermöglichte, dass die Entwicklung der Säugetiere einen neuen Aufschwung nahm, an dessen vorläufigem Ende wir Menschen uns als Krone der Schöpfung wähnen.
Ebenso kann man aber munter und medienwirksam darüber spekulieren, ob auch unser Ende eines – hoffentlich fernen – Tages aus dem All daherkommt, sei es nun in Gestalt eines Asteroiden oder anderer desaströser Launen des Kosmos.
Immerhin verdanken wir einem frühen Bombardement aus dem All auch die Anreicherung unserer Erdkruste mit all den Preziosen, nach denen wir heute so emsig und profitorientiert graben. Dazu gehören auch die Rohstoffe, auf denen zunehmend unsere Wachstumsphilosophie fußt, von den klassischen Metallen bis zu den Seltenen Erden. Und natürlich nicht zu vergessen das Gold, jenes Faszinosum, welches schon vor 6000 Jahren die Menschheit betörte.
Das Gold diente über Jahrtausende als Symbol für das Göttliche schlechthin, es steht seit je für werthaltige Beständigkeit und Glanz. Natürlich gilt auch hier, dass sich bei so viel Licht auch Schatten findet, und so wurde die Geschichte des Goldes eine ambivalente Schicksalsgeschichte des modernen Menschen. Da wurden Edelmetalle zum Zankapfel zwischen Völkern, seine Ausbeutung führte hier und da zur Bekehrung und Versklavung und manch einer wurde selbst zum Sklaven des Goldes, ohne es zu reflektieren. Natürlich griffen auch alle großen Religionen zur Instrumentalisierung des Edelmetalles, denn was die Massen fasziniert, wurde schon immer von Religionsführern aller Couleur in ihren Dienst gestellt. Noch heute bewegt das Gelbmetall die Gemüter, ob nun aus Eitelkeit oder zur Besicherung des eigenen Vermögens angesichts der globalen Staatsschuldenkrise.
Letztere zwingt uns auch zunehmend zur Beschäftigung mit exorbitant großen Zahlen, völlig jenseits von Alltagsbezug und unserer eigenen Lebenswirklichkeit. Wollen wir unser Dasein da nicht nur als staunender Zuschauer fristen, sind wir gut beraten, auch hier unser Wissen auf den neuesten Stand und in einen historischen Zusammenhang zu bringen. Schon Archimedes fragte sich, wieviel Sandkörner ins Universum passten, wir fragen uns im Kontext von Big Data, ob die neuen Computer der NSA schon in der Lage sind, die gesamte Welt in Silizium zu spiegeln.
Lebenslanges Lernen heißt die ausgegebene Parole. Das ist so neu nicht und liegt ganz auf der Linie schon der alten griechischen Philosophen mit ihrem Wissensdurst. Schon damals spielte sich Wissen auf der Schnittstelle von Praxis und Theorie ab, zwischen Archimedes und Sokrates, sowie unter der ontologischen Fragestellung von Sinnhaftigkeit und Risiko.
Das muss nicht immer von schulischem Ernst geprägt sein, es darf hier und da auch unterhaltsam sein.
2
Eine Frage der Dosis
Am Anfang war der Urknall. Es war der Anfang der Zeit und des Raumes gleichermaßen, und es wurde auch Licht. So jedenfalls lehrt es uns das kosmologische Standardmodell der Physik.
Kurz danach hat das Universum mit über Lichtgeschwindigkeit sehr schnell weiteren Raum gewonnen, es war die Phase der Inflation, und auch in den folgenden Milliarden von Jahren expandierte der Kosmos weiter fort. Heute und 13,8 Mrd. Jahre nach dem großen Knall würde man nun erwarten, dass die Materie einigermaßen gleichmäßig im Raum verteilt ist, auch wenn hier und da eine gewisse Klumpenbildung erfolgte, und zwar zu jenen Strukturen, die wir heute als Galaxienhaufen, Galaxien und Sonnensysteme bezeichnen.
Aber es ist im Weltraum und überhaupt in der Natur nicht alles gleichmäßig, oder wie der Naturwissenschaftler sagen würde, homogen und isotrop verteilt. Die gleichen Kräfte und Gesetze der Physik, die für eine Expansion des Universums sorgten, bewirkten auch die bekannten lokalen Konzentrationen von Masse und Struktur, die galaktischen Verklumpungen.
Unter einer homogenen Verteilung versteht man übrigens eine solche wie etwa bei einem Gas in einem Luftballon oder wie bei der Durchmischung des Kaffees mit der Milch nach ausreichend langem Rühren. Das ist ein Idealfall und es hat etwas mit der immer zunehmenden Entropie zu tun, einem natürlichen Drang der Dinge zur Verteilung. Mikroskopische Substanzen oder Stoffe neigen, wenn man sie sich selbst überlässt, nicht zur Konzentration, sondern zu Unordnung oder Zerstreuung. Dies ist auch der Grund, warum unsere Atmosphäre mit ihren Hauptbestandteilen Stickstoff und Sauerstoff so gut durchmischt ist und weshalb der Salzgehalt in den Weltmeeren lokal nicht besonders schwankt.
Durchmischung unter dem Einfluss von Bewegung ist ein physikalisches und gleichzeitig ein statistisches Phänomen. Ein Lied davon singen kann jeder, dem schon mal eine Tüte Erbsen auf den heimischen Fliesenboden gefallen ist oder einmal ein Kinderzimmer nach einem Kindergeburtstag aufräumen musste. Eine solche Art der Unordnung scheint ein natürliches Prinzip zu sein, aber vielleicht sagen Sie dies erst einmal besser nicht weiter an Ihre lieben Kleinen … sie könnten es als Rechtfertigung für ihr Tun verwenden.
Doch wozu dient diese Eingangsbetrachtung? Es veranschaulicht, dass wir zwar in einer unordentlichen Natur leben, in unserer technisch hochgerüsteten und zivilisierten Gesellschaft aber dazu neigen, stoffliche Elemente, chemische Komponenten oder Rohstoffe aufwendig zusammenzusuchen und zu sortieren. Oder wir holen sie aus der Tiefe der Erde, um sie danach zu filtern, zu raffinieren, zu veredeln und dann in konzentrierter Form in unsere Industrieprozesse oder engste Alltagsumgebung einzuführen. Dort dienen sie dann zum technischen oder ganz persönlichen Gebrauch, bis sie wieder entsorgt werden.
Ständig müssen wir unter Energieaufwand die Umwelt bearbeiten, um die benötigten Materialien, Produkte oder auch Nahrungsmittel zu erhalten. Dieses Prinzip ist die eigentliche Grundlage unserer Zivilisation und des technischen Fortschritts: Ordnung schaffen aus dem vermeintlichen natürlichen Chaos. Auf diese Weise bilden wir hilfreiche Strukturen, gestalten Lebensräume und schaffen Werte.
Zwangsläufig aber konzentrieren wir dabei auch Schadstoffe und Gifte in unserer unmittelbaren Umwelt, auch da, wo diese nicht hingehören. Durch den fortwährenden Prozess der Konzentration bestimmter Stoffe in unseren Behausungen, Produkten oder auch deren Abfallresten generieren wir Risiken und Bedrohungen für Umwelt und unsere eigene Gesundheit. Dabei wird niemand bestreiten, dass alles das, was uns als Rohstoff dient, natürlich auch ohne menschliches Zutun existent ist und damit ein gewisses Risiko darstellt. Jedoch finden wir es normalerweise an Orten, in Zuständen und in Mengen vor, wie die Erdgeschichte es uns über Jahrmillionen hinterlassen hat, und worauf sich die langsame menschliche Evolution einstellen konnte.
Als aktuelle Beispiele für typisch anthropogene Schadstoffkonzentration mit fatalen Auswirkungen lässt sich vieles anführen. Neben den generell verwerflichen Industrieabwässern in Flüssen, Luftverschmutzungen oder illegaler Giftmüllentsorgung in entlegenen Gebieten der dritten Welt sind es aber auch die scheinbar ganz normalen Vorgänge unseres Alltags. Es beginnt mit dem energieintensiven Einkauf per Auto und endet mit der Entsorgung der sogenannten Verpackungswertstoffe. Dazu kommen Risiken aus der Konzentration neuer Problemstoffe in unserer Lebensumgebung, ob nun karzinogenes Asbest in Gebäudeteilen, chronisch toxisches PCB (polychlorierte Biphenyle) in unserer Nahrungskette oder der berüchtigte vielschichtige Feinstaub in urbaner Atemluft.
Nicht umsonst bestehen die Lösungsansätze nicht nur aus einer vielenorts schon übertriebenen Regulierung mit allerlei Verboten und Verordnungen, sondern auch aus einer umfassenden Aufklärung von Bürgern und Verbrauchern, um über die Vermeidung von Risiken auch selbst entscheiden zu können.
Da aber das Übel prinzipiell in einer anthropogenen Konzentration von Schadstoffen in der eigenen Lebenswelt besteht, dürfte die effektivste Maßnahme dagegen in einer Reduzierung oder Unterlassung liegen. Endlagerlösungen, wie sie beispielsweise in der deutschen Atomenergiefrage seit gefühlten hundert Jahren diskutiert werden, müssen nicht notwendigerweise auch richtig für konventionelle Schadstoffe und Umweltgifte sein. Die Alternative könnte auch lauten: solution by dilution of pollution, also gewissermaßen die Wiederherbeiführung des natürlichen Ausgangszustandes, wenn denn jener in einer weitläufigen Verteilung unbedenklicher Konzentration bestand.
Die Umweltproblematik erfasste man erkenntnistheoretisch erst relativ spät am Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts und erfand dafür auch extra das neue Wort Umweltverschmutzung. Mittlerweile begleitet uns das Thema auf Schritt und Tritt, mit eigenen Gesetzen, EU-Verordnungen und entsprechender Bußgeldbedrohung. Wir unterscheiden zwischen unbedenklichen normalen Müllarten, die wir ebenfalls fleißig sortieren, und Schadstoffen sowie den eigentlichen Giften. Umweltgesichtspunkte prägen mehr oder weniger unser Verhalten und haben ihren festen Platz in den Nachrichten und unserem Bewusstsein, namentlich dem Umweltbewusstsein.
Noch anders verhält es sich mit der Radioaktivität. Hier generieren wir teilweise sogar schädliche Substanzen aus vorher vollkommen unproblematischer Materie durch eine künstliche Veränderung der Identität des chemischen Elements. Es entsteht etwas, was vorher gar nicht da war, der Traum der Alchemisten, leider manchmal auch mit der lästigen Konsequenz, dass der hierbei generierte radioaktive Abfall noch tausende von Jahre in die Zukunft strahlt und unserer sorgsamen Überwachung bedarf.
Unbestritten scheint jedenfalls, dass der Mensch durch die zivilisatorischen Erfordernisse, oder das, was er dafür hält, eine Veränderung seiner eigenen Umwelt betreibt und sich damit zusätzlichen Risiken aussetzt. Diese sind zumeist eine Frage der Dosierung.
Alle Dinge sind Gift (Sola dosis facit venenum) wusste bereits im 16. Jahrhundert Paracelsus1) und wird mit diesem Zitat noch heute viel gepriesen.
Nicht immer zu Recht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass er sonst auch sehr viel, wenn auch aus seiner Zeit verständlichen Unsinn über die Ursachen von menschlichen Krankheiten verbreitet hat. So existierten für ihn dafür die fünf Hauptfaktoren Gestirneinfluss, Macht Gottes, Geistereinfluss, konstitutionale Vorherbestimmung und erst als letztes der Gifteinfluss. Er war eben ein Alchemist und er lebte in der Hochzeit der Hokuspokus-Medizin, die schon immer mit viel Magie und einem Schuss Astrologie operierte. Tragisch übrigens für ihn selbst, dass er offenbar aus seinem revolutionären Wissen nicht die richtigen Konsequenzen zog. Es wird nach wissenschaftlichen Untersuchungen seiner sterblichen Überreste vermutet, dass er an einer Quecksilbervergiftung verstarb. Übrigens nicht der erste Prominente, der mit diesem äußerst giftigen Metall allzu leichtfertig herumexperimentierte, denn bereits der erste Kaiser von China teilte sein Schicksal auf dem Wege in die vermeintliche Unsterblichkeit. Er glaubte der Beratung seiner Alchemisten, durch die beständige Einnahme von Quecksilberpräparaten das ewige Leben zu gewinnen.
Vielleicht hat Paracelsus auch einfach nur nicht die richtigen Konsequenzen aus seinen eigenen Weisheiten gezogen, es kommt eben auf die richtige Dosierung an.
Die Grenzen zwischen Heilmittel oder Gift sind oft recht schmal. Hiervon überzeugt uns auch heute immer wieder das unangenehme Studium des Beipackzettels unserer Medikamente. Erst 1976 beschloss der deutsche Bundestag ein neues Arzneimittelgesetz als Antwort auf die 15 Jahre vorangegangene Contergan-Katastrophe der Firma Grünenthal GmbH mit ihren tragischen Folgen der schweren Behinderungen für viele Menschen.
Ohne Nebenwirkung keine Wirkung… und keine Wirkung ohne Ursache
Ursache und Wirkung gehören zusammen, und zwar in genau dieser Reihenfolge, wie wir aus der Betrachtung des Phänomens der Zeit wissen. Trotzdem gehört die Vertauschung von Ursache und Wirkung zu den beliebtesten und gelegentlich auch vorsätzlichen Irrtümern. Manchmal wollen uns gewisse Zeitgenossen auch lehren, dass noch so kleinste Ursachen die größten Wirkungen entfalten können. Das mag zwar für den Grenzbereich der Chaosphysik manchmal zutreffen, ist aber dann nicht reproduzierbar und nur selten von praktischem Anwendungsnutzen.
Neben den Vertretern und Anhängern von religiösen und metaphysischen Denkmodellen waren es vor allem die Alchemisten und Scharlatane der vergangenen Jahrhunderte, die mit ihren Thesen und Versprechungen die Menschen in ihren Bann zogen. Das gilt leider auch bis in die heutige Zeit. Religiöser Glaube an vermeintliche Wunder oder Heils- und Heilungsversprechen, die mit ihren Wirkungen angeblich auch direkt in unseren irdischen Alltag reichen, sind und bleiben verbreitet. Oft ist es auch der Glaube als mentaler Kitt, der in jenen Fällen greifen soll, wo das Kausalitätsverständnis versagt, etwa weil der betreffende Sachverhalt für unsere Intelligenz zu kompliziert ist oder sich ohnehin in metaphysischen Sphären abspielt. Das wirkt sich auf sehr viele unserer täglichen Entscheidungen aus, die wir dann viel lieber mit dem Bauch als mit dem Verstand treffen, auf der Basis eines Glaubens an eine religiöse, politische oder medizinische Grundanschauung. Und es ist der Traum eines jeden Marketeers, wenn sich die Equity seiner Brand auf den uneingeschränkt loyalen Glauben seiner Konsumenten stützt. Das gilt in besonderem Maße für Heilmittel, und da bleibt man dann seiner Marke lebenslang treu, weil man glaubt, und nicht aufgrund wiederholter kritischer Kausalitätsbetrachtungen.
Der einzige plausible Fall, in denen die Ursache der Wirkung nachfolgt, ist übrigens derjenige, bei dem auf einer Beerdigung der behandelnde Arzt hinter dem Sarg des an seiner Behandlung verstorbenen Patienten läuft. So jedenfalls überlieferte es uns schon kein geringerer als der Nobelpreisträger Robert Koch (1843–1910).
Nehmen wir uns als historisches Beispiel Wilhelm Heinrich Schüßler (1821–1898) vor, jenem homöopathischen Arzt, dem wir die bahnbrechende Erfindung der Schüßlersalze verdanken.
Schüßler gewann seine Eingebung, wie er es zu Ruhm und Reichtum bringen könnte, nach der Analyse menschlicher Totenasche. In dieser glaubte er zunächst, zwölf verschiedenartige Mineralsalze gefunden zu haben. An sich nichts Besonderes, allerdings besteht der menschliche Körper zu drei Vierteln aus Sauer- und Wasserstoff, einem Fünftel aus Kohlenstoff und nur etwa zu einem Zwanzigstel aus anderen chemischen Elementen. Unter dieser Gesamtverteilung der menschlichen Konsistenz bleibt also rein statisch nur wenig Raum für Feststoffe wie metallhaltige Salzverbindungen. Diese bezeichnet man im Zusammenhang der Betrachtung von Organismen als Mineralstoff. Chemisch sind sie nichts weiter als Metallsalze, die in Wasser gelöst zu elektrisch leitenden Elektrolyten werden und für die Funktion des Organismus unentbehrlich sind. Etwa drei Kilogramm solchen Materials bleiben bei der Einäscherung eines Menschen zurück.
Und da Schüßler im Verlauf seiner Arbeiten die Zahl 12 wohl zu rund und zu biblisch erschien, legt er später noch mit einigen Ergänzungsstoffen nach und numerierte diese weiter durch bis zur Zahl 27. Alle diese Substanzen hielt er für prominent lebenswichtig und seine These war, dass menschliche Krankheiten durch einen Mangel an solchen Mineralstoffen entstünden, eine Heilung sei also durch eine entsprechende Zufuhr zu erreichen.
Allerdings, und hier wird die Sache kurios, müssten seine Salze bei der Einnahme in der Regel eins zu einer Million oder gar eins zu einer Billion verdünnt sein, und er behauptete, dass die betreffenden Mineralstoffe von den Körperzellen in dieser Verdünnung viel besser aufgenommen werden könnten. Auf der Methode der hochverdünnten Wirkstoffaufnahme beruht auch die Homöopathie, deren Losung ja bekanntlich lautet: Potenzierung durch Verdünnung. Allerdings legte Herr Schüßler stets Wert auf die Feststellung, dass seine Methode etwas grundlegend anderes als Homöopathie darstelle.
Bei der Homöopathie, deren Erfinder ein Zeitgenosse Schüßlers namens Samuel Hahnemann war, wird Ähnliches mit Ähnlichem bekämpft (Simile-Prinzip), natürlich in homöopathischen Dosen. Dagegen behandelte Schüßler die Malaisen mit seiner Standardauswahl an Mineralstoffen, aber eben auch in minimierter Dosierung. Zwischen den Anhängern beider Heilmethoden entwickelte sich im 19. Jahrhunderts ein bizarrer Wissenschaftsstreit. Schüßler wurde dabei Verrat an der homöopathischen Sache vorgeworfen, bis er schließlich aus dem Centralverein homöopathischer Ärzte austrat. Von Anfang an war da wohl ein Schuss Ideologie im Spiel, gepaart wie so oft mit übersteigertem persönlichem Ehrgeiz und ökonomischem Interesse.
Bei einer Konzentration von eins zu einer Million muss man etwa 1000 Tabletten schlucken, um nur ein Milligramm des von Ihren Körperzellen angeblich vermissten Minerals aufzunehmen. Wo da die Logik zur Behebung eines Mangels ist, hat Herr Schüßler wohl als Geheimnis mit ins Grab genommen. Wollten Sie gar ein ganzes Gramm der von Ihrem ausgelaugten Körper so dringend benötigten Substanz aufnehmen, müssten Sie etwa eine Million Tabletten vom Gewicht einer ganzen Tonne verschlucken. Gesund ist das wohl nicht … Um wieviel reicher Sie dann hiermit den Schüßlersalz-Vertreiber machen würden, überlasse ich Ihren eigenen Berechnungen.
Letztlich aber heißt es ja bekanntlich: Wer heilt, hat Recht, jedenfalls im jeweiligen Einzelfall und aus der Sicht des erfolgreich kurierten Patienten.
Wenn Sie zum Beispiel kleine Kinder haben, sollten Sie unbedingt die Heiße 7 kennen. Es handelt sich hierbei um Magnesium-Phosphoricum, das in heißem Wasser aufgelöst verabreicht werden sollte, geschüttelt und nicht gerührt, schon gar nicht mit einem metallenen Löffel! Es soll hervorragend helfen zur Beruhigung der kleinen aufsässigen Fratzen. Diese glauben selbst zwar nicht an die Wirkung, aber immerhin hat die Einnahme eine ungeheuer beruhigende Wirkung auf die Eltern.
Und sollten Sie unter einer wie auch immer gearteten Blockade leiden, so empfiehlt die homöopathische Gilde neuerdings Murus Berlinensis, und zwar in der Centesimal-Potenz C6. Das Homöopathikum gibt es, neben der traditionellen Darreichungsform als Globuli, sogar auch ganz innovativ als Tropfen oder Mundspray. Der Wirkstoff ist besonders originell, es handelt sich um pulverisierte Bruchstücke der Berliner Mauer.2)
Unverständlich ist es aber, dass selbst einige Krankenkassen die Kosten für eine Behandlung nach Schüßler übernehmen, übrigens trotz chronischer Budgetprobleme und eines grundlegend negativen Urteils durch die Stiftung Warentest. Letztere ist ja bekanntlich zu einer Art TÜV in Sachen Konsumentenprodukte avanciert, und an deren Urteil hat sich schon so manch ein Hersteller auch juristisch die Zähne ausgebissen, wenn er sich beim StiWa-Rating benachteiligt fühlte. Der Fachbereich der Humanmedizin an der Philipps-Universität Marburg brandmarkte die Homöopathie 1992 im Rahmen der Marburger Erklärung zur Homöopathie übrigens als Irrlehre und Täuschung des Patienten, und zwar als es um die Frage ging, sie in den offiziellen Lehrplan des Fachbereichs Medizin aufzunehmen.3) Ebenso gut könne man Reinkarnationstherapie und astrologische Gesundheitsberatung in den Universitätsbetrieb einführen, so die deutliche Begründung.
Seien Sie also in jedem Falle vorsichtig, wenn Ihnen jemand Schüßlersalze empfiehlt, reiner Blödsinn macht noch kein Geheimnis. Interessant auch, dass gerade unter dem für mystische Kräfte so anfälligen Nationalsozialismus die praktizierenden deutschen Alternativheiler den offiziellen Status eines Heilpraktikers erhielten.
Allerdings versetzt der menschliche Glaube bekanntlich Berge. Vielleicht ist es ja das, und ein Placebo-Effekt sollte so einfach nicht von der Hand gewiesen werden. Dabei handelt es sich um die Täuschung als Wirkprinzip mit einer durchaus realen Heilungschance. Glaube und Zuversicht aktivieren die Selbstheilungskräfte.
Aber funktioniert so ein Placebo-Effekt auch bei Tieren, etwa unseren geliebten Schoßhündchen [1]? Es scheint fast so, denn mittlerweile hat man auch schon das Schüßlergeschäft für Hundehalter entdeckt. Bei Afterbrennen reichen Sie einfach Nr. 3 Ferrum Phosphoricum. Und sollte Ihr Liebling unter Gedächtnisproblemen leiden, etwa wenn er das Kommando Bei Fuß! vergessen haben sollte, dann besorgen Sie ihm schnell die Nr. 1 Calcium Fluoratum. Zumindest Sie als Halter werden hinterher Stein und Bein schwören, dass es geholfen hat.
Das Verlässliche an solchen Präparaten ist aber in jedem Falle eines: Was keine Wirkung hat, hat auch keine Nebenwirkung! So fand schon der deutsche Pharmakologe Gustav Kuschinsky (1904–1992): Wenn behauptet wird, dass eine Substanz keine Nebenwirkung zeigt, so besteht der dringende Verdacht, dass sie auch keine Hauptwirkung hat.
Nebenwirkungen von Medikamenten sind mittlerweile trotz ausgiebiger Warnungen auf den Beipackzetteln auf der Hitliste der Todesursachen ganz oben gelandet. Jährlich sterben etwa 100 000 Menschen in Deutschland an solchen Kollateralschäden pharmazeutischer Produktanwendungen.
Was unsere Schüßlersalze anbelangt, so sollten wir wenigsten beachten, dass das Schüßler-Tablettenträgermaterial selbst aus Laktose besteht, schlecht also für die 15% aller Deutschen mit einer ausgeprägten Intoleranz. Und letztlich besteht auch immer die Gefahr, im naiven Glauben an das Wunder einer natürlichen Heilung eine eigentlich notwendige schulmedizinische Therapie zu unterlassen oder zu verzögern.
Dagegen hat die Sache mit der homöopathischen Dosis aber auch neben dem Placebo-Effekt seinen ideellen Reiz. Im Bewusstsein, dass sich der menschliche Körper in seinen Ingredienzien aus der Umwelt ernährt, wurden wir nicht nur aus Erde geschaffen, darunter auch aus solcher, die dem Material fremder Sternensysteme entstammt. Wir zerfallen bekanntlich auch wieder zu Staub und führen uns selbst somit wieder einer Wiederverwertung durch die lebendige Natur zu, etwa, indem unsere Körpermoleküle von Pflanzen neu aufgenommen werden. Ein Gedanke, den übrigens auch der Alt-Kanzler Helmut Schmidt in einem bekannten Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit als tröstlich ansah.4) Dabei geschieht dies übrigens nicht nur nach unserem Tode, auch fortlaufend regeneriert sich der Körper, so etwa alle zehn Jahre. Noch tröstlicher mögen es daher einige finden, dass sie somit in homöopathischer Dosis (und darunter) nicht nur aus ihren Vorfahren bestehen, sondern dass dies sogar alle illustren Persönlichkeiten der Vergangenheit mit einschließt, inklusive Jesus, Buddha und Mohammed höchstpersönlich.
Wo wir aber nun schon das Thema Nebenwirkungen gestreift haben, wollen wir das auch vertiefen. Nehmen wir uns das Beispiel eines blutdrucksenkenden Präparates, eines dieser modernen Patentmittel gegen unsere Zivilisationskrankheiten, denen wir maßgeblich das hohe Durchschnittslebensalter unserer Zeit verdanken.
Wenn Sie beim angestrengten Studium des Kleingedruckten im Beipackzettel Ihres unaussprechlichen Beta-Adrenorezeptorenblockers Bisoprololhemifumarat auf der Suche nach der Erklärung potenzieller Nebenwirkungen endlich an der Stelle mit den Häufigkeitsangaben angelangt sind, werden Sie beruhigt feststellen können, dass eine Schuppenflechte eher selten und Muskelkrämpfe nur gelegentlich auftreten können. Nun gilt auch dieses natürlich in Abhängigkeit von der Dauer und Dosis der Einnahme, aber immerhin ist doch nach langwierigen Test- und Zulassungsprozeduren sichergestellt worden, dass unsere Arzneimittel einigermaßen sicher sind.
Nach dem deutschen Arzneimittelgesetz (AMG) und den gängigen Vorschriften sind die Angaben über das Auftreten von Nebenwirkungen Pflicht und wie folgt genormt:
• Sehr häufig:
mehr als 1 Behandelter von 10
• Häufig:
1 bis 10 Behandelte von 100
• Gelegentlich:
1 bis 10 Behandelte von 1000
• Selten:
1 bis 10 Behandelte von 10 000
• Sehr selten:
weniger als 1 Behandelter von 10 000
• Nicht bekannt:
Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
Auch den Hinweis, dass die Behandlung bei Verdacht auf Überdosierung nach Rücksprache mit dem betreuenden Arzt abgebrochen werden sollte, nehmen wir dankbar zur Kenntnis. Galt doch zu früheren Zeiten eher die pauschale Erkenntnis: Viel hilft viel.
Die überhaupt erfolgreichsten Zivilisationspräparate sind Betablocker und Mittel gegen Bluthochdruck. Die Prophylaxe und Therapie gegen Bluthochdruck ist ein ausgesprochener Segen für Menschheit und der Erfolg dieser Präparate ist ein Grund dafür, dass die Lebenserwartung signifikant steigt. Schlaganfälle und Herzinfarkte sorgten noch bis in die 60er Jahre häufig für das jähe Ende von hauptsächlich Männern in ihren besten Jahren und waren unter den Top 10 der natürlichen Todesursachen. Fast jeder kann sich wohl heute an einen solchen traurigen Fall bei den eigenen Eltern oder Großeltern erinnern.
Aber auch früher gab es schon Mittel dagegen. Skurril geradezu mutet das alte Hausmittel gegen hohen Blutdruck an: das Setzen von Blutegeln. Katharina die Große soll darauf geschworen haben, verschiedene Substanzen im Speichel der kleinen Tierchen haben eine gefäßerweiternde und gerinnungshemmende Wirkung, darunter das bekannte Heparin. Gelegentlich wandte man das Mittel aber auch bei akutem Schlaganfall an.
Das skurrilste Beispiel hierfür ist wohl das des alternden Massenmörders Josef Stalin. Der Diktator litt nicht nur unter Bluthochdruck, sondern offenbar auch an Verfolgungswahn, was ihm in dieser Kombination schließlich zum Verhängnis werden sollte.
Anfang März 1953 ereilte ihn überraschend ein Schlaganfall, dummerweise aber hatte er erst kurz vorher seine Leibärzte aus einem paranoiden Anfall heraus in den Ruhestand versetzt. Nach einem Kommuniqué der Nachrichtenagentur Tass hieß es dazu Anfang des Jahres: Sowjetische Sicherheitsorgane entlarvten vor einiger Zeit eine terroristische Gruppe von Ärzten, die das Leben sowjetischer Führer zu verkürzen suchten, indem sie schädliche Arzneien verordneten.5)
So kam es, dass die verängstigten, aber trotzdem in seiner Nähe verbliebenen Ärzte vorsichtshalber nur eine sehr behutsame konservative Behandlung vornahmen. Selbst nach einer akuten Hirnblutung des Diktators und tagelanger Bewusstlosigkeit begnügte man sich einfach mit dem Ansetzen von Blutegeln. Das alte Hausmittel konnte aber natürlich in dieser außergewöhnlich lebensbedrohlichen Situation keinen Heilerfolg mehr bringen. Falsche Dosis, falsches Mittel, falsches Timing.
Abb. 2.1 Medikament und Gegenmittel.
Eine schnelle erste effiziente Hilfe wurde auch durch die Sicherheitsmaßnahmen erschwert, denn der Despot weilte in seiner komfortablen Datscha aus Angst vor Attentaten stets in einem von gleich drei identisch ausgestatteten Gemächern. Die Türen ließen sich aber nur von innen durch einen besonderen elektrischen Schließmechanismus entriegeln. Damit war eine frühe Entdeckung des Kollabierten eher unwahrscheinlich, und aus Respekt musste durch die Partei erst eine Kommission aus Freiwilligen gebildet werden, die nach dem Rechten sehen sollten. Das gelang dann nicht mehr rechtzeitig, nach offiziellem Bulletin verstarb der 73-jährige Generalissimus am 5. März 1953 um 21:50 Uhr an den Folgen einer Arteriosklerose.
Die Sowjetunion war damit erst einmal entstalinisiert, ihre lange Periode der Entstalinisierung der Systeme sollte aber gerade erst beginnen.
Nach den Zahlen des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller e.V. wurden 2011 Mittel in Höhe von knapp 40 Milliarden über den deutschen Apothekertisch gereicht. Bei allen politischen Anstrengungen zur Kostenreduzierung und den Bemühungen der Pharmalobby um einen profitablen Markt bleibt dieser aufgrund der alternden Gesellschaft ein Wachstumsmarkt. Interessant ist dabei nicht nur, dass die Hälfte davon in den Schubladen der Patienten vergammeln, sondern auch, dass sich auch aus den Nebenwirkungsrisiken neue Wachstumsimpulse ergeben. Schließlich lassen sich auch diese Nebenwirkungen mit wieder anderen Präparaten behandeln (Abb. 2.1).
Nehmen wir als Beispiel das bekannte Schmerzmittel Diclofenac (Antirheumaticum/Analgetikum) gegen unsere arthritischen Rückenschmerzen vom jahrelangen Sitzen in gekrümmter Haltung vor dem Personalcomputer. Bei aller guten Wirkung sind hier die am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen Magenschleimhaut– und Darmbeeinträchtigungen, mal ganz abgesehen von neueren Hinweisen auf die abschwächende Wirkung auf blutdrucksenkende Präparate und eine signifikante Erhöhung des Herzinfarktrisikos. Diclofenac hemmt im Magen die Produktion der Prostaglandine und damit des schützenden Magenschleims auf der Schleimhaut gegen die aggressive Magensäure. Viele Menschen sind überrascht von der Menge an Salzsäure, die ein menschlicher Magen so an einem Tag produziert, schließlich fällt ihr die Aufgabe der Zersetzung unserer Nahrung zu. Der tägliche Liter solch scharfen Magensaftes könnte ausreichen, sämtliche Toilettenschüsseln und Waschbecken eines großen Einfamilienhauses frei von Verkalkung zu halten und sich den kommerziellen Kalkreiniger zu sparen. Beeinträchtigt nun unser Diclo den Magenschleimhautschutz, wendet sich die Salzsäure gegen sie selbst und beschert vielen Daueranwendern Magenoder Zwölffingerdarmgeschwüre. Warum also nicht gleich mit einem zusätzlichen Medikament dazu die Magensäureproduktion hemmen?
Nun sollte man annehmen, dass beispielsweise ein deutsches Krankenhaus ein Ort der ärztlichen Weisheit und Anwendungssicherheit bei Medikamenten ist. Wenn Sie einer solchen Ansicht zuneigen, sollten Sie zumindest einmal den zweiten Teil der Annahme kritisch überdenken. Tatsächlich gibt es mehr Medikamententote in deutschen Krankenhäusern als Unfalltote im täglichen Leben wie Haushalt, Beruf oder Verkehr. Die Experten sprechen dabei von unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Anstatt dass Heilmittel bestehende Leiden bekämpfen, werden sie durch Überdosierungen, Nebenwirkungen oder allergische Reaktionen so selbst zu einer Krankheitsursache, manchmal versetzten sie dem ohnehin angeschlagenen und oft auch älteren Patienten den Todesstoß.
Krankenhaus ist dabei nicht gleich Krankenhaus. Was früher unter kommunaler Hoheit und Aufsicht stand und vielleicht sogar medizinisches Kompetenzzentrum der Region war, leidet heute unter Kosten -oder Konkurrenzdruck. Private Gesundheitskonzerne und jede Menge ambulante Versorgungszentren kämpfen um die Gunst und vor allem das Geld des Patienten. Dabei mischen sich auch fragwürdige Klitschen unter die vielen Ärztehäuser oder Medizinische Versorgungszentren, in denen das große Geld mit Knieprothesen, Kiefer-OPs oder angeblich so wichtigen, aber nicht risikolosen Darmspiegelungen gemacht wird. Die medizinischen und hygienischen Bedingungen, unter denen dort Vollnarkosen verabreicht werden, erfüllen mancherorts nicht einmal veterinärklinische Standards. Es werden Zahlen über fatale Vorkommnisse von etwa 30 000 bis 60 000 pro Jahr genannt, wobei es sich um Schätzungen oder Hochrechnungen aus Studien handelt.
Exakte ursachenbezogene Zahlen darf man hier nicht erwarten, schließlich ist der Tod im Krankenhaus in den meisten Fällen keine eindimensionale Folge einer klar diagnostizierten Allein-Ursache, sondern oft der letzte traurige Schritt inmitten multifaktoriell bedingter Funktionsstörungen in einem komplexen Behandlungsumfeld. So gesehen ist es auch erklärlich, dass die behandelnde Ärzteschaft sich im Einzelfall immer wieder aus der direkten Verantwortung herausargumentieren kann.
Überhaupt geht der Trend zur sogenannten Multimorbidität, ironischerweise eine Folge der durch die Medizinkunst erhöhten Lebenserwartung.
Auch wenn ich ein Krankenhaus grundsätzlich natürlich für eine sehr nutzbringende und für viele Menschen lebensrettende Einrichtung halte, kann ich es mir bei dieser Gelegenheit nicht verkneifen: Zu den Kollateralschäden durch Arzneimittel kommen auch noch die sogenannten ärztlichen Kunstfehler. Das Wort Kunstfehler alleine schon lässt einen innehalten, es ist ein etwas künstliches Wort für die Beschreibung eines Behandlungsfehlers, bei dem die ärztliche Berufskunstausübung weit unterhalb der gebotenen Qualitätsstandards zurückbleibt. Selten konzediert man dann ein medizinisches Versagen oder gar schuldhaft ärztliche Sorgfaltspflichtverletzung. Dagegen wählt man lieber Ausreden, die in den Ohren der Patienten fast zynisch klingen, zum Beispiel, dass sich ein behandlungsimmanentes Risiko realisiert habe, am besten auch noch bei einer von vorne herein schicksalhaften Erkrankung. Solche Geschehnisse dann im Nachhinein sachlich sauber aufzuklären, fällt angesichts eines ausgeprägten und überholtem Standesbewusstsein geschuldeten ärztlichen Chorgeist alles andere als leicht.
Die behandelnde Medizin ist also keine besonders hervorgehobene Wissenschaft, sondern eine Kunst. Vielleicht ist sie aber auch nur eine Handwerkskunst oder bloß ein Handwerk, wenn auch mit anspruchsvollerer Ausbildung und finanzieller Aufstiegsgarantie für Mediziner. Möchten Sie einen Arzt im Krankenhaus sprechen, hat er zumeist gerade einen Notfall. Ist etwas schiefgelaufen, ist er meist gar nicht mehr zu sprechen, ist versetzt worden oder macht eine Art freiwilliges soziales Jahr bei Ärzte ohne Grenzen in Afrika. Das gängige Bonmot hierzu lautet: Erst pfuschen und dann vertuschen – und dem Patienten widerfährt dabei im medizinischen Fachjargon ein unerwünschtes Ereignis. Diese unerwünschten Ereignisse kommen heutzutage in unseren Hospitälern gelegentlich bis häufig vor.
Auf der Suche nach verlässlichen Statistiken hierfür wird man auf weit divergierende Schätzungen stoßen, die offizielle Web-Seite des Bundesministeriums für Gesundheit bietet die folgende Variante an: Die Annahmen reichen von 40 000 bis 170 000 Behandlungsfehlern jährlich. Geht man jedoch alleine von den offiziell gemeldeten und den Kliniken auch schuldhaft eingeräumten Todeszahlen aus, so waren es 2010 bescheidene 1712 Todesfälle. Das Aktionsbündnis für Patientensicherheit ging allerdings zu diesem Zeitpunkt von rund 17 000 Todesfällen aus. Die restlichen ca. 90% sind also Dunkelziffer, gekennzeichnet durch Ignoranz, Vertuschung, Schutzdiagnosen und auch unerkannte Fälle.
Was hier fehlt, ist Wahrhaftigkeit und Transparenz, ein unabhängiges und professionelles Berichtssystem (Critical Incident Reporting) mit der Erfassung auch einfacher Verstöße gegen beispielsweise Desinfektionsvorschriften und Arbeitsanweisungen, das Berichten von Beinahe-Fehlern und die entsprechenden regelmäßigen Audits durch objektive Fachkollegen. Leider scheitert dies oft an einer anachronistischen Ärzte-Autokratie mit Egomanen in den Chefpositionen und unkritischen und auf die eigene Karriere fokussierten Assistenzärzten. Dazu kommen auch noch Sprachbarrieren mit ausländischem Personal, sodass selbst der Marburger Bund forderte, dass ausländische Ärzte eine Deutschprüfung ablegen sollten. Ihr Vorsitzender meinte: Ein Arzt aus einem Drittland muss mehr können, als in der Nachtschicht Pizza zu bestellen. Denn schließlich sollte der Operateur wenigstens seinen Patienten selbst aufklären können.7), 8)
Dazu und zum Thema der richtigen Dosierung durchaus passend kommt dann noch ein neues und ganz typisch deutsches Phänomen, das der sogenannten Überbehandlung. 2013 veröffentlichte die OECD eine Studie, nach der 800 000 Überbehandlungen, sprich medizinisch unnötige Operationen jährlich an deutschen Patienten durchgeführt würden. Dabei handelt es sich überwiegend um Knie-, Hüft-, und Wirbelsäulen-OPs, die durch das deutsche Fallpauschalensystem und finanzielle Fehlanreize für die Ärzteschaft in deutschen Krankenhäusern durchgeführt werden. Incentives und Boni also nicht nur für deutsche Versicherungsvertreter und Banker, sondern auch für Ärzte, die dann dem Patienten, statt ihm den medizinisch besten Weg zu weisen, nicht nur überflüssige Igel-Leistungen (Individuelle Gesundheitsleistungen) andienen, sondern gleich auch noch in eigener OP-Sache verkäuferisch tätig werden. Menge kloppen nach dem Motto: Ich hätte da rein zufällig noch ein Belegbett für Sie frei. Nirgends auf der Welt werden so viele Rücken-OPs durchgeführt wie hierzulande. Kein Wunder, wenn die wie Profit-Center geführten privatisierten Krankenhäuser nicht mehr nach Liegetagen, sondern Fallzahlen gegenüber den Krankenkassen abrechnen, und Ärzte Zielvereinbarungen über immer mehr Operationen als Teil ihrer Arbeitsvereinbarungen unterschreiben. Bei 12 000 pro OP ist das ein Riesengeschäft.
Ohnehin geht der Trend zum schnellen operativen Eingriff, sei es aus kosmetischen oder rein gesundheitlichen Gründen. Das ist dann zwar keine Frage der Dosis im eigentlichen Sinne mehr, eher eine Frage der Überdimensionierung des medizinischen Eingriffs. Eine neue Entwicklung bahnt sich mit der rein prophylaktischen Operation an, man lässt sich operieren, obwohl man noch gar nicht krank ist. Das klingt an sich schon krank, wird aber wohl zum Hype der Zukunft, etwa die Entfernung funktional unnötiger oder redundanter Organe. Wozu ein Blinddarm, wenn er doch nur als potenzieller Entzündungsherd fungiert, oder warum nicht gleich die Korrekturlinse direkt ins Auge hineinoperieren. Einen medizinisch tieferen Sinn könnte eine prophylaktische Brustoperation bei Frauen in jenen Fällen machen, in welchen aufgrund eines vererbten Gendefekts ein bis zu 90-prozentiges Krebsrisiko besteht. Es handelt sich dabei um die Mutation des Tumor-Suppressor-Gens BRCA (breast cancer). Angelina Jolie hat daraus für sich die bittere Konsequenz gezogen, unter den Augen der globalen Medienöffentlichkeit. Es darf jedoch bezweifelt werden, ob dies die Lösung für jedermann und für jede Art von solchermaßen bedingtem Krebs ist.
Vorbeugenden Operationen, die nicht der Krankheitsheilung, sondern einer reinen Funktionsverbesserung dienen, dürfte jedoch die ferne Zukunft gehören. Science Fiction über Cyborgs (cybernetic organism), die halb Mensch und halb Maschine sind, weist uns hier den unvermeidlichen Weg. Den Anfang machen wir bereits heute mit Prothesen und künstlichen Organen.
Natürlich sind heute stationäre Klinikaufenthalte trotz der damit immanenten Risiken nicht zu umgehen. Wenn Sie aber noch die Wahl haben zwischen Krankenhaus und Urlaubsreise, sollten Sie rein statistisch besser das letztere wählen. Es ist sehr viel sicherer, sich per Flugzeug auf die Reise zu begeben. Ihre Chance, da wieder heil herauszukommen ist um den beeindruckenden Faktor 10 000 besser als bei einem Krankenhaus. Schwere oder tödliche Komplikationen während eines Fluges unterliegen der Wahrscheinlichkeit von lediglich eins zu zwei Millionen!9)
Dabei sind die gesundheitsschädlichen Vorfälle mit Medikamenten im täglichen Leben noch gar nicht mit einbezogen. Auch hier gibt es versehentliche Einnahmefehler oder im Extremfall Missbrauch mit ähnlich katastrophalen Folgen, und auch vom neuerlichen Boom mit gefälschten Arzneimitteln aus Rumänien ist da noch einiges zu erwarten. Etwa fünf Prozent aller Krankenhauseinweisungen sollen auf das Konto von derlei unerwünschten Einnahmefolgen gehen.
Im Übrigen kann man auch ohne medizinische Ursache krank werden. So wie es den Placeboeffekt gibt, gibt es auch den Noceboeffekt: Wer glaubt, dass er krank sein könnte, wird auch krank. Bei manchen steigt schon der Blutdruck, wenn er nur in die Nähe einer Klinik kommt, eine Art Weißkittel-Hypertonie. Die gibt es tatsächlich, da kann schon der Arzt selbst als Nocebo wirken.
Als einzelner Geschädigter eines ärztlichen Kunstfehlers schafft man es selten in die Öffentlichkeit. Die Fälle werden gerne auf intransparente Art und Weise geregelt. Wenn überhaupt, zahlt man lieber nach jahrelangen Streitigkeiten per gerichtlichem Vergleich oder außergerichtlicher Entschädigung, als langfristig teurere Präzedenzurteile zu riskieren. Vorgeschoben werden dafür meist der Schutz der Privatsphäre, die ärztliche Schweigepflicht und das äußerst beliebte Scheinargument des schwebenden Verfahrens.
Große und kleine Skandale
Anders sieht es bei großen Ereignissen und Vorgängen aus, die sich in aller Öffentlichkeit oder in freier Natur abspielen. Die global vernetzten Medien werden solche Fälle binnen kürzester Zeit verbreiten, wenn nicht gar vermarkten, wenn man an die Quote für die zwischengeschalteten Werbeblocks von Sendern wie z. B. n-tv und N24 denkt. Könnte man einerseits dankbar für die vermeintliche totale Transparenz sein und den Umstand, dass vor der globalen Öffentlichkeit heute nichts mehr verborgen gehalten werden kann, muss man andererseits verstehen, dass die Dinge lauffeuerartig hochgeputscht werden, indem einer beim anderen abschreibt unter dem marktimmanenten Zwang, dabei zu sein oder noch einen drauf setzen zu müssen. Für ein paar Tage sind die Zeitungen und TV-Kanäle voll davon, um sich allerdings auch wieder schnell neueren Themen zuzuwenden, nachdem das Thema totgeritten wurde. Medienpluralität ist wohl etwas anderes. Später, nach Jahren des allgemeinen Vergessens wird dann höchstens noch einmal eine Dokumentation zu Unterhaltungszwecken aufgelegt (Stichwort: Edutainment).
Dabei beschränken sich die Medien nicht nur auf ihr Heimatland, sondern glauben, der Bürger sei auch an der Sendung eines Youtube-Videos in den heute-Nachrichten interessiert, das einen in Australien an den Strand gespülten Wal zeigt. Früher hat man den Sack Reis in China auch mal einfach umfallen lassen. Heute sind die Medien gefangen in einem onanistischen Blindstrom des Sensationswettbewerbs und zeichnen mit dem Herauspicken von irrelevanten Highlights und Einzelschicksalen ein Zerrbild der Welt.
Kommen wir aber zu den wirklich relevanten Ereignissen und nehmen beispielsweise den schweren Cyanidunfall am 30.1.2000 in Rumänien.
Was war passiert? Der Damm eines Rückhaltebeckens brach nach schweren Regenfällen, eine rötlich-braune Tunke bahnte sich ihren Weg durch die Landschaft und ergoss sich über das Flüsschen Somes in die Donau. Über 100t mit Schwermetallen versetzte Cyanidlauge gelangte so über einen 2000 km langen Weg ins Schwarze Meer und hinterließ außer 1400t toter Fische auch weithin verseuchte Landstriche. Die freigesetzte Menge an Giften hätte vermutlich ausgereicht, um eine Milliarde Menschen umzubringen. Fast zwei Millionen Menschen in Ungarn konnten nicht mehr auf ihre gewohnten Trinkwasserquellen zurückgreifen. Verantwortlich waren einmal wieder die berühmt-berüchtigten vielschichtigen Ursachen: Konstruktionsfehler und schlechtes Qualitätsmanagement paarte sich mit kriminell menschlichem Versagen und zufällig ungünstigen Wetterbedingungen.
Ein Joint Venture eines australischen Goldminenbetreibers, die Fa. Aurul S.A. betrieb in Baia Mare (heißt: Große Grube, deutsch: Frauenbach) im Gebiet des erzreichen Karpatenbogens im Nordwesten Rumäniens eine Goldaufbereitung. Es war nicht der erste Unfall dieser Art,10) aber nun war erst einmal Schluss, das Werk wurde geschlossen.
Was blieb, sind die Abraumhalden von Jahrhunderten, belastet mit Schwermetallen und anderen Schadstoffen. Schon vor diesem Unfall war Baia Mare mit seinen 140 000 Einwohnern die rumänische Stadt mit der geringsten Lebenserwartung ihrer Einwohner, sie beträgt lediglich 60 Jahre! Offenbar der Preis des Goldes.
Die Geschichte vom Selbstmord der Katzen von Minamata ist nicht minder traurig, der Fall wurde sogar zur Mutter aller Umweltskandale schlechthin.
In der japanischen Bucht von Minamata verseuchte der japanische Chemiekonzern Chisso schon lange vor dem zweiten Weltkrieg jahrelang das Meer mit Quecksilberrückständen. Chisso war in Japan zum Marktführer für unter anderem Düngemittel aufgestiegen und einer seiner industriellen Schlüsselprozesse bestand darin, mit Quecksilbersulfat als Katalysator, den wichtigen chemischen Ausgangsstoff Acetaldehyd herzustellen. Mangels jeglichen Umweltbewusstseins und unternehmerischer Verantwortung leitete man die quecksilberhaltigen Abfallprodukte einfach per ungeklärtem Abwasser ins Meer.
Quecksilber bestach seit jeher die Menschen durch seinen silbrigen Hochglanz (lat. Hydrargyrum: flüssiges Silber) und seine große technische Bedeutung für die Goldförderung. In den Mythen der antiken Alchemisten fand Quecksilber bereits früh seinen festen Platz an der Seite des Planeten Merkur (deshalb englisch: Mercury), so wie die Sonne für das Gold und der Mond für das Silber stand.
Es handelt sich um ein Schwermetall, das schon bei Zimmertemperatur flüssig ist. Wir kennen das schließlich von dem Alltagsgebrauchsgegenstand des Thermometers, jedenfalls solange unser Alltag noch nicht mit chinesischer Ramschtechnik digitalisiert war. Würden Sie eine Billardkugel in eine Tasse mit Quecksilber tauchen, würde diese zu Ihrem Erstaunen auf dem Quecksilber schwimmen. Allerdings ist vom Hantieren mit solchen Mengen Quecksilbers dringend abzuraten. Die Schattenseite von Quecksilber ist nämlich seine akute und auch schleichende Giftigkeit, die sich mithin erst nach Jahren auch kleindosierter Aufnahme im Körper zerstörerisch bemerkbar macht, vornehmlich im Nerven- und Immunsystem. Die Symptome einer chronischen Vergiftung reichen von Gedächtnisverlust über Zittern, seit jeher bekannt als Merkurialzittern, bis zu Psychosen und schwereren Krämpfen. Es muss also nicht immer gleich Alzheimer oder Parkinson sein, vielleicht haben Sie einfach zuviel Thunfisch gegessen, zum Beispiel den in Sushi-Restaurants so beliebten und besonders belasteten Roten Blauflossenthunfisch.11)
Vor über 60 Jahren waren im zerstörten Nachkriegs-Japan potenzielle chronische Schädigungen durch Umweltgifte aber kein Thema, und so musste das Unheil in der Bucht von Minamata seinen Lauf nehmen, leider nur unweit der erst kurz vorher durch die zweite amerikanische Atombombe zu trauriger Berühmtheit gelangten Stadt Nagasaki.
Es begann zu Beginn der 50er Jahre in relativer Stille, und zuerst waren es die Tiere. Man wunderte sich zunehmend über angeschwemmte tote Fische. Dies war schon beunruhigend genug, denn ganze Küstenstädtchen lebten zu dieser Zeit vom Fischfang. Auch, und wohl gerade deswegen schwiegen Behörden und Bevölkerung das augenscheinliche Problem lange nieder. Besonders als stolzer Japaner scheute man schließlich jede Art von negativer Publizität, ob nun aus falsch verstandenem Ehrgefühl oder reinem Geschäftsinteresse.
Ganz ähnlich lief es übrigens auch bereits beim mehrfachen Ausbruch der Pest in Venedig im 16. Jahrhundert. Schon dort standen Geschäftsinteressen der eigentlich gebotenen frühen Warnung und Aufklärung der Bevölkerung im Wege.
In Minamata mussten dann erst noch tote Vögel als Symptom und Menetekel hinzukommen, und schließlich fingen auch die in diesem Gebiet sehr verbreiteten Katzen an, sich merkwürdig zu verhalten. Sie wurden von einer Art Veitstanz befallen, neigten zu unkoordinierten Bewegungsabläufen und es hatte letztlich den Anschein, als wollten sie sich das Leben nehmen, indem sie mit dem Kopf gegen Wände liefen oder sich einfach ins Wasser stürzten.
Irgendwann dann machten diese Ungereimtheiten auch vor den Menschen selbst keinen Halt mehr. Man beobachtete unter den Anwohnern Symptome wie Zittern, epileptische Krämpfe und auch intellektuelle Aussetzer. Schnell wurde klar, dass es sich hier um Vergiftungserscheinungen durch quecksilberhaltiges Trinkwasser und auch Fischnahrung handeln musste. Es waren die typischen neurotoxischen Symptome, obwohl der Chisso-Konzern noch lange alle Schuld und Verantwortung leugnete, und dies, obwohl er sogar in eigenen Kontrollversuchen an Tieren die beobachteten Symptome längst testweise reproduziert hatte. Spätestens 1955 standen Ursache und Wirkung behördlich und auch öffentlich bekannt fest. Man nannte es die Minamata-Krankheit, deren Symptome durch eine Schädigung des Nervensystems durch eine Anreicherung von Methylquecksilber im Körper hervorgerufen wurden. Bei den betroffenen Einwohnern fanden sich Gesundheitsbeeinträchtigungen von Müdigkeit und Körperschmerzen über Lähmungen und Psychosen bis zum Koma.
Vergiftungen und Krankheit hatten sich über die Nahrungskette und die Wasserverunreinigung über den Ozean bis zurück zum Menschen als Verursacher erstreckt. Die vielen Katzen der Umgebung waren vornehmlich von den Fischern selbst gehalten worden, um die Ratten von ihren Fischlagerhallen abzuwehren. Zum Dank wurden sie dafür mit Makrelen und Fischresten gefüttert. Damit war klar, dass sie bei dieser recht einseitigen Ernährung die Hauptbetroffenen der Vergiftungswelle sein und auch zu Tausenden sterben mussten. Man könnte auch sagen zum Glück für die Menschen, die dadurch die Gefahr früher erkannten.
Letztlich mussten mindestens 20 000 Menschen direkt unter neurologischen Funktionsstörungen leiden, man schätzt bis zu 3000 Tote.12)
Am Ende wurden die Kernbereiche des mit Klärschlamm verseuchten Meeresbodens ausgebaggert und im Rahmen von Landgewinnungsmaßnahmen mit Beton und Stahl abgedichtet. Erst gegen Ablauf der 90er Jahre wurde die Fischerei von der japanischen Regierung in den gesperrten Gebieten wieder freigegeben.
Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) und die EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit)13) warnen seit dem immer wieder vor dem übermäßigen Verzehr von Thunfisch und andern Fischarten, und zwar nicht etwa aus artenschützerischen Gründen. Die Fa. Chisso existiert weiterhin auch heute, und der Streit um Entschädigungen für die Opfer zog sich über ein halbes Jahrhundert hin! Entschädigungsregelungen wurden noch im Jahr 2009 per Beschluss des japanischen Parlamentes erlassen.14)
Die Erbin des Chisso-Vermögens, Masato, heiratete schließlich Japans Thronfolger Naruhito, den ältesten Sohn des gegenwärtigen Kaisers Akihito, und machte noch vor ein paar Jahren in der internationalen Yellow-Press bedauerliche Schlagzeilen mit ihrer Depression, da es ihr nicht vergönnt schien, dem Gatten und kaiserlichen Kronprinz einen Sohn für die Sicherung der Dynastie zu schenken.
In unseren Längengraden haben wir es dagegen eher mit dem Schadstoff Dioxin zu tun, irgendwo ist davon immer zuviel drin.
Zuletzt war es in Deutschland im Hühnerfutter, angeblich Rückstände aus der Biodiesel-Fertigung. Im Januar 2011 ging es durch die deutsche Presselandschaft, dass eine Firma aus Schleswig-Holstein dioxin-verseuchtes Futterfett in Umlauf gebracht hat. In großem Stil wurde aus reinem Profitinteresse jahrelang mit technischen Fettsäuren gepantscht. Rein zufällig wurde dies nun publik und damit zum ersten deutschen Lebensmittelskandal des neuen Jahrzehnts.
Dioxine sind chemische Verbindungen, die unterschiedlich giftig sind. Sie entstehen als Nebenprodukte bei Verbrennungsreaktionen von über 300 °C, wie etwa in Müllverbrennungsanlagen. In den menschlichen Körper gelangt, etwa durch kontaminierte Nahrung, reichert es sich im Fettgewebe an, führt bei schädlicher Dosierung zu Stoffwechselstörungen und hat langfristig eine krebserregende Wirkung. Der bekannteste Vertreter ist das aus den 60er Jahren bekannte Seveso-Gift TCDD (Tetrachlordibenzodioxin), das bei seiner Freisetzung bei einem Chemieunfall in einem Werk von Hoffmann – La Roche 1976 in Mailand traurige Berühmtheit erlangte. Übrigens nicht nur wegen der unmittelbaren schädlichen Wirkung auf Flora und Fauna in der Umgebung, sondern auch wegen den damit verbundenen Schmiergeldskandalen und noch nach Jahren später laufenden Fahndungen nach durch die Müll-Mafia verschobenen Seveso Giftmüllfässern. TCDD ist so etwa 1000 mal giftiger als das allseits gefürchtete Gift Zyankali und hat sich bei Tierversuchen schon bei kleinsten Mengenaufnahmen (ein Millionstel Gramm pro Kilo Körpergewicht) als tödlich erwiesen.
Ein eindrucksvolles Beispiel für eine Dioxinvergiftung lieferte uns 2004 der Fall Viktor Juschtschenko. Schon früher war die UdSSR als Reich des Bösen mit ihrem von ethischen Bedenken relativ unbelasteten Geheimdienst KGB ein beliebtes Experimentierfeld für politische Giftmorde. Dies geht offenbar auf eine lange russische Tradition schon zur Zarenzeit zurück und hielt sich auch nach dem Fall des Eisernen Vorgangs als zwar plumpe, aber wirkungsvolle Methode zum Loswerden unbequemer Antagonisten. Der ukrainische Präsidentschaftskandidat Wiktor Juschtschenko kämpfte lange mit den Folgen des Giftes, das ihm beim Abendessen mit dem ukrainischen Geheimdienstchef untergejubelt worden war. Organleiden, Nervenschäden, die Entstellung seines Gesichtes und etwa 25 Operationen waren die dramatische Folge dieses heimtückischen Mordversuches.
Beim deutschen Dioxin-Eierskandal Anfang 2011 aber versuchte man zunächst, den Ball flach zu halten. Die beruhigenden Empfehlungen der verantwortlichen Stellen lauteten zunächst, dass man bis zu zwei Eier täglich essen dürfe, bevor der relevante Grenzwert überschritten werde. Gleichzeitig konnte man aber immer wieder der Presse entnehmen, dass sich Dioxin im Körper nur sehr langsam abbaut. Wie kann das also Sinn ergeben? Entweder baut der menschliche Organismus Dioxin zeitnah ab, dann kann man täglich eine konstante Dosis zu sich nehmen, ohne dass eine Gesundheitsgefahr besteht, oder aber es baut sich eben nicht ab, dann kumuliert sich die tägliche Dosis im Körper und man bekommt irgendwann todsicher ein Problem à la Juschtschenko.
Die Pressekonferenz unserer Gesundheitsministerin Ilse Aigner am 14.1.2011 gab hierüber leider keinen Aufschluss, trotz einiger obskurer Diskussionen über die Definition jener Grenzwerte und deren Sinnhaftigkeit. Diese seien an einem adoleszenten Menschen normiert worden, und eine Gefahr für Säuglinge bestünde von daher gesehen auch bei Kumulation nicht, da der Säugling ja nicht ewig Säugling bleiben würde. Das hatte nicht wirklich beruhigend gewirkt, außerdem hält sich die Realität nun einmal nicht immer an die Norm.
Interessant war in diesem Zusammenhang auch, dass es immer noch möglich war, nach der Skandalveröffentlichung dioxinbehaftetes Schweinefleisch nach Polen zu exportieren, und dass es gerade China war, das sogleich einen Importstop für Fleisch und Eiern aus der EU aussprach.15)
Gerade China! In Sachen Umweltschutz stellt die Volksrepublik ein Problem für sich dar, und nur wenn die chinesische Regierung dieses Problem auch als Herausforderung begreift, haben die globalen Klimaschutzbemühungen eine realistische Chance.





























