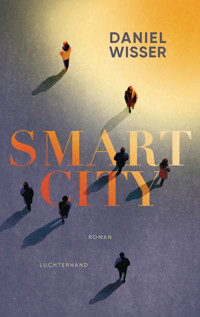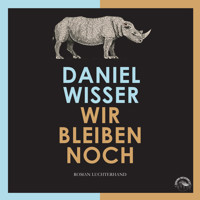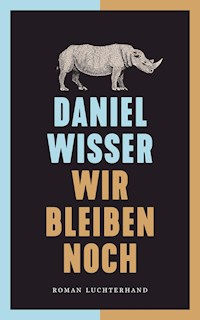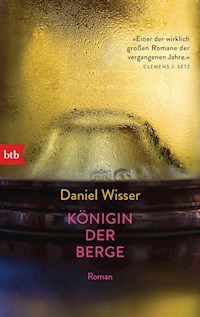15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Wiedergeburt eines Schelms mitten in den Krisen unserer Gegenwart. »Eine erfrischend lakonische Perspektive auf den Zeitgeist. Zum Auftauen komisch.« Galore
Vor dreißig Jahren verstorben, bekommt der Computerentwickler Erik Montelius ein zweites Leben geschenkt: Als erster Patient weltweit wird er aus der kryotechnischen Konservierung geholt. Fortan sieht er sein Dasein nicht in Leben und Tod geteilt, sondern in erstes Leben, zweites Leben und Tod. Doch auch im zweiten Leben ist die Welt keine bessere: Seine Frau hat seinen Geschäftspartner geheiratet – der hat zudem Eriks Ideen geklaut. Die Menschen tragen Masken über Mund und Nase, wischen auf tragbaren Computern herum und haben die Visionen von einer gerechten und umweltfreundlichen Gesellschaft aufgegeben. Erik hat nichts, kein Geld, kein Zuhause, nicht einmal einen Ausweis. Aber er hat einen Verdacht, wem er seinen ersten Tod zu verdanken hat. Und er hat einen Buchvertrag und damit die Gelegenheit, die Wahrheit ans Licht zu bringen …
Leichtfüßig und lakonisch erzählt Daniel Wisser von einem Schelm inmitten der großen Krisen der Gegenwart. Erik Montelius existiert von Amts wegen nicht – diese Freiheit muss er nutzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch:
Vor dreißig Jahren verstorben, bekommt der Computerentwickler Erik Montelius ein zweites Leben geschenkt: Als erster Patient weltweit wird er aus der kryonischen Konservierung geholt. Fortan sieht er sein Dasein nicht in Leben und Tod geteilt, sondern in erstes Leben, zweites Leben und Tod. Doch auch im zweiten Leben ist die Welt keine bessere: Seine Frau hat seinen Geschäftspartner geheiratet – der hat zudem Eriks Ideen geklaut. Die Menschen tragen Masken über Mund und Nase, wischen auf tragbaren Computern herum und haben die Visionen von einer gerechten und umweltfreundlichen Gesellschaft aufgegeben. Erik hat nichts, kein Geld, kein Zuhause, nicht einmal einen Ausweis. Aber er hat einen Verdacht, wem er seinen ersten Tod zu verdanken hat. Und er hat einen Buchvertrag und damit die Gelegenheit, die Wahrheit ans Licht zu bringen …
Leichtfüßig und lakonisch erzählt Daniel Wisser von einem Schelm inmitten der großen Krisen der Gegenwart. Erik Montelius existiert von Amts wegen nicht – diese Freiheit muss er nutzen.
Zum Autor:
DANIELWISSER, 1971 in Klagenfurt geboren, schreibt Prosa, Gedichte, Songtexte. 1994 Mitbegründer des Ersten Wiener Heimorgelorchesters, zuletzt erschien das Album »Die Letten werden die Esten sein«. 2018 für den Roman »Königin der Berge« mit dem Österreichischen Buchpreis und dem Johann-Beer-Preis ausgezeichnet. 2021 mit seinem Roman »Wir bleiben noch« sowohl auf der SWR-Bestenliste wie auch auf der ORF-Bestenliste. Im Frühjahr 2022 erschien der Erzählungsband »Die erfundene Frau«. Daniel Wisser lebt in Wien.
Daniel Wisser
0 1 2
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Covergestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © Getty Images / CSA Images
ISBN 978-3-641-29436-6V004
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
Haimo Wisser gewidmet
ich wurde geboren
am 17. august
bald wurde ich größer
doch war’s mir nicht bewußt
ich lernte auch sprechen
und bausteine brechen
dann bin ich gestorben
am 17. august
ein jahr nur ein jahr nur
hat gott mir geschenkt
doch war es ein reiches
wenn man es recht bedenkt
Konrad Bayer
Donkey Kong
01.07.2022
Nikki will mit Leonie und mir ans Meer fahren. Ich sage ihr nicht, dass ich das Meer hasse (oder fürchte?). Ich habe beschlossen, meine Biografie nicht von einer Ghostwriterin schreiben zu lassen. Ich schreibe sie selbst und habe dafür wahrscheinlich nur zwei, drei Monate Zeit.
Immer wieder werde ich gefragt, was ich nach dem Aufwachen als Erstes dachte. There will be an answer: Ich glaubte, eine Schildkröte zu sein. Natürlich erzähle ich das nur, damit ich irgendetwas erzähle. In Wahrheit dachte ich, dass man mich zum Sterben in ein anderes Zimmer geschoben hatte. Ich hatte Krebs, das wusste ich. Brustkrebs. Normalerweise bekommt ein Krebskranker von seinen Mitmenschen geheucheltes Mitleid. Ein Mann, der Brustkrebs hat, bekommt hingegen nur ein blödes Grinsen. Als ob er am Brustkrebs nicht genauso leiden würde wie eine Frau! Ich hatte Brustkrebs, aber daran wäre ich nicht gestorben. Es sollte nur so aussehen, als wäre ich an einer Krebserkrankung gestorben. In Wahrheit wurde ich ermordet.
Alle fragen mich, woran ich mich als Erstes erinnern kann. Und ich sage: DDT. Im Zimmer roch es nach DDT. Und da war noch jemand mit mir im Raum. Ich hatte die Augen geschlossen, aber ich hörte sie reden. Sie – denn es war eine Frauenstimme.
– Ich höre dich kaum. Hier ist der Empfang so schlecht.
Die Tür ging auf. Plötzlich war eine zweite Stimme zu hören:
– Kommst du mit in die Kantine?
– Was gibt’s denn heute?
Schritte. Langsames, fast kindliches Vorlesen:
– Dienstag, 9. November 2021: Fleischbällchen im Speckmantel.
– Na gut, was soll’s! Man lebt nur einmal und das wahrscheinlich nicht lange.
Schritte. Tür auf. Tür zu. Beide waren weg. Ich öffnete die Augen.
Alle wollen wissen, was ich als Erstes gesehen habe. There will be an answer: Jesus. Einen billigen, vom Sonnenlicht ausgebleichten Holzjesus, das Gesicht verkrampft, wahrscheinlich von der Abneigung gegen den DDT-Geruch im Zimmer. Was für ein armseliges Spitalszimmer, in dem zwei armselige Acrylgemälde hingen und ein armseliger Holzjesus. Und eine große Uhr. Sie zeigte zwei Uhr und zweiundzwanzig Minuten.
Ich hatte noch das Datum im Ohr, das die Frauenstimme genannt hatte: 9. November 2021. Ich dachte nach. 2021 ist eine Ternärzahl, die wir im Dezimalsystem Einundsechzig nennen. Früher hatte ich die Formel im Kopf beherrscht, jetzt musste ich hochzählen:
0 1 2 10 11 12 20 21 22 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222 1000 1001 1002 1010 1011 1012 1020 1021 1022 1100 1101 1102 1110 1111 1112 1120 1121 1122 1200 1201 1202 1210 1211 1212 1220 1221 1222 2000 2001 2002 2010 2011 2012 2020 2021
2021 war die Ternärzahl für den Dezimalwert 61, aber die Formel für die Umrechnung, die ich früher im Schlaf beherrscht hatte, fiel mir nicht mehr ein. Ich blickte wieder zu Jesus auf und dachte: Wenn der Menschensohn zurückkommen wirdin aller Herrlichkeit, wird er sich mit allen Engeln auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen.
Nach einiger Zeit kam wieder jemand ins Zimmer. Es war eine Frau in hellblauer Hose und hellblauem Kasack. Die Hellblaue nahm ein kleines schwarzes Gerät zur Hand und begann es zu streicheln. Das Ding erinnerte mich an die Tric O Tronic-Spiele, die ich früher gespielt hatte. Und mein allerliebstes Tric O Tronic-Spiel war Donkey Kong. Man konnte die kleine Konsole aufklappen und spielte auf zwei Bildschirmen. Multi Screen – so hieß es auf der Verpackung. Plötzlich begann die Hellblaue zu sprechen:
– Entschuldige, du klingst ganz abgehackt. Warte! Jetzt geht es wieder.
Ich konnte zwar die Brille sehen und die abstehenden Ohren. Aber Kinn, Mund und Nase waren von einer OP-Maske verdeckt. Lange betrachtete ich sie, bis sie plötzlich zu mir herüberblickte und bemerkte, dass ich sie ansah. Sie stand auf, kam auf das Krankenbett zu, blieb stehen und bewegte ihre Hand langsam vor meinen Augen hin und her.
– Das gibt’s ja nicht! Hallo, können Sie mich hören? Hallo! Herr Montelius! Hören Sie mich?
Ich folgte ihrer Hand nicht, sondern blickte ihr in die Augen. Jetzt bemerkte ich, dass sie keine abstehenden Ohren hatte, sondern dass die Zugbänder ihrer OP-Maske ihre Ohren auffalteten. Es war keine normale OP-Maske. Sie hatte eine Schnabelform wie eine venezianische Karnevalsmaske.
– Man lebt nur einmal und das wahrscheinlich nicht lange.
Mehr als sie erschrak ich darüber, die eigene Stimme zu hören. Meine Stimme klang fremd, blechern und (Soraya, füge bitte hier noch irgendein Adjektiv ein!). So, wie wenn man sich selbst mit einem Kassettenrekorder aufnimmt.
– Das habe ich doch vor dem Essen zu Schwester Vanessa gesagt. Haben Sie mitgehört?
– Sunday’s on the phone to Monday. Tuesday’s on the phone to me.
– Herr Montelius! Es ist … ein Wunder!
Sie war aufgeregt. Die hochgesteckten Haare hüpften unentwegt auf und ab. Da sie weitsichtig war und die Brille ihre Augen vergrößerte, sah sie noch aufgeregter aus. Sie hatte die Brille so weit hochgeschoben, dass die Gläser auch ihre Augenbrauen vergrößerten. Doch ich konnte die Augenbrauen nur verschwommen sehen, denn der Atem, der aus ihrer Gesichtsmaske kam, hatte die Brillengläser beschlagen.
– Sie sind … Sie sind … wach! Bitte, warten Sie einen Moment!
Sie lief aus dem Zimmer. Ich blickte zur Uhr. Es war immer noch zwei Uhr und zweiundzwanzig Minuten. Wenig später kam sie mit einer anderen Frau zurück, die einen weißen Kittel trug. Die Frau im weißen Kittel hielt einen Plastikbecher in der Hand. Während sie zur Tür hereinkam, redete sie ohne mich zu beachten.
– Ich bin so schrecklich müde. Vielleicht hat’s mich erwischt. Ich habe gerade eine Pechsträhne. Gestern ist mir auch noch das Auto eingegangen. Mitten auf der Stadtautobahn. Also, ich hoffe, die Werkstatt kriegt das bis morgen hin. Ich fahre sicher nicht mit der U-Bahn, jetzt wo die nächste Welle kommt!
– Ich auch nicht. Ich fahre mit dem Rad.
– Na ja, jetzt setzen sie ja auch schon auf Herdenimmunität. Wie die Schweden. Also: Wie geht’s unserem Zombie?
Sie setzte sich an mein Bett. Ich las das Schild an ihrer Brust: Oberärztin Dr. Kerkhoff. (Hatte sie keinen Vornamen?, fragt Soraya. Ich glaube, sie hieß Carmen. Aber das spielt keine Rolle. Oder doch?) Mit dem Zombie hatte sie mich gemeint, doch eigentlich sah sie wie ein Zombie aus. Sie hatte immer noch den Becher in der Hand, schaute sich um und stellte ihn auf dem Tischchen neben dem Bett ab.
– Warten Sie, ich muss die Maske aufsetzen.
Sie griff in ihren Ärztemantel, zog eine OP-Maske heraus, und die gelifteten Lippen verschwanden darunter. Ich wunderte mich, dass alle hier Masken trugen. Dr. Kerkhoff nahm meinen Arm und fühlte den Puls. Ich blickte zu ihrem Kaffeebecher.
– Wie lange, bis dieser Becher verrottet?
Die Oberärztin reagierte nicht. Die Hellblaue aber rannte aufgeregt herum, suchte nach einem Stift, einem Blatt Papier, nahm den Donkey Kong und rückte einen Stuhl an das Bett.
– 450 Jahre?
Die Hellblaue hatte einen Stuhl ganz nah an mein Bett gerückt und saß an meiner linken Seite. Ich konnte ihren Atem riechen. Das waren wohl die Fleischbällchen.
– Können Sie bitte wiederholen, was Sie gerade gesagt haben?
– Ich habe gefragt, wie lange es dauert, bis dieser Plastikbecher verrottet.
Die Oberärztin griff zum Fußende des Betts und zog einen Zettel aus einem Schlitz. Er steckte in einer Klarsichthülle. Sie brauchte einige Zeit, bis sie den Zettel daraus befreit hatte.
– Plastik, Plastik, Plastik.
– Der denkt anscheinend nur an Plastik.
Dr. Kerkhoff redete nur mit der Hellblauen, nicht mit mir.
– Trinkt man denn immer noch aus Plastikbechern?
Zum ersten Mal blickte mir die Ärztin in die Augen und schüttelte dabei den Kopf. Dann kritzelte sie auf den Zettel.
– Labor machen wir gleich neu. Wegen der Werte muss ich mit Ihnen sprechen, Frau Hanson. Ich sage es gleich den Schwestern: Die Sonde bleibt. Wenn er schlucken kann, soll er was Breiiges probieren. Katheter bleibt. Ich brauche seine Werte rund um die Uhr!
Dann stand die Oberärztin Dr. Kerkhoff auf, verließ das Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Die Hellblaue rückte mit dem Stuhl näher.
– Herr Montelius!
– Erik. Ich bin Erik. Sie können Du zu mir sagen!
– Ich würde es vorziehen, beim Sie zu bleiben.
– Wie Sie möchten! Wann werde ich operiert?
– Sie werden gar nicht operiert. Wie kommen Sie denn darauf?
– Warum tragen Sie dann eine OP-Maske?
– Das erkläre ich Ihnen später.
– Später ist es zu spät.
– Herr Montelius, mein Name ist Lillemor Hanson.
Lillemor drückte die Brille mit dem kleinen Finger gegen die Nase und nickte.
– Ich möchte ein Gespräch mit Ihnen führen. Ist es in Ordnung, wenn ich es aufzeichne?
– Wenn ich mir die Aufnahme nicht anhören muss. Meine Stimme …
– Okay, wir starten.
Lillemor legte den Donkey Kong vor sich hin und berührte ihn ein paarmal mit dem Zeigefinger.
– Der Donkey Kong ist ein Kassettenrekorder?
– Was?
– Das Ding da.
– Das ist … Das erkläre ich Ihnen später.
Schon wieder dieses Später. Wann sollte das sein? Es wurde ja nicht später. Die Uhr über der Eingangstür zeigte immer noch zwei Uhr und zweiundzwanzig Minuten.
– Herr Montelius, wie geht es Ihnen?
– Warum riecht es hier nach DDT?
– Ich rieche nichts. Was war der erste Gedanke, den Sie beim Aufwachen hatten?
– Der nullte Gedanke. Wir fangen immer bei null zu zählen an.
– Wenn Sie meinen …
– Also: Ich dachte … ich dachte, ich bin eine Schildkröte. Die Schildkröte Kurma.
– Herr Montelius, wissen Sie, wann Sie geboren sind?
– Am 29. Februar 1952.
– Hey, das ist richtig. Sie haben also schon gelebt, als der Staatsvertrag unterzeichnet wurde.
– Wenn das das Erste ist, was Ihnen dazu einfällt.
– Und wissen Sie, was heute für ein Tag ist?
– Fleischbällchen im Speckmantel … Heute ist Dienstag.
– Richtig. Heute ist Dienstag. Dienstag, der 9. November. Und wissen Sie auch welches Jahr?
– Wie war noch mal Ihr Name?
– Hanson.
– Ich meinte Ihren Vornamen.
– Lillemor.
Ich fand es lächerlich, dass sie mir das Du-Wort ausgeschlagen hatte und ich sie Frau Hanson nennen musste.
– Lillemor ist ein schöner Name.
– Danke. Als Kind habe ich meine Eltern dafür gehasst, dass sie mich Lillemor genannt haben. Aber inzwischen …
– Ich finde, es passt zu Ihnen.
– Nun ja. Name ist Schall und Rauch, wie schon Goethe sagte.
– Jetzt reden Sie wie mein Vater.
Sie erzählte über sich, wo sie geboren wurde, wo sie aufgewachsen war, von ihrem Vater, der aus Schweden kam, und von ihrem Studium. Über weite Strecken hörte ich nicht zu. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Es war wie bei der Formel für die Umrechnung von Dezimalzahlen und Ternärzahlen: Ich konnte nicht bei der Sache bleiben und gab auf. Trotzdem wünschte ich, dass Lillemor immer weiterreden würde und ich nichts sagen müsste. Doch sie hörte nicht auf, mir Fragen zu stellen.
– War Ihr Vater auch Schwede? Montelius ist in Schweden ein häufiger Name.
– Was wollen Sie denn immer mit meinem Vater?
– Herr Montelius, Sie haben von Ihrem Vater gesprochen. Nicht ich.
– Sicher nicht! Ich hasse Väter. Väter sind uninteressant. Mein Vater hat immer nur gelesen und zitiert.
– Ihr Vater war also ein gebildeter Mann?
– Schluss! Ich will nicht mehr über meinen Vater sprechen.
Ich erfuhr, dass Lillemor Psychologie studiert hatte. Ihr Spezialgebiet war die Rehabilitation von Komapatienten.
– Bin ich ein Komapatient?
– Genau genommen: Nein. Aber Sie waren lange ohne Bewusstsein, Herr Montelius. Sehr lange. Dreißig Jahre.
– Warum bin ich jetzt aufgewacht?
– Ich denke, Sie sollten sich erst an alles gewöhnen. Wir werden darüber sprechen, und Sie werden viel Neues hören. Wir müssen uns Zeit nehmen.
Ich blickte wieder auf die Uhr über der Tür. Lillemor bemerkte, dass ich ihr nicht mehr zugehört hatte.
– Sie sind müde? Machen wir für heute Schluss!
– Die Ärztin, die hier war …
– Dr. Kerkhoff. Ja. Was ist mit ihr?
– Sie hat gesagt, dass ihr Auto kaputt ist.
– Sie haben sich wirklich alles gemerkt. Ja, das hat sie gesagt.
– Können Sie mir sagen, womit dieses Auto betrieben wird?
– Na ja, mit Diesel oder Benzin. Warum? Woher soll ich wissen, was die Frau Doktor für ein Auto hat!
– Mit Diesel oder Benzin …
– Genug für heute, Herr Montelius. Ich weiß nicht, wie spät es ist.
– Ich weiß nicht, wie spät es ist.
– Ich schon: Zwei Uhr zweiundzwanzig.
Ich zeigte zur Wand. Lillemor blickte auf die Uhr und lachte.
– Die Uhr ist stehen geblieben. Ich gebe der Haustechnik Bescheid.
03.07.2022
Wir sind im kleinen Ort M. am Ligurischen Meer. Ich bin nicht sicher, ob wir wirklich in Italien sind. Niemand hier raucht. Keine einzige Frau liegt oben ohne am Strand. Im Gegenteil: Viele von ihnen tragen im Wasser T-Shirts und seltsamste Verhüllungen. Leonie schwimmt den ganzen Tag, während Nikki die meiste Zeit schläft. Ich gehe ein paar Schritte ins Meer, nur so weit, bis mir das Wasser bis zu den Hüften reicht.
Als ich aufwachte, saß Lillemor im Zimmer und streichelte ihren Donkey Kong. Sie bemerkte, dass ich wach war, und lächelte.
– Guten Morgen!
– Können Sie mir etwas erklären?
– Sie könnten wenigstens Guten Morgen sagen.
– Guten Morgen. Ich habe die ganze Nacht nachgedacht. Ich habe drei Fragen.
– Schießen Sie los!
– Wer hat mich an der Leber operiert? Wieso wurde ich gerade im Jahr 2021 aus dem Tiefschlaf geholt? Und: Warum tragen Sie heute schon wieder diese Faschingsmaske?
– Herr Montelius, das alles sind wichtige, aber sehr komplexe Dinge. Ich erkläre Ihnen das später, aber nicht heute.
– Das sagen Sie ständig. Ich akzeptiere kein Später mehr! Ich will es jetzt wissen.
– Einen Moment noch, bitte! Wenn Sie einverstanden sind, zeichne ich …
– Ja, Frau Dr. Lillemor Hanson, Sie dürfen das Gespräch mit Ihrem Handy aufzeichnen.
– Danke.
– Wir leben schließlich im Jahr 2021.
– Das ist korrekt. So, die Aufnahme läuft.
Es gefiel mir, wenn Lillemor ein Bein über das andere legte. Das hieß, dass sie noch lange bleiben würde. Plötzlich beruhigte es mich, dass sie da war.
– Sie haben über Ihren Vater gesprochen.
– Da irren Sie sich. Sie reden immerzu von meinem Vater.
– Sie haben ihn zuerst erwähnt. Ich habe Goethe zitiert und Sie haben gesagt: Jetzt reden Sie wie mein Vater. Wenn Sie wollen, können wir uns die Aufnahme von gestern anhören!
– Bitte nicht. Ich kann meine Stimme nicht hören.
– Herr Montelius, in welchem Jahr ist Ihr Vater geboren?
– 1927.
– Gut. Und in welchem Jahr leben wir jetzt?
– 2021. Das sagen Sie mir doch alle paar Minuten.
– Gut. Wie alt ist Ihr Vater dann?
– Mein Vater ist etwas über sechzig.
– Herr Montelius, Ihr Vater ist 1927 geboren, und wir leben im Jahr 2021. Er wäre also heute vierundneunzig Jahre alt. Ein sehr hohes Alter. Er hat es nicht erreicht.
Das war die eleganteste Todesmeldung seit der Erfindung der Subtraktion. Und auf meine Nachfrage folgte ihr, ähnlich schmucklos, aber ebenso arithmetisch einwandfrei, die Nachricht vom Tod meiner Mutter, zweieinhalb Jahre nach dem Tod des Vaters. Die Sitzung – so nannte es Lillemor – wurde gleich wieder unterbrochen. Man servierte Schonkost: Grießbrei. Noch dazu verließ Lillemor das Zimmer nicht, sondern sah mir dabei zu, wie ich den Grießbrei anstarrte und dann den Teller drehte, um zu sehen, ob die Südseite ein wenig freundlicher aussah.
– Langsam essen, Herr Montelius! Und vergessen Sie nicht: Sie müssen viel trinken. Das gilt für den ganzen Tag.
– Na gut. Bringen Sie mir zwei große Bier!
Lillemor verdrehte die Augen. Dann widmete sie sich wieder dem Donkey Kong.
– Jetzt sagen Sie bloß, dass im Jahr 2021 die Prohibition wieder eingeführt wurde.
– Herr Montelius, ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie können schon wieder sprechen. Das ist fantastisch. Ich habe das nicht erwartet. Aber Sie sind noch nicht gesund.
– Dann eben ein kleines Bier.
– Nein. Vielleicht in ein paar Wochen. Jetzt geht das nicht!
In ein paar Wochen. Lustlos nahm ich ein Löffelchen vom Grießbrei. Mein Vater hatte immer gesagt, es gibt nur drei Dinge, die er seit der Nazizeit nicht mehr riechen kann: Deutsche, Österreicher und Grießbrei.
– Darf ich etwas fragen? Wie alt bin ich?
– Jetzt essen Sie einmal. Wir reden später darüber, okay?
Ich hatte keine Lust mehr, mich vertrösten zu lassen. Ich hatte keine Lust mehr, ein Patient zu sein, dem man nach Belieben Informationen vorenthalten, das Du-Wort ausschlagen und Bier verweigern konnte.
– Ich habe keine Lust mehr, diese Gespräche mit Ihnen zu führen.
– Warum nicht? Was stört Sie?
– Ich habe es schon gesagt: Weil Sie mir die Wahrheit nicht zumuten.
– Ein Patient braucht nach langem Koma eine Phase der Rehabilitation. Sie können nicht alles auf einmal verarbeiten.
– Rufen Sie die Oberärztin. Ich unterschreibe den Revers und gehe.
– Sie unterschreiben einen Revers?
– Genau!
– Herr Montelius, das gab es, als Sie jung waren.
– Wie meinen Sie das? Bin ich denn hier eingesperrt? Holen Sie die Stationsärztin! Ich gehe nach Hause.
– Was wollen Sie denn wissen?
– Wer mich operiert hat.
– Sie wurden von Frau Dr. Heiss operiert.
– Kann ich mit ihr sprechen?
– Herr Montelius, Dr. Heiss ist Chirurgin. Entweder sie hat frei oder sie ist im OP.
Lillemor stand vor mir und verschränkte die Arme. Ihre Brust bebte. Ihr Hals bebte. Sie war mir so nahe, dass ich sie mit Leichtigkeit hätte berühren können. Ich staunte selbst darüber, dass ich so ruhig blieb. Vielleicht war in der Infusion auch ein Beruhigungsmittel.
– Ich will nach Hause. Warum muss ich überhaupt mit Ihnen reden?
– Damit ich Ihre Neuroplastizität einschätzen kann.
– Meine was?
– Ihre Fähigkeit, sich an eine veränderte Umgebung anzupassen. Sie sagen, Sie wollen nach Hause. Wo ist denn Ihr Zuhause?
– Bei meiner Frau.
– Ihre Frau …
– Sie heißt Kristina Montelius. Sie wohnt in Großibm. Postleitzahl: 2526. Gartengasse 1.
Plötzlich spürte ich mein Herz schlagen. Endlich fühlte ich mich lebendig, während Lillemor Hanson sich gefasst hatte und ruhig vor mir stand. Sie nickte. Ich ließ mich im Bett nach vorne fallen und legte mein Gesicht auf ihre Brust, während ich versuchte, sie mit den Armen zu umfassen. Lillemor nahm meine Arme und drückte mich zurück in das Kissen.
– Ich bitte Sie, Herr Montelius. Bei allem Respekt …
– Ist Kris … meine Frau … Kristina Montelius … lebt sie noch?
– Natürlich, Herr Montelius. Sie lebt noch. Und sie heißt heute Kristina Haberler.
Lillemor Hanson konnte ihren Triumph nicht verbergen. So war das also. Man wollte mir bestimmte Dinge verschweigen. Das hatte mir Pascal am Vortag gesagt. Und jetzt verstand ich auch warum.
– Sie kommt her, um Sie zu besuchen!
– Hierher?
– Ja. Nächsten Freitag werden Sie sie wiedersehen. Es lohnt sich also, noch ein wenig hierzubleiben.
– Frau Hanson, wie alt ist meine Frau?
– Herr Montelius, es war alles ein wenig viel für heute. Sie haben jetzt eine Einheit Physio, und dann sollten Sie sich ausruhen. Wir machen am Nachmittag weiter, okay?
– Sagen Sie mir bitte nur noch, wie alt meine Frau ist.
– Wann wurde sie denn geboren?
– Am 15. Februar 1959.
– Na, dann rechnen Sie einmal, wie alt man im Jahr 2021 ist, wenn man im Jahr 1959 geboren wurde.
Ich kann nicht sagen, warum ich diese einfache Subtraktion nicht durchführen konnte. Ich schaffte es nicht einmal zu überlegen, welcher Wert von welchem subtrahiert werden musste. Ich wurde davon nur müde. Meine Plastizität, dachte ich, ist abgeschlossen. Ich bin schon ganz Plastik. Dann muss ich eingeschlafen sein.
03.07.2022
Mit äußerster Anstrengung habe ich die ersten zwanzig Seiten diktiert und sie Soraya geschickt. Ihre Antwort kam wenige Minuten später. Sie findet meine Erzählung wirr, meinen Stil plump, die Dialoge zu lang, und sie schreibt: Die indirekte Rede ist komplett falsch. Und diese dummen ineinander verschachtelten Klammern! Ach, Soraya! Ich war einmal Programmierer (aus diesem Grund (das musst du (BITTEBITTE!) verstehen) liebe ich Klammern so sehr!). Und ihr fehlt die Geschichte meines Vaters. Mein Herr und Vater, denkt ihr denn alle nur an Väter?
Soraya selbst ist in meiner Erzählung noch gar nicht aufgetaucht. Liebe Einmalgeborene, ihr müsst noch Geduld haben. Soraya lerne ich erst im zweiten Teil des Buches kennen. Ich kann euch aber jetzt schon verraten, dass sie Journalistin ist und früher einmal Ghostwriterin war. Das ist ein ehrbarer Beruf, den Menschen ausüben, die ihre Ehre jenen borgen, die keine haben: Betrügern, die behaupten, ein Buch geschrieben zu haben.
Soraya wollte auch meine Lebensgeschichte schreiben, aber ich habe das nicht zugelassen. Ich möchte, dass in diesem Buch die Wahrheit steht und nichts als die Wahrheit. Ich glaube gerne, dass jemand anders mein Leben so erzählen könnte, dass es mehr Leser finden würde als meine Fassung. Ich bin sicher, dass sich eine erfundene Biografie besser verkaufen würde. Aber was wäre ein solches Buch anderes als ein weiterer Mord an mir?
Anfangs war ich gar nicht abgeneigt, Soraya meine Geschichte schreiben zu lassen. Der Plan war: Ich sollte plaudern, sie würde ein Buch daraus machen. Dann aber erzählte sie mir folgende bemerkenswerte Geschichte: Soraya wurde einmal von einem Verleger kontaktiert. Dieser Verleger suchte eine afrikanische Frau, die Genitalverstümmelung, Gewalt und Missbrauch erlebt hatte. Er wollte ihre Lebensgeschichte als packende, mitreißende, wütend machende Autobiografie aufmachen. Schnell hatte er eine brauchbare Person gefunden, eine schöne junge Dame, die auf Englisch ihrem Diktiergerät von sich erzählte und diese Aufnahmen an Soraya schickte, die daraus eine Biografie machen sollte.
Sie sollte Szenen schreiben, Beschreibungen von der Hütte, in der die Frau aufwuchs, dem Brunnen, von dem sie als Kind Wasser holen musste, von der Landschaft ihrer Heimat, dem Boden, den Bäumen, dem Himmel, dem Sonnenuntergang, der Dürre, dem Regen usw. usf. Die Frau schilderte all das nicht. Also wandte sich Soraya mit der Bitte, ihr eine Reise in die Heimat der Frau zu ermöglichen, an den Verlag. Die Antwort lautete, es muss ausreichen, wenn Soraya sich YouTube-Videos ansieht.
Soraya schrieb das Buch trotzdem. Es wurde ein Bestseller. Und während sie dafür dürftig entlohnt wurde, mussten drei hochbezahlte Bodyguards her, deren Hauptaufgabe es war, dafür zu sorgen, dass die vermeintliche Autorin sich auf Buchmessen wenigstens erst nach ihren Auftritten dem Alkohol widmete.
Liebe Leute, ihr seid keine Opfer eines solchen Betrugs. Alles, was ich hier berichte, hat sich genau so zugetragen. Ihr dürft dieses Buch hassen, meine Geschichte hassen, meine Art zu schreiben hassen. Nichts hinterlässt so bleibende Eindrücke wie Dinge, die man hasst. Ihr dürft mich hassen! Aber in diesem Buch wird nichts verschwiegen und nicht gelogen.
04.07.2022
Vielleicht aber wird Soraya dieses Buch fertigstellen müssen, denn um die Wahrheit zu sagen: Es steht sehr schlecht um meine Gesundheit. Ich bin völlig kaputt, kann mich kaum wach halten, und mir fehlt es an Konzentration. Es laugt mich aus wie das Komponieren des eigenen Requiems. Aber die liebe Soraya soll auch etwas bekommen: die Geschichte meines Vaters. Ich kann nur immer wieder sagen, dass mich Familien, Väter und Mütter und Verwandte, niemals interessiert haben. Der Zwang, mit Blutsverwandten aufwachsen und zusammenleben zu müssen, richtet ungeheuren Schaden am Menschen an.
Die Geschichte meines Vaters ist nicht schwer zu erzählen. Das war sie nur für ihn. Er hat sie einmal, befeuert vom Genuss des Rotweins aus Doppelliterflaschen, in drei Nächten in seine Schreibmaschine geklopft. Das Manuskript und zwei Durchschläge wurden in der Buchbinderei Sedlacek in schwarzes Leinen gebunden. Auf dem Rücken stand in goldenen Lettern Münchhausen 1953. 1953 war vermutlich das Entstehungsjahr. Das Original hatte meine Mutter, der erste Durchschlag stand in der Bibliothek meines Vaters. Und wohin der zweite Durchschlag verschwunden ist, weiß ich nicht. Ein Satz, den mein Vater ständig wiederholte, lautete: Das Wichtigste für ein Kind ist lesen lernen. Also kletterte ich eines Tages das von meinem Vater gezimmerte Bücherregal aus Buchenholz hoch (als Kind konnte ich das), nahm sein Exemplar von Münchhausen 1953 und begann darin zu lesen. Und ich erfuhr, dass Lisbeth (die (zweite) Frau meines Vaters) nicht meine Mutter war. Meine Mutter war Johanna Montelius, geborene Kramar. Sie starb, als ich sieben Monate alt war.
05.07.2022
Nikki und Leonie sind essen gegangen.
Das Einzige, was ich am Krankenhaus mochte, war die Physiotherapiestunde. Der Grund dafür war mein Therapeut Pascal. Er interessierte sich aber nicht für seine eigentliche Aufgabe und sagte, dass man nach einer Woche auch nicht viel erwarten kann. Eigentlich wollte er mir das Gehen, das er im Übrigen Laufen nannte, gar nicht erst beibringen. Darum beschloss ich, selbst laufen zu lernen, um wegzulaufen.
Ich hatte ein Lied im Ohr. Ich wollte es abstellen, aber es war stärker als ich:
One sweet dream
Pick up the bags and get in the limousine.
Soon we’ll be away from here,
Step on the gas and wipe that tear away!
Dass eine Limousine auf mich wartet, kann ich nur geträumt haben. Ein süßer Traum von einer schwarzen Limousine. Pascal hätte sich ohnehin nicht dafür interessiert. Er interessierte sich nur für Gespräche über Computertechnik und immer intensiver für meine Biografie und meine Familie. Während ich Gleichgewichtsübungen machte und Hanteln stemmte, die ein anderer mit dem kleinen Finger aufgehoben hätte, zupfte mein Physiotherapeut an seinem Bärtchen und zog die Stirn in Falten.
– Dieser Dr. Lackermeier hätte dich damals operieren sollen. Ich verstehe, ich verstehe. Und er war ein Freund deines Kompagnons, sagst du?
– Ja, er war ein Freund von Winfried Haberler.
– Und deine Frau ist jetzt auch eine Haberler?
– Hat mir die Schwedin gesagt.
– Ja, ja … zuerst Haberer, dann Haberler.
Dann wieder brach Pascal in lange Monologe aus, die davon handelten, wie schlecht und kaputt unsere Welt ist. Ich konnte nicht über Umweltschutz sprechen, ohne einen solchen Monolog auszulösen, in dem er über Ökologie und die grüne Partei herzog. Er behauptete, dass sie heute gegen das Verbot von Umweltgiften sind, gegen die verpflichtende Betäubung bei der Kastration von Ferkeln, gegen eine Reichensteuer, und dass sie keine einzige Temporeduktion auf den Straßen durchgesetzt haben, sondern sogar eine Prämie für Neuwagen ausbezahlen. Und das für ihn Verwerflichste an den Grünen war, dass sie – wie Pascal behauptete – in einem Krieg für Bombenabwürfe waren; ich glaube, es ging dabei um Jugoslawien. Glauben konnte ich ihm das alles nicht. Aber ich beschloss, in den nächsten Wochen nachzulesen, was in Jugoslawien geschehen war, was überhaupt in diesen dreißig Jahren meines Totseins geschehen war.
Trotz seiner seltsamen Ansichten war Pascal der einzige Mensch im Krankenhaus, der mich wirklich ernst nahm. Und er sagte mir immer die Wahrheit. Zum Beispiel über diese seltsame Epidemie. Er sagte, dass die meisten Ärzte im Haus fanden, dass es unverantwortlich ist, gerade zum jetzigen Zeitpunkt ein medizinisches Experiment mit einem Kryopatienten durchzuführen. Durch all diese Grübeleien und Diskussionen vernachlässigte Pascal leider seine Arbeit. Also machte ich zwischen den Physio-Einheiten heimlich allein die Übungen, die eigentlich er mit mir machen sollte. Ich wollte so schnell wie möglich wieder gehen können, meine Umwelt aber in dem Glauben lassen, dass man mich im Rollstuhl herumschieben muss. Ich wollte mir den Tag gut überlegen, an dem ich aus dem Rollstuhl steigen würde. So eine Art wundersame Heilung. Ich würde aufstehen und gehen und nicht aufhören zu gehen und immer weiter gehen, das Krankenhaus verlassen und durch die Welt da draußen laufen.
Pascal bemerkte mein Vorhaben nicht und auch nicht, dass ich mich mit den Übungen leichttat. Er begann, mir immer detailliertere Fragen über mein erstes Leben zu stellen. Er wollte genau wissen, wer dieser Winfried war, der mit mir Computer gebaut hatte, wie lange wir uns davor gekannt hatten, wem ich das Patent an den Rechnern vererbt hatte, ob ich ein Testament verfasst hatte, woher Winfried Dr. Lackermeier kannte, wie viel jeder von ihnen verdiente und wie ihr Lebenswandel war. Fehlte nur noch, dass er die Schuhgrößen und Sozialversicherungsnummern all dieser Menschen wissen wollte und deren Quersummen errechnete.
Dazwischen musste ich vor allem Balanceübungen machen. Es freute mich, dass ich dabei immer besser wurde. Die Kontrolle über meinen Körper war wie ein Videospiel: Nach vier oder fünf neuerlichen Versuchen schaffte ich es immer ein Level weiter. Ich durfte mir keine Fehler mehr erlauben. Ich hatte nur noch ein Extra-Life. Mit diesem Extra-Life musste ich das Spiel gewinnen.
Möglicherweise besserten sich auch meine schlechten Blutwerte langsam, denn eines Tages hörte ich, wie Lillemor Hanson im Gespräch mit Dr. Kerkhoff etwas sagte wie: Offenbar ist sein Körper doch erst vierzig Jahre alt.
Immer öfter hielt mir Pascal lange Monologe über den Unsinn der Evolutionstheorie, das Einpflanzen von Chips unter die Haut der Menschen, um sie zu überwachen, dass Impfen die Gegner einer neuen Weltordnung unterwerfen soll, dass Kommunisten heute Umweltschützer sind, die den Westen durch das Aufstellen von Windrädern zerstören wollen, und über gezielt gelenkte Flüchtlingsströme, mit denen die Bank von England gesprengt werden soll. Seine seltsamen Theorien störten mich weniger als seine Fragen.
– Warum hast du dich eigentlich einfrieren lassen?
– Ich habe dir schon gesagt: Ich wollte meinen Körper der Forschung zur Verfügung stellen. Ich finde Beerdigungen sinnlos. Ich finde, Leichen sollten der Wissenschaft überlassen werden.
– Vielleicht wolltest du auch miterleben, wie die ganze Welt deine Computer verwendet?
Ihr seht also, dass er mir nicht glaubte und sich die Antworten auf seine Fragen selbst gab.
Abends ließ ich mir von Lillemor Hanson einen Notizblock und einen Kugelschreiber bringen und wollte alles aufschreiben, was mir einfiel. Eigentlich hätte ich die Zettelchen gerne vor Lillemor versteckt, doch sie war sehr neugierig und fragte jeden Morgen, was ich aufgeschrieben hatte. Ich besaß ja nichts, keine Kleidung, keine Bücher, in denen ich die Zettel hätte verschwinden lassen können. Das hielt mich manchmal davon ab, Notizen zu machen. Manchmal aber fand ich am Morgen doch ein Wort auf dem Notizblock und konnte mich nicht erinnern, es geschrieben zu haben.
So entstanden auch meine Erinnerungen an das Typoskript Münchhausen 1953. (Oder hatte es Münchhausen 1952 geheißen? (Inzwischen war ich unsicher.))
06.07.2022
Gestern über dem Schreiben eingeschlafen. Wir fahren heute weiter nach N., wo Nikki zwei Wochen lang bleiben will.
Mein Vater gab mich nach dem Tod meiner Mutter sofort in die Obhut meiner Großtante, seiner Tante, und begann zu trinken. Erst später, nach einem Spitals-Aufenthalt, lernte er Lisbeth kennen und heiratete sie. Er behauptete immer, dass Lisbeth ihm das Leben gerettet hat. Als ich vier Jahre alt war, nahmen sie mich zu sich. Für mich war Lisbeth immer meine Mutter. Sie erfüllte ihre Pflicht, übererfüllte sie sogar. Daraus entstanden in mir zahlreiche Abneigungen. Ich hatte etwas gegen das Kruzifix, gegen Schuheinlagen, kratzende Wollmützen, lange Unterhosen, gegen Karfiol und Sellerie, gegen den Geruch von Haarfestiger, Hirschtalg, Lavendel und Baldrian. Ich hatte etwas gegen die Art, wie sie meinen Vater umerziehen wollte. Aber trotz alldem war sie die einzige Person, die sich um mich kümmerte. Mein Vater tat das tagsüber nicht, weil er las, und abends nicht, weil er betrunken war.
Pascal wollte nichts über meinen Vater wissen. Er interessierte sich nur für Kristina und Winfried.
– Deine Frau kommt dich also besuchen …
– Hat die Schwedin gesagt.
– Sie haben dich einfach ausgetauscht. Verstehst du?
– Wer?
– Na, deine Frau und dieser Winfried. Du wurdest als Ehemann ausgetauscht, als Vater und als Erfinder deiner Computer. Und du musst jetzt zurückschlagen.
Ihr müsst euch, liebe Debildete, vorstellen, wie ich dieses Gespräch führe, während ich als Neununddreißigjähriger (oder als fast Siebzigjähriger (ich wusste ja nicht, welche Wahrheit die wahrere war)) versuche, meinen Körper drei Zentimeter mit meinen an Ringen zerrenden Händen aus einem Rollstuhl hochzuhieven.
– Zurückschlagen?
– Das ist ein Krieg. Verstehst du? Krieg.
Mir fiel ein Satz aus der Bhagavadgita ein: Es gibt für einen Krieger nichts Höheres als einen gerechten Krieg.
– Kennst du die Bhagavadgita?
– Lass mich mit so was in Ruhe. Diese Inder, die kleine Mädchen vergewaltigen und sie dann in den Straßengraben werfen oder gleich anzünden … Das ist ein grausames Land, das seine soziale Einteilung in Kasten niemals überwunden hat.
Pascal hatte also nicht nur etwas gegen Umweltschützer, Impfen und die Evolutionstheorie, er hatte auch etwas gegen Inder. Ich erzählte ihm, dass ich über die Beatles zur indischen Musik und Philosophie gefunden hatte. Sein Blick verfinsterte sich noch mehr.
– Die Beatles. Diese fröhlichen Affen, die Tanzmusik für Schwiegermütter und ohnmächtige Teenager gemacht haben. Ihr Anfang war mehr als peinlich.
Er hatte also auch etwas gegen die Beatles. Ich durfte Pascal, meinen einzigen Freund, nicht verlieren und hatte daher Angst, ihm zu widersprechen. Also schwieg ich, zog heftiger an den Ringen und hielt meinen Körper einige Sekunden in der Luft über dem Rollstuhl, bis ich nicht mehr konnte.
Ich ließ die Ringe los und fiel in den Rollstuhl zurück. Ich konnte ihm nicht sagen, dass, seit ich aus dem Koma erwacht war, die B-Seite von Abbey Road ohne Pause in meinem Kopf lief (vielleicht mit Ausnahme von Here Comes the Sun). Aber von Because bis The End gingen alle Songs ineinander über wie auf der Platte, und sie erzählten meine Geschichte. Ich musste mir selbst eingestehen, dass ich die Songs in meinem ersten Leben gar nicht verstanden hatte. Ein Song kündigte auch Kristinas Besuch an:
Well, you should see Polythene Pam,
she’s so good-looking but she looks like a man.
Und ich verstand endlich, dass mit She Came In Through The Bathroom Window nicht Kris gemeint war, sondern Engratia Haberler, Winfrieds Frau. Die Zeile
Protected by a silver spoon
hatte ich noch nie verstanden. Nun war mir aber klar, dass sich diese Zeile auf Gratias Herkunft bezog. Sie kam aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie. (Kris hatte früher immer gesagt: Es steht nicht alles in den Beatles-Texten. Vorsicht! Vorsicht! Manson-Gefahr!) Ich verschwieg Lillemor meine Vergangenheit, und auch Pascal erzählte ich vieles nicht. Mir war aber, als ahnte er, woran ich dachte. Er stand neben mir und hob den Zeigefinger.
– Er hat sich an deine Frau herangemacht, verdammt noch mal. Hast du dich an seine Frau herangemacht?
Ich war knapp davor, Pascal die Wahrheit zu erzählen. Ach, Gratia und ich! Einmal sind wir heimlich getürmt und zu einem Open-Air-Konzert gefahren. Wir hatten nur ein Zelt mit. Absichtlich. Wir kifften und soffen. Und wir knutschten die ganze Nacht. Aber mehr wurde nicht daraus. Das hat Gratia sehr frustriert. Sie hatte Winfried schon einmal verlassen, um in einer Kommune zu leben. Dort saßen alle nackt beim Essen und riefen die Promiskuität aus. Dann aber wollte niemand Ernst machen mit der Promiskuität, und man diskutierte nur darüber und besoff sich dabei. Ach, Gratia, du hattest die schönste Nase der Welt und überhaupt. Nein, das war keine Wahrheit für meinen Pascal.
– Nein, habe ich nicht.
– Na also. Warum solltest du das auf dir sitzen lassen?
07.07.2022
Hier in N. ist es nicht anders als irgendwo. Ich versuche, viel Zeit mit Nikki zu verbringen und nachsichtig zu sein, wenn sie beleidigt ist. Das Essen darf immer sie aussuchen. Sie sagt, dass ich zu wenig Rücksicht nehme. Zum Beispiel darf sie keinen Prosciutto Crudo essen! Ich vergesse das immer. Abends darf ich zwei Bier trinken.