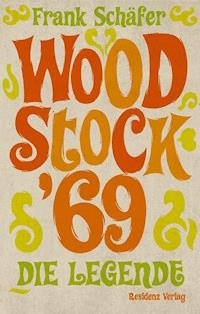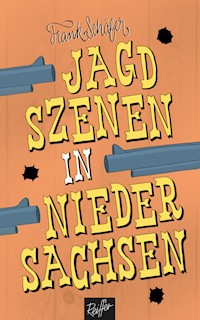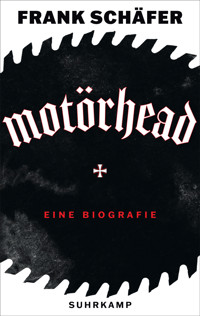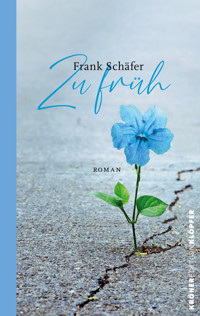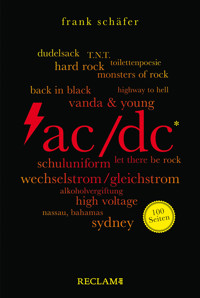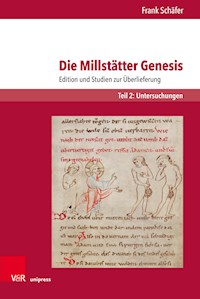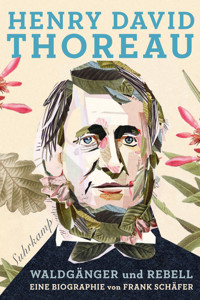9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dies ist keine Musikhistorie im herkömmlichen Sinne. In kleinen unterhaltsamen und witzigen Geschichten, Variationen, Glossen, Mini-Essays und kritischen Exkursen beschwört das Buch die Faszination dieser Musikrichtung, die ja zugleich viel mehr ist: eine Lebenseinstellung und Weltanschauung nämlich. Nach dem großen Erfolg des ersten Buches erzählt der Autor nun in 33 Bonustracks neue komische, tragische und tragikomische Geschichten von fast vergessenen Helden (Demon, Badlands etc.), von der sprichwörtlichen Gastfreundschaft der Metalheads, vom Metal im Nahen Osten, von Jerry Cotton, der auch nicht mehr um Heavy Metal herumkommt, und Gary Moore, der im Tod dann doch wieder ein echter Metaller war, von Metal-Dorfdiscos, den einschlägigen Musikvideos, von Anthrax als Modepionieren, vom Doping in der Szene und vielem mehr. Das erste und einzige Lemmy-Lexikon beschließt dieses um ein Drittel erweiterte Standardwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Frank Schäfer
111 GRÜNDE, HEAVY METAL ZU LIEBEN
Ein Kniefall vor der härtesten Musik der Welt
Die erweiterte Neuausgabe des Standardwerks mit 33 brandheißen Bonusgründen
Schwarzkopf & Schwarzkopf
INHALT
GEBRAUCHSANWEISUNG
Dies ist keine Musikhistorie im herkömmlichen Sinne, keine wissenschaftliche Monografie, keine Satire, kein Lexikon und keine Geschichtensammlung, sondern alles dies zusammen, aber nichts davon richtig. Es erschien mir reizvoll, die enorm ausdifferenzierte, atomisierte Heavy-Metal-Kultur auf eine Weise darzustellen, die ihrer Heterogenität auch formal Rechnung trägt. Hier stehen deshalb Mini-Essays, kritische Exkurse und theoretische Erörterungen neben Pastichen, Glossen, Capriccios, Kurzgeschichten und Listen. In der unordentlichen Struktur spiegelt sich also in gewisser Weise die Szene selbst.
Ein solches keinem systematischen, sondern eher einem aphoristischen Prinzip gehorchendes Buch wird notgedrungen keine der Gesamtdarstellungen zum Thema ersetzen – nicht die grundlegenden akademischen Studien wie etwa Deena Weinsteins »Heavy Metal. A Cultural Sociology« und auch nicht Ian Christes kongeniale Geschichte des Genres »Höllen-Lärm«.‹ Weitere Literaturhinweise im Kap. 8: Listen.› Es kann jedoch diese Standardwerke immer mal wieder ergänzen und möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle korrigieren. Und ein paar Witze mehr sind hier ja vielleicht auch drin.
Ein Buch mit dem Titel »111 Gründe, Heavy Metal zu lieben« lädt naturgemäß zur wilden Lektüre ein. Und jeder einzelne Text lässt sich denn auch voraussetzungs- und kontextlos lesen, dennoch habe ich versucht, Redundanzen so weit zu vermeiden, dass eine Lektüre von Deckel zu Deckel ebenfalls komfortabel möglich ist. Sie ist sogar ausdrücklich erwünscht! Und vielleicht ist es außerdem nicht gar zu vermessen, mir einen Idealleser vorzustellen, der das Buch anschließend ins Eichenregal stellt oder auf den Klostapel legt, um es auch späterhin als Nachschlagewerk, Zitatsammlung, Pointenfundus, Laxativ oder wie auch immer zu benutzen. Horns!
KAPITEL EINS
GESCHICHTE
GRUND NR. 1
Weil sogar die Beatles zwei Metal-Songs im Programm hatten
Zunächst »Helter Skelter« vom »White Album«. Paul McCartney hatte im »Guitar Player« gelesen, wie Pete Townshend seinen eigenen Song »I Can See For Miles« feierte als den härtesten, lautesten, dreckigsten Song aller Zeiten. Das weckte offenbar McCartneys Ehrgeiz. Und der Umstand, dass er mit seinem öffentlichen Image als unverbesserliche Balladen-Tante nicht so recht glücklich war, spielte dann wohl auch eine Rolle bei der Entstehung dieses für Beatles-Verhältnisse ganz untypisch schroffen, lauten, straighten Rumpel-Rockers. So untypisch, dass Ringo Starr irgendwann seine Sticks wegwarf und schrie: »I’ve got blisters on my fingers!« Das hat George Martin mit auf die Platte genommen, damit auch alle merken, was hier gespielt wird: so eine Art Proto-Metal nämlich, der dann entsprechend gern von Exponenten des härteren Genres – etwa Mötley Crüe, Aerosmith, Gillan und, na ja, wir wollen mal nicht so sein, Bon Jovi – gecovert wurde. Dass Charles Manson nicht zuletzt dieses Stück als verschlüsselte Prophezeiung für eine bevorstehende apokalyptische Auseinandersetzung der weißen und der schwarzen Rasse deutete, aus der er und seine Family als Weltenherrscher hervorgehen sollten, und »Helter Skelter« dann als Chiffre für ihre Ritualmorde umgewidmet und folglich auch beim Hollywood-Massaker an Sharon Tate und ihren Freunden mit dem Blut der Opfer an die Wand geschmiert wurde, hat der Popularität in Hard’n’Heavy-Kreisen alles andere als geschadet.
Noch einen anderen Song aus dem Beatles-Werkkatalog könnte man hier cum grano salis anführen: »I’m Down«, die B-Seite der »Help«-Single von 1965, die ihnen eine Zeit lang als Rausschmeißer bei Konzerten gute Dienste geleistet hat. Die Version von ihrem gefeierten Auftritt im Shea Stadium 1965 ist die beste, zumindest aber die kaputteste. Lennon kloppt mit den Ellbogen auf seiner Vox-Orgel herum, McCartney schreit sich die Seele aus dem Leib, und alle grinsen. Mehr Spaß hatten sie selten. Auf ein offizielles Studio-Album hat der Song es nie geschafft, das sollte seine Beliebtheit bei Hard-Rock-/Metal-Bands – u.a. Heart, Jay Ferguson, Aerosmith, Beastie Boys, Victory – jedoch nicht schmälern. Zumal hier eine Ur-Situation im Geschlechterverhältnis auf eine Weise skizziert wurde, die auch den besoffensten Headbanger nicht überforderte:
Man buys ring woman throws it away Same old thing happens everyday I’m down (I’m really down) I’m down (down on the ground)
GRUND NR. 2
Weil Heavy Metal von William S. Burroughs erfunden wurde
Für Norman Mailer war er der einzige zeitgenössische amerikanische Literat, »der möglicherweise von Genie besessen ist«, er selbst bemerkte später einmal: »Ich glaube, dass ich einer der wichtigsten Leute auf dieser verdammten Welt bin.« Die Beatles sahen das genauso und verewigten ihn auf dem Plattencover von »Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band«. Er war ein Junkie, schwul und verheiratet. Er schoss seiner Frau Joan im Drogenrausch, bei einer wahnwitzigen »Wilhelm-Tell-Nummer«, das Gehirn weg und ging ins selbstauferlegte Exil – nach Tanger und hierhin und dorthin. Sie nannten ihn »El Hombre Invisible«, wegen seiner distinguierten, aristokratischen Erscheinung. Jahrelang lebte er in dem umgebauten Umkleideraum einer YMCA-Turnhalle, dem legendären »Bunker«. Er war ein Waffennarr mit reaktionären Anwandlungen, ein amerikanischer Pionier im Geiste, eine Ikone der Pop-Kultur. Man begrub ihn mit seinem Lieblingsrevolver, einer geladenen 38er, einem Joint und einer kleinen Tüte Heroin in der Tasche, denn »da, wo er hingeht, wird ihn keiner mehr hochgehen lassen«.
Die Rede ist von William Seward Burroughs (1914–1997), der mit »Naked Lunch«, dieser Bricolage aus Sucht-Anekdoten, zoomorphen Phantasien, satirischen Attacken gegen die Heuchelei in Wissenschaft, Politik und Business, aus absurden Verschwörungstheorien, kalten, emotionslosen, aber sprachlich fulminanten Endzeitvisionen, eines jener drei, vier Bücher schrieb, deren Einfluss auf die Gegenkultur der 60er- und 70er-Jahre gar nicht recht zu ermessen ist. Jener Burroughs war es auch, der in seinem fünf Jahre später erschienenen Cut-up-Roman »Nova Express« (1964) die Figur des »Uranium Willy, the heavy metal kid« auftreten lässt, die den großen Lester Bangs zum schmucken Genrenamen inspiriert haben soll, als er versuchte, die musikalische Sensation Black Sabbath (gelegentlich liest man auch: Yardbirds) in Worte zu gießen. Vermutlich hat er das Rubrum aber bloß maßgeblich popularisiert, denn wirklich frühe Belege von Bangs ließen sich bisher nicht finden.
Von Barry Gifford stammt die erste dokumentierte Verwendung des Begriffs, und zwar in einer Besprechung des Electric Flag-Albums »A Long Time Comin’« im »Rolling Stone« vom 11. Mai 1968: »This is the new soul music, the synthesis of white blues and heavy metal rock.« Etwas später, im »Rolling Stone« vom 12. November 1970, übernimmt Mike Saunders diesen Terminus und bezeichnet Humble Pie als ziemlich langweilige »noisy, unmelodic, heavy metal-leaden shit-rock band«, deren aktuelles Album nur »more of the same 27th-rate heavy metal crap« enthalte.
Neben Burroughs zieht man gern noch Steppenwolfs »Born To Be Wild« (1968) als Vorlage heran. Dummerweise erscheint diese Korrespondenz fast plausibler. Erstens ist der Song mit seiner einschlägigen Metapher »heavy metal thunder«, für das Motorengeräusch großer Straßenmaschinen, zeitlich näher dran. Zweitens war diese neben Deep Purples »Smoke On The Water« wohl niedergedudeltste Hard-Rock-Hymne aller Zeiten für einen Musikkritiker absolut präsent, mit Sicherheit präsenter als Burroughs’ Avantgarde-Roman. Drittens bezeichnet das Bild schon ein akustisches Ereignis, lag seine Instrumentalisierung und leichte semantische Umwidmung also auch insofern näher.
Abgesehen davon konnte man auf den in der Chemie und Metallurgie schon über Jahrhunderte gebräuchlichen Begriff auch ohne Vorbild kommen. Zumal das Adjektiv »heavy« als Attribut für eine laute, harte Musik durchaus schon im Schwange war.‹ In Deutschland kennt man »heavy« als Genre-Attribut vermutlich erst seit 1970. Eine Durchsicht der »Sounds«-Plattenkritiken 1966ff. jedenfalls ergab den ersten Treffer in einer Besprechung von »Led Zeppelin 2«, Winfried Trenkler beschreibt hier Led Zeps Musik als »hocheplosiven Heavy-Rock«.
»Heavy Rock« ist denn auch der Spartenbegriff, der sich in der deutschen Musikjournaille (in bezug auf Bands wie East of Eden, Black Sabbath, Stone The Crows, The Who, Cactus, Humble Pie, Blue Öyster Cult, Focus, Thin Lizzy etc.) durchgesetzt hat, in der Regel synonym zum Hard Rock.
»Heavy Metal« scheint erst richtig gebräuchlich geworden zu sein mit dem Erfolg der »New Wave Of British Heavy Metal« gegen Ende des Jahrzehnts. Erstmals 1977 habe ich die Bezeichnung »Schwer-Metal-Trio« gefunden – in einer Kritik von Dr. Gonzo alias Jörg Gülden im »Sounds«, der das Album »Back To The Music« der deutschen Band Mass bespricht. Und derselbe Dr. Gonzo schreibt im selben Jahr in einer Sammelbesprechung von Ted Nugent (»Cat Scratch Fever«) und Starz (»Violation«) über den »Heavy Metal-Madman« Nugent: »Nee, von Feeling kann da nicht mehr die Rede sein, das ist so seelenlos wie eine Monochromie von Ives Klein, und wer das für Heavy Metal hält, der muss neben einem Hammerwerk wohnen und ›Paranoid‹ von Black Sabbath für’n Schlummerliedchen halten! Brrr...«› So betitelte die Proto-Metal-Band Iron Butterfly ihr Debütalbum »Heavy« (1968) und erklärt den ersten Teil ihres Bandnamens – auf dem Bestselleralbum »In-A-Gadda-Da-Vida« aus demselben Jahr – folgendermaßen: »Iron – symbolic of something heavy as in sound ...«
Trotzdem gefällt mir die Traditionslinie zu Burroughs weitaus besser, weniger weil sich Heavy Metal so weltliterarisch nobilitieren lässt, sondern vielmehr weil den Autor durchaus noch mehr mit dem Genre verbindet.
Widerstand gegen jegliche Form von Kontrolle, vor allem aber gegen die unrechtmäßige, normierende und damit reduzierende Einflussnahme der Konsensgesellschaft auf den Einzelnen, ist Burroughs’ poetologischer Hauptimpuls. Sein ganzes Schreiben ist ein Aufbäumen gegen das Reglement, ein Durchbrechen von Beschränkungen. Er befreit sich mit Hilfe von Drogen aus den Fängen und Zwängen der Ratio und flüchtet in ein Land der frei flottierenden Phantasmen, und die dabei entstehenden lauten, brutalen, abstoßend obszönen, furios geschmacklosen Texte ließen sich nicht zuletzt als Kampfansage an den sich allzu repressiv gerierenden Obrigkeitsstaat lesen. Die Strukturanalogien zum Heavy Metal liegen ja irgendwie auf der Hand.
GRUND NR. 3
Weil im Heavy Metal ADS kein Manko ist
John Michael Osbourne leidet seit frühester Kindheit an ADS und noch dazu an Dyslexie, das heißt, er kann keinen Satz vernünftig zu Ende lesen, viel weniger noch schreiben. Um seine Minderwertigkeitskomplexe zu überspielen und in der Schule nicht ausgegrenzt zu werden, macht er sich zum Affen. Aus John Michael wird Ozzy – und die Nummer des Madman, des durchgeknallten, unberechenbaren, aber stets unterhaltsamen Clowns schon frühzeitig habituell. Seine schulische Karriere entwickelt sich entsprechend debakulös. Mit einem Abschlusszeugnis, das ihm ebenso schlicht wie niederschmetternd attestiert, eine Schule besucht zu haben, mehr nicht, und angesichts seiner proletarischen Herkunft kann er sich leicht seine Chancen ausrechnen in der heruntergekommenen, noch in den 60ern ziemlich kriegsversehrten Industriemetropole Birmingham. Er versucht einiges, arbeitet als Klempner, in der metallverarbeitenden Industrie, eine Zeit lang gar als Autohupenstimmer und schließlich im Schlachthof. Und gerade die letzten beiden Jobs kommen seiner späteren Profession ja schon einigermaßen nahe.
Tiere töten kann er gut. Endlich etwas, das »mir Spaß machte«, schreibt er später in seiner »Autobiografie«. Er watet im Blut, mutiert wie alle anderen Kollegen auch zum sadistischen Drecksack mit merkwürdig abseitigem Humor, aber »ich liebte den Job«, und wenn seine Schichtkollegen es nicht übertrieben hätten mit ihren perversen Neckereien und er sich nicht mit einer Eisenstange zur Wehr gesetzt hätte, wer weiß, wer weiß ...
Dann die Beatles als Initiationserlebnis, wie so oft. Auch sie sind Arbeiterkinder und bald seine Leitsterne. Weil er kein Instrument spielt, will er singen. Und auch schon mal aussehen wie ein Musiker. Er macht sich Tattoos, läuft barfuß, trägt einen Wasserhahn um den Hals. Sein Vater – der nichts rausrückt, als Ozzy nach seinem ersten kläglich gescheiterten Einbruch zu einer Geldbuße verurteilt wird, weshalb er für ein paar Wochen in den Knast einfährt – streckt ihm auf einmal das Geld vor für eine Gesangsanlage, ahnt offenbar, dass er es ernst meint. Und irgendwann hängt da dieser Zettel im lokalen Musikaliengeschäft: »Ozzy Zig needs a gig!« Der Beiname war allein dem Reim geschuldet.
Tony Iommi, ein überregional bekannter Gitarrist, einer dieser vielen Beinahe-Profis, immer kurz davor, braucht mal wieder eine neue Band, will aber schon umdrehen, als er sieht, wer sich hinter Ozzy Zig verbirgt – der Schulspinner von damals. Sein Schlagzeuger Bill Ward überredet ihn, es zu versuchen, immerhin hat er eine Gesangsanlage. Und es klappt irgendwie, auch weil man sich ziemlich einig ist, welche Musik man nicht spielen will. »Der süßliche Hippie-Scheiß, der die ganze Zeit im Radio lief, ging mir auf die Nerven, und zwar gewaltig. Alle diese Wichser von den Oberschulen in ihren Polohemden liefen in die Läden und kauften Songs wie ›San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair)‹. Blumen im Haar?! Das durfte doch nicht wahr sein ... wen kümmerte es überhaupt, was die Leute in San Francisco trieben? Die einzigen Blumen, die man in Aston [dem Stadtteil Birminghams, in dem Ozzy aufwächst] zu Gesicht bekam, waren die, die sie einem ins Loch runterwarfen, wenn man mit 53 Jahren abgekratzt war, weil man sich kaputt geschuftet hatte.«
Stattdessen einigt man sich auf harten, schweren Blues Rock, zähflüssig wie das geschmolzene Erz aus dem nahe gelegenen Stahlwerk. Ozzy kennt auch noch einen Rhythmusgitarristen, Geezer Butler, der mal schnell auf Bass umlernt. Die Polka Tulk Blues Band ist komplett. Zunächst die Ochsentour durch die umliegenden Clubs. Erste Erfolge auch überregional. Die Umbenennung in Earth. Eine Tour auf dem Kontinent. 1969 ein Arrangement im Hamburger Star Club. Schließlich, zurück in England, die endgültige Umbenennung in Black Sabbath. Nach dem Trainingscamp Star Club mit mehreren Gigs am Tag war die Band voll ausgehärtet, ein schwerer, schwarzer, matt schimmernder Block. Düstere Tritonus-Akkordfolgen, »Teufelsintervalle«, umgaben ihren Heavy Blues mit einer unheimlichen Aura. Ihre Musik vertonte die Okkultismus-/Satanismus-Mode, die beginnende Desillusionierung und Depression in den ausgehenden 60er-Jahren so kongenial, dass schließlich auch die Plattenindustrie nicht mehr an dieser Band vorbeikam. In einem Tag rotzt man das Debütalbum ins Mischpult. »Black Sabbath« erschien im Februar 1970, wurde von den Kritikern fast einhellig in der Luft zerrissen, aber die Plattenkäufer waren wieder mal klüger. Mit ihrem Debüt und den folgenden drei Alben »Paranoid«, »Masters Of Reality« und »Vol. 4« schufen sie gleich ein paar neue Genres (Heavy Metal, Black Metal, Doom Metal, Stoner Rock, Gothic) und verdienten sich eine goldene Nase.
Es folgen die immer wieder gleichen Eckpunkte einer großen Rockstar-Karriere: Tour folgt auf Album, Album folgt auf Tour, eine zermürbende, alle kreative Vitalität auspressende, nur unter Drogen zu ertragende Vereinnahmung durch die Plattenfirma, ein arglistiger Manager, der die Band quasi-entmündigt und in die eigene Tasche wirtschaftet, in Rekordzeit auf Überlebensgröße aufgeblasene Egos, enormer Erfolgsdruck, noch mehr Drogen, Zusammenbrüche, schließlich »musikalische Differenzen«.
Aber Ozzy hat das unverschämte Glück, nach Tony Iommi noch einmal einen genialischen Musiker zu treffen: Randy Rhoads. Mit ihm als musikalischem Herz und Hirn beginnt er seine Solokarriere gleich mit zwei ebenfalls zu Genre-Klassikern avancierenden Alben (»Blizzard Of Ozz« und »Diary Of A Madman«). Dann stirbt Rhoads, der Freund, tragisch bei einem Flugzeugunglück, und diesen Tod, so scheint es, hat Ozzy nie richtig verwunden. Musikalisch sowieso nicht. Aber so einer wie er muss sich um Kleinigkeiten wie gute Alben nun wirklich nicht mehr kümmern. Spätestens als MTV ihm die Chance gab, mit dem Reality-Sitcom-Dauerbrenner »The Osbournes« auch sein ausgesprochenes Komiker-Talent unter Beweis zu stellen, ist er ohnehin eine nationale Ikone und hat alle Hände voll zu tun, den damit verbundenen Prominentenpflichten nachzugehen: den American Music Award zu moderieren, mal wieder bei der Oscar-Gala vorbeizuschauen, zum Fuffzigsten der Queen aufzuspielen oder mit Bush vor laufender Kamera feist zu dinieren. Und das alles trotz beziehungsweise gerade wegen ADS. Man sollte sich das mit dem Ritalin also vorher genau überlegen ...
GRUND NR. 4
Weil Heavy Metal die Kritiker schließlich doch überzeugt hat
Am Anfang jedoch stand das Missverständnis – sogar bei Lester Bangs. Als Black Sabbaths Debütalbum, der Genre-Urmeter, erschien, konnte Bangs hier nur weitere Epigonen von Cream hören, einer Band, die er ohnehin verachtete, weil sie ihr »ansehnliches Talent vom eigenen Hype schlucken ließen, um haufenweise Kohle zu scheffeln«. Die Quintessenz seines Verrisses im »Rolling Stone« vom 17. September 1970: »Genauso wie Cream! Nur schlimmer.«
Vorher jedoch hat er richtig vom Leder gezogen. »Das ganze Album ist ein Quatsch – trotz der düsteren Songtitel und ein paar durchgeknallter Texte, die klingen, als würden Vanilla Fudge Aleister Crowley räudigen Tribut zollen, hat das Album nichts zu tun mit Religiosität, Okkultismus – oder irgendetwas anderem außer steifen Rezitationen von Cream-Klischees, die klingen, als hätten die Musiker sie aus einem Buch gelernt, wieder und wieder gepaukt mit hündischer Ausdauer. Der Gesang ist spärlich, der Großteil des Albums wurde gefüllt mit schwerfälligen Bass-Linien, über die die Leadgitarre hölzerne Claptonismen aus des Meisters müdesten Cream-Tagen träufelt. Sie haben nur unmelodische Jams mit Bass und Gitarre zu bieten, die wie aufgedrehte Speedfreaks über die musikalischen Horizonte des jeweils anderen kacheln, ohne jemals die richtige Abstimmung zu finden ...«
Und auch der gute Rainer Blome, der frühe deutsche Fürsprecher des Rock, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass sich das Jazz-Blatt »Sounds« der populären Musik öffnete, und der, nur ein Beispiel, ohne weiteres die Größe der Stooges erkannte, kanzelt »Black Sabbath« ab. »Eine von vielen bösen englischen Gruppen, die eine Menge unverdauten harten Blues und schwere, tausendmal gehörte Gitarrenriffs in den Raum schmeißen, um die Teenager zum Schwitzen zu bringen. Das ist Black Sabbath. In der Richtung, die Black Sabbath einschlägt, ist so gut wie alles gesagt worden. Da kann nur wiederholt werden, was andere schon längst wiederholt haben. Ossie Osborne (!), ein Sänger ohne Kompetenz und Format, möchte gern Robert Plant und Mick Jagger gleichzeitig sein. Er, wie auch die übrigen drei Mitglieder von Black Sabbath, haben an Originalität nichts, an Plagiaten aber alles zu bieten. Solche Platten gehören in die Discotheken, wo es auf musikalisch-ästhetische Werte ohnehin nicht ankommt.«
Lester Bangs hingegen war lernfähig. Und das zeichnet eben den wirklich großen Kritiker aus – dass er jederzeit bereit ist, sein einmal gefälltes Urteil zu revidieren. Er sah ein, dass Black Sabbath eines immerhin auf grandiose Weise gelang: »die Teenager zum Schwitzen zu bringen«! Und er sah auch ein, dass dies eine keineswegs zu vernachlässigende Größe war. »The only criterion is excitement, and Black Sabbath’s got it«, schreibt er im Jahre darauf in seiner Besprechung des dritten Sabbath-Albums »Masters Of Reality« (»Rolling Stone«, 25. November 1971).
Bangs hatte auch erkannt, worauf diese Qualität zurückzuführen war. »Seit wann ist denn im Rock’n’Roll Monotonie so ein Tabu?«, fragt er rhetorisch. Black Sabbath haben »wie die besten Rock’n’Roller seit dem Pleistozän« eine Vision, »die ihrer Musik Einheit und Richtung gibt und aus ihren simplen Strukturen mehr macht, als man ihnen zunächst ansieht«. Sie konzentrieren sich »unerbittlich auf die selbstzerstörerische Kehrseite all der hippiesken ›Let’s Get Together‹-Plattitüden der Gegenkultur«. Und gerade das »Naive, Simple, Repetitive, Kindische« sowohl in der Musik wie auch in den Texten erweise sich dabei als ihre Stärke, weil es ihnen erlaube, wie Chuck Berry, The Who oder MC5 vor ihnen, »die konfuse, quasi-politisierte Verzweiflung des Aufwachsens in diesen Zeiten« darzustellen.
Dass er hier nicht nur eine Band, sondern pars pro toto das ganze Genre mit in den Blick nahm, zeigt sein Aufsatz »Heavy Metal« in »The Rolling Stone Illustrated History of Rock’n’Roll« (1976), der die in der Black Sabbath-Kritik ausgebreitete Argumentation noch einmal wiederholt. Für ihn sind die Stooges, MC5, Black Sabbath, Grand Funk, Alice Cooper etc. vor allem Lieferanten großartiger, adäquater »Angst-Hymnen«. Von »Chuck Berry an hat der Rock Hymnen an die Teenagerzeit geschaffen, sich mit der Teenager-Frustration beschäftigt, und es existiert vielleicht keine Musik, die die aufschreienden Nerven pubertärer Frustration besser begleitet als Heavy Metal«. Wenn ein Rockkritiker aus der Vor- und Frühgeschichte des Heavy Metal sein Wesen verstanden hatte, dann war das Lester Bangs.
Noch ein kleiner Nachtrag. Beim »Sounds« dauerte es übrigens bis 1975, bis zum »Sabotage«-Album, ehe man Black Sabbath adäquat zu würdigen wusste. Jörg Gülden scherzt zwar einerseits freundlich über die »Mini-Altmeister der Nekrophilie«, macht aber auch deutlich, dass es bei einer rockmusikalischen Instanz schlicht albern wäre, noch immer grundsätzlich deren Qualitäten in Zweifel zu ziehen. Die »Gegner der Band dürfen wieder von zähflüssigem Lava-Sound und monotonem Geriffe mosern, doch all die kleinen Black Sabbath-Okkultisten – und das sind einige – wissen nach einmaligem Anhören der Platte: Das ist die wohl reifste Platte der Vier. – Find’ ich übrigens auch ...«
GRUND NR. 5
Weil man Heavy Metal schon immer sofort als solchen erkannt hat
Das brachte Heavy-Metal-Bands von Beginn an den Vorwurf ein, sie klängen ja alle gleich. Lester Bangs, der große Metal-Mentor aus den Kindertagen des Genres, der vor allem im »Creem« und »Rolling Stone« immer wieder die Fahne hochgehalten hat, räumt in seinem Überblicksartikel für »The Rolling Stone Illustrated History of Rock’n’Roll« (1976) entschieden auf mit dieser »weit verbreiteten Klischeevorstellung«. »Sie klingen nur für das ungeübte Ohr gleich. Wahr ist, die Abhängigkeit von der Technologie begünstigt eine gewisse maschinenhaftige Uniformität (wenn nicht Präzision).«
Und was Bangs mit »Abhängigkeit von der Technologie« meint, hat er kurz zuvor erläutert (ich zitiere das nur, weil es deutlich macht, wie bekannt die Metaphorik klingt, mit der schon vorgestern über diese Musik geschrieben wurde): »Von allem kontemporären Rock ist Heavy Metal das Genre, das am ehesten mit Gewalt und Aggression, Plünderung und Gemetzel gleichgesetzt wird ... Als Eric Burdon in Monterey von ›zehntausend Gitarren‹ sang, die ›alle zusammenspielen‹, war er unabsichtlich ein Prophet des Heavy Metal, dessen Lärm durch elektrische Gitarren erzeugt wird, durch eine stattliche Anzahl von Verzerrungshilfsmitteln, vom Fuzz hin zum Wah-Wah, gefiltert und auf etliche Dezibel oberhalb der Schmerzgrenze aufgedreht, laut genug, um noch von den Wänden der größten Stadien zurückgeworfen zu werden.« Und er gibt auch schon kritisch zu bedenken, was jeder heutige Metal-Hörer und mit Sicherheit jeder Konzertgänger bestätigen kann: »Es besteht nur eine dünne Grenze zwischen wuchtigen Melodiefloskeln und schwerfälligem Klanggemansche.«
So ganz kommt Bangs nicht los von dem Etikett der »Uniformität« (die bei ihm aber ja gar nicht nur negativ gemeint ist, sondern immer die volle Beherrschung des musikalischen Formats mitmeint, eben die »Präzision«). Er erzählt im Folgenden eine sprechende Anekdote über die Metal-Stammväter Blue Cheer. »Blue Cheer waren wirklich ihrer Zeit voraus; ausgerechnet aus San Francisco kommend, war dieses Power-Trio derartig laut, dass sie ein Rezensent einer ihrer ersten Konzerte aus Mangel an Worten als ›Superdruiden-Rock‹ bezeichnete.« Dieser Rezensent war womöglich Lester Bangs selbst, das nur am Rande. Aber dann kommt die eigentliche Pointe. »Ein Freund von mir hatte einen Plattenspieler mit, der den Plattenteller in entgegengesetzter Richtung drehen konnte; als wir das erste Album von Blue Cheer, ›Vincebus Eruptum‹, rückwärts spielten, hörte man keinen Unterschied zu vorwärts.« Das ist wahre Präzision!
Das klingt ein bisschen wie gut ausgedacht, muss aber nicht sein. Mit dieser einen famosen, ihrer Zeit um Jahrzehnte vorauseilenden Prog Metal-Band Salem’s Law, der als Gitarrist anzugehören ich die große Ehre hatte, habe ich durchaus Vergleichbares erlebt. Wir ließen obligatorisch bei jeder Übungs-Session ein Band mitlaufen, wie man das so macht, wenn man die Musik so ernst nimmt wie nichts sonst auf der Welt, viel zu ernst also. Als Aufnahmegerät kam jedoch keins dieser semiprofessionellen Homestudio-Geräte zum Einsatz, die es auch Mitte der 80er schon gab, wenn auch noch analog, nein, wir besaßen einen morbiden, in hunderten Freibad-Einsätzen aufs Schäbigste runtergerockten Ghettoblaster. Er funktionierte noch, und das ist auch schon das Beste, was man von ihm sagen konnte. Und er hatte zwei eingebaute Mics ab Werk, die unsere Musik im Versuchsstadium aufnahmen, sogar Stereo, und so vor dem Vergessen bewahrten. Nach einem solchen Übungsabend hörten wir uns meistens noch mal die Riffs, Song-Fragmente oder fertigen Songs an, um uns gegenseitig auf die Schultern zu klopfen, und bei einer solchen Session-Nachbesprechung passierte es. Jemand hatte vergessen zurückzuspulen. Wir hörten also die leere B-Seite der Kassette, aber plötzlich vernahm man im Hintergrund einen bekannten Sound. Der Tonkopf nahm offenbar die andere Seite des Bandes ab, und die lief entsprechend rückwärts. »Was ist das denn, mach mal lauter«, rief einer. Durch Rechtsanschlag des Volumenpotis und starken Druck auf die Kassettenfachabdeckung ließ sich die Musik halbwegs hörbar machen. Und wir sahen uns jetzt erstaunt und vielleicht sogar ein bisschen schuldbewusst an. Denn das waren wir, ganz eindeutig. Wir klangen ganz genauso wie immer. Allerdings wesentlich besser. Die gerade gehörten Killer-Riffs wären uns nie selbst eingefallen, das wussten wir alle. Und vielleicht ahnte der eine oder andere von uns bereits, dass wir es als Band – richtig herum – vielleicht doch nicht ganz so weit bringen würden.
GRUND NR. 6
Weil man mit Heavy Metal zu Gott (und Golf) finden kann
Das beweist nachdrücklich: Alice Cooper. Als vor vielen Jahren ein befreundeter Journalist ein Interview mit Alice Cooper offeriert bekam, überlegte er mit seinem Fotografen, wie sie dem ehemals so großen Mann angemessen gegenübertreten sollten. Man einigte sich schließlich auf die berühmte Szene in »Wayne’s World«, in der Wayne und Garth backstage einem Vortrag Coopers über die indianischen Wurzeln der Stadt Milwaukee lauschen und sich dann vor Demut in den Staub werfen: »Wir sind unwürdig ...« Zwei Minuten vor der Audienz bekommen die beiden dann aber doch kalte Füße, finden das alles plötzlich albern, ändern ihr Konzept kurzfristig und begrüßen ihn ganz schlicht, auf Augenhöhe, mit einem Handschlag. Cooper sieht sie überrascht an und nickt dann zufrieden: »Endlich mal einer, der nicht diese beschissene ›Wayne’s-World‹-Nummer abzieht!«
Ende der 90er war die ehemals auratische Gestalt zu einer Szene in einem Comedy-Streifen eingedampft. Den Rest interessierte fast nur noch die Oldie-Fraktion. Und so teilt auch er das Schicksal vieler Rock’n’Roll-Ahasvers: Er muss nun für alle Zeiten durch die Mehrzweckhallen und Bürgerzentren in der Diaspora tingeln – und schließlich bei Thomas Gottschalk auftreten.
Angesichts der freudlosen Gegenwart kann ein bisschen nostalgische Rückschau nicht schaden, und diesem Bedürfnis ist Alice Cooper mit seiner zweiten Autobiografie »Golf Monster. Mein Leben zwischen Golf und Rock’n’Roll« nachgegangen. Die zwölf Exkurse, in denen er beschreibt, wie er nach zwei Entzügen seinen Alkoholismus eintauscht gegen die Golfsucht, und dann auch gleich noch ein paar Tipps gibt, mit welchem Gallaway-Driver man neun Meter mehr rausholt, wo der Ellbogen beim Chippen anliegen muss, und wie man sich zu verhalten hat, wenn man aus Versehen die vor einem spielende Gruppe abgeschossen hat usw., kann getrost überschlagen, wer dieser Sportart nicht frönt. Ich habe das jetzt für Sie gelesen: Glauben Sie mir, Sie verpassen wirklich nichts!
In den übrigen zwei Dritteln des Buches erinnert er sich unbefangen, aufrichtig und – auch wenn ihm die eine oder andere Ehrpusseligkeit durchrutscht – beinahe bescheiden an seine gloriose Zeit als Musiker. An die späten 60er etwa, als er neben MC 5, Stooges, Amboy Dukes und ein paar anderen den Hippies mit ihren Paradies-Naherwartungen einen ungeschlachten, asphaltharten Brocken Detroiter Stahlstadtrealität vor die gebatikten Lätze knallte. Er ist sogar redlich genug, die Qualität seiner Kontrahenten anzuerkennen: »Ich trat nicht gerne nach Iggy auf! Er erschöpfte das Publikum. Vielleicht waren wir musikalisch besser und visuell umwerfender, doch bei den Stooges ging die Post ab.«
Schon früh hatte er sich von der befreundeten Girl-Band GTO’s ein abgerissenes Fummeltrinen-Outfit auf den Leib schneidern lassen. Das war Glam avant la lettre. Und als der dann tatsächlich so hieß und die Band ihre Musik vom Produzenten Bob Ezrin noch einmal vollständig zerlegen und marktgerecht wieder zusammensetzen ließ, begann die große Zeit von Alice Cooper. Er ging noch einen Schritt weiter und hyperbolisierte das Glam-Konzept in Richtung Horror Show mit elektrischem Stuhl, Guillotine, Zwangsjacke, eimerweise Filmblut und der notorischen Würgeschlange. Groucho Marx, der väterliche Freund, hatte gar nicht so unrecht damit, wenn er ihn als »die letzte Hoffnung des Varietés« bezeichnete. Ein ziemlich eklektischer, mit Motiven aus Gothic-Literatur und Horror-B-Movies spielender Vaudeville-Mummenschanz wurde hier dargeboten, der die größten Säle und Stadien füllte und ihm schließlich sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde einbrachte: 1973 bestritt er in São Paulo vor 158.000 Zuschauern das bisher größte Hallenkonzert, in einem Gebäude, siebenmal so groß wie der Madison Square Garden. Aber was für ein Chaos-Trip: »Als wir eine Pressekonferenz gaben, erschienen 30.000 Leute. Während dieser Pressekonferenz wurden in den Toiletten zwei Menschen erstochen. Soldaten waren da. Ein Baby wurde geboren.«
Dann der Suff, ein paar weniger erfolgreiche Alben. Alice Cooper war beinahe schon weg vom Fenster, als sich Mitte der 80er die Theater AG des Heavy Metal emanzipierte und als »Sleaze« auch noch Erfolge feierte. Mötley Crüe, Faster Pussycat, Guns N’ Roses, Poison beriefen sich immer wieder vollmundig auf Alice Cooper. Der nutzte seine Chance, ließ sich von einschlägig erfahrenen Produzenten (Beau Hill, Michael Wagner) und jungen, gutaussehenden Mietmusikern musikalisch runderneuern und konnte seine Karriere so bis in die 90er-Jahre auf hohem kommerziellen Niveau fortführen, bis Grunge den Metal als Hätschelkind der Plattenindustrie ersetzte und zurück in die Nische stieß.
Von dem letzten Karriereknick erfährt man in seiner Autobiografie natürlich nicht viel, dafür umso mehr darüber, wie er ihn kompensiert. Mit Golf – und dem lieben Gott. Er führt am Ende einen peinlichen Eiertanz auf, will einerseits den alten Apostaten-Fans klarmachen, dass man auch als gläubiger Christ immer noch »schwer auf Draht« sein könne, und zugleich sich und seinem Herrn Rechenschaft ablegen. Auf einmal darf die Show auch kein kurzweiliges Varieté-Spektakel ohne tieferen Hintersinn mehr sein, sondern muss den hehren Zweck haben, die »Niedertracht auf der Welt satirisch darzustellen«, um der »Welt heute eine gewaltige Dosis Moral und gesunden Menschenverstand« einzutrichtern. Man fühlt sich sofort an Karl May erinnert. Als der die sterbende Rothaut am Ende von »Winnetou III« hauchen lässt »Winnetou ist ein Christ«, hätte man das Buch auch am liebsten in die Ecke gepfeffert. Hier geht es einem ähnlich. Dabei hat man sich passagenweise sogar ganz gut amüsiert. Einmal erzählt er von seiner Liebe zu schlechten Kung-Fu-Filmen, die er sich allem Gespött der Roadies ungeachtet regelmäßig vor der Show ansieht: »Jeder Musiker hat seine eigenen Rituale, bevor er auf die Bühne geht. Peter Frampton bügelt.«
GRUND NR. 7
Weil Heavy Metal sich für den Tierschutz stark macht
Die Scorpions sind lebende Legenden des deutschen Humorschaffens. Es darf also vielleicht erlaubt sein, auf ein frühes, noch nicht so bekanntes Kapitel ihres Werkes hinzuweisen. Unter dem Tarnnamen The Hunters schickte sich die Hannoveraner Band im Jahr 1975 an, den heimischen Schlagermarkt zu knacken. Ihr Prä-Metal-Krautrock war zwar schon leidlich erfolgreich, aber mit eingedeutschten Versionen internationaler Hits ließ sich schon immer eine richtige Mark machen. Und so nahm die Electrola, heute nicht umsonst die Labelheimat von Howard Carpendale, Tim Toupet, Mickie Krause, den Höhnern und anderen Schießbudenfiguren, eine Single mit ihnen auf, die zwei Coversongs der Bubblegum-Hardrocker Sweet enthielt. Die B-Seite ist schon ziemlich ausgeschlafen. Der gerade geläufige Chartburner »Action« wird hier zu »Wenn es richtig losgeht«, und bereits die erste Gesangsstrophe kündet – wenn auch etwas holprig, sie singen ja sonst eher »englisch« – von einer ziemlich realistischen Selbsteinschätzung: »Ja, du siehst das falsch, / denn ich bin kaum der Typ, / den du verbrauchst / zum geistigen Bedarf.« Das stimmt heute immer noch genauso wie vorgestern.
Zu recht auf die A-Seite hat es aber ihre Anverwandlung von »Fox On The Run« geschafft. Aus dem Stück über ein Groupie, dessen Namen das lyrische Ich gar nicht wissen will, weil es mittlerweile ziemlich scheiße aussieht, machen die Hunters / Scorpions ein Tierschützer-Lied – »Fuchs geh voran«. »Hey-hey, / du wunderschönes Tier / Ich komm und helfe dir, / bist du mal in Gefa-a-ahr. / Okay-ay, / sie wollen alle nur dein Fell, / und wer das hat, verkauft es schnell – / ja, das ist leider wa-a-ahr.«
Deshalb ihr guter Tipp für die gefährdete Kreatur: »Fuchs geh voran / und lauf, so schnell du laufen kannst, / die Meute, die dich jagt, die ist / schon so nah dra-an. / Fuchsi, geh vora-a-an. / Fuchsi-Fuchs, komm sei schlau, / geh in den Bau.«
Aber Meine und seine Mit-Hunters belassen es eben nicht nur bei wohlfeilen Ratschlägen für Freund Reineke Fuchsi-Fuchs. Nein, sie wenden sich in der zweiten Strophe direkt an die Waidmänner und schreiben ihnen folgende letzte Warnung ins Stammbuch. »Hey-hey, / ich sag euch, her mit dem Gewehr. / Ich gebs euch dann nie wieder her. / Was soll die Wilderei-ei-ei. / Nei-ein, / das ist ein arger Lump, / der tötet ohne Grund, / haut ab mit eurem Blei-ei-ei ...«
»Blei« meint natürlich die Schrotkugeln. Und zugleich auch das Schwermetall, mit dem die Jäger, gleich Hunters, gleich Scorpions es auf uns arme Füchse, die Menschheit, abgesehen haben. Also, da sage keiner, sie hätten uns nicht gewarnt. Viermal noch schärft er uns ein: »Fuchsi, geh vora-a-an. / Fuchsi-Fuchs, komm sei schlau, / geh in den Bau.«
Wie sagte schon Johann Wolfgang von Goethe: »Nicht nur einen roten Schwanz haben, auch Fuchs sein!«
GRUND NR. 8
Weil Heavy Metal traditionsbewusst ist
»Where were you in ’79 when the dam began to burst?«, fragt Peter »Biff« Byford von Saxon in »Denim And Leather«, diesem gesungenen Heavy-Metal-Einstellungstest. Und mit Argwohn und zurückgehaltenem Zorn, der jeden treffen wird, der sich widerrechtlich Zugang zum Metal-Elysium verschaffen will, prüft er den Anwärter auf Herz und Nacken. »Did you check us out down at the local show? / Were you wearing denim, wearing leather? / Did you run down to the front? / Did you queue for your ticket through the ice and snow?« Na, dann nur herein, mein Freund.
Punk war schon durch Ende der 70er-Jahre und der musikalische Untergrund wieder ein paar Clubs weitergezogen. Die neue Avantgarde assimilierte den Hard Rock der frühen Jahre – von Led Zeppelin, Deep Purple, Grand Funk Railroad und vor allem Black Sabbath –, schöpfte aber auch noch das letzte Gramm Bluesschlacke ab. Das ergab urbanen, dreckigen, aber technisch kalkulierten und effizienten Lärm, gewissermaßen das akustische Äquivalent zur Fabrik. Und aus dem Industrieproletariat respektive Kleinbürgertum rekrutierte sich zunächst auch das Gros der Heavy-Metal-Klientel. Wie immer verschliefen die großen Firmen die Anfänge, die Szene musste sich selbst helfen, gründete Indielabels wie Music for Nations, Ebony Records oder Neat Records und brachte erprobte Club-Größen wie Raven, Diamond Head, Samson, Angel Witch, Witchfynder General usw. in die Plattenläden. Als dann 1979 ein Medienstreik in England die Promotionabteilungen der Plattenfirmen lahmlegte und die Verkaufscharts ein paar Wochen tatsächlich mal ein Abbild des von Marketingbudgets unbeeinflussten Käuferverhaltens zeigten, wurden endlich auch die Major Labels wach. Sie taten, was sie immer tun, sie schöpften den Rahm ab und nahmen die kommerziell vielversprechendsten Exponenten unter Vertrag: Iron Maiden, Saxon, Def Leppard und einige andere. Noch im selben Jahr bekam das neue Genre von Geoff Martin im »Sounds« eine zugkräftige, leitartikeltaugliche Aufschrift – »New Wave Of British Heavy Metal«.
Was damals in diesem Genre-Kreativpool herumschwamm, war bereits so heterogen, dass die dann ab 1983 beginnende Ausdifferenzierung zumindest im Rückblick eine gewisse Folgerichtigkeit besaß. Auch wenn man die immerwährende Dynamik zwischen der Avantgarde- und Konsens-Kultur bedenkt: Heavy Metal war 1983 bereits dabei, im Mainstream anzukommen (in den USA erhöhte sich sein Anteil am Gesamtumsatz der Musikindustrie 1983/84 von 8 auf 20 %), und der Underground reagierte seinerseits darauf, indem er sich weiterentwickelte, spezialisierte, gewisse Merkmale expressiver ausformte.
Es gab zwar schon Raven, die mit ihrem hyperaktiven Geschredder bereits auf der Grenze des Genres entlanghetzten, und natürlich Motörhead, die noch vor der Konsolidierung der NWOBHM mit »Overkill« den Prototypen eines Thrash-Songs im Programm hatten. Es gab Venom, die das Motörhead-Konzept noch einmal forcierten durch musikalischen Dilettantismus und bitterböse Symbolik und noch einige andere mehr. Aber einer Musik, die sich das Extreme auf die Kutte geschrieben hatte, war das Prinzip Steigerung nun mal wesenhaft. Und so zog man die Geschwindigkeit noch einmal an, gestaltete das Riffing militanter, vor allem die Schlaghand des Gitarristen war deutlich extensiver gefordert, das gesamte Notenaufkommen duplizierte, vervielfachte sich, der Song als solcher emanzipierte sich von der klassischen Harmonielehre. Und auch die in der NWOBHM exponierte technische Akkuratesse wurde drangegeben zugunsten einer dirtyness, einer Brutalo-Attitüde – in der man auch den US-Punk à la Misfits und Black Flag wiedererkennen konnte. Das nannte man dann Thrash Metal! Und so ging die Ausdifferenzierung, Diversifizierung, Genre-Atomisierung weiter und weiter. Irgendwann hatte fast jede Band ihre ureigene Untergattung – aber so richtig interessierte das auch keinen mehr, was da nach »file under ...« stand, denn wer Heavy Metal in den letzten Jahren und Jahrzehnten hörte, brauchte derlei Kategorien nicht, weil er sich sowieso auskannte. Die Spreu hatte sich längst vom Weizen getrennt. Metal hörten nicht mehr die, die immer nur das hören, »was halt so im Radio gespielt wird«, sondern nur noch die »true believers«.
GRUND NR. 9
Weil Heavy Metal einmal wichtig war
Und zwar wichtig nicht insofern, als Heavy Metal in den 80er-Jahren ästhetisch besonders exorbitant gewesen wäre, zumindest nicht in den meisten Fällen, sondern einfach weil er die Popmusik war, die sich in jenen Jahren am besten verkauft hat. Das heißt, die vielen Millionen Hörer haben Metal zu etwas Wichtigem gemacht. Hier zeigt sich einmal mehr der urdemokratische, anti-elitäre Generalbass, der dieses Genre durchpulst. Der Musiker macht einfach nur Musik, erst der Hörer schafft die Bedeutung; und erst indem die Masse der Hörer einem Produkt zu Popularität verhilft, verleiht sie ihm symptomatische Bedeutung, sagt dieses Produkt also wirklich etwas aus über seine Zeit.
So kann man einige gute Gründe nennen, warum sich Heavy Metal in den 80er-Jahren auf breiter Front etablieren konnte. Wegen seiner reißerischen Verpackung war er wie gemacht für das sich rasch entwickelnde Musikfernsehen, das den Video-Clip bald als wichtigstes Marketinginstrument etablierte. Aus dem gleichen Grund profitierte er wohl am deutlichsten von der Ausweitung und Diversifikation des Zeitschriftenmarkts – in den 70ern gab es »Creem« und den »Rolling Stone«, hierzulande »Sounds« und »Musik Express«, Mitte der 80er bereits eine Reihe genauso aufwändig produzierter Spartenmagazine. Außerdem ist er das akustische Äquivalent zum neokonservativen Zeitgeist. Zwar verband ihn der Hass auf die selbstzufriedenen, satten, nostalgischen Ex-Hippies mit dem Punk, aber während der, mit welchen ironischen Pirouetten auch immer, weiterhin auf einer linken Attitüde beharrte, übernahm Glam den Monetarismus der Konservativen. Das Geprotze mit kapitalistischen Status-Insignien in den einschlägigen Videos wird denn auch erst wieder annähernd eingeholt von den Pimps des Rap.
GRUND NR. 10
Weil Heavy Metal ein kreatives Versuchslabor ist
Man kann ja gern darüber klagen, wie die Industrie die Musik kommerziell vernutzt hat, bis nichts mehr da war von der unabhängigen gegenkulturellen Szene Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre, darf aber auch nicht zu erwähnen vergessen, welche enorme Kreativität und Produktivität freigesetzt wurde, als sich die A&R-Manager der großen Konzerne plötzlich wieder für ein paar lausige Garagenbands interessierten – und die sahen, dass hier richtig Geld zu verdienen war. Auch der Hype hat zwei Seiten. Das zeigt ein Blick auf die Sleaze-Szene in Los Angeles Mitte der 80er. Heavy Metal, zumindest seine toupierte Variante, war auf einmal Top-ten-tauglich, Mötley Crüe verkauften sich millionenfach. Die A&R-Scouts suchten den L.A.-Underground argusäugig nach Nachfolgern ab. Und hier brodelte es. Die Chancen auf einen hochdotierten Major-Deal standen so gut wie nie, und so mutierte die Stadt zu einer Art Versuchslabor, in dem praktisch jeder mal mit jedem probte, um zu sehen, ob nicht etwas dabei heraussprang, das mehr war als die Summe der Teile. Diese kreative Reagenzglassituation spiegelt sich schon im Bandnamen Guns N’ Roses, einer Kontamination aus Hollywood Rose und L.A. Guns, der beiden Club-Größen, aus denen sich die Stammbesatzung rekrutierte. So eine kreative Explosion wie das GN’R-Debüt »Appetite For Destruction« hätte es mit Sicherheit nicht gegeben ohne das böse Streichholz des Kapitals, das Feuer an die Lunte gelegt hat.
GRUND NR. 11
Weil Heavy Metal mit deutschen Texten immer schon Ärger bedeutete
Ich spreche jetzt mal nicht über Rammstein und auch nicht Doro (vgl. »Für immer«) und schon gar nicht über die Neue Deutsche Härte (also Oomph!, Riefenstahl, Fleischmann, Rinderwahnsinn, Leichenwetter, Hämatom, Samsas Traum, Metallspürhunde – um hier nur mal ein paar erlesene Namen eines an erlesenen Namen nicht armen Subgenres zu nennen). Nein, ich gehe jetzt zurück zu den Anfängen: zu Breslau mit Jutta Weinhold und dem kahlköpfigen, ZZ-Top-langbärtigen, im letzten Jahr verstorbenen Chefcholeriker Alex Parche an der Gitarre, die schön stumpfes Altmetall in deutsche Lettern gossen. »Volksmusik« (1982) heißt ihr einziges, von Michael Wagner sehr roh und einfach, aber stimmig produziertes Album, das dann auch gleich wegen vermeintlich rechtsreaktionärer Inhalte von den Medien geächtet wurde. Das etwas kuriose Cover spielt tatsächlich mit dem Tabubruch. Der in Fraktur gesetzte pastellgrüne Albumtitel ziert einen Schattenriss, der vier Wandervögel zeigt, also Exponenten jener im Kaiserreich gegründeten, zunächst durchaus emanzipatorische Ziele verfolgenden Jugendbewegung, die sich dann später vor den völkischen Karren spannen ließ. Und das Titelstück beginnt denn auch entsprechend:
Die Musik ist schnell und hart,
nach der guten Deutschen Art. Die Menge jubelt, tobt und stampft,
es geht ab voller Dampf. Jedes Lied singt ihr mit,
so hält sich der Deutsche fit.
Norddeutschland, Süddeutschland,
überall ist sie bekannt.
Volksmusik, so muss sie sein.
So nach und nach wird aber klar, worum es hier eigentlich geht. Der Song ist letztlich nicht mehr als eine ungelenke, nicht sonderlich gewitzte, holzhammerironische Begründung, warum Weinhold nicht auf Englisch singt. Wir schreiben das Jahr 1982, die Neue Deutsche Welle beginnt sich in den Mainstream-Medien durchzusetzen, aber im Metal ist die allgemeine Amts- und Verkehrssprache weiterhin Englisch – und da können ein paar Worte zur Erklärung, warum man plötzlich im Idiom der Feinde, des Musikantenstadels, singt, nicht schaden. Allgemeinverständlichkeit ist das Hauptargument (»überall ist sie bekannt«). Man will die deutsche Sprache nicht so einfach denen überlassen, die Scheißmusik damit machen.
Wie Volksmusik stattdessen »sein muss« – oder vielmehr sein müsste! – , klärt die zweite Strophe.
Gitarren braten höllisch heiß,
von der Bühne fließt der Schweiß.
Das Schlagzeug hämmert wild drauflos,
Schlag auf Schlag, Stoß um Stoß.
Verstärker an, verzerrter Klang,
so hört sich ein Volkslied an.
Mit anderen Worten: Breslaus Musik – Heavy Metal! – ist die einzig wahre Volksmusik! Dass der Witz – wir benennen unsere Musik mit einer ganz abseitigen, übel konnotierten Genrebezeichnung und deuten sie einfach metaphorisch um – etwas fad schmeckt, mag ja allemal sein, aber eine rechtsreaktionäre Gesinnung kann man der Band auch schon deshalb nicht unterstellen, weil der übrige Kontext dagegenspricht. Die Cover-Rückseite zeigt einen irr grinsenden Jugendlichen mit einer Eistüte in der Hand und einem Ghettoblaster auf der Schulter, der vermutlich Breslau hört. Ein ziemlich zeitgeistiges, infantiles, also stinknormales NDW-Backcover. Offenbar rechnete man eher mit einer solchen Klientel oder versuchte diese gezielt zu ködern. Das Album wurde dann aber trotzdem wahr- und alles in allem wohlwollend aufgenommen in der HM-Szene – und keinesfalls besonders kontrovers diskutiert, obwohl die sonst eigentlich immer ziemlich empfindlich reagiert auf Rechtsausleger.
Es war eine typische, von den Medien einmal mehr denunziatorisch geführte PC-Kampagne, die Jutta Weinhold so verschreckte, dass sie sich bald nach Erscheinen des Albums absentierte. Dabei verraten auch die anderen Songs keine verfängliche Gesinnung, im Gegenteil. Auch der zweite inkriminierte Song, »Held im Traum«, erweist sich bei genauerer Lektüre als campige S/M-Phantasie.
Blondes Haar mit Seitenscheitel
und ein klarer heller Blick.
Schöne blanke Lederstiefel,
die Uniform ist schick.
Die Figur ist überragend.
Dein Körper ist so hart wie Stahl.
Ich fühle mich bei dir geborgen,
und du bist so schön brutal.
Ein paar Songs sind sogar dezidiert ideologiekritisch. »Kampfmaschine« etwa macht sich lustig über maskulinen Körperkult und Macho-Attitüde, und in »Exzess« spielt Weinhold die Femme fatale und propagiert einen explizit weiblichen Ex-und-hopp-Hedonismus, der das in der Rockmusik probate Bild vom Ladykiller ironisch ins Gegenteil verkehrt. Das trägt schon beinahe feministische Züge.
Nachdem der Name Breslau verbrannt und Weinhold geflüchtet war, machte der Chef unter dem Label Alex Parche Band weiter und achtete bei den Lyrics tunlichst darauf, keine Zweideutigkeiten mehr zu produzieren. Besser wurden die Text nicht unbedingt dadurch. Auf dem Nachfolger »Adrenalin« (1983) lutscht er nur noch ultraorthodoxe Rocker- respektive Biker-Klischees weiter aber.
Der Motor röhrt, die Kolben glühn,
Blanker Chrom, die Funken sprühn.
Die Automacker hupen laut
Er hat die Vorfahrt eingebaut.
Die Braut hängt an ihm dran,
wärmt ihm die Eier an.
Was er braucht, hat er dabei,
auf der Straße ist er frei.
Motormann, Motormann, Motormann –
wirf die Maschine an.
Und der für Weinhold eingesprungene Josef Schmeink machte seine Sache nicht mal schlecht, aber ihre zwischen Hysterie und Laszivität pendelnde Intonation verlieh Parches sehr robustem, ungewaschenem Blues-Punk-Metal dieses Quentchen Fragilität und Luftigkeit, das es interessant machte.
GRUND NR. 12
Weil selbst die DDR den Heavy Metal nicht verhindern konnte
»Rock im Rock, obwohl die Interpreten Hosen anhaben«, erklärte »Rund«-Moderator Bodo Freudl im April 1981 den Zuschauern seiner Musiksendung den wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag der Band Girlschool. Recht hatte er ja, aber ...
Ein bisschen hausbacken und von vorgestern ist es immer, wenn sich das Staatsfernsehen mit Popkultur befasst, das war im Osten nicht anders als im Westen. Und wesentlich häufiger als die DDR hatte die Bundesrepublik Metal auch nicht auf dem Schirm, jedenfalls noch nicht in den ganz frühen 80ern. Ich erinnere mich an eine »Musikladen«-Sendung mit Motörhead, die im Vollplayback »Ace Of Spades« gaben, als mein Vater zufällig ins Wohnzimmer kam, überrascht stehen blieb, gebannt die restlichen zwei Minuten zuschaute, um dann mit einem seltsam enttäuschten Gesicht wieder hinauszugehen. Wir haben nie darüber geredet.
Egal. Zurück zu Girlschool. Der affizierte DDR-Bürger hätte vielleicht gern noch ein paar Basis-Informationen zum bisherigen Werk der Band gehabt, nur um zu wissen, was er bisher musikalisch verpasst hatte – beziehungsweise was er den Westverwandten demnächst auf den Wunschzettel schreiben musste (zwei Alben immerhin, »Demolition« und »Hit And Run«, und die in Kollaboration mit Motörhead unter dem Namen Headgirl entstandene EP »St. Valen- tine’s Day Massacre«). Aber worauf es Freudl hier offenbar entschieden ankam, war die Indienstnahme der Musik für die gute sozialistische, hier eben frauenemanzipatorische Sache. Ohne einen solchen didaktischen Rahmen wäre diese Musik damals offensichtlich den Funktionären nicht zu vermitteln gewesen.
Diese Strategie der »Umarmung«, die sich die Kulturverweser des Zentralkomitees ausgedacht hatten, weil man wohl einsehen musste, dass sich aktuelle Popformate nicht wirklich unterdrücken und schon gar nicht geheim halten ließen, weichte in den folgenden Jahren mehr und mehr auf, nicht zuletzt im Radio, wo sich bald Sendungen etablierten, die das Genre mehr oder weniger entpolitisiert präsentierten und also eher den Fan-Interessen Rechnung trugen: »Heavy-Stunde«, »Tendenz Hard bis Heavy« und »Beatkiste« vor allem. Aber gelegentlich brachten die Redakteure auch bei den Mitschnitt-Sendungen »Duett – Musik für den Rekorder« und »Vom Band fürs Band« Heavy Metal unter. So konnte der Ost-Thrasher im Dezember 1986 ein ganzes Slayer-Album aufnehmen – ohne dass man in »Hell Awaits« eine schöne Message für die Proletarier aller Länder hineinzugeheimnissen versuchte. Das hätte wohl auch einen Bodo Freudl überfordert.
Aber seit 1984 waren die Dämme sowieso gebrochen, da wurden Raven, Manowar, Metallica, Venom, etwas später dann auch Slayer, Running Wild, Grave Digger, Kreator, Destruction, Celtic Frost, Onslaught, Anthrax und sogar übel beleumdete, ganz sicher nicht die Staatsdoktrin stützende Bands wie Carnivore oder S.O.D. einfach so weggesendet. Offensichtlich waren die Zensoren schlicht überfordert von deren semantisch uneindeutigen, nicht auf eine griffige Formel zu bringenden Lyrics, oder es war ihnen nicht wichtig genug.
Nicht mal vor Sodoms oft inkriminiertem Song »Bombenhagel« schreckten die Rundfunkmoderatoren zurück – offenbar im vollen Bewusstsein, was sie da taten. Der prononcierte Nonkonformismus des Heavy Metal bot genügend Anknüpfungspunkte und konnte so leicht mit subversiven Konnotationen aufgeladen werden. Uwe Breitenborn jedenfalls, dessen Aufsatz »Bombenhagel und Eiserner Vorhang« ich hier auswerte,‹ Uwe Breitenborn: Bombenhagel und Eiserner Vorhang. Heavy-Metal-Subkultur im Staatsradio. In: Sascha Trültzsch, Thomas Wilke (Hgg.): Heißer Sommer – Coole Beats. Zur populären Musik und ihren medialen Repräsentationen in der DDR. Frankfurt/M. 2010, S.105ff.› ist sich sicher, dass er in diesem Sinne verstanden wurde.
Ein Titel wie Running Wilds »Victim Of States Power« mit den Zeilen:
How long do you want to be the victim of state’s power?
Stand up and struggle for freedom
And be Lucifer’s friend
besaß »für Hörer in der DDR« ganz offensichtlich »eine andere Bedeutung als für Hörer in der Bundesrepublik«. Er musste in einem als repressiv erlebten gesellschaftlichen Kontext wohl notwendig als staatsfeindliche Provokation gehört werden. Insofern war Heavy Metal in der DDR wenigstens partiell wirklich einmal das, was er oft genug eben nur zu sein vorgibt: ein Medium des Widerstands.