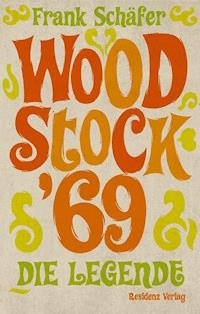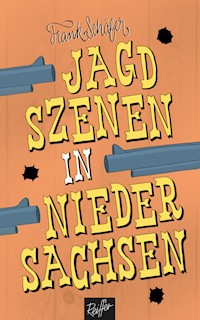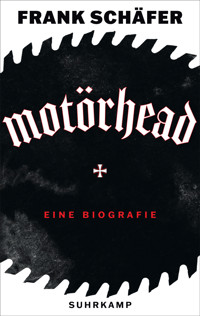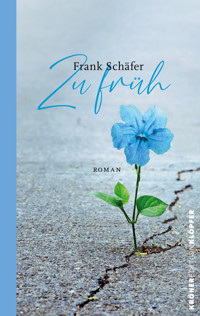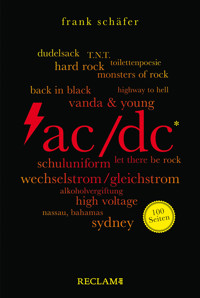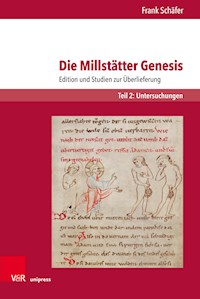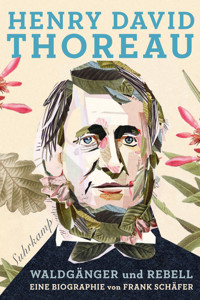5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Andreas Reiffer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: edition kopfkiosk
- Sprache: Deutsch
Ein Buch voll toxischer Gitarrensoli. Ein Buch über die Musik von vorgestern. Ein Buch über Proleten, die sich die Produktionsmittel aneignen. Voller Mythen und Legenden. Und nicht zuletzt ein Buch, das beweist: Alle Wege führen zum Heavy Metal. Man muss es nur wollen. Frank Schäfer berichtet über dessen Wegbereiter: Robert Johnson, Leo Fender, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Rory Gallagher, Led Zeppelin, Hawkwind, Malcolm Young, Uli Jon Roth, Hannes Bauer, Judas Priest und viele andere mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Neuerfindung des Rock’n’Roll
Essays von Frank Schäfer
1. Auflage 2020 © Verlag Andreas Reiffer | edition kopfkiosk | Bd. 02
ISBN 978-3-945715-93-1, identisch mit der Printausgabe
Verlag Andreas Reiffer, Hauptstr. 16 b, D-38527 Meine, www.verlag-reiffer.de
Sweeter than the heavens and the fate means stumble
But it’s saturday night when heavy rock was born
Phil Lynott
Rory Gallagher
Intro
Wer sich als Musikschreiber verdingt, macht irgendwann – etwa nach zwei Wochen – die Erfahrung, dass die langen Riemen und großen Geschichten nicht gedruckt werden, weil da einer besonders inspiriert ist oder viel weiß, sondern weil die Redaktion einem Thema besondere Relevanz und damit mehr Platz einräumt. Es gibt also Anlässe, und die werden in der Regel von der Musikindustrie gesetzt. Ein neues Album, ein Boxset, ein Jubiläum, das die Backlist noch einmal ins Bewusstsein rufen soll.
Idealisten müssen jetzt sehr stark sein: In einem kapitalistischen System kümmert sich der Kulturjournalist nicht in erster Linie um das Gute, Wahre und Schöne, sondern um Produkte. Man kann das bedauern und lieber Gedichte schreiben – oder man kann versuchen, diesen Anlass vergessen zu machen. Ob mir das in der folgenden Auswahl geglückt ist, müssen andere entscheiden, als Ideal und Anspruch jedenfalls steht das hier über dem Eingang zum Lesesaal.
Obwohl diese Kompilation also Gelegenheitstexte versammelt, im Musikjournalismus gibt es gar keine anderen, hört man vielleicht doch so etwas wie einen Basso continuo, wie wir Klassikfreunde sagen, der diesen Sermon irgendwie zusammenhält. Nicht dass es beabsichtigt gewesen wäre, das ist mir selbst erst beim Zusammenstellen der Essays aufgegangen.
Es gibt ja bekanntlich einen Kulminationspunkt der Musikgeschichte, auf den alles zuläuft – das Jahr 1979, als der Heavy Metal sein fettzöpfiges, splissgeschädigtes, milchbärtiges, eiterpickelgebeuteltes Haupt erhebt. Diese Sammlung trägt dem Umstand Rechnung, dass die ganze populäre Musikhistorie eigentlich nur passiert ist, damit es irgendwann Metal gibt. Wenn also im Folgenden die allmähliche Elektrifizierung der Gitarre, die sukzessive Verweltlichung von ursprünglich religiösem Liedgut oder die Erfindung des Geschäftsmodells Open-Air-Festival zur Debatte steht, kommt am Ende immer irgendwie Metal dabei heraus. Das kann auch gar nicht anders sein, denn Heavy Metal ist das Genre, das alle anderen aufhebt.
Kleine Kulturgeschichte des Gitarrenhelden
Als der Gitarrenheld auf der Bildfläche erschien, war offenbar niemand so recht darauf vorbereitet. »Hendrix schloss die Gitarre an und ließ sie gleich ganz wahnsinnig losheulen und pfeifen, wir dachten erst, seine Anlage ist kaputt. Aber dann legten Schlagzeug und Bass los, und Hendrix würgte seine Gitarre, biss rein und spielte mit der Zunge und auf dem Rücken und unterm Knie, und er haute sie gegen den Marshall-Turm, das klang so, als explodierte gerade ein Elektrizitätswerk.« Der Besucher des Star-Club-Auftritts im März 1967 hat Mühe, seine Irritation in Worte zu fassen. »Dazu verzog er ständig sein Gesicht, das war ein voller Film, der da ablief, also auf dem Gesicht konnte man richtig die Töne sehen, die er erzeugte. Dazu dann noch seine heisere Stimme, die wilden Haare und die kaputte Uniformjacke, die er am ersten Abend trug – das hat uns alle völlig fertiggemacht. Dass da noch andere Leute mit auf der Bühne standen, haben wir gar nicht mitgekriegt. Wir haben immer nur diesen Kerl gesehen, der da Sachen machte, die so total wahnsinnig waren, dass wir gar nicht begreifen konnten, dass es so was gibt. Zum Schluss hat er dann ›Wild Thing‹ gespielt, über zehn Minuten lang, in einer Mörderversion. Als er fertig war, waren wir auch alle fertig. Keiner ist gegangen, alle blieben da, um ihn um Mitternacht noch mal zu sehen.« Eine akustische Epiphanie. Was Gitarrenhelden damals bei den Zeitgenossen auslösten, lässt sich heute kaum mehr wirklich nachempfinden.
Im Blues gab es den Saitenindividualisten und Teilzeitsolisten schon immer. Robert Johnson, Leadbelly, Blind Lemmon Jefferson, Big Bill Broonzy und all die anderen begleiteten sich selbst an der Gitarre, und die stand nach alter Call-and-Response-Manier im Dialog mit der Stimme. Die Bluesmen streuten kleine rhythmische Variationen, Bonsai-Soli, Mini-Licks in die Gesangspausen ein, um den Vortrag auf Spannung zu halten. Bendings, Slides, Blue Notes, Fingervibrato, an den Tricks und Kniffen und nicht zuletzt an ihrem originären Ton sollte man sie erkennen. Hier war fast alles schon da und harrte nur noch der Weiterentwicklung, Ausformulierung und nicht zuletzt – Elektrifizierung. Die kam auch bald. Elmore James, einer der Gründungsväter des Chicago Blues, schraubte einen Tonabnehmer auf seine Akustikgitarre, jagte sie über einen Amp und übersetzte so Robert Johnsons Klassiker »Dust My Broom« in ein neues Zeitalter.
Im geläufigen Swing- und Jazz-Big-Band-Kontext Anfang des 20. Jahrhunderts nahm die Gitarre nur die Rolle eines Begleitinstruments ein. Hart angeschlagene Rhythmusakkorde drangen gerade noch durch, aber Single-Note-Soli waren einfach zu leise. Das Schlagzeug butterte sie unter und die Brass-Section blies sie erst recht weg. Man brauchte also Verstärkung, denn Gitarristen sind nun mal Egomanen, sie wollen sich solistisch in Szene setzen, sonst wären sie ja Bassisten geworden. Die Jazzgitarren-Pioniere Lonnie Johnson und Eddie Lang wiesen schon mal die Richtung und Charlie Christian eröffnete daraufhin der Gitarre als führendes Melodieinstrument ganz neue Welten. Die 1935 in Serie gehende Gibson ES-150, eine Hollow-Body-Gitarre mit eingebautem Pickup, machte es möglich.
Bereits in den frühen Zwanzigern hatte Gibsons Elektroakustiker Lloyd Loar einen Tonabnehmer entwickelt, der allerdings nicht so recht für den Bühneneinsatz taugte und von seinen eher traditionell denkenden Arbeitgebern skeptisch beäugt wurde. Man setzte lieber auf einen größeren und also volltönenenderen Klangkörper.
Etwas später, 1931, ging der Schweizer Emigrant Adolph Rickenbacher, der mit seiner Firma Rickenbacker in der Folge vor allem Bassisten glücklich machen sollte, mit der »Frying Pan« auf den Markt, einer elektrischen Lap-Steel-Gitarre im edlen Bratpfannendesign.
Jetzt erkannte Gibson die Zeichen der Zeit und entwickelte, gefolgt von Gretsch etc., Pickup-bestückte Hollow-Body-Gitarren, die allesamt nur ein Problem hatten: die ungewollte Mikrofonie, das plombenziehende Pfeifen bei höheren Laustärken. Also immer dann, wenn es gerade mal Spaß zu machen begann.
Der Jazzgitarrist und große Bastler Les Paul sägte deshalb 1941 in der Epiphone-Werkstatt eine akustische Gitarre in der Mitte durch und setzte einen massiven Holzblock dazwischen. Dieses Monstrum klang sogar, vor allem aber pfiff »the log« nicht mehr aus dem letzten Loch. Paul ging mit seiner Entwicklung zu Gibson, aber man blieb einmal mehr abwartend.
The Frying Pan
Dabei lag der nächste Schritt nahe. Leo Fender und Co. taten ihn. Fender war ein innovativer Geist, der konsequent auf Elektrifizierung setzte. Er hatte bereits Amps entwickelt und einen Pickup, den legendären Single-Coil-Tonabnehmer, der für Begeisterung unter Musikern sorgte. Jetzt kümmerte er sich um den Rest. Als erste Amtshandlung ließ er vollständig die Luft aus dem Bauch der Gitarre. Mit dem Modell »Broadcaster« ging 1948 die erste echte Solid-Body-Gitarre in Produktion; zwei Jahre später hieß sie »Telecaster« – und so heißt sie bekanntlich auch noch heute. Die Mutter aller Stromgitarren, der Ur-Meter der bretterbauenden Industrie.
Gibson zog 1952 nach. Man hatte Les Paul schließlich doch erhört und ließ das mit ihm weiterentwickelte und folglich auch nach ihm benannte Modell in Serie fertigen. Zwar ebenfalls ohne Resonanzraum, aber mit einem etwas dickeren, noch an die traditionelle Akustik-Gitarrenform erinnernden Korpus. Der zweite Klassiker. Der dritte folgte 1954. Fender legte eine Weiterentwicklung der Tele auf. Die »Stratocaster« ist ergonomisch günstiger geformt, mit einem zusätzlichen oberen Cutaway, der eine bessere Bespielbarkeit in den höheren Lagen gewährleistet. Drei Single Coils sorgen für ein breiteres Klangspektrum und mit dem schräggestellten Steg-Pickup sieht sie auch noch verdammt cool aus. Ein Geniestreich des Produktdesigns.
Mit diesem Gitarren-Triumvirat gab man den bereits lauernden Krawallbrüdern endlich professionelle Instrumente an die Hand, die sich ohne große Probleme amplifizieren ließen und folglich die Gitarre zum ebenbürtigen Soloinstrument in der Band machten. Die Entwicklung von Verstärkern, die den veränderten Ansprüchen genügten, lief parallel. Fender, Rickenbacker, Gibson boten die entsprechenden All-in-one-Pakete an. Aber bald darauf schon spezialisierte sich der Markt, eigene Verstärkerfirmen wurden gegründet. Zunächst Vox und dann Marshall, dessen Hundert-Watt-Türme, die sich parallel schalten und zu formidablen Schrankwänden kombinieren ließen, überhaupt erst die Power hatten, auch große Hallen mit dem nötigen Schalldruck zu versorgen.
Nachdem die Büchse der Pandorra erst mal geöffnet und der böse elektrische Sound entwichen war, gab es keine Hemmungen mehr, ihn weiter zu verfremden. Link Wray perforierte die Lautsprecher mit der Bleistiftspitze, um diese hübsch schnurrende Verzerrung hinzubekommen, Dave Davies von den Kinks rückte ihnen mit der Rasierklinge zu Leibe und Ritchie Blackmore, so heißt es, latschte ganz profan ein Loch hinein. All das war eigentlich nicht mehr nötig, als der singuläre Audio-Elektronik-Tüftler Roger Mayer in den frühen Sechzigern die ersten Tretminen herzustellen begann, Verzerrer-Fußpedale zunächst, die den Kompressionsgrad erhöhten und den Sound so herrlich vermatschten. Mit einer Fuzz Box bekam die Gitarre ein Sustain bis zum jüngsten Tag und kippte bei entsprechender Haltung zum Amp und Lautstärke auch noch problemlos in ein harmonisches Feedback um, das nicht von dieser Welt zu sein schien. Andere Modulationseffekte wie Phaser, Flanger, Chorus, Octaver etc. kamen hinzu. Der Sound selbst wurde zu einer relevanten Größe.
Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Mike Bloomfield etc., sie alle nutzten die elektroakustischen Entwicklungen der Zeit, aber keiner integrierte sie so organisch in sein Spiel wie Jimi Hendrix. Hendrix stellte der klassischen Note den Sound, das bloße Geräusch, gleichberechtigt an die Seite. Seine diversen sonischen Eskapaden und akustischen Exaltationen, nicht zuletzt im Studo mit dem Daniel Düsentrieb Eddie Kramer am Pult, haben diesen Zweck: die klassische tonale Struktur zu erweitern. Wie suggestiv das zumindest mal war, zeigten die Reaktionen auf seine effekthascherische Dekonstruktion von »Star-Spangled Banner«. »Das war der mitreißendste Moment in Woodstock«, schwärmte der Musikkritiker der »New York Post«, Al Aronowitz, »und es war wahrscheinlich der großartigste Augenblick der 60er Jahre.« Geschaffen von einem Gitarristen.
Die Solid-Bodies emanzipierten den Gitarristen musikalisch, aber eben auch als Bühnenpersönlichkeit. Sie waren robuster und vor allem weitaus handlicher als die voluminösen, bauchigen Vollakustik-Gitarren. Der Bluesman und Big-Band-Gitarrist saß auf der Bühne, das Instrument auf den Knien. Mit einer Tele vorm Bauch konnte man zum Solo nach vorne an den Bühnenrand tänzeln – und bald auch noch ganz andere Sachen machen. Leo Fender ging eigens eine Kooperation mit dem Autolackhersteller DuPont ein, um an die schicken, modischen Anstriche zu kommen. Kurzum, die Stromgitarre erweiterte den Bewegungsradius des Spielers und entgrenzte sein Potential als Showman.
Bühnencharismatiker wie T-Bone Walker und Chuck Berry hatten gezeigt, wie man mit einer Gitarre hübsch herumfuchteln konnte, über dem Kopf, hinterm Rücken, im Entengang, die Nachgeborenen setzten noch eins drauf, forcierten die Bühnenaction, und die abgeklärte, alles weglächelnde Souveränität des Entertainers wich wütender Zerstörungslust. Auf einmal machten die Musiker Ernst.
Zuallererst vermutlich Pete Townshend bei einem Who-Gig in der Londoner Railway Tavern, am Bahnhof Harrow & Wealdstone, im September 1964. Mitten im Set zerbrach seine Rickenbacker. Vielleicht eher unabsichtlich. Vielleicht aber auch, wie er später gern behauptete, weil er hier jene »auto-destructive art« auf die Bühne bringen wollte, die sein Lehrer an der Ealing School of Art, Gustav Metzger, als Gegenentwurf zur restaurativen Nachkriegskunst theoretisch entwickelt hatte. Townshend führte einen Veitstanz auf, der das Publikum förmlich hinriss und ihn davon überzeugte, eine Masche daraus zu machen.
Michelangelo Antonioni brachte den Spaß zwei Jahre später auf die Leinwand. In »Blow Up« lässt er seinen Helden mehr zufällig in ein Yardbirds-Konzert taumeln (für The Who reichte das Budget nicht). Das Publikum ist teilnahmslos, geriert sich wie eine Ansammlung von Schaufensterpuppen, aber dann muckt Jeff Becks Verstärker. Beck wird sauer, zerschlägt seine Gitarre, tritt fluchend auf ihr herum und schmeißt die Einzelteile in die Menge, die jetzt doch noch zu wilder Begeisterung fähig ist. Hier hat der Gitarrist dem Sänger bereits die Show gestohlen.
Auch Jimi Hendrix zerlegte allenthalben Gitarren. Er wollte seinem Image als »Wild Man Of Borneo« gerecht werden, und das gelang ihm ganz gut. Für das Monterey Pop Festival im Juni 1967 durfte es dann aber schon etwas mehr sein. Es waren 90.000 Zuschauer vor Ort, ABC-TV berichtete, und D.A. Pennebaker drehte einen Konzertfilm. Hendrix wusste, was auf dem Spiel stand, und er wusste auch, dass The Who kurz vor ihm spielten. Erwartungsgemäß schlachtete Townshend am Ende von »My Generation« eine Strat. Hendrix war präpariert, in einer Art heidnischem Opferritual ließ er bei »Wild Thing« seine in Flammen aufgehen. »Jimi Hendrix, baby believe me, set the world on fire, yeah«, wird Eric Burdon nur kurze Zeit später in dem Song »Monterey« singen, und wenn man Pennebakers Film sieht, dann glaubt man das wirklich. Eine Zuschauerin bricht in Tränen aus. Die Menge kann es kaum fassen.
Spätestens seit der zweiten Hälfte der Sechziger war der Sensationswert des Gitarristen dem des Sängers mindestens ebenbürtig. Nicht zuletzt visuell. Eine naheliegende ikonographische Folge war der Schwarz/Weiß-Antagonismus des Frontpärchens, oft unterstützt durch ein entsprechendes Bühnenoutfit. Während Roger Daltrey, Robert Plant, Ozzy Osbourne, David Coverdale oder David Lee Roth den mehr oder weniger blonden, blütenweißen Engel gaben, markierten Pete Townshend, Jimmy Page, Tony Iommi, Ritchie Blackmore oder Eddie Van Halen den dunklen, verruchten Sechs-Saiten-Diabolo. Und während der eine Teil des Publikums sich verliebte, wurde der andere eins mit dem Idol beim Vollzug der Luftgitarre.
Dass der Rockgitarrist seit der zweiten Hälfte der Sechziger mit soviel Aufmerksamkeit rechnen konnte, lag auch an seinen spieltechnischen Weiterentwicklungen. Infolge des Blues Booms adaptierten die jungen Wilden all die Tricks und Kniffe, mit denen die schwarzen Entertainer ihre Show würzten. Muddy Waters, Elmore James oder »the three Kings«, Freddie, Albert und BB King, befruchteten die Spielweisen der Rockgitarristen ungemein. Sie gaben ihnen einen unbedingten Unterhaltungsauftrag mit auf den Weg und darüber hinaus das Ideal eines distinkten, jederzeit wiederkennbaren Personalstils. Nicht nur der Sänger, auch der Gitarrist entwickelte seine ureigene Stimme und sorgte damit für die Unverwechselbarkeit einer Band.
Muddy Waters