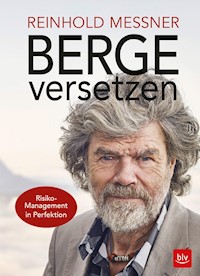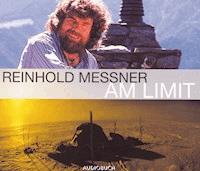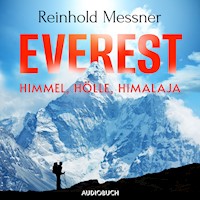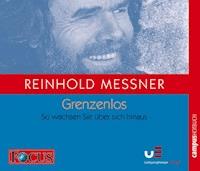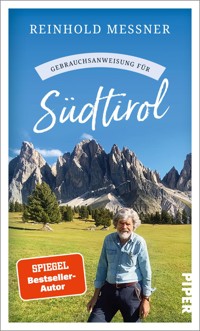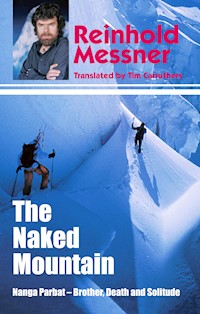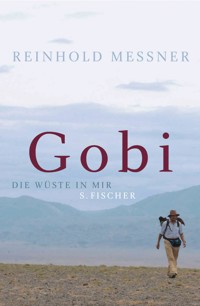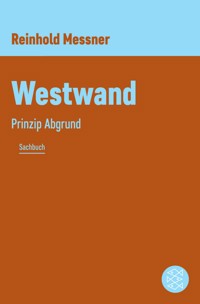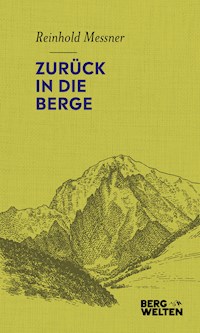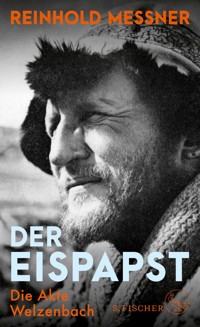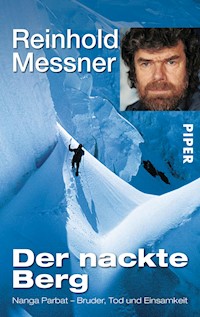13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In keinem Buch schreibt Reinhold Messner offener über sich selbst, in keinem zieht er so umfassend Bilanz. Unter dem Motto »Ich bin, was ich tue« unternimmt er den Versuch, der Essenz seines Lebens auf die Spur zu kommen, und scheut dabei nicht davor zurück, eigene Schwächen offen zu legen. Messner erzählt von seinem ersten selbst verdienten Geld als Bergführer in den Dolomiten, vom Alltag eines Grenzgängers mit Familie, von seinem lebenslangen Einsatz für die Natur. Und von seinen prägendsten Erlebnissen als Abenteurer an den Achttausendern und in den großen Sand- und Eiswüsten der Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.malik.de
Für Sabine, die eine neue Hierarchie in unserer Familie aufstellte: mit Kindern
© Piper Verlag GmbH, München 1994
Covergestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, München
Covermotiv: Peter Rigaud/Laif
Fotos Innenteil: Archiv Reinhold Messner (Ausnahmen beim Foto)
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
Unser Tun als Widerspiegelung der Seele
1 Vom Klettern im Fels
Cima Bella Madonna, direkte Nordwand
Kein Totentanz an der Senkrechten
2 Vom Sammeln als Trieb
Der tibetische Sagenheld Gesar
Ling ist überall
3 Vom Gestalten meiner Heimat
Halbruine Juval
Meine Fluchtburg
4 Vom Niederschreiben einer Idee
Der Bergfilm als Erzählform
Schrei aus Stein
5 Vom Umherziehen in der Einsamkeit
Kailash und Manasarovar-See
Im Kreise gehen
6 Vom Zustand des Bergbauern
Selbstversorgerdasein in Südtirol
Zwischen Bleiben und Gehen
7 Vom Jagen in der Erinnerung
Ein Blauschaf in Bhutan
Ein Gejagter als Jäger
8 Vom Erzählen auf der Bühne
Projizierte Abenteuer
Als Stellvertreter in der Arena von Verona
9 Vom Streiten für die Wildnis
Als Opfer und Täter vor der »Versteckten Kamera«
Der Kiosk am Matterhorn
10 Vom Leben mit Familie
Zwischen Meran und Nepal
Zu Hause bei den Kindern
11 Vom Gehen übers Eis
Grönland-Längsdiagonale
Der lange Weg nach Thule
12 Vom Durchqueren der Wüste
Takla Makan
Allein in der Wüste des Todes
13 Vom Steigen im Gebirge
Eine Höllenleiter vor der Haustür
Die Spitze des Berges
Wenn wir darüber nachdenken,wissen wir nicht, wer wir sind. Undwenn wir uns darstellen, zeichnen wirWunschbilder. Wir setzen unsMasken auf.
Seine Seele zeigt der Menschnur in seinem Tun. Ich erzähle also,was ich tue, damit die anderenbegreifen können, wer ich bin.
Unser Tun als Widerspiegelung der Seele
Im holzgetäfelten Süderker auf Burg Juval, wo der Blick 500 Meter tief ins Etschtal abfällt und die Berge dahinter die Welt begrenzen, saßen mir in den vergangenen zehn Jahren eine Reihe neugieriger Menschen gegenüber, die mit ihren Fragen alle dasselbe suchten: einen Blick in meine Seele.
Sie alle bekamen Antworten, und ich verriet ihnen vieles, doch meine Seele verriet ich ihnen nicht.
»Ein Grenzgänger wollen Sie also sein, ein Pfadfinder, der die kalten, dunklen, einsamen Winkel seiner Seele erkundet.«
»Ja, ich bezeichne mich als Grenzgänger. Das ist ein Mensch, der am Rande des gerade noch Machbaren in der wilden Natur unterwegs ist. Mit eigenen Kräften. Ich suche das Extreme, bemühe mich jedoch, nicht umzukommen. Mein Tun wäre kein Grenzgang, wenn das Todesrisiko von vornherein ausgeschlossen wäre.«
»Sie setzen Ihr Leben aufs Spiel, um es zu retten?«
»Das ist kein Widerspruch. Für mich ist dieser Zusammenhang logisch. Ja, ich gehe zum Nordpol, weil es gefährlich ist, und nicht, obwohl es gefährlich ist. Aber ich will dabei nicht umkommen. Durchkommen heißt meine Kunst.«
»Können Sie mir erzählen, wann Ihre Neigung zu solchen eher wenig verbreiteten Künsten entstanden ist?«
»Ich kann es nicht genau aufschlüsseln und will auch nicht mein eigener Psychotherapeut sein. Ich vermute aber, dass es unter anderem mit meiner frühesten Jugend zu tun hat.
Ich bin in einem engen Alpeneinschnitt aufgewachsen, ganz unten im Tal. Ich wollte aus dieser Enge heraus, wollte die Welt von oben sehen, wollte über den Rand des Tales hinausschauen. Als ich mit fünf Jahren meinen ersten Dreitausender bestieg, natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Vater, bekam ich hinterher für meine Ausdauer und Geschicklichkeit viel Lob. Bereits in der Pubertät zeigte ich beim Klettern mehr Geschick als auf jedem anderen Gebiet, sei es in der Schule, beim Sport oder bei den Mädchen. Ein weiteres Moment der Spannung bestand natürlich darin, dass wir Kinder selbstständig, ohne Begleitung von Erwachsenen, zum Bergsteigen gingen. Ich habe mich rasch zum fanatischen Kletterer entwickelt. Damit einher ging eine Abneigung gegen Moralapostel und gegen Autorität in jeglicher Form. Die althergebrachte Wahrheit, die Doktrin der Lehrer, das Gehabe der Spießbürger, das Urteil der Masse war mir zuwider. Später kam Ehrgeiz dazu: Ich wollte die extremen Leistungen der anderen übertreffen, zuerst im Alpen-Klettern, dann im Himalaja-Bergsteigen und zuletzt im Eiswandern.«
»Sie muten damit Ihrer Familie eine ganze Menge zu! Ist sie nicht ständig in einer Art Warte- und Abschieds- und Wiederkehrhaltung?«
»Sabine, die Frau, mit der ich seit Jahren lebe, hat mich kennengelernt, als ich ein Grenzgänger war. Sie hat sich trotzdem mit mir zusammengetan. Und sie weiß – das gilt auch für meine Freunde und Verwandten –, dass ich ein vorsichtiger Mensch bin. Trotzdem, es kommen dann und wann Ängste auf. Bei Sabine, bei mir. Nicht jedoch bei den Kindern, denn sie sind noch zu klein. Meine Gefahren sind sichtbar, hörbar, fühlbar. Sie füllen die Welt um mich herum und in mir aus – weil unter mir ein Abgrund klafft oder weil ein Schneesturm tobt oder weil ich am Rande meiner physischen Kräfte bin. Wer mich kennt, weiß, dass das, was ich mache, gefährlich ist. Gefahren aber bedrohen jeden Einzelnen von uns. Sie gehören zum Leben wie der Tod. Viele Menschen sind latent durch Krebs oder Herzinfarkt gefährdet. Die meisten aber sind sich dieser Gefahr nicht bewusst, weil sie noch keine konkrete Gestalt angenommen hat, noch nicht manifest geworden ist, die Auswirkungen noch nicht spürbar sind. Und die globalen Gefahren, die uns alle bedrohen, spüren wir noch weniger. Die globale Gefahr, dass die Menschheit in ihrer Gesamtheit umkommt, ist ebenso groß wie die Gefahr, dass ein Einzelner stirbt. Ich weiß, dass ich früher oder später sterbe. Dass ich aber bei meiner nächsten Expedition umkomme, die ich im Frühling 1995 zum Nordpol unternehmen werde, halte ich für unwahrscheinlich. Ich werde alles tun, um den Gefahren auszuweichen. Wenn ich merke, es wird zu gefährlich, gebe ich auf. Ich habe viele Grenzgänge abgebrochen, kann mir das Scheitern ebenso wie die Kritik, ein störrischer Einzelgänger zu sein, leisten. Mit der Einstellung, Scheitern kommt nicht infrage, weil es meinem Image schadet, würde ich den Grenzgänger zum Todeskandidaten machen. Stolz und unnachgiebig bin ich nur den Menschen gegenüber, der Natur ordne ich mich unter. Ich bin einem körperlichen Veränderungsprozess unterworfen, werde schwächer, unbeweglicher, aber ich hoffe, dass ich mir die Fähigkeit erhalte, zu wissen, wie weit ich jeweils gehen kann. In diesem Punkt bin ich rechtschaffen bis zur Pedanterie.«
»Sie wollen überleben, sagen Sie. Davon gehe ich auch aus. Und trotzdem behaupte ich, dass hinter diesem Grenzgängertum eine geheime Todessehnsucht steckt.«
»Ich behaupte das Gegenteil, kann es aber nicht beweisen. Todessehnsucht wird von Außenstehenden sehr gern in das Tun des Grenzgängers hineininterpretiert. Aber gerade wenn jemand immer wieder an die äußerste Grenze geht, obwohl er Tragödien zu verkraften hat – ein Bruder von mir ist an einem Achttausender ums Leben gekommen, ein anderer in den Dolomiten tödlich abgestürzt, Freunde sind erfroren, an Erschöpfung gestorben –, lebt er doch Hunger nach Leben vor. Wie oft habe ich mit dem Rücken zur Wand gestanden! Wie oft habe ich keinen Ausweg mehr gesehen! Umzukommen wäre das Leichteste gewesen. Ich habe mich dagegen gewehrt. Also war es nicht Todessehnsucht, die mich antrieb. Mein Spiel heißt Durchkommen. Nicht Umkommen. Jedes Spiel hat Regeln, und die Regeln beim Grenzgang mache ich mir selber. Meine erste Regel dabei heißt: lebend zurückkommen. Wenn ich mich umbringen wollte, müsste ich nicht monatelang bei minus 40 Grad durch Grönland laufen oder unter höllischen Anstrengungen auf den Mount Everest steigen. Ich gehe weiter und behaupte, dass potenzielle Selbstmörder zum Leben zurückfänden, wenn sie sich derartigen Anstrengungen und Gefahren bei ihren Selbstmordversuchen aussetzten. Gefahr weckt Energie und Lebensfreude, wenn wir ihr Schritt für Schritt, in kleinen Dosierungen begegnen. In der Wildnis bemühen wir uns, trotz häufiger lebensgefährlicher Augenblicke nicht umzukommen. Kurz: Wenn ich mich umbringen wollte, dann nicht in der Antarktis, nicht am Nordpol und nicht am Mount Everest. Jetzt und hier wäre es einfacher.«
»Sie sind fünfzig Jahre alt. Wann beginnt für Reinhold Messner der Ruhestand?«
»Mit dem Tod. ›Unsere Natur ist in Bewegung, völlige Ruhe ist der Tod‹, sagt Pascal. Also vorerst kein Ruhestand. Aber ich beginne mich damit auseinanderzusetzen, dass ich all das, was ich jetzt tue, früher oder später nicht mehr tun kann. Zweimal schon habe ich mich von einer Sparte des Grenzgangs in eine völlig andere verändert. Mit fünfundzwanzig bin ich vom Felskletterer zum Höhenbergsteiger umgestiegen. Beim Überleben in sauerstoffarmer Luft brauchte ich weniger Schnellkraft, dafür mehr Ausdauer. Mit fünfundvierzig habe ich nochmals den Beruf gewechselt und als Fußgänger einen Schlitten durch die Antarktis gezogen. Für dieses Unternehmen waren meine psychischen Kräfte in weitaus größerem Maße gefordert als meine physischen.«
»Einen Beruf nennen Sie das?«
»Was sonst. Gehen ist das, was ich am besten kann. Nur darin bin ich kein Dilettant. Gehen hat mit Lust, Wohlbefinden, Erkennen zu tun. Denn die Welt, durch die ich gehe, ist eine andere als die Welt, von der wir reden. Das gilt auch für unsere Innenwelt. Mit 45 Jahren verfügte ich über jenes Maß an Ausgeglichenheit, dass ich mich mir selbst auf einer Laufstrecke von 2800 Kilometern 90 Tage lang ausliefern konnte. Früher wäre ich vor so viel Weite und Leere an Angst erstickt.«
»Und was wollen Sie mit sechzig tun?«
»Ich werde noch einmal umsteigen. Nach der Vertikalen und der Horizontalen bleibt mir nur noch eine geistige Dimension. Dabei kann ich sogar sitzen. Und schlimmstenfalls verrückt werden.«
»Sie vertrauen letztendlich nur auf Ihre eigenen Kräfte. Sind Sie ganz im Innern ein Einzelgänger?«
Wer ich bin, glaubten viele zu wissen. Was ich aber denke und fühle, interessierte sie mehr. Mehr als das, was ich tue.
»Ich bin nicht immer allein unterwegs, und ich bin kein Einzelgänger. Ja, ich habe Alleingänge gemacht, verspüre einen starken Wunsch nach Autarkie und Autonomie, und gleichzeitig brauche ich Freunde. Vertrauensbeweise rühren mich zu Tränen, Vertrauensbrüche erschüttern mich nachhaltig.«
»Die Partner als Versuchskaninchen?«
»Mich interessiert, wie mein Gegenüber wirklich ist. Jede Maske fällt, wenn wir in einer senkrechten Felswand klettern oder der Alltag am Ende der Welt nur noch vom Kampf ums Überleben geprägt ist.«
»Was verbirgt sich hinter Ihrer Maske?«
»Zum Beispiel Kopflosigkeit. Selbstkontrolle musste ich mühsam lernen. Wie oft habe ich mich dabei ertappt, dass ich mich in die Flucht nach vorne rettete, ohne Sinn und Verstand weiterkletterte, weil ich die Übersicht verloren hatte, keinen Ausweg mehr sah. Meine Ausstrahlung als ausgeglichene, souveräne Persönlichkeit steht auf den tönernen Füßen meines Wunschdenkgebäudes.
Auch bin ich ein ungeduldiger Mensch, und ich habe große Probleme, die Leistung anderer anzuerkennen. Ich kann motivieren, aber kritisieren kann ich besser.«
»Haben Sie noch Freunde?«
»Ja. Einen guten Freund kann ich nicht durch Kritik oder kopfloses Handeln verlieren. Sonst ist er kein Freund. Einen Freund verliere ich, wenn ich keine Zeit für ihn habe, wenn ich unsere Freundschaft aufgebe. Und wenn er keine Zeit mehr für mich hat, hat er unsere Freundschaft gekündigt. Fehlverhalten gibt es in einer Freundschaft nicht. Das Wesen von Freundschaft ist das Annehmen eines anderen Menschen mit all seinen Vorzügen und Mängeln. Wir alle haben positive und negative Seiten. Sie bilden eine Einheit. Und Freundschaften bedeuten für mich, dass ich die anderen als ganze Menschen, wie sie sich zeigen, wie sie sind, mit und ohne Maske, als die akzeptiere und respektiere, die sie sind. Ich habe wenige Freunde, ganz einfach deshalb, weil ich nur begrenzt Energie und Zeit für sie habe.«
»Oder weil Sie Kritik nicht vertragen?«
»Im Gegenteil, ich freue mich über die Kritik eines Freundes, über seine Anregungen. Ein Freund kann mich nicht beleidigen.«
»Müssen die Weggefährten auf Ihren extremen Touren Freunde sein?«
»Nein. Weggefährten sind Partner für eine bestimmte Zeitspanne oder eine bestimmte Tour. Die Seilschaft ist zuallererst eine Zweckgemeinschaft. Das Bild von der Seilschaft als Synonym für Kameradschaft oder Freundschaft ist ein dummes Klischee. Es kann sein, dass sich aus dem Zusammenspiel in schwierigen Situationen eine Freundschaft entwickelt. Aber es muss nicht notwendigerweise so sein. Ich weiß, dass viele die Gemeinschaft am Berg als Zweckgemeinschaft nicht wahrhaben wollen und ein vom Nazismus hochgehaltenes Ideal der Kameradschaft verherrlichen.«
»Ist es Ihre Zielstrebigkeit, die zu so vielen Erfolgen geführt hat?«
»Nein, die Identifikation mit dem jeweiligen Ziel. Und die Fähigkeit, Realutopien zu entwickeln. Ich lebe oft jahrelang mit einer Idee, die sich schließlich zur Realutopie auswächst. Dabei stauen sich Motivation, Energie und Ausdauer an. Der schwierigste Schritt ist das Umsetzen der Idee in die Tat. Das Handwerk ist Voraussetzung, die Identifikation mit dem Ziel Bedingung, das Umsetzen der Idee in die Tat erst der Auslöser für einen Grenzgang.«
»Und Disziplin?«
»Auch Disziplin ist wichtig. Die viel gescholtene und viel strapazierte Disziplin bedeutet, vor allem bei der Vorbereitung Sorgfalt walten zu lassen.«
»Wie geht es einem fünfzigjährigen Halbnomaden?«
»Ich jammere nicht. Meine psychischen Schäden auf die Kindheit abzuwälzen und die physischen auf das Alter nützt nichts. Ich habe damit zu leben. Ich bin ein erwachsener Mensch und bereit, meine Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Deshalb habe ich im Moment keine großen Probleme mit meinem Alter. Viele Dreißigjährige, die im Leben nie etwas Höheres als einen Barhocker bestiegen haben, sind – wenigstens was das Körperliche angeht – in schlechterer Verfassung.«
»Sie glauben also an sich. Glauben Sie auch an Gott, den Weltenschöpfer?«
»Ich glaube generell nicht, sondern akzeptiere nur das, was ich sehe. Der Natur als einer unendlich sich verändernden Kraft kommt eine göttliche Dimension zu. Einen Gott außerhalb dieses Kosmos postuliere ich nicht, schließe ihn aber auch nicht aus. Ich würde mein Leben, mein Denken und Fühlen nicht ändern, wenn es diesen Gott, der alles lenken und bestimmen soll, nachweislich gäbe. Mir reicht die Welt um mich herum, um in ihr Teil zu sein.«
»Und Religion als Ausweg, Andacht als Ventil für all die Gefühle dem Erhabenen gegenüber?«
»Sie werden sentimental? Trotzdem, Staunen, Respekt, Ehrfurcht kenne auch ich. In diesem Zusammenhang empfinde ich mein Tun – das Gehen, das Steigen, das Unterwegssein – als Andacht, als ein einziges Gebet. Nicht, indem ich irgendwelche Naturgötter anbete, sondern indem ich die sinnlich erfahrbare Wirklichkeit in mich aufnehme, aufsauge. Dabei wachsen mir Kraft und Lebensfreude zu.«
»Trotzdem sind Sie zum Zerstörer dieses Erhabenen geworden, zum Werbeträger für den Massentourismus, unfreiwillig vielleicht, aber Vorbild für viele, die in Europa, in Asien, in Tibet Berge stürmen.«
»Aus diesem Dilemma finde ich keinen Ausweg. Obwohl ich immer dorthin gehe, wo die anderen nicht sind, hat der Massentourismus den Mount Everest erreicht. Noch steigen weniger auf den höchsten Berg der Welt als aufs Matterhorn. Dennoch sind es zu viele. Die Umweltschäden dort sind sichtbar und riechbar.«
»Jeder hat das Recht, klaren Himmel, Stille und Weite zu erleben.«
»Ja, aber Ruhe, Erhabenheit, Harmonie sind Werte, die allesamt bei den fünf Milliarden Menschen eines voraussetzen: das Verständnis für diese Werte. Das Wesen von Ruhe ist Ruhe und nicht Unruhe. Als ich alleine am Mount Everest war, habe ich alle diese Werte dort gefunden.
Weil ich aber viele Menschen für diese Landschaften begeistert habe, trifft mich eine Mitschuld, wenn Erhabenheit und Stille auch im Himalaja verloren gehen.
Es ist völlig abwegig, wenn eine Menschenkarawane in die ›Arena der Einsamkeit‹ aufbricht. Weil sie damit zur ›Arena der Massen‹ wird. Durch die Multiplikation reduziert sich der Erlebnisgehalt, der Grenzgang wird pervertiert und in sein Gegenteil verkehrt. Ob in der Antarktis, in der Wüste Gobi, in der Sahara oder im Himalaja, mit dem Massentourismus werden die alten Götter vertrieben und die wilden Landschaften ihrer Ausstrahlung beraubt. Sie werden als Orte der Ruhe und Erhabenheit wertlos und in letzter Konsequenz überflüssig. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis sich der Trend umkehrt. So wie der Treibhauseffekt das Eintreten der nächsten Eiszeit beschleunigen kann.«
»Deshalb haben Sie eine alte Burg in Ihrer Südtiroler Heimat als Reueklause. Was bedeutet Heimat für Sie?«
»›Heimat‹ ist ein viel gebrauchter und viel missbrauchter Begriff. Für mich ist Heimat dort, wo meine Kinder sind.
Menschen, die ganz selbstverständlich da sind, wo sie sind. Kinder und alte Leute beispielsweise tragen das in sich, was ich ›Heimat‹ nenne. Dazu zählen vor allem die Nomaden, die außer diesem Selbstverständnis nichts haben.«
»Sie halten klugerweise die Balance zwischen Bleiben und Gehen. Ihre Expeditionen sind kostspielige Unternehmungen, und die Gelder kommen aus der Wirtschaft und aus dem Verkauf Ihrer Bücher. Sie sind also nicht nur Grenzgänger, Burgherr und Bergbauer, sondern auch Schriftsteller.«
»Erzähler und Sachbuchautor.«
»Ihre Bücher erschöpfen sich durchaus nicht in tagebuchartigen Erlebnisschilderungen. Historische Rückblicke, Ausblicke, Visionen gehören dazu. Können Sie sich vorstellen, das Schreiben in den Mittelpunkt Ihres Lebens zu stellen?«
»Ja. Ich möchte intensiver von den Motiven und Emotionen, die mein Tun bestimmen, erzählen, möchte endlich den Berg und die Wüste draußen als Entsprechung einer inneren Befindlichkeit darstellen lernen.«
»Dort, auf Ihrer Burg Juval, können Sie doch nicht schreiben! Die Landschaft draußen ist verführerisch; der Bauernhof ist kein Garten Eden, aber idyllisch, nur einen Steinwurf weit weg, und immer ist die Familie um Sie herum. Halten Sie sich an Stundenpläne, oder wie gehen Sie arbeitsökonomisch vor?«
»Zurzeit habe ich zwei Arbeitsmethoden. Ich trage Ideen, Notizen, Infos für ein Dutzend Bücher zusammen, die nie erscheinen müssen. Es gibt keine Verträge für diese Buchideen. Dieses Sammeln betreibe ich so lange, bis ich spüre, dass einer der Buchpläne reif ist. Mein Konzept bespreche ich dann mit einem Verleger bis in sämtliche Details: Seitenzahl, Preis, Anzahl der Abbildungen. Wir legen den Terminplan von der Titelgestaltung bis zum Erscheinungsdatum fest. Zuletzt wird der Vertrag gemacht. Nachdem diese Absprachen getroffen sind, setze ich mich ans Schreiben. Das geschieht meist unter Zeitdruck. Entweder schreibe ich mehrere Stunden am Tag diszipliniert von Hand, oder aber ich diktiere, lasse die Bänder abschreiben und überarbeite das Manuskript anschließend zwei- bis dreimal. Bei diesem Vorgang miste ich aus, stelle neu zusammen, ordne die Kapitel. So entsteht der Rhythmus des Buches.«
»Findet dieses Ordnen und Gestalten, Entwickeln und Erarbeiten nur in Ihrem Kopf statt, oder hat die Familie im Gespräch daran Anteil?«
»Ja und nein. Wenn ich daheim bin, bin ich in die Familie integriert. Wir leben gemeinsam hier. Ich komme nicht nur zum Schlafen heim, wie die meisten Familienväter. Oft bin ich wochenlang 24 Stunden am Tag in Juval. Dann bin ich wieder drei Monate lang weg. Ganz weg. Die Kinder erleben mich, wenn ich schreibe, und sie erleben mich, wenn ich die Schottischen Hochlandrinder auf der Weide suche. Auch die Gespräche beim gemeinsamen Frühstück oder Mittagessen bekommen sie mit. Ich kann und will meine Ideen nicht für mich behalten. Selbst das Aufbrechen zu einer Extremtour, wenn ich Skistöcke und Eispickel aus dem Expeditionskeller hole, erleben sie mit. Unmittelbar.
Dadurch werden mein Leben und mein Tun für sie selbstverständlich. Das heißt natürlich nicht, dass die Kinder mich immer gerne ziehen lassen.«
»Wie verhalten Sie sich vor dem Aufbruch zu einer Expedition?«
»Vor Grenzgängen konzentriere ich mich so stark auf das, was ich vorhabe, dass alles andere untergeht. In dieser Phase kann es vorkommen, dass ich die anderen gar nicht mehr wahrnehme. Weil ich im Geiste schon unterwegs bin oder meine Idee so verinnerlicht habe, dass für die Familie kein Platz und keine Zeit mehr bleibt. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, was recht ist und was unrecht. Notwendig ist mein Tun ganz sicher nicht. Ich erlaube mir einfach zu tun, was ich nicht lassen kann. Den Kindern zuliebe als braver Papa zu Hause zu sitzen brächte uns allen keine Freude. Wenn ich ab und zu etwas Verrücktes machen kann, haben meine Kinder vielleicht keinen vernünftigen, aber dafür einen ausgeglichenen und lebenslustigen Vater.«
»Sollen Ihre Kinder in Ihre Fußstapfen treten?«
»Ich werde es nicht fördern. Nicht nur, weil es gefährlich ist, sondern auch, weil meine Kinder nicht an mir gemessen werden sollen. Meine Kinder sollen sich entfalten, ihren Weg finden. Mein Weg war vielleicht für mich richtig, für meine Kinder wird es andere Wege geben. Es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt.«
Ich bin nicht der, der ich mit Worten und Gehabe zu sein vorgebe. Noch weniger bin ich der, der ich in den Vorstellungen der anderen als Reinhold Messner zu sein habe. Vielleicht bin ich erkennbar durch mein Tun. Wie unsere Sprache die Widerspiegelung unserer Welt ist, ist unser Tun die Widerspiegelung unserer Seele. Das behaupte ich. Einfach so.
Indem ich mein Tun beschreibe, offenbare ich meine Seele.
1 Vom Klettern im Fels
Cima Bella Madonna, direkte Nordwand
Am 15. Oktober 1967 durchkletterte ich mit meinem Bruder Günther die senkrechte, wenig gegliederte Wand links der berühmten »Schleierkante«, die – 1920 von Gunther Langes und Erwin Merlet erstbegangen – lange Zeit als die »schönste Klettertour der Dolomiten« galt.
Die direkte Nordwand-Route verläuft etwa 100 Meter links der »Schleierkante« und zeichnet sich wie diese durch griffigen, festen Fels aus. Die Kletterschwierigkeit in der 300 Meter hohen Nordwand wurde von uns um einen Grad höher eingestuft als die in der »Schleierkante«.
Eine senkrechte Felswand, wie die Nordwand der Cima della Madonna, ist eine aufgestellte Wüste. Eine Wüste ist ein hingestreuter Berg. In der Steilwand erhöht sich das Ausgesetztsein um ein Vielfaches.
Am Anfang bin ich um die Berge herumgelaufen. Zuerst in den Dolomiten, anschließend in den Westalpen, zuletzt im Himalaja. Und plötzlich war es beschlossen hinaufzusteigen. Dabei gaben mir die Formen der Felsen meine Art der Besteigung vor. Den Val-di-Roda-Kamm (linke Bildmitte) galt es zu überschreiten, auf die Cima della Madonna (ganz rechts) kletterte ich über verschiedene Routen und zu allen Jahreszeiten.
Günther war Bruder, Freund, Weggefährte und Partner zugleich. Eine Zweckgemeinschaft war unsere Seilschaft auch, weil wir oft dasselbe Ziel hatten und mit der gleichen Lebensfreude im Fels kletterten. ©Toni Mutter
Kein Totentanz an der Senkrechten
Es war Mitte Oktober und in den Morgenstunden so kalt, dass das Wasser in den Rinnen am Fuße »unserer« Nordwand gefroren war. Beim Zustieg zum Anfang der Kletterwand gingen wir nicht am Seil. Günther trug einen kleinen Rucksack, ich das Doppelseil, das ich mir auf den Rücken gebunden hatte.
Ohne viel zu reden, ab und zu nach oben schauend, blieben wir genau im Winkel zwischen der Wand über uns und einem Felsvorbau, der den Berg wie ein gigantischer Schuppenpanzer zu stützen schien. Wir stiegen über Rampen und Kamine schräg nach links aufwärts.
Wie immer vor einer schwierigen Klettertour hatte ich schlecht geschlafen. Es war eine nervöse Aufregung in mir gewesen, die meinen Vogelschlaf ständig mit Bildern und Gefühlen des Fallens zerrissen hatte, eine innere Anspannung, die genährt wurde von Nichtwissen, von Zweifeln am eigenen Können, von Hilflosigkeit. Auf die mir vertrauten Gefahren – fallende Steine, die Knebelposition, die einen durch eine unüberlegte Kletterbewegung fesseln kann, ein ausbrechender Griff – konnte ich im Halbschlaf reagieren. Der Gedanke an all das Fremde aber, das Unvorhersehbare, das Unvorhersagbare, das sich beim Klettern auf dem Weg bis zum Gipfel ereignen konnte, war nur schwer zu ertragen.
Als wir unter die senkrechte Plattenflucht kamen, die in einem leicht vorstehenden, abgerundeten Pfeiler bis zur Gipfelabdachung emporragt, blieben wir stehen. Wir legten die Köpfe weit in den Nacken und schauten die Wand hinauf.
»Zu machen«, war Günther überzeugt.
»Kein Morgenspaziergang allerdings.«
»Nein, bei dieser Kälte nicht.«
Aus unserer Perspektive schien die Wand kurz zu sein und durchgehend senkrecht. Oben, über dem Gipfel, der gleißende Morgenhimmel. Die Lichtflut blendete uns.
Wir waren an der richtigen Stelle, um einzusteigen. Günther holte die »Schlosserei« aus dem Rucksack: zwei Kletterhämmer, einige Haken, ein halbes Dutzend Karabiner. Wir seilten uns an.
Am Vortag beim Aufstieg aus dem Tal hatten wir die Wand genau studiert. Aus der Entfernung von einigen Kilometern war sie viel besser zu überblicken gewesen als jetzt, unmittelbar an ihrem Fuß. Ich hatte mir die mögliche Linie des Aufstiegs genau eingeprägt und verglich dieses Erinnerungsbild mit der tausendfach größeren Realität.
Aus der Struktur der Felsen ließen sich kaum Anhaltspunkte entnehmen, doch ermöglichte ihre Farbe Rückschlüsse auf Festigkeit und Steilheit. Es war eindeutig zu erkennen, dass die gesamte Wandflucht frei kletterbar war.
»Alles Freikletterei.«
Auch Günther war von der Begehbarkeit der Wand überzeugt.
»Frei« hieß für uns nicht, ohne Seil und Sicherung zu klettern. Beim Freiklettern, das damals viel mehr als heute als Gegensatz zum technischen Steigen stand, wurden Schlingen und Strickleitern niemals in Haken gehängt, um so Griff- und Trittersatz zu schaffen. Die meisten Kletterer fanden nichts dabei, wenn sie sich zwischendurch an Haken festhielten. Es sollte später jedoch eine Stilfrage werden, Sicherungspunkte nicht mehr als Griff- oder Trittersatz zu benutzen.
Die Freikletterei ist seit einem Jahrhundert als das Emporklettern an naturgegebenen Halte- und Stützflächen in möglichst steilen Felsformationen definiert. Zu jener Zeit, in den 60er-Jahren, hätten wir über eine so trockene Erklärung nur gespottet, obwohl wir uns gegenseitig danach beurteilten, wie viele Haken einer einsetzte. Je weniger, umso besser. Ja, unser Ehrgeiz saß auf einem unberechenbaren Pferd, und seine Sporen waren die Schwierigkeiten und die Absturzgefahr. Wir wollten nicht nur klettern, indem wir darauf verzichteten, uns an in Ritzen und Löcher getriebenen Eisenstiften, sogenannten Fiechtelhaken, wie wir sie damals noch benutzten, hochzuziehen. Wir wollten auch mit möglichst wenig Zwischenhaken auskommen. Stürzen war lebensgefährlich, Klettern im Fels nicht nur Sport.
Am Einstieg fanden wir eine Sanduhr und eine Ritze, in die ich mit zehn Hammerschlägen einen Haken trieb. Günther band sich mittels Karabiner an diesem Haken und über eine Reepschnur, die ich durch die natürliche Öse im Felsen gefädelt hatte, am ersten Standplatz fest. So konnte er mich am Doppelseil sichern. Er wäre im schlimmsten aller Fälle – wenn ich als Vorauskletternder gestürzt wäre – nicht aus der Wand gerissen worden.
»Alles fertig?«
»Ja, du kannst losklettern.«
Es war immer noch eisig kalt. Kaum war ich die ersten Meter emporgestiegen, waren meine Finger starr und gefühllos. Der feuchte, kalte Fels entzog den Händen die Wärme. Ich blieb stehen. Beim Blick zurück zu Günther fiel mir auf, dass die Hänge unter dem Kar in der Sonne lagen. Ich kletterte ohne Handschuhe, weil der Fels kleingriffig war – und außerdem hatten wir gar keine dabei. Die ersten dreißig Meter brauchte ich, um mich an die Kälte zu gewöhnen und mir die Morgenstarre aus Beinen und Armen zu schlenkern. Die Wand war viel griffiger, als ich beim Studium von unten geahnt hatte. Senkrecht zwar, aber gegliedert wie ein Korallenriff. Bei jeder Bewegung nach oben fand ich für die eine Hand, die weitergriff, oder für einen Fuß, den ich nachzog, sofort einen weiteren Haltepunkt. Ich stieg nicht wie ein Mensch, der auf einer Leiter steigt, sondern bewegte mich wie ein wildes Tier, das sich unbeobachtet fühlt, senkrecht nach oben.
Alle meine Sorgen und Ängste waren verdrängt. Ich war völlig konzentriert: auf die Griffe, die ich prüfte, bevor ich sie belastete, auf die Tritte, auf den Weg vor mir. Es waren nur einige wenige Quadratmeter Fels, die ich aus meiner Perspektive überschauen konnte. Immer wieder kombinierte ich im Geiste, ohne es bewusst als Antizipation zu empfinden, jeweils eine Serie von Griff- und Trittfolgen, die mich zum nächsten bequemen Standpunkt bringen sollten. Klettern und Denken bildeten eine Einheit – das Klettern als die konkrete Ausführung meiner geistigen Vorstellungen.
»Noch zehn Meter Seil.« Günther rief mir die Information mit kräftiger und überzeugt klingender Stimme zu. Es gab mir Sicherheit. Wir kletterten mit 50-Meter-Seilen. Ich hatte noch zehn Meter Spielraum. Die ersten 40 Meter war ich ohne Zwischensicherung geradewegs nach oben gestiegen. Ich sah mich nach einer größeren Nische um und kletterte sie an. Dort angekommen, brauchte ich einige Minuten, um mich selbst an zwei Haken zu sichern. Dann erst konnte ich meinen Bruder nachkommen lassen.
»Stand!«
»Seil ein.«
Ich zog das Seil durch einen Karabiner, bis es spannte. Jetzt konnte Günther von mir am Seil gesichert nachklettern.
»Seil aus.«
»Nachkommen.«
Günther wurde langsam warm. Ich spürte es an seiner Geschwindigkeit. Bald schon hatte ich Mühe, das Seil so rasch einzuziehen, wie er nachstieg.
Es schien ein guter Tag zu werden. Die Ängste und Zweifel, die mich in den frühen Morgenstunden geplagt hatten, waren verflogen. Mein Denken kreiste nur noch um einen einzigen Punkt: Würden wir durchkommen?
Sicherheit beim Klettern war bei mir nie eine Frage der reinen Technik, also der perfekten Sicherung, sondern eine Frage des Gefühls, das mit Vergessen zu tun hatte: Jetzt waren alle Todesängste verflogen. So, wie sich Alltagsängste beim Sex auflösten.
In den Nächten vor dem Aufbruch sehnte ich mich stärker als sonst nach Frauen und Sex. Als müsste ich das haben, um die Schwerkraft des Todes aufzuheben.
Eine Art Kletterfieber hatte uns nach der ersten Seillänge gepackt. Als Günther bei mir stand, band er sich an meine beiden Haken. Ich band mich gleichzeitig aus, gab ihm mein Seil, und er nahm es über die Schulter. Zögerlich kletterte ich weiter. Die ersten Bewegungen nach dem Standplatz waren wie immer die unangenehmsten. Ich brauchte ein paar Züge, um wieder in den Rhythmus des selbstverständlichen Kletterns zu kommen, dieser harmonischen Abfolge von Steigen, Vorausschauen, Hinabschauen, Vorausschauen, die ich nicht als getrennte Bewegungen wahrnahm. Ich hatte die Wand vor mir so verinnerlicht, dass ich an ihr emportänzelte. Als gäbe es nichts auf der Welt als diese paar Quadratmeter Felsen, an denen ich aufrecht stand: der Berg als Ebene, horizontal, die Schwerkraft wie aufgehoben. Der Gedanke, dass nur ein Fehler genügte, um abzustürzen, existierte nicht.
Drei Wochen vorher waren Günther und ich an der »Schleierkante« gewesen, ohne Seil, jeder wie ein Alleingeher. An dieser berühmten Felstour weiter rechts von der direkten Nordwand steckten so viele Haken, dass wir am Seil kaum hätten abstürzen können. Wir stiegen also seilfrei empor, jeder für sich, zuerst hintereinander, bald parallel. Wir kletterten schnell, ohne Schwierigkeiten, obwohl die Route aufgrund der häufigen Begehungen damals schon glasige, schlüpfrige Griffe aufwies. Nach dem Vorbau begannen wir, ohne es abgesprochen zu haben, alte Haken zu entfernen. Da und dort schlugen wir welche heraus und nahmen sie mit. Nicht um Haken zu sammeln, sondern einfach so, weil wir übermütig waren, in guter Form und die Route als »übernagelt« empfanden. Nach einer anderen Rechtfertigung für unsere Säuberungsaktion fragten wir nicht.
Die »Schleierkante« war 1920 von Gunther Langes und Erwin Merlet erstbegangen worden. Jahrelang hatte sie als eine der klassischen Freikletterrouten in den Dolomiten gegolten, und es gab keinen Zweifel, sie war eine faszinierende Felstour. Immer noch. Allerdings reichten ihre schwierigen Passagen nicht annäherungsweise an die Kletterschwierigkeiten heran, die von Könnern inzwischen frei geklettert werden konnten. Seit Jahrzehnten nicht mehr.
Weil es an der Kante mehrere Varianten gab, trennten Günther und ich uns ab und zu. Wir kamen oberhalb der oft nur wenige Dutzend Meter auseinanderlaufenden Kletterstrecken wieder zusammen, wie bei einem konspirativen Treffen, und zeigten uns jedes Mal die Hakenausbeute, die wir an den verschiedenen Passagen hatten mitnehmen können. Unsere Schadenfreude dabei galt nicht den Erstbegehern, sondern der Dekadenz des alpinen Kletterns. Wenngleich Günther und ich jetzt ohne Seilsicherung über die nur leicht angelehnten grauen Felssäulen stiegen, empfanden wir aufrichtigen Respekt vor den Erstbegehern.
Die Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg hatte für die Dolomitenkletterer eine Phase des Aufbruchs bedeutet. Ihre Ausrüstung war kaum anders als die der Vorkriegsgeneration gewesen, jedenfalls nicht annähernd so gut und so leicht wie die unsere. Langes und Merlet waren 1920 mit Hanfseilen geklettert. Ihre Kletterschuhe waren mit einer Art Filz besohlt, der sich rasch abnutzte, nicht mit Gummisohlen, die je nach Härte und Zusammensetzung eine Haftung auch an winzigen Trittflächen garantieren. Der Rucksack damals war unförmig und schwer.
Von mehreren Stellen der »Schleierkante« hatten Günther und ich nach links in die Nordwand schauen können, jene Wand, in der wir jetzt kletterten. Von der Seite hatte sie steil ausgesehen, senkrecht, wenig gegliedert, aber griffig. Wir hofften damals trotzdem, dass sie machbar wäre.
Wir brauchten eine Stunde, um die »Schleierkante« zu klettern. Bis zum Gipfel hatten wir 36 Haken erbeutet, alles Haken, die zu viel in der Wand gewesen waren. Dort auf dem Gipfel fällten wir den Entschluss, die Nordwand zu versuchen.
Gunther Langes war ein alter Herr, als ich ihn kennenlernte. Er überarbeitete seine Dolomitenführer, die er nach dem Zweiten Weltkrieg herausgegeben hatte, und er bat meinen Bruder und mich, ihm als Zuträger zu helfen. Wir hatten viele der modernen Dolomitentouren wiederholt, hatten eine Reihe eigener Routen erstbegangen und konnten bei vielen Wegbeschreibungen behilflich sein. Bei den Arbeitsgesprächen in seiner Bozener Wohnung haben wir mit Gunther Langes natürlich auch »philosophiert«, wie alle Bergsteiger, die nicht nur mit Händen und Füßen klettern.
Insider hatten das Klettern nie nur als eine rein körperliche Tätigkeit verstanden. Jeder Kletterer hatte seine eigene Philosophie, die er seinem Tun zugrunde legte, und ich selbst habe mit meinen eigenen Vorstellungen dazu nie gegeizt.
»Die Kletterer heute sind Techniker, nicht Turner«, lautete Langes’ Kritik an unserer Generation. Trotz meines großen Respekts für das Kletterkönnen vor und nach dem Ersten Weltkrieg musste ich Gunther Langes widersprechen.
»Aber sie klettern schwierigere Passagen.«
»Nein, die ›Schleierkante‹ bleibt unübertroffen«, lautete sein kategorisches Urteil. Weil Langes damit behauptete, dass das Kletterkönnen, das reine Freikletterkönnen wohlgemerkt, das er und Merlet an der »Schleierkante« erreicht hatten, niemals übertroffen werden könnte, wollte ich widersprechen, aber Günther zwinkerte mir ein »Lass ihm den Glauben« zu. Ich blieb still. Günther und ich lachten Langes nicht aus, wir empfanden Respekt.
»Alles, was nachher kam, von der Civetta-Nordwestwand bis zur Großen-Zinne-Nordwand, ist nichts als Nagelei.«
Mit dieser Behauptung verwickelte mich Gunther Langes in einen Disput über die jüngere Geschichte der Dolomitenkletterei, und diesmal musste ich widersprechen.
»Comici hätte an der Zinnenwand vielleicht sogar gebohrt«, sagte ich, »Solleder aber, dann Vinatzer, später Rebitsch sind frei geklettert.«
»Mit genügend Haken unterm Hintern vielleicht«, höhnte Langes.
»Nein«, sagte ich. »Solleder hat bei der ersten Begehung der Civettawand nur ein Dutzend Zwischenhaken geschlagen, keine Fortbewegungshaken. Die Freikletterstellen dort sind mindestens um einen Grad höher als die in der ›Schleierkante‹. Die Vinatzer-Routen sind um zwei Grad schwieriger und weniger abgesichert als eure ›Schleierkante‹.«
»Unfug«, antwortete Langes. »Unfug. Schwieriger als die ›Schleierkante‹, die wir vollkommen frei erstbegangen haben, kann niemand klettern. Unmöglich. Niemals.«
Ich lächelte. Günther schüttelte den Kopf. Wir wussten, dass das Freiklettern weiterentwickelt worden war, und mussten uns das nicht von einem alten, kranken Mann ausreden lassen. Natürlich hatte Langes in einem Punkte auch recht: Absicherung durch Haken oder was auch immer – alle zwei Meter ein Fixpunkt – war immer auch Technologie. Aber er irrte, wenn er sagte, dass der Höhepunkt im Freiklettern ein für alle Mal erreicht war. Mit mehr Training, mehr Erfahrung und leichterer Ausrüstung sollte schwieriger geklettert werden, als wir es uns alle damals überhaupt vorstellen konnten.
Obwohl ich mich selbst vor 25 Jahren schon von der extremen Kletterszene zurückgezogen habe, bin ich von Erstbegehungen immer noch fasziniert. Die reine Schwierigkeit interessiert mich dabei viel weniger als die gekletterte Linie und das Erlebnis zwischen Einstieg und Gipfel. »Du sammelst immer noch Erstbegehungen?«, fragte mich kürzlich einer dieser jungen Kletterstars.
»Ja, ich bin so veranlagt. Als Kletterer bin ich Sammler und Künstler. Und ich werde Sammler bleiben.«
»Die Erstbegehung als Kunstwerk, der Kletterer als Künstler, das ist doch nur als Provokation gedacht?«
»Nein, jede neue Route bringt Kreativität zum Ausdruck. Der Kletterer, der sich eine Linie durch eine Wand ausdenkt und diese mit Händen und Füßen kletternd realisiert, ist ein Künstler. Sein Talent drückt sich primär in der Linie, in seinem Empfinden für seine Linie aus. Die Wahl seiner Linie sagt viel über ihn aus.«
»Zum Beispiel?«
»Wie er sich einschätzt und was er unter Struktur von Natur versteht. Oder welches Verhältnis er zum Nichtexistenten hat, zu der Felswand als weißer Leinwand. Ein Kletterer, der unter einer tausend Meter hohen Bergflanke steht und eine imaginäre Linie zieht, über die er hochklettern will, hat genau den gleichen Blick wie der Maler vor der weißen Leinwand. Während er steigt, realisiert er Griff für Griff, Tritt für Tritt, seine Linie. Er arbeitet nicht mit Meißel und Messer oder Pinsel und Farbe, sondern setzt all seine Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit ein. Seine Mittel sind die Aktion, das Klettern. Und wenn er zurückkommt ins Tal und hinaufschaut in ›seine‹ Wand, ist sie für ihn nicht mehr dieselbe wie vorher. Es zieht sich eine Linie hindurch, wenngleich unsichtbar. Diese Linie existiert nur im Kopf des Kletterers. In der Wand bleibt im Idealfall nichts, aber dieses Nichts ist ein Kunstwerk.«
»Wie bitte?«
»Künstler setzen Erkenntnisse, Ideen, Gefühle in Sichtbares, Greifbares, Hörbares um. Der Kletterer hinterlässt nichts in ›seiner‹ Wand, die aber trotzdem eine andere geworden ist.«
Günther und ich stiegen nicht ohne Zwischenhaken durch die Nordwand der Cima della Madonna. Aber viele schlug ich nicht, und ich kletterte eine Seillänge nach der anderen aus. Wie programmiert, fand ich nach jeweils 45 Metern einen Standplatz, oft nur einen winzig kleinen Felsvorsprung. Die Seile schlingerten frei durch die Luft, wenn ich sie einholte. Unser Übermut wich mehr und mehr dem Erstaunen, dass es an dieser senkrechten Dolomitenwand, die von unten so kurz ausgesehen hatte, immer wieder weiterging. Auch wenn unsere Lage manchmal hoffnungslos schien, fand ich genügend große Haltepunkte, um ohne jedes Sturzrisiko höher steigen zu können.
Wir waren überzeugt durchzukommen. Und wir hatten keine Spuren von Vorgängern gefunden. Damit wussten wir, dass wir uns auf einer Erstbegehung befanden, denn diese Wand hätte früher kaum jemand ohne Stand- oder Zwischenhaken klettern können. Günther war fasziniert.
»Diese Kletterei hier ist ›Schleierkante‹ hoch zwei«, jauchzte er.
In der Pubertät waren Günther und ich daheim keine Seilschaft gewesen. Zwischen zwölf und sechzehn Jahren war ich lieber mit meinem älteren Bruder Helmut oder mit dem Vierten in der Reihe, Erich, geklettert. Günther war ein Einzelgänger gewesen und störrisch dazu. Später dann, als sich Helmut und Erich stärker der Schule und dem Studium widmeten, wurde Günther mein bevorzugter Kletterpartner. Er zeigte mehr als Begeisterung, wenn es um die Berge ging. Wie selbstverständlich er sich dabei in die Rolle des Seilzweiten fand, ist mir erst später, nach seinem Tod am Nanga Parbat, klar geworden. Konditionell war er mir überlegen, in der Kletterkunst ebenbürtig. Vielleicht fehlten ihm die beiden Jahre Erfahrung, die er jünger war als ich, und die Besessenheit, die mich umtrieb.
Als Fanatiker bezog ich damals eindeutig Stellung fürs Freiklettern, ordnete die Geschichte der Kletterkunst nach der Zahl der geschlagenen Haken – je weniger Sicherungshilfen, desto wichtiger die Tour – und kletterte viel allein.
Günther und ich wurden zwangsläufig eine Seilschaft, bald die ideale Seilschaft. Wenn es Günthers Zeit erlaubte – er arbeitete als Bankkaufmann zuerst im Gadertal, dann in Bruneck –, kletterten wir zusammen. An jedem Wochenende, den ganzen Sommer über. Wir haben nie im Jahresrückblick gezählt, wie viele Touren wir zusammen gemacht hatten, wir haben aber immer wieder von Erstbegehungen geträumt, haben geplant, Wände studiert, trainiert. Wir dachten nur in die Zukunft.
Die Sommer 1967 und 1968 waren unsere erfolgreichsten gemeinsamen Kletterjahre, getragen von einem Gefühl der Unverwundbarkeit, das uns ungebrochen überallhin begleitete. »Uns passiert nichts« oder »Wir kommen durch« waren unsere Standardantworten auf die Zweifel und Warnungen der anderen. »Wenn wir nicht bis zum Gipfel kommen, werden wir eben abseilen. Ganz einfach.«
Unser Bruder Siegfried war nicht nur jünger, er war auch anders. Ihm fehlte dieser instinktive Orientierungssinn in großen Wänden, dieses Selbstverständnis in der Wildnis, mit dem Günther und ich uns bewegten. Bei späteren Klettertouren mit Siegfried habe ich nie dieses tragende Vertrauen empfunden wie zu Günther. Siegfried kletterte ordentlich, seine Kondition war gut. Aber er war nicht so überzeugt vom Durchkommen, dass ich ihn bei Erstbegehungen hätte mitnehmen wollen. Bei Günther war es genau umgekehrt gewesen. Erstbegehungen machte ich am liebsten mit ihm. Er war der beste Partner.
Siegfried ist später Bergführer geworden, ein erfahrener, ausgeglichener Mann. Aber das Klettern als Selbstzweck war seine Sache nicht. Am Stabeler-Turm in den Dolomiten wurde er während einer Tour als Bergführer vom Blitz getroffen und aus der Wand geschleudert. Er starb an den Folgen. Sein Tod als Arbeitsunfall war für mich leichter zu verkraften als Günthers Tod am Nanga Parbat.
Klettern war für mich nicht einfach eine Fortbewegungsart, um vom Einstieg bis zum Gipfel zu kommen. Ich kletterte weniger der Kletterkunst wegen als vielmehr wegen der Spannung vor und während der Tour, die mich antrieb und ängstigte zugleich. Diese Spannung wirkte wie eine Droge.