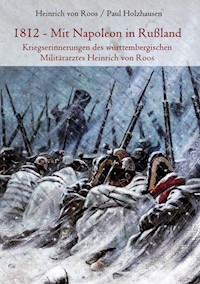
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Deutsch
Ein Lied von übermenschlichem Elend singt das Buch, das hier vor der Leserwelt aufgeschlagen wird, das Buch des schwäbischen Arztes Heinrich Ulrich Ludwig von Roos, der einst, wie er schreibt, eine Reise "von den westlichen Ufern der Donau an die Nara, südlich von Moskau und zurück an die Beresina" gemacht hat. Mit wem? Mit der großen Armee, deren tragischer Untergang die Welt in beispiellose Aufregung versetzte, der Hunderttausenden von Familien aller Länder den Trauerflor ins Haus brachte... Ein bewegendes, eindringliches Zeitdokument, welches, die unendliche Grausamkeit des Krieges bezeugend, an Aktualität nie verlieren kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis.
Die Tragödie des großen Heeres
Vorwort von Heinrich von Roos
1. Kapitel
Vorbereitung zum Ausmarsch. - Marsch durch die Heimat. - Leipzig. Lob den Sachsen. Frankfurt a. d. Oder
2. Kapitel
Marsch durch Polen. - Ein Prophet. - Der Weichselzopf. - Westpreußen. - Heerschau bei Ostrolenka. - Plünderungs-Requisitionen. - Übergang auf russischen Boden
3. Kapitel
Mangel an Nahrung. - Plünderung der Eiskeller. - Krankheiten bei Reiter und Pferd. - Wilna. - Napoleon und General Wattier. - Erstes Gefecht mit Kosaken. - Murat. - Strafexetutionen. - Weitere Gefechte. - Mein Reitknecht. - Prinz Hohenlohe gefangen. - Beredsamkeit des Generals Sebastiani. - Wir schwimmen durch die Düna. - Polozk. - Alarm. - Schlacht bei Witebsk
4. Kapitel
Wir sind unsere eigenen Diener. - Diarrhöe reißt ein. - Duell polnischer Offiziere - Unser Lager bei Rudnja. - Behandlung der Kranken. - Russischer Geistlicher daselbst. - Unser Auditor verkauft den Proviant. - Eine erfolgreiche Requisition. - Schlimme Nachrichten. - Unglückliches Gefecht bei Inkowo. - Unser Oberst gefangen
5. Kapitel
Lubowzy. - Ein versüßter Geburtstag. - Streifzug bis Mohilew am Dnjepr. - Smolensk in Brand und Rauch. - Ein melancholischer Arzt. - Ein Kosakenüberfall. - Wohlstand mancher Gegenden. - Dorogobush in Ruinen. - Nachrichten über die große Armee. - Überall Verwüstung. - Die Straße nach Moskau. - Nachzügler. - Wjasma und Gshatsk. - Wir stoßen zur großen Armee. - Ein Wiedersehen
6. Kapitel
Die Schlacht bei Borodino. - Napoleons Tagesbefehl. - Die erste Schanze ist genommen. - Mein Beschäftigungsort. - Zuwachs an Verwundeten. - General Montbrun wird verwundet. - Die zweite Schanze ist genommen. - Die dritte Schanze wird erobert. - Rückzug der Russen. - Aussicht über das Schlachtfeld. - Wieder unter Murat bei der Vorhut. - Vorrücken im Walde. - Verbrannte und verkohlte Verwundete. - Ein Duell. - Eine friedliche Nacht
7. Kapitel
Tägliche Reitergefechte. - Wir sehen die Zarenstadt.- Napoleon bei der vorderen Spitze der Avantgarde. - Die Alliierten eröffnen den Einzug nach Moskau. - Wir reiten quer durch die Stadt. - Friedliche Beziehungen zu den russischen Truppen. - Schreckliche Explosion. - Der Brand von Moskau. - Die Russen gehen auf der Straße nach Kasan zurück
8. Kapitel
Der König Murat alarmiert selbst. - Auf der Straße nach Kasan. - Wir haben des Feindes Spur verloren. - Podolsk. - Wir treffen den Feind wieder. - Tägliche Gefechte. - Eine wilde Flucht. - Unser Verlust. - Wir beziehen ein Lager am Dorfe Teterinka. - Großer Mangel. - Wir bekommen unser Schlachtvieh. - Betrübende Nachrichten. - Gefahrvolle Fouragierungen. - Die Regimenter werden immer kleiner. - Überfall und Schlacht. - Wir müssen weichen. - Auflösung des Regiments
9. Kapitel
Rückzug gegen Moskau. - Graf von Scheler. - Neue Beschäftigungen. - Reichtümer der Truppen, die aus Moskau gekommen. - Marsch nach Borowsk. - Szenen von Elend in der Nacht. - Napoleon kehrt mit der Armee von Malojaroslawez zurück. - Der allgemeine Rückzug beginnt. - Wir betreten die Straße nach Smolensk. - Das Wegwerfen der Waffen beginnt. - Wehmütige Betrachtungen. - Trauriges Schicksal von Verwundeten
10. Kapitel
Ein Mordbefehl. - Ein Kurier aus Stuttgart. - Kosakenüberfall. - Ich werde stellvertretender Generalchirurg. - Die Württemberger verstecken ihre Fahnen. - Abzug aus Wjasma. - Plünderung gebrochener Wagen. - Kanonen werden im Stiche gelassen. - Der Rückzug wird beschwerlicher, die Not größer. - Ein Hund zur Nahrung. - Geburtstag des Königs. - Eine schreckliche Nacht. - Der Paß von Solowjewa. - Schauerszenen. - Drei Tage in Smolensk. - Ein freundlicher Pole
11. Kapitel
Ein Offizier mit einem Teewagen. - Unter Führung der Generale von Kerner und von Stockmayer. - In Krasnoi. - Allerlei Kranke. - Marsch im Kugelregen. - Erblinden der Soldaten. - Mein letztes Pferd. - In Orscha. - Der nützliche Mann
12. Kapitel
Wir erhalten Verstärkung. Schlimme Nachrichten. - Ein unglaublicher Betrug. - An der Beresina. - Fünf vergebliche Versuche zum Überschreiten der Brücke. - Schreckliche Verwirrung. - Ich werde von Kosaken gefangen und ausgeplündert. - Leutnant Schäfer. - Selbstmordplan. - Ankunft im brennenden Borissow. - Plan zu entkommen. - General Graf von Wittgenstein. - Ich komme in russischen Dienst. - Dr. Witt, dessen Frau und deren Menschenliebe. - Meine Tätigkeit in Schützkow. - Ich werde vom Kriegstyphus befallen. - Besserung und Erholung. - Mein Ruf als Arzt
13. Kapitel
Ich bin nach Borissow versetzt. - Schicksal vieler Weiber und Kinder. - Spazierritt nach Studjenka. - Grabhügel. - Aus der Beresina gezogene Beute. - Eine Prügelexetution. - Gefangene aus der Schlacht bei Bautzen. - Die deutsche Legion. - Baron Korsak. - Die Judensprache. - Erzählung aus dem Kriege 1809. - Höchst merkwürdige Verwundung. - Etwas über die Deutschen. - Friedensschluß. - Abreise von Borissow. - Kabinettsordre S. M. des Königs von Württemberg. - Nachrichten aus dem Vaterlande. – Meine Todesanzeige. - Interessanter Brief aus Lauterburg. - Schlußbemerkungen
Die Tragödie des großen Heeres.
EIN Lied von übermenschlichem Elend singt das Buch, das hier vor der Leserwelt aufgeschlagen wird, das Buch des schwäbischen Arztes Heinrich Ulrich Ludwig von Roos, der einst, wie er schreibt, eine Reise „von den westlichen Ufern der Donau an die Nara, südlich von Moskau und zurück an die Beresina“ gemacht hat. Mit wem? Mit der großen Armee, deren tragischer Untergang vor hundert Jahren die Welt in beispiellose Aufregung versetzte, der Hunderttausenden von Familien aller Länder den Trauerflor ins Haus brachte und eine Umwälzung der gesamten Lage Europas im Gefolge hatte, das im weiteren Verlauf der Dinge diejenige politische Gestalt annahm, die es, von einigen kleineren oder größeren Grenzverschiebungen abgesehen, bis heute behalten hat.
Ja, man kann ihn in eigentlichem Sinne eine Tragödie nennen, den Feldzug von 1812, die Tragödie jenes großen Heeres, das bis dahin in lustigem Siegeszuge alle Städte und Länder durchflogen, den kleinen Regisseur im grauen Überrock an der Spitze, den Kriegsgott, dessen Erscheinen schon dafür zu bürgen schien, daß jede der von ihm aufgeführten Haupt- und Staatsaktionen mit glorreichem Finale - vive l'Empereur! Brillantfeuerwerk und Triumphbögen - abschließen würde.
Wenn man das Wesen des Tragischen darin sieht, daß der Held im Konflikt mit der bestehenden Ordnung der Dinge oder den Anschauungen seiner Zeit und seines Jahrhunderts untergeht, so wäre bei dem Kriege des Jahres 1812 geradezu eine Häufung tragischer Momente vorhanden. Ein Blick auf die politische und militärische Lage der Zeit wird den Leser hiervon bald überzeugen.
Es war nicht, wie man so oft liest, zügellose Herrschbegier, nicht „Cäsarenwahnsinn“, was den großen Feldherrn verleitete, durch einen Angriff auf das ungeheure Zarenreich seinen Ruhm und seine Machtstellung aufs Spiel zu setzen.
Solch irrigen Volksvorstellungen gegenüber mag auf die heute als feststehend anzunehmende Tatsache verwiesen werden, daß Napoleon den Krieg eigentlich nicht gewollt hat. Wenigstens nicht zu der Zeit, wo er ausbrach. „Er hatte ihn nicht gesucht“, sagt ein sehr guter Kenner jener Jahre1, „er hätte ihn gern vermieden; er hoffte noch im Mai, als er in Dresden weilte, auf eine friedliche Lösung des Konflikts mit Rußland.“ Was die jahrelangen „Freunde“ und nunmehrigen Gegner widereinander zwang, war eine Art Verhängnis: die Unmöglichkeit für Napoleon, der russischen Hilfe bei der Durchführung seines Handelskampfes gegen England zu entbehren, und die Unmöglichkeit für den Herrscher im Osten, dem Kaiser des Westens hierin zu Willen sein, ohne die wirtschaftlichen Kräfte des auf einen Austausch mit England angewiesenen eigenen Landes ernstlich zu gefährden. Ein Handelskrieg war, wie oft, so auch hier dem Kampf mit den Waffen vorausgegangen.
Viel gewaltiger aber erscheint die Tragik der Verhältnisse, wenn man diese von noch höherem Gesichtspunkt aus betrachtet. Das „Ewig-Gestrige“ heftet sich dem großen Korsen an die Fersen, wie es sich im 17. Jahrhundert dem Friedländer an die Fersen hängte. Er kann nicht in Rußland einziehen, ohne einen grollenden Erdteil hinter sich zu lassen. Das sind die „Bundesgenossen“, die unlängst Geschlagenen, Preußen und Österreich, deren zwangsweise gelieferte Hilfstruppen er - anscheinend ein schwerer Fehler - auf den linken und rechten Flügel stellt, anstatt sie, wie er vielleicht gekonnt hätte, bei seinem Zentralvorstoß gegen Moskau mitzunehmen. Dies würde Yorks Abfall und Schwarzenbergs Verhalten in Wolhynien unmöglich gemacht haben. Die Untätigkeit des Österreichers aber wird von verhängnisvollen Folgen sein. Denn dadurch, daß er den russischen Admiral Tschitschagow, den er in Schach halten soll, entschlüpfen läßt, wird es diesem möglich, der auf dem Rückmarsch befindlichen großen Armee den Beresinaübergang bei Borissow zu sperren. Dadurch wird für die schwerste Katastrophe die Bühne hergerichtet werden.
Aber lange bevor es hierzu kam, war das Schicksal des großen Heeres entschieden. Schon auf dem - ohnehin zu spät angetretenen - Hinmarsch nach Moskau, nicht eigentlich, wie wieder die Volksvorstellung will, auf dem Rückzug ist der größere Teil des Heeres zugrunde gegangen, das sich mit seinen zahllosen Fußvölkern, seinen glänzenden Reitergeschwadern und den nicht enden wollenden Zügen der Geschütze, Munitions- und Bagagewagen im Frühjahr 1812 auf allen Straßen der norddeutschen Ebene der russischen Grenze entgegen bewegte. Rund 450,000 Mann mit annähernd 1200 Geschützen sind es gewesen.
Aber die Größe des Unternehmens wurde sein Verderben. Auch hierin zeigt sich für den Denker ein tieftragischer Zug. Der geniale Führer des französischen Heeres hatte etwas versucht, was zu erreichen bei dem damaligen Zustande der Technik zu den Unmöglichkeiten gehörte. Denn so groß die nach Rußland ziehende Armee den Zuschauern vorkommen mochte, die deren lange Kolonnen sich hatten durch die Straßen winden sehen: aus der Vogelperspektive betrachtet, war es ein wimmelnder Haufen winziger Ameisen, der sich bald auf einem ungeheuren Terrain zerstreute und den nach einem einheitlichen Willen zu leiten selbst die Kraft eines Napoleon überstieg. Zur damaligen Zeit - müssen wir wieder hinzufügen -, wo es keinen Telegraphen gab, der in wenig Augenblicken Befehle in die Ferne zu übermitteln, keine Eisenbahnen, die innerhalb von Stunden Lebensmittel und Truppen in großen Massen an die Orte zu schaffen imstande sind, wo man deren gerade am dringendsten bedarf. Da ihm diese und hundert andere Hilfsmittel der heutigen Technik fehlten, die zur schnelleren Fortbewegung seiner Heeresmassen und zu deren einheitlicher Lenkung unentbehrlich waren, so entging ihm die Möglichkeit, während der ersten Periode des Feldzugs die Russen zu fassen und deren getrennte Korps entscheidend zu schlagen.
Bekanntlich hatten diese zwei Westarmeen aufgestellt, eine unter Barclay de Tolly im nördlichen Litauen und eine zweite mehr im Süden, in der Gegend von Wolkowisk, unter Bagration. Napoleons Plan, durch einen Marsch auf Wilna sich keilförmig zwischen beide hineinzuzwängen und sie im Einzelkampfe zu vernichten, war glänzend erdacht; doch kam er aus den angegebenen und anderen Gründen zum Scheitern. Im Süden ließ die Saumseligkeit Jérômes, den der Kaiser nicht gehörig überwachen konnte, den Fürsten Bagration entwischen, und auch im Norden wollte es nicht glücken, Barclay zum Entscheidungskampf zu stellen.
Nur belanglose Teilerfolge wurden unter großen Opfern von den Franzosen errungen, während es den beiden russischen Führern gelang, sich rückwärts bei Smolensk zu vereinigen, wo es wiederum zu einem blutigen, aber unfruchtbaren Kampfe kam, dessen einziges Ergebnis für Napoleon die Einnahme einer halbzerstörten Stadt werden sollte.
Inzwischen hatten die wochenlangen Märsche über die weiten Flächen des Zarenreiches die physischen und moralischen Kräfte der großen Armee in ihren Grundfesten erschüttert. Das ungewohnte Klima - glühende Hitze bei Tage und kalte Nächte - und die schlechte Verpflegung brachten Mensch und Tier herunter. Ruhrartige Krankheiten rissen ein; die Gäule litten besonders infolge des nassen Grünfutters, das eine Auftreibung der Leiber zur Folge hatte, die man nur durch angestrengtes Laufen der Tiere beseitigen konnte; 80,000 Pferde soll die Armee auf dem Hinmarsch nach Moskau verloren haben. Die Mannschaften verwilderten in dem unwirtlichen Lande. Auch in dieser Hinsicht scheiterte das ganze Unternehmen an der unerbittlichen Logik der Tatsachen. Napoleon hatte das Mögliche zur Unterhaltung der gewaltigen Masse von Kriegern getan, die sich auf seinen Befehl in das menschenarme Land ergossen. Herden von Rindern und Schafen wurden dem Heere nachgeschickt. Sie blieben zurück, wurden abgefangen, kamen auf den Wegen um oder langten in einem Zustande an, der das Fleisch der jämmerlich abgemagerten Tiere ungenießbar, ja, gesundheitsgefährlich machte. So waren die Soldaten auf Selbsthilfe angewiesen. Demoralisation und Disziplinlosigkeit rissen in weitem Umfange ein. Schon jetzt war die Zahl der Marodeurs eine unverhältnismäßig große, und die Bauern hatten von ihren Untaten zu leiden. Das wird die Rache dieser halbwilden Menschen heraufbeschwören; es gab zu denken, daß schon jetzt viele der auf Nebenwegen Plündernden von der aufgebrachten Landbevölkerung erschlagen wurden. Auch in dieser Hinsicht kann Napoleon nicht der Vorwurf gemacht werden, daß er die Dinge hätte gehen lassen. So lange er konnte, trat er dem Marodeurwesen entgegen. In Litauen wurde eine Menge von Plünderern erschossen. Unser Doktor Roos ist dafür ein klassischer Zeuge; denn er hat gesehen, wie bei Wilna ergriffene Wegelagerer selbst ihr Grab graben mußten, bevor sie vor ein Peleton gestellt wurden, das sie niederschoß. Noch schlimmer war Hauptmann Coignet daran, auch ein Teilnehmer an der Heerfahrt nach Rußland, dem selbst die traurige Pflicht zufiel, einen Haufen dieser eingefangenen Übeltäter - es waren größtenteils Spanier - zu eskortieren, und der dabei zugegen war, als ihrer 62 auf einmal füsiliert wurden. Noch auf dem Rückzug gab der Kaiser die strengsten Befehle für Zucht und Ordnung, freilich ohne bei dem Zustand, in dem sich der weitaus größte Teil des Heeres damals befand, irgend etwas damit zu erreichen.
Schon in Smolensk waren die meisten der Heerfahrt herzlich müde, und fast ausnahmslos waren die Marschälle der Ansicht, daß man stehen bleiben und der Feldzug für dieses Jahr seinen Abschluß finden möchte. Aber dem Kaiser fehlte die Schlacht, die große, entscheidende Schlacht, die wie bei Austerlitz, Friedland, Wagram den Feind niederwerfen und den Krieg auf einen Streich beendigen sollte. So zog man weiter, und noch einmal - am Straganbach bei Walutina Gora - bot sich Gelegenheit, dem russischen Heer eine schwere Niederlage zu bereiten. Und wieder zeigt sich jene eigentümliche Laune des Schicksals, das den großen Kriegshelden zu narren schien: abermals versagte einer seiner Unterführer - einer der ältesten seiner Kampfgefährten, der schon vor zwanzig Jahren mit ihm bei Toulon gewesen war - Junot, Herzog von Abrantes. Und auch hier tritt etwas Dämonisches hervor; waren es doch die Schatten des Irrsinns, die den tapferen Mann umfingen und die zum Schlagen ausgestreckte Hand zurückhielten.
Ja, es schienen unterirdische Mächte gegen den Korsen zu arbeiten. Eigene und von französischer Seite begangene Fehler führten die Russen - anfangs unbewußt und gegen ihren Willen - auf die richtige Art der Kriegführung, die darin bestand, den Gegner immer tiefer ins Land zu locken, um ihn dann der todbringenden Gewalt des nordischen Winters und seiner Gefährten, Frost und Hunger, zu überliefern. Nebenbei bemerkt: eine für die Russen insofern bequeme Art der Kriegführung, als sie an die strategische Kunst ihrer Heeresleiter verhältnismäßig geringe Anforderungen stellte. Wir werden sehen, daß sie auch diesen bescheidenen Ansprüchen nur höchst unvollkommen zu genügen wußten. In der moskowitischen Volksphantasie, die durch flammende Proklamationen aufgeregt wurde, in denen wie in Spanien „Beelzebub“ und „Antichrist“ eine Rolle mitspielten, mußte dann naturgemäß die Vorstellung von einem „Gottesgerichte“ erstehen, das jenen Teufel und Antichristen verderbt hätte, eine Vorstellung, die sich auch in unserem Lande im naiven Glauben der Menge mit bemerkenswerter Zähigkeit behauptet hat.
Doch konnten und wollten die Vertreter des Altrussentums sich nicht in den Gedanken schicken, daß die heilige Zarenstadt Moskau ohne Kampf dem Feinde übergeben werden dürfe. Dies hatte zunächst einen Wechsel im russischen Oberkommando - an Stelle Barclays trat nunmehr der einäugige, verschlagene Kutusow - und dann die Schlacht bei Borodino zur Folge, die gräßliche Schlacht an der Moskwa, die verlustreichste aller seit der Erfindung des Schießpulvers gelieferten Schlachten, ein grausiges Blutbad, in dem der den Russen eigentümliche passive Mut des Sichtotschlagenlassens der glänzenden Tapferkeit der Franzosen und ihrer Verbündeten zuletzt erlag. So war der erwünschte Sieg für Napoleon endlich gekommen, aber es war kein Sieg wie bei Wagram oder Friedland. Immer fehlte etwas in diesem Feldzuge, dem ersten, den der große Feldherr unglücklich führen sollte. Diesmal war er's selbst, der dadurch, daß er im entscheidenden Momente die Garde zurückhielt, eine Vernichtung des feindlichen Heeres verhindert hatte. Trug ein Unwohlsein die Schuld daran, wie von einigen behauptet wurde? „Niemals war er weniger groß als an jenem Tage“, wagt ein Mitkämpfer, General Dedem de Gelder, von dem Sieger an der Moskwa zu sagen. Stand wohl gar dieser bisher allen überlegene Stratege nicht mehr auf der Gipfelhöhe einer vollen Kraft? Oder sind es doch vielleicht - in seiner Lage - richtige Erwägungen gewesen, die ihn wie einst bei Eylau abhielten, das Äußerste zu wagen: die Rücksicht Cäsars auf seine 10. Legion, auf den kernhaftesten Teil des reißend dahinschmelzenden Heeres?
Wir müssen es uns versagen, diese Fragen hier des näheren zu untersuchen. Jedenfalls hatte Napoleon nur einen halben Erfolg errungen, und wenn auch die Russen mit erheblich größeren Verlusten2 abgezogen waren, so konnte doch ihr neuer Führer Kutusow ziemlich unangefochten durch Moskau zurückgehen, um alsbald bei Tarutino eine für die Franzosen höchst unangenehme Flankenstellung einzunehmen, um so gefährlicher, als der Russe die Waffenfabriken von Tula in erreichbarer Nähe hatte und in der Lage war, sich durch neue Zuzüge fortwährend zu verstärken.
Aber der Weg nach der Zarenstadt stand dem französischen Heere nunmehr offen. „Moskau, Moskau!“ war der Ruf, der von allen Seiten erscholl, als der überraschte Blick von der Höhe des Grußberges zu der Riesenstadt hinüberflog, die mit den seltsamen Bauten ihrer von goldenen und silbernen Kuppeln und wunderlich geformten Zwiebeldächern überragten Kirchen einen märchenhaften Eindruck machte, während die langen Schlösserreihen des Kreml drohend dreinschauten - ein imponierendes Abbild der unheimlichen Größe dieses weiten Reiches, das nur allzubald das Grab des französischen Heeres werden sollte.
Und unheimlich war alles, was man hier sehen sollte: öde, leere Straßen, in denen sich nur wenige Einwohner zeigten, und verschlossene Häuser, die erbrochen werden mußten, um zu den asiatischen Reichtümern des Innern zu gelangen. Bald züngelten Flammen aus ihnen hervor, ein leuchtendes Menetekel, das den Eroberern die Fülle des Hasses zeigte, der in der abgrundtiefen Seele dieses Slavenvolkes und seiner Führer lohte - denn daß die Russen selber Moskau angezündet, war den Denkenden im Heere alsbald ebenso klar, wie sie mit Grauen der Gedanke erfüllen mußte, daß man die Zerstörung des nationalen Heiligtums den Gegnern in die Schuhe schieben und sie die Schuld dafür bezahlen lassen würde, wenn das Glücksrad eine entschiedene Drehung zu deren Ungunsten zeigen würde. Und das stand zu erwarten, sobald der natürliche Bundesgenosse der Moskowiter, der Winter, herankam.
Der Brand von Moskau bildet den Gipfelpunkt der Tragödie von 1812. Die Verwicklung hat ihre Höhe erreicht: zum erstenmal in seinem Leben war Napoleon in eine Lage geraten, in der er nicht vorwärts noch rückwärts konnte. Moskau aufgeben und ungesäumt den Rückmarsch antreten - was immerhin das Ratsamste gewesen wäre - schien ihm, abgesehen von den unzweifelhaften Regungen seiner siegesstolzen Seele, die sich dagegen sträuben mußte, auch aus dem durchaus logischen Grunde untunlich, weil ein Rückzug dem Eingeständnis einer verfehlten Unternehmung gleichkommen mußte und politisch recht bedenkliche Folgen für ihn haben konnte. So suchte Napoleon einen anderen Ausweg, der ihm nicht leicht geworden sein mag: er versuchte, mit dem Zaren anzuknüpfen, und tat selbst den ersten Schritt zu Friedensverhandlungen, bei denen ihn die Russen, denen ihr Ziel längst offen vor Augen lag, so lange hinzuziehen wußten, bis es für Napoleon zu spät war.
Der Franzosenkaiser täuschte sich in der „shakespearischen“ Seele Alexanders; er täuschte sich vor allem in der Macht der Einflüsse, die auf den Zaren einwirkten, in der Energie der nationalen Instinkte, die jenem sein Handeln geradezu vorschrieben. All das wird man gern unterschreiben; aber seltsam erscheint die Behauptung, daß er sich inzwischen gegen die Mahnungen einer besseren Erkenntnis in vulgärer Weise habe betäuben wollen. Keinesfalls kann das, wie wohl gesagt worden ist, durch den Besuch der Vorstellungen einer in Moskau spielenden französischen Theatertruppe geschehen sein, denen er, im Gegenteil, wie ein Augenzeuge, der Palastpräfekt de Bausset, ausdrücklich hervorhebt, niemals beigewohnt hat.3
Vielleicht mehr als solche Vorwürfe dürfte ein anderer angebracht sein, den schon der berühmte Chefarzt des französischen Heeres Larrey in seinen Memoiren erhoben hat. Larrey weist auf die reichen Vorräte an Tuchen und besonders an Pelzwerk hin, die sich in den Moskauer Gewölben auch nach dem Brande noch fanden und die man, statt sie dem Raube der Einzelnen zu überlassen, systematisch hätte verarbeiten und unter die Truppen verteilen lassen sollen - ein praktischer Gedanke des hervorragenden Chirurgen, dessen Ausführung von unberechenbarem Nutzen hätte werden können.
Daß auch mit den Lebensmitteln anders hätte gewirtschaftet werden sollen, ist selbstverständlich - aber was wollte der Kaiser tun? Es ist dies einer der Fälle, wo sich zeigt, wie bald die Macht des Mächtigsten ihre Grenzen hat. Die Plünderung der unermeßlich reichen Stadt, anfangs verboten, wurde nach dem Brande freigegeben. Was war gegen die entfesselte Soldateska auszurichten, die sich in die Keller stürzte und sich in den kostbarsten Weinen und Likören sinnlos berauschte! „Hier herrschte ein Durcheinander, wie ich es noch nie gesehen“, schreibt der westfälische Musikmeister Friedrich Klinkhardt. „Es war ein Jammer, das ansehen zu müssen“, klagt der Hauptmann Coignet. „Der unerwartete Überfluß“, sagt der Mediziner Larrey, „verdarb die Kriegszucht und die Gesundheit dieser unmäßigen Menschen.“ Auch der Artillerieoberst Pion des Loches, damals Kapitän, erzählt die unglaublichsten Dinge über die Zügellosigkeit und den Unverstand der Plünderer. „Punsch und Glühwein fließen in Strömen in silberne Becher“, notiert der Gardemajor Fantin des Odoards in sein Journal. Ein anderer Offizier, de Mailly-Nesle, sah, wie im Kreml die Grenadiere statt der Gewehre mit Suppenlöffeln auf Posten zogen. In den Wachtstuben lagen Töpfe voll der ausgesuchtesten Konfitüren und Haufen von Flakons und Flaschen, denen man der Einfachheit halber die Hälse abschlug. Freilich setzt dieser Berichterstatter halb entschuldigend hinzu: „ Die armen Teufel hatten so viel Hunger und Durst gelitten, daß mir bei dieser Gelegenheit Nachsicht wie eine Art von Gerechtigkeit vorkam.“ Und wer wird seine Ansicht nicht teilen, nicht wenigstens begreifen, wenn er daran denkt, wie teuer diese Unglücklichen die Moskauer Festtage bezahlen mußten und daß ohnedies die Feinde selber durch die Einäscherung der Stadt den Soldaten das Signal zur Plünderung gegeben hatten?
Wenn es Napoleon unmöglich war, den zentrifugalen Tendenzen, die schon damals sein Heer aus den Fugen zu sprengen drohten, scharf entgegenzutreten, ja, wenn es vielleicht nicht einmal geraten erscheinen mochte, in dieser Lage die überschäumende Lebenslust des Troupiers allzu stark zu dämpfen, so ist es schwieriger zu erklären, weshalb der große Stratege den Rückzug, mit dessen Eventualität er immer rechnen mußte und den er seit Anfang Oktober planmäßig überlegte, in der Weise und auf der Straße ausführt, die er tatsächlich eingeschlagen hat. Alles in allem boten sich ihm dafür drei Möglichkeiten dar: entweder konnte er über Bjeloi und Welikija-Luki nach Witebsk marschieren, ein Projekt, das insofern etwas Verlockendes haben mochte, als er sich auf diesem Marsche St. Petersburg erheblich genähert hätte. Aus welchen Gründen er den Plan verworfen, vermag ich nicht anzugeben. Was dafür angeführt wird, z. B. „daß ihm diese Marschrichtung zu furchtsam und seiner unwürdig vorgekommen (Beitzke)“, scheint mir wenig stichhaltig zu sein.4 Dann gab es zwei andere Wege, die beide über Smolensk zurückführten. Der eine war die Moskau-Smolensker Straße, die er gekommen war, gefährlich wegen des Zustandes der schon auf dem Hinmarsche fast gänzlich ausgesogenen Gegenden; doch glaubte man auf etwa 14 Tage Proviant von Moskau mitnehmen zu können, und zudem war es die Etappenstraße, auf der sich an mehreren Orten Magazine und Munitionsvorräte befanden. Aber wie, wenn diese nicht in wünschenswerter Ordnung waren oder von den inzwischen in Massen aufgebotenen Kosaken geplündert wurden? Blieb der dritte Weg, der in südwestlicher Richtung ebenfalls nach Smolensk, aber über Kaluga führte, wie der zuerst genannte durch fruchtbare, vom Kriege unberührte Gegenden. Nach Kaluga gingen zwei Straßen, die alte, ziemlich gerade nach Süden laufende und eine andere, die mehr westlich führte. Die letztere bot den Vorteil, daß man von ihr aus, auch wenn Kaluga nicht zu erreichen war, noch weiter westwärts über Juchnow-Jelnja marschieren und auf diesem Wege gleichfalls Smolensk gewinnen konnte, wiederum ohne die verheerten Landschaften zwischen Moskau und der Stadt am Dnjepr noch einmal durchqueren zu müssen.
Der Weg nach Juchnow biegt von der neuen Kalugaer Straße in Malojaroslawez ab, der hochgelegenen, das Tal der Luscha beherrschenden Stadt. Diese mußte daher das französische Heer vor allem zu gewinnen suchen, wenn es auf Kaluga wollte. Hierzu aber hatte sich Napoleon entschlossen, als er am 19. Oktober aus der Zarenstadt endlich aufbrach. Bei Malojaroslawez kam es daher zu einer ersten größeren Schlacht, die allerdings, nach einem fürchterlichen Blutbade, mit der Behauptung des Ortes durch die Franzosen endete, aber den Kaiser bewog umzukehren und über Moshaisk an dem alten Schlachtfeld von Borodino vorüber wieder in die Moskau-Smolensker Straße einzubiegen.
Lange Erwägungen, Rekognoszierungen, auf deren einer Napoleon selbst in Gefahr geriet, von Kosaken aufgehoben zu werden, und Beratungen mit seinen Unterführern waren dem folgenschweren Entschlusse vorausgegangen. Ségur mit seiner glänzenden Feder hat die Szene in der armseligen Hütte des Webers von Gorodnja ausgemalt, wo zum letztenmal die Würfel über Sein oder Nichtsein des französischen Heeres geworfen wurden, und wenn auch, wie oft bei diesem Schriftsteller, in den Einzelheiten nicht stichhaltig, so ist doch das Bild im ganzen wohl richtig getroffen, und daß der Kaiser in dieser verhängnisvollen Stunde seinen Generalen nachgab, hat sein Schicksal und das der Seinen besiegelt.5 Was Napoleon bewog, den unglücklichsten aller Entschlüsse zu fassen, war neben dem Zureden fast aller seiner Unterfeldherren die Befürchtung, den Weg nach Kaluga nur durch eine neue Schlacht erzwingen zu können, die er mit seinem erschütterten Heere nicht mehr wagte und die ihm neben den 3-4000 bei Malojaroslawez Verwundeten eine neue Masse Blessierter und verstümmelter Menschen auf den Hals geladen haben würde. Und doch erscheint trotz dieser an sich haltbaren Gründe der Blick des genialen Heerführers umschleiert. Denn Kutusow, der russische Fabius Cunctator, dem der alte Schrecken von Austerlitz und der neue von Borodino noch gehörig in den Gliedern saß, empfand einen gewaltigen Respekt vor der geistigen Superiorität seines Gegners und ist diesen auch während der ganzen Kampagne nicht losgeworden. So hat er sich auch nach Malojaroslawez - der Tag hatte ihm beiläufig 8000 seiner Russen gekostet - zurückgezogen, und es kam der im Kriege bisweilen eintretende Fall vor, daß zwei Gegner einander den Rücken wenden. Höchstwahrscheinlich hätte Napoleon, wenn auch nicht ohne eine neue Schlacht, auf Kaluga durchbrechen, so doch an Kutusow vorüber auf dem vorhergenannten Wege über Juchnow und Jelnja ziehen und seinem Heere den entmutigenden Anblick des mit verwesten Leichen bedeckten Schlachtfeldes und den schrecklichen Weg auf der Moskau-Smolensker Straße ersparen können, wo nur die halbzerstörten Städte Gshatsk, Wjasma und Dorogobush Haltepunkte zu kurzer, schwererkämpfter Rast bieten sollten. „Kutusow“, sagt ein Adjutant des russischen Feldmarschalls, der spätere General Löwenstern, sehr verständig, „würde ihn auf diesem Wege nicht mehr beunruhigt haben wie auf dem anderen.“
Durch den Zug nach Süden hatte Napoleon eine kostbare Zeit verloren. Er suchte jetzt in Eilmärschen auf die große Straße zurückzukommen. Schon begann Unordnung in dem Heere einzureißen. Man muß, um das zu verstehen, die Eigenart dieser Armee kennen, die sich von Napoleons früheren Heeren nicht unwesentlich unterschied. Einst hatte der General Bonaparte in Siegesflügen die Länder erobert, und auch der Kaiser hatte die großen Erfolge der Kampagnen von 1805 und 1806 zum guten Teil der Schnelligkeit seiner Bewegungen zu verdanken gehabt. Seit dieser Zeit hatte das französische Heer an Qualität verloren, wenn es an zahlenmäßiger Größe gewann. Der ungeheure Menschenverbrauch der napoleonischen Feldzüge mußte sich mit den Jahren rächen. Seine alten Kerntruppen waren großenteils gefallen oder dienstunbrauchbar geworden. Dazu kam, daß bei dem ungesunden Anschwellen des Reichskörpers wie einst im Römerreiche die „Bundesgenossen“, einen immer stärker werdenden Bruchteil des Heeres ausmachten. Bei der großen Armee von 1812 betrugen sie mehr als die Hälfte, diese Deutschen aller Kleinstaaten, diese Preußen und Österreicher, Polen, Schweizer und Holländer, die dunklen Spanier und die braunen Portugiesen, diese Illyrier, Piemontesen und Neapolitaner, Menschen verschiedenster Gesinnung und Gesittung, die nur teilweise dem großen Imperator gerne folgten, und unter denen auch die Vielsprachigkeit mancherlei Verwirrung anrichten mußte. Schon in den früheren Phasen des Feldzugs hatte das Heimweh unter ihnen Opfer erfordert. Man mag es bei Marbot, der mit einem Truppenteil des linken Flügels an der Düna stehen geblieben war, lesen, wie viele der Deutschen lebensmüde in den Lazaretten nach dem „Sterbezimmer“ verlangten, in dem sie sich aufs Stroh hinstreckten, um nicht wieder aufzustehen. Die nach Moskau gezogen und dort glücklich angekommen waren, hatten tapfer mitgezecht und mitgefeiert; aber die besseren Instinkte des Menschen waren es nicht, die durch alkoholreiche Getränke und den ungewohnten Anblick fabelhafter Reichtümer dort in ihnen erweckt waren. Verständnislos schleppten sie diese Dinge mit, alles durcheinander, Kaschmirschals und Pelzpelissen, deren Reste in den letzten schweren Wochen wohl noch manchen vor dem Tode des Erfrierens retteten; aber auch Bilder, Bücher, Schmuck- und Nippsachen, Gold und Silber, oder was sie dafür ansahen, hatten sie in die Tornister gestopft. Wer Pferd und Wagen besaß, besonders die Offiziere, hatte sie damit beladen. Dazu kam eine Menge in Moskau ansässiger französischer Familien, die, mit Grund den Haß der Russen fürchtend, im Gefolge des Heeres die Stadt mit Kind und Kegel und ihrer wertvollsten Habe verlassen hatten. Endlich die zahllosen Bedienten, Marketender und Marketenderinnen und ein Schwarm von Offiziersdamen und -liebchen, Soldatenweibern und ähnlichen Lebewesen. So folgte ein anfangs meilenlanger Schweif dem Heere, der dessen Bewegungen verlangsamen und hemmen, seine Schlagfertigkeit vermindern und das Verderben des Ganzen beschleunigen mußte.
Auch in bezug auf Bewehrung und Bewaffnung war das Heer äußerst schwerfällig geworden. Anfangs führte es noch über 500 Geschütze und eine entsprechende Anzahl von Munitionswagen mit sich. Wenn nun auf der einen Seite den Geniegeneralen Eblé und Lariboisière, die beide Opfer des Feldzugs geworden sind, nachgerühmt wird, daß es dank ihrer Fürsorge der Armee in den Kämpfen, die sie zu bestehen hatte, an Munition eigentlich niemals gefehlt hat, so wird man anderseits zugestehen dürfen, daß die Menge des artilleristischen Materials eine neue Last war, die das kleiner gewordene und immer kleiner werdende Heer nur beschwerte, um so unnützer, als dieses Material an den Etappenorten ergänzt werden konnte und wirklich ergänzt worden ist. Schon in den ersten Wochen mußten Hunderte von Geschützen zurückgelassen werden, die man anfangs noch vernagelte, später einfach stehen ließ, und Hunderte von Caissons flogen in die Luft. Man versteht den Jammer braver Artilleristen, die ihre abgetriebenen Pferde über jede Höhe peitschen mußten, bis sie zusammenbrachen und die prächtigen Geschütze nun doch in Feindeshände fielen.
Daß die Pferde so frühe marode wurden, hatte seine guten Gründe. Schon an sich ist der Franzose nicht gerade musterhaft in der Behandlung dieses intelligenten Tieres. Auch Napoleon war kein Kavallerist, und so mag ihm ein Umstand entgangen sein, der, an sich anscheinend geringfügig, von den weittragendsten Folgen werden sollte. Wie manches andere, so war auch der Hufbeschlag der französischen Pferde nicht auf den Winter berechnet, da die Tiere weder Eiskrampen noch geschärfte Hufe hatten. Obwohl erst neuerdings ein deutscher Schriftsteller6 hiergegen eifrig polemisiert hat, darf die Behauptung aufrecht erhalten werden, daß dieser Umstand neben dem Fouragemangel wesentlich dazu beigetragen hat, die ohnehin schon schwer erschütterte Kavallerie vorzeitig zu vernichten. Alle sachverständigen Offiziere, besonders Kavalleristen und Artilleristen, von französischer Seite die Obersten Griois und Marbot, von Deutschen der badische Graf Hochberg und der westfälische Hauptmann Borcke, auf russischer Seite der erwähnte Löwenstern, unter den Polen Kapitän Warchot und der bekannte Graf Soltyk, sind einstimmig in der Beurteilung dieses Punktes, und der letztere behauptet, daß die abweichend von der französischen ausgerüstete polnische Artillerie zwei volle Drittel ihres Geschützbestandes nach Warschau zurückgebracht habe. Das mag etwas übertrieben sein, sicher aber ist, daß das frühzeitige Hinsinken der Pferde Tausende und Abertausende unglücklicher Soldaten den Piken der umherschwärmenden Kosaken überliefert hat, die an sich keineswegs so gefährlich waren und deren Nachkommen im russisch-japanischen Kriege bekanntlich ganz und gar versagt haben.
Der Verlust der Pferde hatte nun freilich die eine günstige Folge, daß das Fleisch der massenhaft fallenden Tiere zur Nahrung für die Menschen wurde, die, als die von Moskau mitgenommenen Vorräte auf die Neige gingen, bitteren Mangel zu leiden begannen. Was die kleineren Etappenorte an Vorräten boten, wurde, soweit es nicht ohnehin von vorauseilen den Kosaken schon geplündert war, von den ersten Truppen, zumal der Garde, schnell aufgezehrt, so daß die folgenden Korps, besonders die fast beständig mit dem nachsetzenden Feinde kämpfende Nachhut, fast nichts bekamen. So war man neben kümmerlichen Kartoffeln, Korn-, Mehlresten und Abfällen ganz wesentlich auf das Fleisch der Pferde angewiesen, das am Biwakfeuer geröstet, ja, bei der steigenden Not selbst in rohem Zustande verschlungen wurde. Auch das Blut wurde gierig getrunken. Man ließ die Tiere zur Ader, man schnitt und riß von den noch lebenden Stücke ab, während die armen Geschöpfe, wie ein württembergischer Offizier, Christoph von Yelin, schaudernd berichtet, „mit weit auseinanderstehenden Füßen, oft an allen Seiten blutend, zitternd und betäubt, noch stehend zu sehen waren, bis sie endeten und zusammenstürzten.“ Die Nationalfranzosen, erzählt derselbe Zeuge, waren vor allem auf die Zungen versessen, und auch diese wurden den Pferden oft bei lebendigem Leibe aus den Mäulern geschnitten.
Leider wird der Leser noch viel Schlimmeres zu hören bekommen. Bis Anfang November war das Wetter verhältnismäßig milde gewesen. Gegen den 5. schlug die Witterung um; es trat lebhafter, bald starker Frost ein. An Unterkunft in Ortschaften war wenig zu denken. Zumal die nachziehenden Truppenteile fanden in der Regel nichts als rauchende Trümmer, da Städte und Dörfer von den Vorausmarschierenden gänzlich verbrannt wurden. Das soll anfangs, um dem nachrückenden Feinde Abbruch zu tun, auf Befehl erfolgt sein, der später aus naheliegenden Gründen zurückgenommen wurde. Aber die Arrieregarden waren darum kaum besser dran; denn bei der Sorglosigkeit der Soldaten und der immer steigenden Not war an irgendwelche Schonung und Rücksicht auf andere nicht zu denken. Fenster, Türen, Pfosten und Balken flogen in die Biwakfeuer; die Dächer der Häuser und Scheunen wurden abgetragen, so daß diejenigen, die sich hineingeflüchtet, oft mitten in der Nacht unter freiem Himmel erwachten. Ein noch schlimmeres Los wurde den Insassen zuteil, wenn die von ihnen in den Stuben und auf den Tennen angezündeten Feuer die Häuser selbst in Brand setzten und die Todmüden und Schlaftrunkenen nicht rechtzeitig erwachten. Eine der gräßlichsten Szenen dieser Art findet sich in den Aufzeichnungen des Sergeanten Bourgogne.7 Es ist der Brand eines an der großen Heerstraße inmitten eines Waldes gelegenen Posthauses, in dem sich eine Anzahl Soldaten zusammengefunden hatte. Um gegen lästige Eindringlinge sicher zu sein, hatten sie die Eingangstore fest verrammelt. Ihre Selbstsucht sollten sie mit qualvollem Tode büßen. Denn beim Ausbruch des Feuers hinderten die vorgelegten Querbalken die Öffnung der Tore, so daß fast sämtliche Insassen des Gebäudes unter fürchterlichem Geheul verbrannten. Der Fall war keineswegs vereinzelt; eine Menge Menschen sind auf ähnliche Weise umgekommen, und auch der berühmte Doktor Larrey ist nur mit Mühe und Not dem Feuertode entgangen.
Schrecklich klingt die Anklage eines Offiziers der Rheinbundstruppen: daß die Hütten oft von böswilligen Neidern absichtlich angezündet worden wären, „um die drinnen befindlichen Glücklichen auszuräuchern.“
Täglich wuchs die Zahl der „Isolierten“ und Nachzügler, d. h. der Leute, „die ihre Reihen verlassen hatten, um sich dem Dienste gegen den Feind zu entziehen und durch Ausplünderung der Landesbewohner und vorzüglich der in das Gedränge gekommenen Wagen der Armee ihre Habsucht zu befriedigen.“ Freilich hatten schon Elend und Krankheit den meisten unter ihnen die Waffe aus der Hand gewunden. Truppweise zusammenlebend, auch einzeln ihres Weges wandernd, fanden sie sich allabendlich an den Biwakfeuern ein, um ihre zusammengesuchten, meist geraubten und noch öfter gestohlenen Vorräte zu kochen und zu verzehren. Wohl selten ist mit größerem Raffinement gestohlen worden als im russischen Feldzuge. Fünf Pelze hat sich deshalb Oberst Griois nacheinander auf dem Rückzuge kaufen müssen. Man schnitt den Reitern die Mantelsäcke ab, während sie auf den Pferden saßen. Ja, es kam vor, daß ein Kavallerist oder Bedienter, der ein Offizierspferd hinter sich am Zügel führte, mit den leeren Zügeln über dem Arme dastand, während das Rößlein spurlos verschwunden war. Auch förmliche Räuberbanden bildeten sich aus den Isolierten. Der wackere Bourgogne war einmal in Smolensk in Gefahr, von einer solchen ermordet zu werden.
Nun würde es ein unrichtiges Bild ergeben, wenn man nach diesen Armseligen, zu deren Entschuldigung sich ja auch so vieles sagen läßt, die Armee als solche beurteilen wollte. Mit bewundernswerter Ausdauer hat ein großer Teil derselben - bis Smolensk etwa die Hälfte - bei den Fahnen ausgehalten. Neben der Garde besonders das 3. Korps unter dem heldenmütigen Ney, das meist die Nachhut bildete und nachher so glorreich unterging.
War es schon an sich ein Großes, bei schwindender Kraft wochenlang in täglich erneuertem Kampfe mit einem weit überlegenen, kräftigen und wohlgenährten Feinde sich zu schlagen, so wurde das Heldentum dieser Menschen durch die begleitenden Umstände zu wahrhaft übermenschlicher Größe erhoben. Kaum vermochten die verklammten Finger der Kämpfer die eiskalten Gewehre zu umfassen. Was stürzte, war mit nahezu absoluter Gewißheit dem Erfrieren verfallen. Schon leichtere Verwundungen wurden bei der Temperatur und dem fast gänzlichen Mangel an Verbandzeug und Pflege in der Regel tödlich. Das schrecklichste Los aber wartete der Unglücklichen, die in die Gewalt des Feindes fielen. Unersättlich war die Rache des infolge der Verwüstungen erbitterten und durch die fanatischen Proklamationen aufgestachelten Landvolkes. In und bei den Orten, wo auf der Rückzugsstraße gekämpft war, wurden wahre Orgien der scheußlichsten Blutgier gefeiert. Die moskowitische Bestie wetteiferte an Grausamkeit mit der spanischen. Nach einem Kampfe bei Wjasma, wo sich der „russische Murat“, Miloradowitsch, mit Eugen Beauharnais geschlagen hatte, stießen auf der Straße reitende russische Generale auf eine Schar von Bauernweibern, „die mit Stöcken in der Hand um einen gefällten Kieferstamm tanzten, zu dessen beiden Seiten ungefähr sechzig nackte Gefangene auf dem Boden, mit den Köpfen aber auf dem Baumstamm lagen, auf welche die Furien nach dem Takt eines Nationalliedes, das sie heulten, mit den Knitteln losschlugen, während mehrere hundert bewaffnete Bauern als Wächter dieser schrecklichen Orgie ruhig zusahen. Als sich die Reiter näherten, stießen die Gequälten ein herzzerreißendes Gejammer aus und schrien unaufhörlich: la mort, la mort!“ Dies ist die wörtliche Wiedergabe der Erzählung eines Augenzeugen, des Engländers Wilson, der im Gefolge Kutusows den Krieg mitmachte. Derselbe Gewährsmann berichtet, daß die Bauern Gefangene lebendig begraben hätten, daß aber die französischen Soldaten durch keine Drohung und Marter dahin zu bringen gewesen wären, beleidigende Worte über ihren Kaiser auszusprechen. Fast menschlich im Vergleich zu diesen Teufeleien erscheint ein Blutbad in einer Vorstadt von Dorogobush, wo nach dem Einrücken der Russen die Bürger die vor Schwäche und Wunden zurückgebliebenen Franzosen mit dem blanken Messer dutzendweise abschlachteten. Ähnliches geschah fast überall nach dem Abzug der letzten Verteidiger. Auch in Smolensk wurden die zurückgebliebenen Marodeurs, Kranken und Verwundeten von den Einwohnern zu Tausenden ermordet.
Die Kosaken verkauften ihre Gefangenen - Stück für Stück um einen Rubel - an die vertierten Bauern, die in der geschilderten Weise, mit Variationen natürlich, ihre wütende Rachsucht befriedigten. Das wurde später verboten; aber - „der Zar ist weit“, sagt ein russisches Sprichwort. Und war das Schicksal der übrigen Gefangenen, denen dieses Äußerste erspart blieb, wesentlich besser? Bis aufs Hemde ausgeplündert, wurden sie von den wilden Steppensöhnen mit Knutenhieben und Pikenstichen mißhandelt, viele zu Tode gepeitscht. Einen meiner rheinischen Landsleute, den vor einigen zwanzig Jahren in der Aachener Gegend verstorbenen Oberstleutnant Koch, rettete nur ein auf seiner Brust eingeätztes Kreuz vor dieser furchtbaren Todesart.
Wer die ersten Mißhandlungen überdauert hatte, dem stand das Los bevor, ins Innere des Landes, nach Orel, Perm, Saratow oder gar über den Ural hinaus nach Sibirien transportiert zu werden, in der Weise, wie man in Rußland Gefangene zu transportieren pflegt. Der französische General Pouget mußte mit ansehen, daß seine unglücklichen Landsleute, an Stangen gebunden, die Schwachen und Erschöpften in der Mitte, wie eine Viehherde über die Landstraßen getrieben wurden. Wer nicht weiter konnte, wurde ohne weitere Umstände niedergestochen. Die eisigen Nächte mußten sie in ungeheizten Räumen, Ställen, Scheunen, leeren Fabriken oder gar im Freien zubringen, zu Hunderten an den kalten Mauern zusammengepreßt, Lebende, Sterbende, Leichen, alles durcheinander. Auch viele unserer deutschen Landsleute verfielen dem traurigen Lose; der westfälische Offizier W. von Conrady, der nach Orel geschleppt wurde, erzählt, daß auf dem Marsch von Kaluga nach dieser Stadt über 400 Mann hingemordet und erfroren wären, und Förster Fleck, ein Hannoveraner, der mit etwa 2800 Leidensgefährten an der Beresina gefangen war, gibt an, daß diese bis auf ein winziges Häuflein in ähnlicher Weise umgekommen seien.
Da war es wohl in jeder Hinsicht besser, tapfer kämpfend mit den Waffen in der Hand zu sterben! So dachte auch der Marschall Ney, dessen Bild sich hier mit zwingender Gewalt wieder in diese Zeilen drängt. Smolensk ist vorüber, die von dem leidenden Heere heiß herbeigesehnte „Stadt der heiligen Jungfrau“, wo die Krieger Rast und Erholung erwartet und wo man ihnen Lebensmittel aus den Magazinen versprochen hatte. Getäuschte Hoffnung! Die französische Intendantur versagte in diesem Kriege noch weit mehr als die Heeresleitung. Erstens waren die Vorräte nicht in der erwarteten Menge da, und zudem wurde bei deren Austeilung mit solchem Formalismus verfahren, daß die Hungrigen, des Wartens müde, die Speicher erbrachen, das meiste verstreut ward und nur wenige in den Genuß ausreichender Nahrungsmittel kamen. Dann war die Armee weitergezogen; das Wetter war etwas milder geworden; aber bei Krasnoi hatten die Russen wieder angegriffen und sich zwischen die in Abständen marschierenden Abteilungen zu schieben gesucht. Da machte Napoleon kehrt, und es gelang ihm, die Korps von Eugen und Davout zu sich heranzuziehen. Noch einmal hatte die junge Garde Wunder der Tapferkeit getan. Nur der zuletzt marschierende Ney blieb abgeschnitten.
Jetzt entschloß sich dieser, um den Dnjepr zwischen sich und den Feind zu bringen, zur Überschreitung des halbzugefrorenen Stromes. Der vom Kampf noch blutbedeckte Oberst Pelet soll den Rat zu dem waghalsigen Zuge gegeben haben. So erzählt General Freytag, einer von denen, die dabeigewesen sind. Ein hinkender Bauer zeigt den Weg zu dem Flusse, dessen trügerische Eisdecke, stellenweise mit Wasser überlaufen, im Dunkel des Abends unheimlich daliegt. Man kommt in ein Uferdorf, wo bis Mitternacht gerastet wird. Ein aus Rüben bereiteter Trank ist die einzige Erquickung der tapferen Schar. Ein polnischer Offizier wagt sich über den Fluß. Er kommt mit der Meldung zurück, daß die Eisdecke hält. Langsam bewegt sich der Zug über die schwankende Fläche. Manche versinken in den Spalten; gellende Hilferufe schallen durch die Nacht. Aber der Marschall kommt drüben an - ohne Geschütz und Pferde - um aufs neue auf feindliche Abteilungen zu stoßen. Vergebens läßt ihn Miloradowitsch auffordern, die Waffen niederzulegen. „Ein Marschall von Frankreich ergibt sich nicht“, lautet die Antwort des stolzen Kriegers. Mit List und Geschick weiß er sich den Russen zu entziehen. Tagelang dauern die Manöver. Die Patronen gehen aus. „Man muß sein Leben so teuer wie möglich verkaufen“, sagt der Marschall zu Freytag, der ihn auf den Munitionsmangel hinweist. In der zweiten Nacht geht er mitten durch die Feinde. Napoleon ist schon über Orscha hinaus, in Barany, wo er mit Lefebvre gerade sein Mittagsmahl einnimmt. Da meldet ihm sein Ordonnanzoffizier Gourgaud das Erscheinen von Offizieren, die verkünden, daß der Held von der Moskwa heranrückt und eben Eugen mit den Trümmern seines Korps zu seiner Aufnahme entgegenzieht. „Ist es wirklich wahr, sind Sie Ihrer Sache gewiß?“ ruft der Kaiser Gourgaud entgegen, und dann, als jener es nochmals versichert, soll Napoleon die lapidaren Worte gesprochen haben: „Ich habe zweihundert Millionen in den Kellern der Tuilerien, ich hätte sie hingegeben, um den Marschall Ney zu retten.“ 900 Tapfere brachte Ney von seinem fabelhaften Zuge zurück; erst jenseits der Beresina hat das 3. Korps seine ruhmvolle Laufbahn beschlossen.
Der Übergang über diesen Fluß ist so oft zum Gegenstande historischer, belletristischer, auch poetischer Darstellung gemacht worden, daß ich unterlassen darf, zu den neunundneunzig Berichten den hundertsten zu schreiben. Ein paar Striche aber mögen doch angebracht sein, um den Leser zu orientieren und vielleicht auch wieder einige falsche Vorstellungen hinwegzuwischen, die sich mit dem ominösen Namen des unseligen Gewässers zu vergesellschaften pflegen.
Noch ein besonderer Grund aber macht es dem Herausgeber des Roosschen Buches zur Pflicht, bei dem Übergang über die Beresina einen Augenblick zu verweilen. Das ist der Umstand, daß der Schreiber dieser Erinnerungen zu denen gehörte, die an dem Flusse gefangen wurden.
Gar mancher ist von der Jugendlektüre her gewöhnt, sich die Ereignisse des 26./29. November lediglich als ein wüstes Gewirr von flüchtenden Menschen, zerstörtem Geräte, ertrinkenden Weibern und Kindern zu denken. Unnötig zu sagen, daß in der Regel das „Gottesgericht“ dabei wieder eine große Rolle spielt, daß die Franzosen - nebenbei gesagt, waren gerade an der Beresina die „Bundesgenossen“, Schweizer, Polen, holländische und deutsche Regimenter stark beteiligt - eine völlige Niederlage erleiden, Napoleon den Lohn seiner Sünden empfängt, aber am Ende noch niederträchtig genug ist, seine unglücklichen Gefährten den Flammen einer auf Befehl zerstörten Brücke und der Wut der russischen Barbaren zu überantworten.
Kritisch betrachtet, hat die Sache doch ein etwas anderes Ansehen. Die Schlacht an der Beresina war ein Sieg der Franzosen und ein Waffengang, der, die ungleiche physische und numerische Stärke beider Gegner gerechnet, unter die stolzesten Ruhmestaten der großen Armee und ihres Führers gezählt werden muß. So manchen verhängnisvollen Fehler der Kaiser Napoleon während des Krieges begangen: als Feldherr war er, angesichts der größten Gefahr, die ihn bedrohte, wieder ganz der General von 1796, der mit seinen Republikanerhorden in der lombardischen Ebene vier österreichische Armeen mattgelegt hatte.
Bekanntlich hatten die Russen, ihrem von den Umständen diktierten Plan entsprechend, nichts Geringeres im Sinn, als den Kaiser mit dem gesamten Reste seines Heeres gefangenzunehmen. Während die große Armee, von Kutusow verfolgt, in ihrem elenden Zustand sich der Beresina näherte, waren auf den beiden Flügeln Tschitschagow von Süden, Wittgenstein von der Düna her im Anmarsch, um die Todmüden in Empfang





























