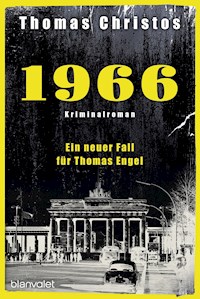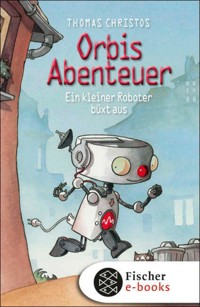9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Thomas Engel ermittelt
- Sprache: Deutsch
1965: Eine Mordserie erschüttert Düsseldorf, und die Spuren führen weit zurück und tief hinein in einen Sumpf aus alten braunen Seilschaften.
In der alten Ruine Kaiserswerth wird ein junges Mädchen tot aufgefunden. Der junge Kriminalbeamte Thomas Engel wittert seinen ersten großen Fall und stürzt sich in die Ermittlungen. Schon bald entdeckt er, dass es nicht das erste Opfer ist, das in der abgelegenen Ruine gefunden wurde. 1939 gab es schon einmal einen ähnlichen Fall. Damals schritt die Gestapo ein und ließ den Mörder hängen. Ist es Zufall, dass sich die Geschichte wiederholt? Engel hat das Gefühl, dass etwas vertuscht werden soll und gerät schnell mitten hinein in alte Seilschaften, die beste Verbindungen in höchste gesellschaftliche Kreise unterhalten.
Der Beginn einer Reihe um den jungen Kommissar Thomas Engel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Düsseldorf, 1965: Für den jungen Kommissar Thomas Engel ist die Stadt am Rhein der verheißungsvolle Beginn eines neues Lebens. Als er zum ersten Mal ein Konzert der Rolling Stones sieht, gibt es für ihn keinen Weg zurück, die Provinz liegt weit hinter ihm. Er stürzt sich in das Leben und in seine Arbeit, die ihm gleich einen spannenden Fall beschert. Ein junges Mädchen wird in der Ruine Kaiserswerth tot aufgefunden. Engel versteht nicht, dass seine Kollegen nicht gleich die Spur verfolgen, die geradewegs in die dunklen 1930er Jahre führt. Versucht man etwas vor ihm zu verheimlichen, und warum will niemand sehen, was so offensichtlich auf der Hand liegt?
Autor
Thomas Christos ist das Pseudonym des Drehbuchautors Christos Yiannopoulos. 1964 kam er als Sohn griechischer Gastarbeiter nach Deutschland. Er studierte Germanistik und Pädagogik in Düsseldorf und schrieb bereits mit 24 Jahren sein erstes Drehbuch, das auch verfilmt wurde. Danach war er hauptsächlich Drehbuchautor für das Fernsehen und wirkte an vielen erfolgreichen Produktionen mit. Unter anderem wurde er für seinen Film »Schräge Vögel« für den Adolf-Grimme-Preis nominiert. Er lebt zurzeit in Düsseldorf.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Thomas Christos
1965
Der erste Fall für Thomas Engel
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Handlung im Roman ist fiktiv, nur an einigen Stellen basiert sie auf wahren Begebenheiten. Die Gräuel, die in Polen stattgefunden haben, sind natürlich nicht erfunden. Rydni ist ein fiktiver Ort, und die Handlung in Rydni und Plowce ist fiktiv. Diese Orte stehen für viele andere reale Schauplätze, an denen die Polizeibataillone Verbrechen begangen haben.
Copyright dieser Ausgabe © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kerstin von Dobschütz und Angela Kuepper
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Reddavebatcave/Shutterstock.com und picture-alliance/dpa-Zentralbild/Reinhard Kaufhold
NG · Herstellung: eR
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24460-6V004
www.blanvalet.de
Teil 1Il Silenzio
1
Blau war die Farbe der Sehnsucht, und Weiß brachte Unheil. Aber das ahnte die zehnjährige Lotte Reimann nicht, die sich unbedingt die blaue Mütze wünschte, die noch zu ihrer Hitlerjugend-Uniform fehlte. Doch die kostete zwei Mark, und das war viel Geld für ihre Eltern, die als einfache Arbeiter jeden Pfennig zweimal umdrehen mussten, um knapp über die Runden zu kommen.
»Wir können uns die Mütze jetzt nicht leisten, die übrige Uniform war schon teuer genug«, versuchte die Mutter zu erklären. Sie und ihr Mann verstanden sowieso nicht, warum sie für den dunkelblauen Rock, die weiße Bluse und das schwarze Halstuch selbst aufkommen mussten, obwohl die Mitgliedschaft im Jungmädelbund, der Mädchenabteilung der Hitlerjugend, Pflicht war.
»Soll doch der Führer zahlen«, brummte der Vater unwillig.
»Unsere Gruppenführerin hat aber gesagt, dass man für den Führer nicht geizig sein darf, Vati!«
»Dann muss er für bessere Löhne sorgen«, schimpfte der Vater und handelte sich einen strafenden Blick seiner Frau ein. Bloß kein schlechtes Wort über den Führer vor dem Kind verlieren! Nachher würde sie etwas ausplappern und den Eltern große Schwierigkeiten bereiten. In der Hitlerjugend, so hatte sie von einer Nachbarin erfahren, brachte man den Kindern bei, dass die Gruppenführerin immer recht hatte und dann erst die Eltern. Aber die Befürchtung der Mutter war unbegründet. Lotte liebte ihre Eltern und hätte sie niemals angeschwärzt. Trotzdem wollte sie nicht auf die Mütze verzichten. Also fasste sie den Plan, die zwei Mark selbst zu verdienen. Am einfachsten ging das als Radschläger, wo man von den Passanten den einen oder anderen Groschen erturnen konnte. Das hatten Generationen von Kindern schon so gemacht, die Radschläger waren eines der Wahrzeichen der Stadt. Woher diese Tradition stammte, wussten die kleinen Turner nicht, aber das spielte auch keine Rolle, zumal viele Jungen und Mädchen diese Einnahmequelle schätzten.
Lotte ahnte nicht, dass sich an diesem Tag sehr viele Menschen in der Stadt versammelt hatten. Die NSDAP hatte zu einer Kundgebung aufgerufen. Ein Mann in brauner Uniform stand auf der Bühne und sprach vor Hunderten von Menschen. Dabei versuchte er, seinem Führer in Gestik, Tonfall und Wortwahl nachzueifern, ja, ihn zu übertreffen, was aber nur zur Folge hatte, dass er sein Idol unfreiwillig parodierte. Die versammelten Anhänger, meist Männer, merkten es nicht, weil sie es nicht merken wollten.
Als Lotte auf dem Platz eintraf, prangerte der Möchtegern-Hitler »das Weltjudentum« an, das einen Krieg gegen Deutschland anzetteln würde. »Wenn Polen nicht nachgibt, wird unser Führer die Ehre Deutschlands verteidigen! Er will keinen Krieg, aber er fürchtet ihn auch nicht!«, brüllte er der Menge zu, die seine Parolen gierig schluckte und sich daran berauschte.
Einer der Zuhörer trug einen teuren grauen Anzug, und am Revers glänzte die frisch polierte Anstecknadel der Partei. Das laute Kläffen des Gauleiters langweilte ihn. Er konnte die Hasstiraden vom Weltjudentum nicht mehr hören, weil er sie auswendig kannte. Sie interessierten ihn auch gar nicht. Er war nur gekommen, weil es ein Pflichttermin für jeden Parteigenossen war. Der Kriegsgefahr sah er gelassen entgegen. Männer seines Schlages fanden immer Wege, nicht als Kanonenfutter zu enden. Ihn plagten andere Probleme. Seit Tagen spürte er in seinem Körper diese verbotene Gier, sein dunkles Geheimnis, das er wie einen giftigen Schatz hütete. Bis jetzt war es ihm stets gelungen, dieses Feuer zu unterdrücken, und manchmal lenkte er sich im Bordell ab, aber nicht immer fanden sich Huren, die seine Wünsche erfüllen wollten und seine perversen Rollenspiele mitmachten. Er wusste, dass das Bordell keine Dauerlösung war. Irgendwann würden seine Dämonen ein erstes richtiges Opfer verlangen. Und das taten sie auch, als das Mädchen mit dem kurzen Rock und der schlichten Bluse auf dem Platz auftauchte. Es stellte sich wie eine Turnerin kerzengerade hin, streckte die Arme elegant wie eine kleine Ballerina nach oben und achtete dabei darauf, dass die Beine geschlossen waren.
Der Anblick schnürte dem Mann die Kehle zu. Er keuchte vor Erregung, was aber keinem auffiel, weil seine Parteigenossen wie hypnotisiert den Ausführungen des Gauleiters folgten. Er dagegen schritt wie in Trance auf das Mädchen zu.
Lotte wollte heute ein besonders gutes Rad hinkriegen. Sie nahm Schwung, die linke Hand ging hinunter, mit der rechten stieß sie sich kraftvoll ab. In der Luft spreizte sie ihre Beine. Auf diesen Moment hatte der Mann gewartet und gehofft.
»Bitte einen Groschen!«, rief Lotte, als sie vor dem Mann elegant zum Stehen kam.
Der versuchte, möglichst unaufgeregt zu schauen, und gab ihr den geforderten Groschen.
»Was willst du damit machen?«, presste er halbwegs normal hervor.
»Ich sammle für meine blaue Jungmädel-Mütze.«
»Der Führer wird sich freuen«, lobte der Mann ohne jede Ironie und winkte mit einer weiteren Münze. »Dann schlag noch einmal ein Rad.«
Das ließ sich das Mädchen nicht zweimal sagen. Während im Hintergrund der Gauleiter den Führer in den Himmel lobte, drehte es ein Rad nach dem anderen, und jedes Mal zahlte der Mann einen Groschen. Irgendwann hatte er vom Zusehen genug. Er brannte. Es gab nur einen Weg, um das Feuer zu löschen.
»Wie viel kostet die Mütze denn?«, fragte er sie leicht keuchend.
»Zwei Mark«, antwortete sie und steckte den letzten Groschen ein.
»Wenn du mitkommst, gebe ich dir das Geld für die Mütze«, sagte er lächelnd und holte zwei Markstücke aus seiner Brieftasche.
Die Augen der kleinen Lotte begannen zu leuchten. Endlich würde sie die Mütze bekommen! Sie würde ein vollwertiges Mitglied der Hitlerjugend sein, der Führer wäre stolz auf sie! Sie zögerte keine Sekunde, als der freundliche Mann ihr anbot: »Wir fahren mit dem Auto zu meiner Mama, und du schlägst ein paar Räder für sie. Sie hat heute Geburtstag und würde sich bestimmt sehr darüber freuen. Willst du?«
»Du hast ein Auto?«, fragte sie beeindruckt.
»Natürlich!« Er reichte ihr die Hand, und dann führte er sie ins Unglück.
Hinter ihnen bebte der Platz vor den lauten Sieg-Heil-Rufen der Menschen, die sich die Seele aus dem Leib brüllten. Es war das Jahr 1939.
2
1965 fanden in Deutschland die ersten Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg statt, im deutschen Fernsehen sorgte eine Sendung namens Beat-Club für wütende Reaktionen bei den Erwachsenen, und irgendwo am tiefsten Niederrhein zwängten sich drei Männer auf einen Hochsitz. Zwei davon, Walter Engel und Kurt Strobel, Mitte fünfzig, sahen in ihrem grünen Loden wie richtige Jäger aus, während der Dritte, der einundzwanzigjährige Thomas Engel, in Räuberzivil steckte. Thomas hasste die Jagd, er hasste auch diese Gegend, die nasskalten Wiesen, die Baumskelette und vor allem den Nebel, der nach Rinderbrühe stank. Trotzdem hast du dich hier wohlgefühlt und bist jetzt voller Schrotkugeln, sagte er in Gedanken zu dem Hasen, den sein Vater vor einer halben Stunde geschossen hatte. Er streichelte ihn sanft, als würde er noch leben. Dass Thomas mit auf die Pirsch gegangen war, hatte einen einfachen Grund. Er wollte gute Stimmung bei seinem Vater machen. Der Vater leitete die kleine Kreispolizeibehörde des Ortes, wobei sich die polizeiliche Arbeit in Grenzen hielt: Es gab gelegentlich eine Verwarnung für zu schnelles Traktorfahren oder eine Rüge für den Kellner des Dorfkrugs, wenn er aus drei angetrunkenen Gläsern Bier ein ganzes machte. Vielmehr sah Thomas’ Vater sich als Hüter der Moral und Bewahrer der Tradition, wie es ihm auch der Gemeinderat anlässlich des dreißigjährigen Dienstjubiläums in einer öffentlichen Sitzung bescheinigt hatte. Und als solcher wollte er ein Vorbild sein. Er schnitt den Rasen vor dem Haus akkurat und maß mit einem Lineal dessen Kanten ab. Unkraut wurde nicht gezupft, sondern gleich herausgebrannt. Thomas’ Mutter wischte jeden Tag die Fenster blitzblank und streifenfrei, putzte alles keimfrei mit Salmiak, und niemals hing die Wäsche schief. Für Thomas hieß es: lernen statt faulenzen. Alkohol meiden. Nicht auffallen, sondern sich anpassen. Gehorchen, statt Fragen stellen. Zur guten Erziehung gehörte es auch, dass sich der pubertierende Thomas beim Katechismusunterricht hatte anhören müssen, dass Selbstbefriedigung eine Sünde sei oder eine Geisteskrankheit. (Der Priester wohnte übrigens seit dreißig Jahren mit der Haushälterin zusammen und hatte da leicht reden.)
Das alles führte dazu, dass Thomas nur von hier wegwollte. Er hatte sein Abitur gemacht, die Stadt lockte, er musste dieser Enge entkommen. Er hatte das wochenlange Übungsschießen im Schützenverein in Kauf genommen, damit er mit seinem Vater auf die Jagd gehen konnte und der ihn akzeptierte. Mit den anderen Schützen, die in Reih und Glied und mit Tschingderassabum durch den Ort marschierten, verband ihn nichts. Sogar sein Vater, der Traditionen eigentlich liebte, hielt sich von ihnen fern. Einmal hatte er gesagt: »Das erinnert mich an das Militär, und damit habe ich nichts zu tun. Ich war immer nur Polizist!« Warum er das Militär kritisierte, behielt er für sich. »Ich war nicht bei der Wehrmacht, ich war nur Polizist. Und der Hitlerpartei bin ich auch nicht beigetreten, obwohl mich die Nazis bedrängt haben«, betonte er oft, ohne ins Detail zu gehen.
Thomas selbst wusste wenig über die Nazis und Hitler, weil der Geschichtsunterricht bei Bismarck geendet hatte. Viele Bewohner des Ortes sprachen gut über Hitler. Nicht selten hörte Thomas den Satz: »Bei Adolf wäre das nicht passiert« – wenn fahrende Zigeuner ihre Teppiche verkaufen wollten oder ein paar vorlaute Jugendliche aus dem Transistorradio »Negermusik« lauschten. Diese Gefahr hatte beim heranwachsenden Thomas allerdings nicht bestanden, denn seine Altersgenossen hatten den Sohn des Polizisten gar nicht in ihre Mitte aufgenommen. So war er ein Einzelgänger geblieben, der in seiner Bücherwelt eine Heimat gefunden hatte. Am liebsten las er Kriminalromane. Er hatte keine speziellen Helden, er mochte Sherlock Holmes genauso wie Sam Spade oder Kommissar Maigret. Aber sein größtes reales Vorbild war Kurt Strobel, den er »Onkel« nannte. Er war ganz anders als sein Vater. Er besaß Humor, lebte in der Stadt, und vor allem war er Leiter der Kriminalpolizei. Das imponierte Thomas gewaltig. So wie Kurt Strobel wollte er auch werden. Kein Dorfpolizist wie sein Vater, sondern ein echter Kriminalist, der das Böse bekämpfte.
»Aufwachen!« Sein Vater drückte Thomas unsanft das Fernglas auf die Brust. »Keine hundertfünfzig Meter, leichtes Ziel, schätze mal neunzig Kilo. Kriegst du mit einem Blattschuss hin.«
Durch das Fernglas sah Thomas eine Wildschweinbache mit ihren Frischlingen.
»Geht nicht. Schonzeit für die Bache«, kommentierte er und reichte seinem Vater das Fernglas zurück.
»Kriegt doch keiner mit, also schieß!«, drängte der Vater.
Widerwillig nahm Thomas das Gewehr und legte an. Die Bache bot zwar ein leichtes Ziel, aber er zögerte.
»Ich kann das nicht.«
»Was anderes kommt dir heute nicht mehr vor die Flinte. Mach endlich, damit wir nach Hause kommen!«
Strobel, der bis jetzt nur zugehört hatte, wandte sich an Thomas’ Vater.
»Walter, er muss doch nicht!«
»Habe ich jetzt einen Sohn oder nicht?«
»Hast du!«, schrie Thomas trotzig und drückte ab.
Durch sein Gebrüll war die Bache hochgeschreckt, aber Thomas traf dennoch. Die Frischlinge quiekten wild und wussten nicht, was sie tun sollten: wegrennen oder bei der Mutter bleiben?
»Waidmannsheil«, sagte Thomas’ Vater und machte sich sogleich daran, den Hochsitz herunterzusteigen.
Thomas ahnte, dass er sie nicht richtig getroffen hatte.
»Warte, die lebt noch«, warnte er, aber sein Vater winkte ab und eilte auf das Tier zu, gefolgt von Strobel. Thomas sollte recht behalten. Das Tier war nicht tot. Unvermittelt begann es zu kreischen, mobilisierte unerhörte Kräfte, kämpfte sich noch einmal auf die Beine und lief geradewegs auf die beiden Männer zu. Doch die Bache kam nicht weit. Sie verfing sich in ihren eigenen Eingeweiden, brüllte vor Schmerzen, spuckte literweise Blut, bis sie schließlich auf die Seite sank, um zu sterben. Statt zu flüchten, liefen die Frischlinge instinktiv zu ihrer Mutter, um Schutz zu suchen. Die wälzte sich im Todeskampf auf dem feuchten Boden und konnte ihnen nicht helfen. Vergeblich stupsten die Tierchen mit den Nasen gegen ihren Bauch, um an die Zitzen zu kommen.
»Gib ihr den Fangschuss«, befahl Walter Engel seinem Sohn. Beim Anblick des leidenden Muttertiers und der hilflosen Frischlinge wurde Thomas speiübel. Er konnte nicht hinschauen. In diesem Moment schwor er sich, nie mehr einen Schuss abzugeben.
»Los, mach schon! Sie leidet, nur weil du zu blöd bist, einen anständigen Blattschuss hinzulegen.«
Thomas brachte es nicht übers Herz.
»Sei doch endlich ein Mann!«
Strobel mischte sich erneut ein: »Walter, kümmere du dich bitte um die Frischlinge. Ich mach das hier.«
Dann lud er sein Gewehr durch, während sein Vater ein Messer hervorholte.
»Du musst den Lauf zwischen die Teller halten und dann abdrücken«, erklärte Strobel.
Thomas hielt noch immer den toten Hasen fest im Arm.
»Und wenn ich nicht treffe, dann leidet sie noch mehr.«
»Komm, ich zeig’s dir.«
Strobel presste den Lauf zwischen die Ohren des Tieres.
»Ich stellte mir immer vor, am Lauf wäre ein Bajonett. Das erleichtert das Zielen.«
Er drückte ab, und der Schuss erlöste das Tier.
»Das mit dem Bajonett habe ich von deinem Vater gelernt«, meinte er und klopfte Thomas auf die Schulter. Der wäre am liebsten weggelaufen. Das quälende Quieken der Frischlinge, die dem Messer seines Vaters nicht entrinnen konnten, war nicht zu ertragen. Strobel legte einen Arm um Thomas’ Schultern.
»Alleine würden sie doch nicht durchkommen.«
Als Thomas die tote Bache sah, die leblosen Frischlinge und seinen Vater, der das Blut vom Messer wischte, wünschte er sich zum ersten Mal in seinem Leben den gewohnten Nebel herbei, damit er das ganze Elend nicht mit anzusehen brauchte.
Während sein Vater die Bache fachgerecht zerwirkte, stand Thomas mit seinem Hasen verloren da. Sein ganzer Plan war schiefgelaufen. Statt dem Vater zu imponieren, fühlte er sich hier, auf der blutgetränkten Wiese, wie ein Versager. Strobel schien Thomas’ Stimmung nicht zu entgehen. Er wandte sich an seinen Freund: »Walter, ich gehe mal mit dem Jungen vor.«
Der Vater hatte nichts dagegen, und Thomas war froh, dass er mit dem Onkel alleine war. Unterwegs bot ihm Strobel ein Erdbeerbonbon an, das er aus einer kleinen runden Dose holte. Der Onkel liebte diese Bonbons und lutschte sie, seit Thomas denken konnte.
»Hast du dir nie überlegt, zur Kripo zu gehen?«, fragte Strobel.
Thomas sah ihn erstaunt an. Konnte er Gedanken lesen?
»Das würdest du doch gerne tun, oder?«
Thomas nickte. »Aber Vater will das bestimmt nicht.«
»Lass mich mal machen.«
Thomas konnte es kaum glauben. Das war mehr, als er je zu hoffen gewagt hätte.
»Das ist mein Geschenk zu deinem Abitur. Ich weiß, dass du dich schon länger für meinen schönen Beruf interessierst. Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen stolz darauf bin, schließlich habe ich das gefördert, oder? Durch die Bücher, die ich dir immer mitgebracht habe.«
Die beiden setzten ihren Weg fort.
»Onkel, darf ich dir eine Frage stellen?«
»Bitte.«
»Du bist mit Vater befreundet, aber ihr seid irgendwie so anders …«
»Na ja, er ist bei der Schutzpolizei und ich bei der Kripo.«
»Das meine ich nicht. Wie soll ich sagen …« Thomas druckste herum, weil er kein schlechtes Wort über seinen Vater verlieren wollte. Verstand ihn der Onkel nicht?
Doch, das tat er. »Wir haben unterschiedliche Temperamente, aber das spielt keine Rolle. Freundschaften, die im Krieg entstehen, halten ewig.«
»Was habt ihr da eigentlich erlebt? Vater spricht nie über den Krieg.«
»Ich habe deinen Vater während des Krieges kennengelernt. Aber wir waren keine Soldaten, sondern immer nur Polizisten …« Strobel machte eine lange Pause.
Thomas wollte nicht weiter in ihn dringen. Viel wichtiger war ihm, dass der Onkel sich für ihn bei seinem Vater einsetzen wollte.
»Was willst du mit dem toten Tier machen?«, fragte Strobel mit Blick auf den Hasen, den Thomas wie einen Teddy in den Händen hielt.
»Begraben«, antwortete er leise und schämte sich beinahe für seine Antwort.
»Dann mach es hier, sonst lacht dein Vater dich aus.«
Das wollte Thomas auf keinen Fall, und so bekam der tote Hase sein Grab. Dass sein Vater wegen des fehlenden Hasen einen Aufstand machen würde, war ihm in diesem Moment egal.
3
Am Abend saß Thomas mit seinen Eltern und Strobel im Wohnzimmer und konnte sein Glück nicht fassen. Bald würde er die ausgestopften Tierköpfe an der Wand, diese ekligen Jagdtrophäen, nicht mehr sehen müssen. Sein Vater hatte dem Vorschlag seines besten Freundes nach einigem Zögern zugestimmt.
»Meiner Überzeugung nach solltest du eher Lehrer oder Buchhalter werden, weil du nicht das Zeug zum Polizisten hast. Aber wenn Kurt der Meinung ist, versuch es halt.«
»Wirst du in der Stadt nicht das schöne Leben hier vermissen?«, fragte die Mutter besorgt, und Thomas ersparte sich eine Antwort, weil er sie nicht beleidigen wollte. Er sehnte sich nach seinem eigenen Leben, ohne die ständige Kontrolle durch seinen übermächtigen Vater.
»Halt dich unbedingt von den Gammlern und Halbstarken fern«, fiel der Mutter noch ein.
»Überlass das Kurt, Mutter, er wird dem Jungen den richtigen Weg zeigen«, beruhigte der Vater sie und holte zwei Batavias aus der Kiste. Thomas, der den Zigarrengeruch auf den Tod nicht ausstehen konnte, wäre normalerweise aus dem Zimmer gegangen, blieb jetzt aber und gab den Männern sogar Feuer.
»Und nun mal Butter bei die Fische«, sagte Strobel und blies mehrere Rauchkringel in die Luft. »Um auf die Landeskriminalschule zu kommen, gibt es zwei Wege. Entweder du bist Schutzpolizist und machst einen fünfzehnwöchigen Lehrgang. Oder du kommst als Quereinsteiger dazu. Dann musst du eine Ausbildung und einen zweijährigen Grundlehrgang in einer Kreispolizeibehörde nachweisen, so eine Art Praktikum.«
»So was habe ich aber nicht«, entfuhr es Thomas besorgt. Er hatte ja nur das Abitur.
»Merk dir eins, Thomas. Ein guter Kriminalist gibt niemals auf. Er sucht immer nach Lösungen«, sagte Strobel schmunzelnd und strich ihm wie einem Schuljungen über die Haare. Thomas nickte und war neugierig, wie der Onkel dieses Problem lösen würde. Sein Vater schüttelte nur den Kopf.
»Doch, Walter, es gibt wirklich eine Lösung, allerdings hängt die von dir und mir ab. Ich kann meine Beziehungen beim Landeskriminalamt spielen lassen, dann ist die abgeschlossene Berufsausbildung nicht so wichtig. Immerhin ist Thomas Abiturient, und davon gibt es viel zu wenige bei der Polizei.«
»Außerdem bin ich letzte Woche volljährig geworden«, warf Thomas ein und handelte sich sogleich einen strengen Blick von seinem Vater ein, der keine Einmischung wünschte. Stattdessen wandte der sich an Strobel: »Und das zweijährige Praktikum?«
»Jetzt kommst du ins Spiel. Wenn du beispielsweise bescheinigen würdest, dass er in den letzten zwei Jahren einen Grundlehrgang absolviert hat …«
Das Gesicht von Thomas’ Vater verdunkelte sich. Solch ein Vorschlag verlangte ihm eine Menge ab. Er war ein Mann, der tagtäglich Recht und Ordnung vorlebte, auch in der Familie. Von der Jagd heute einmal abgesehen. Und jetzt sollte er eine Urkunde fälschen?
»Das kommt nicht infrage! Unser Junge muss doch nicht zur Kripo«, mischte sich Thomas’ Mutter ein, handelte sich jedoch sofort einen strafenden Blick ihres Gatten ein.
»Überlass das mir, Mutter!«
So wie meistens gab sie keine Widerworte. Im Haushalt der Engels waren die Rollen klar verteilt.
»Die Ausstellung falscher behördlicher Urkunden ist strafbar, das ist dir doch bekannt, Kurt, oder? Ich kann nicht glauben, dass du das ernst meinst.«
»Wir reden hier von den Paragrafen 267 bis 282 des Strafgesetzbuches, natürlich«, sagte Onkel Kurt gespielt ernst. »Und wenn das rauskommen würde, gäbe es eine Menge Ärger. Du würdest mindestens suspendiert und müsstest auf deine Rente verzichten.« Er blinzelte Thomas zu. »Aber jetzt mal im Ernst, Walter. Wer soll das herausfinden? So eine Bescheinigung interessiert kein Schwein! Im Moment ist das Innenministerium froh, wenn überhaupt jemand zur Kripo will. Es herrscht Personalmangel, weil die Alten pensioniert werden.«
Das Argument überzeugte Thomas’ Vater nicht. Mürrisch schüttelte er den Kopf. Thomas sah seine Felle davonschwimmen, aber dann zog Strobel breit grinsend ein unerwartetes Ass aus dem Ärmel.
»Ach, mir fällt gerade ein, ich habe euch noch gar nicht mitgeteilt, dass ich bald einen kleinen beruflichen Sprung machen werde. Vor euch steht der nächste Landeskriminaldirektor beim LKA!«
»Landeskriminaldirektor? Dann bist du ja der ranghöchste Kriminalbeamte in Nordrhein-Westfalen«, sagte Walter staunend.
Auch Thomas war beeindruckt. Eine höhere Position war für einen Polizisten nicht zu erreichen.
»Glaub mir, Walter, ich habe die Stelle nicht nur wegen meiner kriminalistischen Fähigkeiten erhalten. Gewisse Beziehungen spielen auch immer eine Rolle, das muss ich ehrlich zugeben. Ich kenne halt die richtigen Leute beim Innenministerium. Und die würden mit Sicherheit keinen Ärger wegen einer kleinen Bescheinigung machen, die kein Mensch überprüfen kann.«
Walter Engel nickte kurz, er schien überzeugt. Dann klopfte er seinem Freund auf die Schulter: »Herzlichen Glückwunsch, lieber Kurt, das ist doch mal eine schöne Nachricht! Mutter, warum haben wir keinen Sekt zum Anstoßen?«
Thomas trat auf Strobel zu und reichte ihm die Hand: »Darf ich dir auch gratulieren, Onkel?«
»Gerne, mein Junge, danke!«
»Aber ein wenig schade ist es doch, weil du ja dann gar nicht mehr im Präsidium bist, wenn ich mit der Ausbildung anfange!«
»Du wirst mich noch eine Weile ertragen müssen, Thomas. Mein Dienst beim LKA beginnt erst, wenn der jetzige Kriminaldirektor in Rente geht, das dauert noch ein paar Monate«, beruhigte ihn Strobel. »Du weißt jetzt, was du deinem Vater verdankst. Belohne ihn dafür mit dem besten Abschlusszeugnis deines Lehrgangs.«
Thomas sah seinen Vater an. »Darauf gebe ich dir mein Wort, Vater!« Dessen Reaktion beschränkte sich auf skeptisches Brummen, aber das war Thomas egal. Hauptsache, er konnte zur Kripo.
Sein Vater wollte den Aufstieg seines Freundes und Kriegskameraden gebührend feiern. Den würdigen akustischen Rahmen bildete eine Platte, die er täglich hörte und die ihn in feierliche Stimmung versetzte: Il Silenzio von Nini Rosso, die seit Wochen die deutsche Hitparade anführte. Es erklang ein Trompetenstück, und der Vater, sonst fern von jeder Emotion, bekam feuchte Augen. Thomas, eher unmusikalisch, mochte das Stück nicht, weil es ihm zu getragen klang. Außerdem musste er auf Anordnung seines Vaters immer schweigen, wenn es im Radio lief. Doch jetzt schwieg er gern. Sein Traum würde in Erfüllung gehen.
1939
4
Lotte träumte von ihrer blauen Mütze. Sie saß vorne neben dem netten Onkel, der seinen imposanten Horch über eine endlos lange Kastanienallee steuerte. Rechts die saftgrünen Wiesen mit den schwarz-weißen Kühen, links bunte Blumenfelder. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie in einem Automobil fuhr, und normalerweise hätte sie jede Sekunde genossen, hätte sich vom Fahrtwind kitzeln lassen oder das Armaturenbrett aus blankem Walnussholz bewundert. Aber ihre Gedanken kreisten nur um ihre BDM-Uniform, die bald komplett sein würde.
»Freust du dich schon?«
»Ja, Onkel, mit der Mütze werde ich ein richtiges Jungmädel, wie der Führer es sich wünscht.«
Der Mann freute sich auch, und zwar auf sein erstes richtiges Mal. Dass er dem Führer ein Jungmädel wegnehmen würde, war ihm herzlich egal. So nah war er seinem teuflischen Ziel noch nie gekommen.
»Sind wir bald da?«, fragte Lotte ungeduldig. Sie war so aufgeregt, dass sie seine Hand auf ihrem Knie gar nicht spürte.
»Gleich!«
Er war derart nervös, dass er Probleme mit dem nicht synchronisierten Getriebe des Achtzylinders bekam. Die Koordination von Ganghebel und Bremspedal stockte, weil er wie ein Anfänger vergaß, Zwischengas zu geben. Unterwegs soff der Motor mehrmals ab.
Die Fahrt, die wie ein schöner Ausflug ins Grüne begann, neigte sich dem Ende zu. Bevor sie die alte Ortschaft Kaiserswerth am Rhein erreichten, steuerte der Mann die Limousine auf einen Feldweg zu. Nun wurde es holprig, und Lotte hüpfte auf dem Ledersitz auf und ab. Schließlich hielt der Mann den Wagen an. Sie stiegen aus. Zur Begrüßung winkte eine knorrige Kastanie, von zahlreichen Blitzschlägen aus der Form gebracht. Sie schien genauso viele Jahre auf dem Buckel zu haben wie die riesige Ruine, die sich dahinter auftürmte: die sogenannte Barbarossaburg oder auch Kaiserpfalz, Überbleibsel einer mächtigen Burganlage mit wechselhafter Geschichte. Bevor sie im achtzehnten Jahrhundert gesprengt worden war, hatte sie nicht nur so manchem deutschen Kaiser als Herberge gedient, sondern auch den vorbeifahrenden Rheinschiffen als Zollstation.
Der Mann war nicht das erste Mal hier. Vor einigen Monaten hatte die Partei eine Feier hier abgehalten, deren Sinn er nicht verstanden hatte. Es war um die Tradition des Tausendjährigen Reichs und um Kaiser Barbarossa gegangen, der hier wohl mal abgestiegen war, so genau hatte er nicht zugehört. Auf der höchsten Spitze der Ruine sollte ein »ewiges Feuer« an die »Helden der Bewegung« erinnern, allerdings hatten die Erbauer nicht an die Tauben und Möwen gedacht, die regelmäßig die Gasleitung in der Steinschale mit ihrer Kacke verstopften. Vielleicht war die fehlende Flamme der Grund dafür, dass die Burg nicht die erhoffte Anziehungskraft für die Parteigenossen hatte.
Jetzt am Nachmittag waren die Ruinen jedenfalls verwaist. Und genau das wusste der Mann.
»Wohnt hier deine Mutti?«, fragte das Mädchen beim Anblick der Burgruine verwundert.
Der Mann nickte abwesend. Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Er blickte sich um und war erleichtert, dass er niemand auf dem Gelände sah.
»Onkel, wann kann ich meine Räder schlagen?«
»Gleich, Liebchen, gleich«, antwortete er und wollte sie zum hinteren Ruinentrakt führen, der vom Burghof und von der Mauer aus nicht einsehbar war. Das Mädchen blieb kurz stehen und sah zwischen zwei Zinnen den Rhein, auf dem die mit Kohle voll beladenen Lastkähne vorbeituckerten.
»Wie blau der Fluss ist! Wie meine Mütze!«
Kaum hatte sie zu Ende gesprochen, zog eine dunkle Wolkenformation auf, die das Blau des Rheins vertrieb und die Kaiserpfalz in Düsternis tauchte.
»Ich will zu meiner Mama!«, rief das Mädchen plötzlich.
Ausgerechnet in diesem Moment entdeckte der Mann eine Person, die die Steintreppe zur ehemaligen Burgkapelle hinaufging.
Er musste jetzt sofort handeln! Schnell zog er die Kleine hinter einen Mauervorsprung und hielt ihr den Mund zu. Sie wehrte sich verzweifelt, konnte aber gegen seine achtzig Kilogramm Körpergewicht nichts ausrichten. Ihr Widerstand machte ihn wütend und aggressiv, er begann sie zu würgen, immer fester und immer unbarmherziger. Er nahm ihr die Luft zum Atmen, zum Leben und zum Träumen.
5
Der Lehrgang in der Landeskriminalschule dauerte zwanzig Wochen. Die Ausbildung hatte für Thomas den Vorteil, dass ihm die Bundeswehr erspart blieb, aber trotzdem glich der Tagesablauf dem eines Soldaten. Die Schüler wurden um sechs Uhr geweckt und mussten zum Morgenappell erscheinen. Noch vor dem Frühstück folgte eine halbe Stunde Körperertüchtigung. Laufen, Turnen, Krafttraining. Der Rest des Tages war mit zahlreichen Unterrichtsstunden angefüllt. Erst ab dem späten Nachmittag hatten die Schüler frei. Die meisten nutzten die Zeit und flüchteten in die Stadt. Thomas nicht. Er wollte als Bester abschneiden, und dafür lernte er jede freie Minute. Er fuhr auch nicht nach Hause, obwohl seine Mutter drängte und ihn mit ihren Mettwürstchen und Rosenkohl zu locken versuchte. Sie wusste ja nicht, dass ihm beides sowieso zum Hals raushing.
Und so kostete Thomas jede Sekunde in der Kriminalschule aus und verschlang fast jedes Buch der Bibliothek. Schnell galt er als Streber und war nicht sonderlich beliebt. Die anderen mieden ihn, aber damit konnte Thomas leben. Das Einzelgängertum schützte ihn auch vor abfälligen Bemerkungen, die mit Sicherheit gekommen wären, wenn seine Mitschüler festgestellt hätten, dass er keine Zoten kannte und auch nicht mit irgendwelchen Frauengeschichten aufwarten konnte. Seine diesbezüglichen Erfahrungen waren gleich null. Schon in der Schule hatten sie ihn ausgelacht, weil er noch nie ein Mädchen geküsst hatte, und das musste er kein zweites Mal erleben. Er konzentrierte sich lieber auf die Ausbildung.
Im Fach Waffentechnik ging es richtig militärisch zu. Sie lernten, wie man Handgranaten warf und ein Maschinengewehr bediente. Thomas hielt nicht viel davon, weil das seiner Ansicht nach nichts mit dem Alltag eines Kriminalbeamten zu tun hatte, aber da er hier ebenfalls die Bestnote erreichen wollte, gab er sich reichlich Mühe.
Zur Ausbildung gehörte auch der Bereich Straf- und Strafverfahrensrecht. Gleich in der ersten Stunde machte Thomas die Erfahrung, dass seine Ausbilder, die seit Jahrzehnten im Polizeidienst waren, die hehre Tradition der Kriminalpolizei hochhielten. Bei jeder Gelegenheit betonten sie die politische Neutralität der Polizei, die nur nach Recht und Gesetz handelte.
»Auch während der Nazizeit haben wir den Polizeidienst immer neutral und gewissenhaft geleistet. Wir haben uns niemals von der Gestapo vereinnahmen lassen, auch nicht 1937, als Himmler die gesamte deutsche Polizei übernahm«, brachte es einer von ihnen auf den Punkt, ohne allerdings näher darauf einzugehen.
Thomas schrieb eifrig mit, hatte aber viele Fragen, die er sich nicht zu stellen traute, weil er sich bei den anderen nicht unbeliebt machen wollte. Doch was war die Gestapo genau? Er hatte gehört, dass sie eine Naziorganisation gewesen war, doch welche Funktion sie gehabt hatte, wusste er nicht. Also versuchte er, in der Zentralbücherei Antworten zu finden. Dort las er in einem Lexikon über die Organisation der Polizei während des Nationalsozialismus nach: Zwischen 1933 und 1945 hatte es eine sogenannte Sicherheitspolizei gegeben. Die war unterteilt in die Geheime Staatspolizei und in die Kriminalpolizei. Die Aufgaben der Kripo waren die Aufklärung und Verfolgung von Verbrechen, wie seit über hundert Jahren üblich. Die Nationalsozialisten führten aber eine neue Polizei ein, die Gestapo. Sie bekämpfte die sogenannten Staatsfeinde, nämlich Juden, Zigeuner und Kommunisten. Nach dem Krieg wurde die Gestapo von den Alliierten als verbrecherische Organisation eingestuft und verboten. Die Methoden der Geheimen Staatspolizei, so las Thomas, waren kriminell. Die Gestapo-Beamten verhafteten Menschen ohne gerichtliche Anweisung, folterten und ermordeten missliebige Personen. Nun erst begriff er, warum die Ausbilder sich von der Gestapo distanzierten.
Im Unterricht aber fiel ihm auf, dass einige Ausbilder ein widersprüchliches Verhältnis zur Gestapo hatten.
»Männer, die unter den Paragrafen 175 fallen, sind seit jeher ein beliebtes Opfer für Erpressungen«, dozierte zum Beispiel ein Ausbilder, ein kerniger Beamter von etwa sechzig Jahren. »Leider stehen uns heutzutage nicht mehr die Mittel der Gestapo zur Verfügung. Wir sind heute gezwungen, in mühsamer kriminalpolizeilicher Arbeit die Männer zu überführen, die gegen diesen Paragrafen verstoßen.«
Thomas wunderte sich, dass derselbe Ausbilder, der sich letztens von der Gestapo distanziert hatte, ihre Methoden nun guthieß.
»Aber die Gestapo bekämpfte doch Staatsfeinde. Sind Homosexuelle denn Staatsfeinde?«, fragte Thomas, ohne lange zu überlegen.
»Weißt du überhaupt, was es bedeutet, wenn man schwul ist?« Der Ausbilder bedachte Thomas mit strengem Blick.
»Wenn ein Mann einen anderen Mann liebt«, antwortete Thomas.
»Genau! Wenn alle Männer schwul wären, gäbe es keine Nachkommen. Dann stirbt unser Volk aus. Willst du das? Deswegen gibt es den Paragrafen 175 zu Recht, und das hat nichts mit den Nazis zu tun«, antwortete der Ausbilder vehement.
In diesem Moment fiel Thomas ein, dass er überhaupt keinen schwulen Mann kannte. Folgerichtig stellte er eine ermittlungstechnische Frage.
»Aber wie erkennt ein guter Kriminalbeamter denn, ob ein Mann einen anderen Mann liebt?«
Seine ernst gemeinte Nachfrage provozierte lautes Lachen in der Klasse. Der Ausbilder dagegen sah so aus, als wollte Thomas ihn veräppeln.
»Bist du so blöd, oder tust du nur so?«
»Ich meine es ernst. Wie erkenne ich als Kriminalbeamter einen Homosexuellen?«, wiederholte Thomas, der sich nicht wie ein dummer Junge abspeisen lassen wollte.
»Guck dir die Friseure an. Die sind doch alle schwul«, sagte der Ausbilder und grinste.
Thomas vermisste bei der Antwort zwar kriminalistische Kriterien, aber seine Kollegen johlten, pfiffen oder klatschten sich auf die Schenkel – das Thema Männerliebe erzeugte die lautesten Witze und Zoten.
»Schau in den Spiegel, dann weißt du, wie ein Schwuler aussieht«, hörte Thomas jemanden hinter sich und konnte nicht verhindern, dass er rot wurde. Er ballte die Faust in der Tasche und beschloss, es seinen Mitschülern mit einem sehr guten Abschlusszeugnis heimzuzahlen.
Viel interessanter und spannender als den Unterricht im Strafrecht fand Thomas das Erlernen des kriminalistischen Handwerks. Wie war der genaue Ablauf, wenn man einen Tatort aufsuchte? Wie wurden Beweismittel gesichert?
Hier traf Thomas auf andere Ausbilder. Sie waren jünger und offen für seine Nachfragen. Das, was sie lehrten, war genau das, was er sich von der Ausbildung erhofft hatte. Die Lehrer mochten Thomas, der alles in sich aufsog. Um auf dem neuesten Stand zu sein, verschlang er auch einige englische und amerikanische Bücher, die ein junger Ausbilder mitgebracht hatte: einen Band über Gerichtsmedizin und ein Buch namens The Cold Case Methods über noch ungelöste Fälle, die bei jedem Kriminalbeamten ein unbefriedigendes Gefühl hinterließen.
Alles andere als unbefriedigend fiel dagegen am Ende der Ausbildung die Prüfung für Thomas aus. Er schloss sie als Lehrgangsbester ab.
1939
6
Trotz seines jungen Alters hatte der Hauptkommissar schon viele Tote gesehen. Aber beim Anblick des Mädchens kämpfte er mit den Tränen. Es lag da wie weggeworfen, den Rock hochgeschoben, das Gesicht bedeckt mit einem Taschentuch. Er hatte Angst vor dem Gesichtsausdruck des Kindes, der ihn erwartete, wenn der Kollege von der Spurensicherung das Tuch entfernen würde. Nur nicht sich ausmalen, was das Mädchen in den letzten Minuten seines kurzen Lebens erlitten haben musste. Doch der Hauptkommissar musste seine Emotionen vor seinen Untergebenen zurückhalten und Professionalität und Führungsstärke an den Tag legen.
»Macht voran, Leute! Die ersten Stunden nach dem Mord sind die wichtigsten für die Aufklärung«, rief er, während der Beamte vom Erkennungsdienst die kleine Leiche fotografierte und der Arzt darauf wartete, sie untersuchen zu können. Die Kollegen der Spurensicherung suchten die Umgebung nach verwertbaren Spuren ab. Und er, vor einer Woche zum Hauptkommissar befördert, ehrgeizig und mit einem enormen Selbstbewusstsein gesegnet, scharrte mit den Hufen. Er musste den Mörder schnappen, bevor er weitere Schandtaten beging. Ohne die Obduktion abzuwarten, war dem Hauptkommissar klar, dass es sich um ein Sittlichkeitsverbrechen handelte, und das sprach für einen Serientäter.
»Chef, ich bin fertig mit der Befragung«, sagte einer seiner Beamten, ein rothaariger Hüne mit schief gebundener Krawatte und falsch geknöpfter Weste, der mit einem jungen Mann um die zwanzig gesprochen hatte. »Der Zeuge befasst sich mit der Geschichte dieser Ruine und schreibt seine Doktorarbeit darüber. Heute Morgen hat er die Leiche gefunden und uns angerufen.«
»Ist das alles?«
»Ja, Chef«, antwortete der Beamte und wollte den Zeugen schon wegschicken.
»Einen Moment bitte noch«, wandte der Hauptkommissar ein. »Hast du dem jungen Mann keine weiteren Fragen gestellt?«
»Nein.«
Am liebsten hätte er seinen Kollegen umgehend zurechtgestutzt, aber vor dem Zeugen gehörte sich das nicht. Also warf er ihm nur einen strafenden Blick zu, bevor er die Befragung selbst in die Hände nahm.
»Ich hätte noch einige Fragen. Woher wussten Sie, dass das Mädchen tot war?«
»Na ja, sie lag völlig regungslos da … Ich habe mir einfach gedacht, dass sie nicht mehr lebt.«
»Befand sich sonst noch jemand auf dem Gelände?«
»Nein, aber das hat mich der andere Beamte doch schon gefragt«, antwortete der Zeuge leicht ungeduldig.
Dessen unbeeindruckt, hakte der Hauptkommissar nach: »Wenn Sie Ihre Doktorarbeit über die Kaiserpfalz schreiben, dann sind Sie doch öfters hier, oder?«
»Ja, in der letzten Woche fast jeden Tag.«
»Welche Art von Besucher kommt hier so her?«
»Manchmal ein Liebespärchen, manchmal spielende Kinder …«
»Aha! Dann hat unser Mädchen hier gespielt und ist von dem Schwein angesprochen worden«, warf der eifrige Kollege ein in der Hoffnung, beim strengen Chef punkten zu können. Stattdessen erreichte er das Gegenteil, einen weiteren strafenden Blick.
»Waren Sie gestern Nachmittag auch hier?«, wollte der Hauptkommissar von dem Studenten wissen.
»Ja.«
»Ist Ihnen etwas aufgefallen? Haben Sie jemanden gesehen?«
Der Student überlegte kurz und schüttelte den Kopf, berichtigte sich dann aber: »Doch, ein Mann ist dort den Feldweg entlanggelaufen und in ein Auto gestiegen.«
»Können Sie den Mann beschreiben?«
»Nicht richtig, er trug einen Hut und einen grauen Anzug, mehr konnte ich nicht erkennen.«
»War der Mann klein, groß, dünn, dick?«, bohrte der Hauptkommissar nach, aber der Student schüttelte erneut den Kopf. »Ich bin mir nicht sicher, aber dick schien er mir nicht.«
»Können Sie Angaben zu dem Auto des Mannes machen? Die Marke vielleicht?«
»Ich kenne mich da nicht aus, aber es hatte eine dunkle Farbe.«
»Dann würde ich gerne wissen, wann Sie den Mann gesehen haben.«
»Kurz bevor ich den Siebzehn-Uhr-Bus in Kaiserswerth genommen habe.«
»War er allein?«
»Ich habe nur ihn gesehen, weil ich gestern lediglich auf der Mauer da oben gestanden habe.« Der Zeuge zeigte auf die Steintreppe.
»Das heißt, dass Sie das Mädchen von Ihrer Position aus nicht hätten sehen können«, kombinierte der Hauptkommissar, der den Blick schweifen ließ.
»Ich bin erst heute hier in diesem Bereich gewesen. Und da lag die Leiche schon da.«
»Können Sie mir bitte zeigen, wo der Mann den Wagen geparkt hatte?«
Der Student nickte und führte die beiden Polizeibeamten zu der Kastanie.
»Üb dich mal in Spurensicherung«, forderte der Hauptkommissar den Rothaarigen auf und wandte sich noch einmal an den Zeugen. »Bitte kommen Sie morgen ins Präsidium, damit wir Ihre Aussage protokollieren können.«
Als der Hauptkommissar sich wieder seinem Kollegen zuwandte, fiel ihm auf, dass der nicht allzu sorgfältig vorging, denn er übersah auf dem lehmigen Boden einen ganz deutlichen Reifenabdruck.
»Wonach suchst du eigentlich?«
»Zigarettenreste, Bonbonpapier«, antwortete der Hüne, der sich eine Zigarettenpackung aus der Tasche holte, was seinen Chef ärgerte, denn jetzt war keine Zeit zum Rauchen.
»Willst du Feuer?«, fragte er ironisch.
»Gerne, Chef!«, antwortete der Kollege und ging auf ihn zu.
»Du sollst bei der Arbeit nicht rauchen«, mahnte der Hauptkommissar, »das mindert die Konzentration.«
»Aber ich habe längst alles untersucht!«
»Und wie steht es mit den Reifenspuren? Müsste doch bei dem Boden hier was zu sehen sein«, deutete der Hauptkommissar an.
»Ist es aber nicht.«
»Und das hier?«, wechselte der Hauptkommissar in einen eisigen Ton und richtete den Zeigefinger auf den Boden. »Wie nennt man das?«
»Na ja, eine Reifenspur«, antwortete der Zweimetermann, wurde plötzlich ganz klein und steckte seine Zigarette wieder ein.
»Merk dir das, das ist eine Eindruckspur«, dozierte sein Chef. »Sie entsteht, wenn das Spuren verursachende Objekt härter ist als der Spurenträger. Hast du das verstanden?«
»Spuren verursachendes Objekt?«, fragte der überforderte Kollege und kratzte sich am Hinterkopf.
»Der harte Reifen hat auf der weichen Erde eine Spur hinterlassen, du Hornochse! Kapier das endlich, sonst wirste ab morgen als Schupo den Verkehr regeln. Kannst du mir mal verraten, wie du zur Kripo gekommen bist?«
»Seien Sie beruhigt, Chef. Ihr Anschiss hat in meiner weichen Birne auch Spuren hinterlassen. Ich habe es kapiert.«
Der Hauptkommissar winkte gereizt ab.
»Wir müssen das Schwein fassen, bevor es ein zweites Mal zuschlägt. Also mach hinne!«
»Woher wissen Sie, dass es ein zweites Mal gibt?«
»Wenn das ein Sexualmord war, und davon ist auszugehen, dann haben wir es mit einem Täter zu tun, der einen perversen Trieb hat. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede!«
Das glaubte der Hüne aufs Wort. Der Hauptkommissar hatte sich vor Jahren seine ersten Sporen bei der Jagd nach dem »Vampir von Düsseldorf«, dem Massenmörder Kürten, verdient. Damals gehörte er den Ermittlern an, die Kürten verhörten.
»Kürten war unersättlich. Er konnte mit dem Morden einfach nicht aufhören. Das will ich nicht noch mal erleben.«
7
Das sehr gute Zeugnis von Thomas rief unterschiedliche Reaktionen hervor. Der Mutter gefiel es nicht, dass er jetzt als Kriminalbeamter in der Stadt leben würde. Der Vater brummte etwas ungehalten, weil er im Fach Rechtskunde nur mit »gut« abgeschnitten hatte.
»Das kommt davon, dass du den Ausbildern zu viele Fragen gestellt hast«, scherzte Strobel.
»Ich habe eben ein paar Dinge nicht verstanden. War das ein Problem?«
»Ein guter Polizist gehorcht seinen Vorgesetzten und stellt keine dummen Fragen«, kommentierte Thomas’ Vater ärgerlich, aber Strobel beschwichtigte ihn sogleich.
»Schon gut, Walter, keiner hat sich über Thomas beschwert. Er war halt ein engagierter Schüler und vor allem sehr, sehr fleißig. Er hat das beste Abschlusszeugnis!«
Dass der Vater recht zufrieden mit ihm war, bewies sein Geschenk. Er überließ Thomas seinen gebrauchten Borgward Isabella.
»Das war Mutters Idee«, grummelte der Vater, dem es auch jetzt noch schwerfiel, seinen Sohn zu loben.
Trotzdem war Thomas zufrieden. Es lief. Er war endlich der spießigen Enge entkommen, die ihm während der Schulzeit manchmal die Luft zum Atmen genommen hatte. Und schneller als erwartet fand er sogar eine möblierte Mansarde, seine eigene Bude. Sie war nicht weit vom Polizeipräsidium entfernt, was ihm ganz recht war. Er wollte als Jungspund nicht gleich mit dem Borgward vorfahren, obwohl der Wagen schon einige Jahre auf dem Buckel hatte. Die Vermieterin, immer mit Lockenwicklern und Kette rauchend, war von dem jungen Mann angetan. Er trug einen Anzug, hatte die kurzen Haare ordentlich gescheitelt und war angehender Polizist. »Vor Ihnen wohnte einer hier, der leider zu oft Damenbesuch hatte. Ich musste ihm kündigen, weil ich nicht gegen das Kuppeleigesetz verstoßen wollte. Aber bei Ihnen als Kriminalbeamten brauche ich da ja wohl keine Angst zu haben.«
Thomas mochte seine Wohnung. Es gab ein Bett, einen Schrank und eine Waschschüssel.
»Baden können Sie bei mir einmal die Woche. Zur Toilette müssen Sie eine Treppe runter«, erklärte die Vermieterin, während Thomas seine wenigen Sachen im Schrank verstaute. Er besaß zwei Anzüge seines Vaters, einige Hemden und Unterwäsche.
»Einen Fernseher müssten Sie selbst besorgen. Aber das Radio ist im Mietpreis enthalten. Ist ein Volksempfänger, funktioniert bestens. Kochen, Alkohol, Rauchen und Radio Luxemburg sind ebenfalls verboten, ich will ein anständiges Haus!« Sie zündete sich eine neue Roth-Händle an.
Thomas hatte nur mit einem Ohr zugehört, weil er sich als nicht rauchender Junggeselle, der Radio Luxemburg gar nicht kannte, ohnehin nicht angesprochen fühlte. In seiner Freizeit hatte er vor zu lesen.
»Wenn Sie wollen«, sagte sie, »können Sie täglich bei mir zu Abend essen, meine Spezialität ist Sauerbraten. Ich kenne da einen guten Pferdemetzger.«
Thomas verzichtete dankend. Das erinnerte ihn zu sehr an die Küche seiner Mutter.
Sein neues Revier, etwa eine halbe Million Einwohner groß, hatte einiges zu bieten. Für die Reichen und Schönen beispielsweise die Prachtmeile der Königsallee, ein Biotop für zahlungskräftige Menschen aus ganz Westdeutschland und natürlich auch für Hochstapler und Erpresser. Angehende Künstler dagegen lockte die Kunstakademie, deren Ruf über die Stadtgrenzen hinaus bekannt war. Die Altstadt imponierte mit Dutzenden Kneipen, in denen an den Wochenenden zahlreiche Schlägereien stattfanden. Im Gegensatz zu anderen Städten gab es hier keine Demonstrationen gegen den Krieg in Südostasien, der als »Vietnamkrieg« schon Einzug in die Tagesschau gehalten hatte. Aber Thomas besaß keinen Fernseher und kümmerte sich ohnehin nicht um Politik. Den Namen des Bundeskanzlers kannte er nicht, aber dafür den des Massenmörders Peter Kürten oder den der ermordeten Hure Rosemarie Nitribitt, beides Kinder seiner neuen Stadt. Die erkundete er nun zu Fuß und kam sich wie Kolumbus vor, der eine neue Welt entdeckte. Für seine Eltern wäre das nichts gewesen. Sie mieden große Städte, weil dort »zu viel Unordnung herrschte«, wie der Vater zu sagen pflegte. Als Thomas einige junge Männer sah, die ihre Haare über die Ohren frisiert hatten, fiel ihm ein Spruch seines Vaters ein: langes Haar, kurzer Verstand.
Gerade wollte Thomas seinen Weg fortsetzen, da wurde er von einem Streifenpolizisten angesprochen: »Junger Mann, was lungerst du hier rum?«
Wortlos zog Thomas seine frische Dienstmarke aus der Tasche und hielt sie dem Schutzmann vor die Nase. Der knallte die Hacken zusammen und salutierte wie Bürgermeister Dr. Müller vor Wilhelm Vogt, der sich als Hauptmann von Köpenick verkleidet hatte.
»Entschuldigung, Herr Kommissar!« Kleinlaut zog er davon, und Thomas schaute auf seine Dienstmarke, die wohl über magische Kräfte verfügte. Belustigt setzte er seinen Weg fort.
Vor dem Rheinturm sah er einige junge »Radschläger«. Immer, wenn sie einen Passanten erspähten, liefen sie auf ihn zu und schlugen geschickt ihre Räder.
»Ein Groschen, ein Groschen!«, riefen die Mädchen und Jungen mit ausgestreckter Hand.
Mancher Passant ging weiter, mancher zahlte. Thomas zeigte sich spendierfreudig.
Einige Straßen weiter entdeckte er einen kleinen Menschenauflauf. Eine Gruppe von Frauen und Männern stand vor einem hell erleuchteten Schaufenster eines Ladenlokals, das sich als Galerie erwies. Thomas wurde Zeuge einer Kunstaktion mit einem merkwürdigen Namen: Wie man einem toten Hasen die Bilder erklärt. Dabei waren die Zuschauer ausgesperrt – in die Galerie durften sie nicht. Dort ging ein Mann, dessen Kopf mit Goldfarbe bedeckt war, mit einem toten Hasen von Bild zu Bild, und es sah so aus, als ob er mit ihm spräche. Die Zuschauer vor dem Schaufenster diskutierten heftig, ja, erregt über die Aktion, die älteren reagierten sogar empört.
»So ein Schwachsinn«, regte sich ein betagter Herr auf. »Und das soll Kunst sein?«
»Der ist reif für die Klapsmühle!«, warf seine Begleiterin ein, eine Dame im Pelz und mit Hochsteckfrisur.
Thomas, der mit Kunst immer das Bild einer Zigeunerin über dem Sofa seiner Eltern in Verbindung brachte, beobachtete gebannt den Mann, der eine Anglerweste trug und sich zweifelsfrei mit dem Hasen unterhielt. Er verstand die Aufregung der Leute nicht. Anstatt die Aktion zu betrachten, empörten sie sich oder machten sich einfach darüber lustig.
»Haha, ist hier jemand, der mir erklärt, was uns der Künstler damit sagen will?«, fragte plötzlich ein Mann, der ein Alt in der Hand hielt.
»Das wissen nur er und der Hase«, meldete sich Thomas zu Wort, der daran denken musste, dass auch er mit einem toten Hasen gesprochen hatte.
»Du willst uns wohl verarschen? Wir sollen den Hasen fragen?«
»Warum nicht? Ich habe auch oft mit Hasen gesprochen«, entgegnete Thomas.
»Ach ja?«, feixte ein anderer Mann. »Und worüber?«
»Das ist meine Sache«, antwortete Thomas und fügte hinzu: »Außerdem hätten Sie das sowieso nicht verstanden.«
»Aha, wir sind wohl zu blöd, du Landei!«
»Offenbar. Sonst hätte der Mann da drin Sie nicht ausgesperrt«, sagte Thomas und eilte davon.
Er fand, der Mann mit dem goldenen Gesicht und der Anglerweste machte alles richtig. Er war nicht verrückt. Er war nur anders. Er ging seinen Weg, so wie Thomas es sich auch für sich wünschte. Und die Leute waren wie sein Vater. Sie hatten Probleme mit Dingen, die sie nicht verstanden.
Das Polizeipräsidium war nicht zu übersehen. Ein mächtiger Bau aus rotem Backstein und unzähligen kleinen Fenstern, die von Weitem an Schießscharten erinnerten. Es wirkte auf Thomas wie eine Festung. Das war jetzt also seine neue Wirkungsstätte. Um acht Uhr war Dienstbeginn, und er sollte sich gleich bei Strobel melden. Der Pförtner erklärte ihm den Weg. Thomas wollte schon die Treppe hochstürmen, da entdeckte er im riesigen Foyer einen Paternoster. Im letzten Moment traute er sich aber doch nicht, in die Kabine zu springen.
»Sie halten den Betrieb auf!«, hörte er von hinten und merkte, dass er einigen Leuten im Wege stand. Schnell ging er zur Seite und nutzte lieber die sichere Treppe. Energisch betrat er Strobels Büro und traf ihn rauchend im Gespräch mit zwei Männern an.
»Guten Morgen, Onkel«, grüßte er ihn und erntete einen irritierten Blick der Kollegen.
Strobel nahm Thomas an die Hand und zog ihn in das Nebenzimmer.
»Schön, dass du da bist, mein Junge, aber zwei Dinge muss ich dir sofort erklären. Nenn mich in Anwesenheit der anderen bitte nicht Onkel, sondern Herr Hauptkommissar, meinetwegen auch Chef. Die Kollegen würden dich sonst nicht ernst nehmen.«
Die Kopfwäsche verfehlte nicht ihre Wirkung.
»Entschuldige, Onkel, ich meine, Herr Hauptkommissar.«
»Und jetzt will ich dich mal offiziell begrüßen«, sagte Strobel lachend und reichte ihm die Hand. Thomas strahlte übers ganze Gesicht. »Die Dienstmarke hast du ja schon, es fehlt nur noch eine Kleinigkeit.«
Strobel griff in eine Schublade und holte eine PPK mit Lederhalfter heraus.
Thomas hatte schon oft Waffen in der Hand gehalten, aber diese PPK war jetzt seine und demonstrierte in eindrucksvoller Weise, dass er zur Kripo gehörte.
»Nachher bekommste einen eigenen Spind, wo du deine Sachen und deine Waffe lagern kannst, wenn du Feierabend hast«, erklärte Strobel. Dann stellte er ihn seinem Stellvertreter vor, einem Mann wie ein Kleiderschrank mit roter Stoppelfrisur, der nicht sonderlich auf sein Aussehen Wert zu legen schien, wie man an seiner schief gebundenen Krawatte erkennen konnte.
»Halt dich immer an den Kollegen Schäfer, der ist meine rechte Hand«, erklärte Strobel und schüttelte ärgerlich den Kopf, als der Angesprochene sich eine Zigarette anstecken wollte. »Du sollst nicht bei der Arbeit rauchen, Schäfer, das mindert die Konzentration.«
»Jawohl, Chef«, brummte Schäfer und steckte sich trotzdem eine an. Dann gab er Thomas die Hand.
»Guten Morgen, Herr Kommissar«, antwortete Thomas und biss vor Schmerzen die Zähne zusammen. Offenbar bevorzugte Kollege Schäfer den Schraubstock-Händedruck.
»Ich zeig dir mal die lustigsten Abteilungen«, grinste Schäfer und führte Thomas zunächst in sein eigenes Büro.
An den Wänden hingen Bilder mit deformierten Geschlechtsorganen, halb nackten Frauen und Leichen – das war das Sittendezernat.
»Meine Hobbys sind Leichen und schnelle Autos. Meine Frau hält mich schon für ganz pervers«, sagte er lachend, und Thomas lachte aus Höflichkeit mit. Kollege Schäfer war nicht sein Ding, und die gruseligen Bilder an den Wänden waren es erst recht nicht.
»Sind Sie schon lange bei der Sitte?«
»Seit Jahren. Aber wenn es darauf ankommt, helfe ich auch bei Morden aus … Je nachdem, wie der Chef mich einteilt.«
Thomas starrte mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination auf die Bilder.
»Ich habe so meine Vorlieben für Vergewaltigungen, Prostitution und Kuppelei«, führte Schäfer grienend aus. »Ich kümmere mich auch um jugendgefährdende Schriften oder durchsuche mit den Kollegen Kioske nach Sexheften. Blöderweise wird unsere Arbeit immer schwieriger, weil mittlerweile mehr erlaubt ist als früher. Schau dir doch die Titelbilder an. Überall Titten und Ärsche … Keine Ahnung, wo das alles hinführen wird, für mich ist das Sodom und Gomorrha!«
Thomas erfuhr weiter, dass Schäfer und die Kollegen auch Verstöße gegen das Kuppeleigesetz ahndeten. »Wenn jemand ein unverheiratetes Paar in seiner Wohnung schlafen lässt, bekommt er mit uns Probleme. Also pass auf, wenn du dein Mädchen bei dir übernachten lässt oder eine Nummer mit ihr schiebst.«
»Ich habe kein Mädchen«, stellte Thomas klar.
»Was? Hau rein, Junge, von uns hast du nichts zu befürchten, Polizisten haben Narrenfreiheit.« Schäfer blinzelte Thomas komplizenhaft zu, der die Andeutung nicht recht verstand, aber trotzdem mitlachte. Dann führte Schäfer ihn zu einem weiteren Foto, auf dem nur ein Staubsauger zu sehen war.
»Du fragst dich bestimmt, was ein Staubsauger inmitten der ganzen Exhibitionisten und geschändeten Frauen sucht, oder?«
Thomas nickte stumm.
»Was meinst du, kann ein Mann in dieses Rohr alles reinstecken?«
Thomas ahnte, worauf Schäfer hinauswollte, aber er weigerte sich, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Doch seine Vogel-Strauß-Politik hinderte Schäfer nicht daran, die Antwort selbst zu liefern.
»Das Rohr ist breit genug, um einen Dödel reinzustecken. Das hat letztens ein Perverser auch gedacht …«
Thomas hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, aber das ging nicht, und so hörte er von einer ziemlich seltsamen Obsession, die zum Tod des Mannes geführt hatte.
Er war froh, als ein anderer Kollege auftauchte, um ihm die Rauschgiftabteilung zu zeigen. Der hieß Baumgarten und war das genaue Gegenteil vom grobschlächtigen Schäfer: klein, gepflegt und mit leiser Stimme. Thomas erfuhr, dass die Morphiumsucht weitverbreitet war. Davon waren in erster Linie kriegsversehrte Männer betroffen. Um an ihr Morphium zu kommen, brachen sie in Apotheken ein, fälschten Rezepte oder bestachen Ärzte. Baumgarten zeigte Thomas den »Giftschrank« mit Dutzenden beschlagnahmten Ampullen, die versiegelt waren. »Danach würde sich so mancher die Finger lecken«, sagte er und schloss den Kasten wieder ab.
Anschließend hörte Thomas von einem neuen Rauschgift, mit dem es die Polizei zu tun hatte.
»Kennst du Haschisch?« Baumgarten holte aus einer Schublade eine Zigarrenkiste mit mehreren dunklen Stäbchen, die wie kleine Briketts aussahen.
»Riech mal. Gar nicht so übel.«
»Und wie nimmt man das ein?«, fragte Thomas, der aus seinen amerikanischen Kriminalromanen nur Kokain kannte.
»Das Harz wird zerbröselt und in den Tabak gemischt. Willst du mal probieren?«
»Ich rauche nicht.«
»Warum das denn nicht? Bist doch nicht mehr bei den Eltern.«
»Mein Vater hätte nichts dagegen, wenn ich rauchen würde, aber ich will nicht.«
1939
8
Der Hauptkommissar hatte die Abteilung in sein kleines, verrauchtes Büro zusammengerufen. Dicht gedrängt und heftig paffend standen nun die Männer vor seinem Schreibtisch, jeder mit einem Notizblock in der Hand, bereit, seinen Anweisungen zu folgen.
Zunächst zitierte er aus dem Obduktionsbericht. Das Mädchen war erwürgt und vergewaltigt worden.
»Der Täter hatte das Gesicht des Mädchens mit einem Taschentuch bedeckt. Hat einer von euch eine Erklärung dafür?«, fragte er in die Runde.