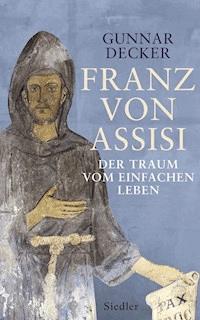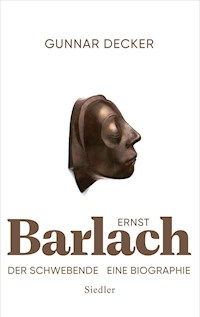Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es war ein kurzer Sommer. Mitte der Sechzigerjahre versuchte die DDR, sich aus der Umklammerung durch die Sowjetunion zu befreien und ihren Künstlern und Intellektuellen größere Freiräume zuzugestehen. Doch schon bald setzten sich die Hardliner durch, die letzten unabhängigen Köpfe verabschiedeten sich von der SED. Für Gunnar Decker setzt damals jene innere Erosion ein, die 1989 zum Zusammenbruch des deutschen Sozialismus führte. Sein Buch spiegelt Aufstieg und Niedergang der DDR in den Schicksalen bekannter und unbekannter Schriftsteller, Theaterleute und Filmemacher. Decker, 1965 in der DDR geboren, erzählt ein Kapitel deutscher Kulturgeschichte, das mit dem Fall der Mauer noch lange nicht zu Ende ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 820
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Abb. 1: Fritz Cremer: Der Aufsteigende, 1966/67, Kunsthalle Rostock
Gunnar Decker
1965Der kurze Sommer der DDR
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24856-4
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2015
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Motiv: © DEFA-Stiftung/Klaus-Dieter Schwarz
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Meinem Vater Prof. Dr. Heinz Decker (1928–2014)
in Dankbarkeit
… ich wollte einfach Erinnerungen provozieren. Die meisten unserer Erinnerungen liegen ja versteckt und sind nicht willentlich heraufzubeschwören; es bedarf eines Anstoßes von außen, einer bestimmten Geste, eines bestimmten Wortes, eines bestimmten Bildes, um sie ins Bewusstsein heraufzuholen …
Franz Fühmann, Böhmen am Meer (1965)
Inhalt
Prolog. Fritz Cremer, »Der Aufsteigende«
Der Aufstieg
Das Schicksalsjahr 1965 – Erich Apels mysteriöses Ende – Handwerker am Sonntag. Schöne neue Kleinbürgerwelt und einige nicht unerhebliche Differenzen – Neues Selbstbewusstsein und fortgesetzter Wettlauf um die »deutsche Seele«? – Das Kreuz mit dem Sozialismus zwischen Emanzipationsbewegung und Despotismus. Das unlösbare Problem der Ökonomie. Vorspiele zum »Bitterfelder Weg« mit Stalin, Bucharin, Benn und Tretjakow – Neue Kader braucht das Land. Hans Bentzien als Kulturminister der Reformzeit. Wie erfindet man den »Bitterfelder Weg«? – Erwin Strittmatters »Ole Bienkopp« oder Sozialistische Helden in der Literatur dürfen per Beschluss nicht sterben – Honecker trifft auf seinen Intimfeind Kurt Turba. Ein Machtkampf mit offenem Ende – Die avisierte Wende: Das Jugendkommuniqué – Es wird ernst mit dem Neuen: Stephan Hermlins Lyrikabend an der Akademie der Künste, Fritz Cremers Ausstellung »Junge Kunst« und die Fernwirkung einer Konferenz zu Franz Kafka in Prag. Das Marsyas-Thema – Hans Fallada und die DDR. Entfremdung im Sozialismus. Günter Kunert, das Fernsehen und die Lyrik – Brigitte Reimann kommt der Macht sehr nahe. Lebenswut und Lebensekel. Die Melancholie in »Franziska Linkerhand« – Christa Wolf versucht auf dem »Bitterfelder Weg« zu gehen, Franz Fühmann auch. »Der geteilte Himmel« trifft auf »Kabelkran und blauer Peter« – Mythos trifft Kunst im Widerstand: Fühmanns »König Ödipus« und »Ernst Barlach. Das schlimme Jahr« – Exkurs: Was ist sozialistischer Realismus? Der nie wirklich beendete ideologische Kampf gegen den »Formalismus« – Maxie Wander, eine Wienerin in Kleinmachnow – Am Scheideweg: Fritz Cremer – Wolfgang Langhoff und »Die Sorgen und die Macht« von Peter Hacks – Friedrich Dieckmann und das »Coriolan«-Problem. Jürgen Teller sieht sich von seinen Lehrern verlassen. Adolf Dresen kritisiert nicht nur Marx – Kann man in der DDR überhaupt Gegenwartsdramatik spielen? Heiner Müllers »Die Umsiedlerin« – Fast ein Klassiker. »Philoktet« als Antwort – Hermann Kant übt sich mit »Die Aula« in Ironie. Das Kunststück, ein Stück DDR-Patriotismus und Musik des Untergangs zugleich abzuliefern – Die Wismut als Tabu. Werner Bräunigs »Rummelplatz« – Die Malerei diesseits und jenseits des »sozialistischen Realismus«. Privates Glück statt Klassenkampf? – Exkurs: Gabriele Mucchi, ein Italiener in der DDR und neuerlich die Frage, was Realismus eigentlich ist – Jazz im Blut. Fritz Rudolf Fries und »Der Weg nach Oobliadooh« – Dialektik ohne Dogma? Warum die Funktionäre Robert Havemann so fürchten und die Künstler so große Hoffnungen auf ihn setzen – Wolf Biermann als Ärgernis. An der »Drahtharfe« verschlucken sich die »alten Genossen«. Statt eines Nachrufs auf sie: »Geht mit Kopfschütteln über meine falsche Haltung / aber G e h t!« – Die Legende von »Renft«. Das Ärgernis Beatmusik und der Leipziger »Gammler-Aufstand« – Ein Schweizer in der DDR: Benno Besson inszeniert »Der Drache«. Peter Weiss und Rolf Hochhuth in Rostock – Uwe Johnson in Westberlin schaut Ostfernsehen und schreibt »Zwei Ansichten« – Der unüberhörbare Außenseiter. Johannes Bobrowski, Dichter der sarmatischen Welt – Der Philosoph Wolfgang Heise zwischen eigenem und fremdem Auftrag – Die Seefahrer. Der Kinderbuchautor Benno Pludra zwischen Utopie und Melancholie – Missglückte Generalprobe zum »Kahlschlag«, die Schriftsteller wehren sich
Der Absturz
Die Vision eines »sauberen Staates« – Auftritt der kleinen Geister auf großer Bühne – Wo ist Stalin geblieben? Stefan Heym stellt hinderliche Fragen und bietet sich allen Funktionären als Feindbild an. »Die Langeweile von Minsk« wird zur Munition des Plenums und der Autor lernt seinen Innenminister kennen – Brigitte Reimann und die Implosion eines Weltbildes – Robert Havemann plädiert via »Spiegel« für eine neue KPD, aber eine reformierte. Ein unwillkommener Reform-Beitrag zum Plenum – Helga M. Novak kehrt in die DDR zurück und übt sich in das Schicksal einer Staatenlosen ein – Mut zum Abseits. Christa Wolfs Plenumsrede. Befreiung im Widerspruch – Auf verlorenem Posten. Ulbrichts große Wirtschaftsreformrede auf dem Plenum und die Fußangeln des »Kahlschlags« – »Fräulein Schmetterling«, Christa und Gerhard Wolfs verlorener Film. Auf dem Weg aus der Krise: »Nachdenken über Christa T.« – Die Welt als Garten. Vorboten zur Wendung in die Romantik in »Juninachmittag« – »Der verlorene Engel«. Einer von zwölf – »Simplicius Simplicissimus«. Mehr als eine Filmerzählung – Kurt Maetzig und Walter Ulbricht. Geschichte einer Demütigung, mit den Augen von Brigitte Reimann gesehen – Exkurs: Besuch zum hundertsten Geburtstag. Kurt Maetzig ist weltweise geworden – Die DEFA-Misere. Frank Beyers »Spur der Steine« wird verboten. Konrad Wolf bekennt sich und widerruft – Werner Bräunigs »Rummelplatz«. Der Arbeiterschriftsteller als Ärgernis – Nochmal die Wismut: »Columbus 64« – Volker Braun, »Kipper Paul Bauch« und Vorspiele zur »Übergangsgesellschaft«. Das »Kursbuch« streitet für die DDR
Die Trümmer
David gegen Goliath. Stefan Heym kennt sich mit psychologischer Kriegsführung aus, zu seinem Glück – Der eiserne Besen: Kurt Turba, Hans Bentzien und Günter Witt werden abgesetzt – Franz Fühmann zieht sich zurück, taucht ab in die Welt der Mythen – Heiner Müllers »Der Bau«. »Die Fähre zwischen Eiszeit und Kommune« – Peter Hacks und »Moritz Tassow«. Ein letzter Versuch, DDR-Gegenwartstheater zu machen – Exkurs: Der Romantikfeind Peter Hacks oder Wer hat Schuld am Untergang der DDR? – Der Einzelne und die Revolte. Einar Schleef kämpft um den Anfang, der einer ist – Anna Seghers sucht das »wirkliche Blau« – Erich Arendt taucht ab, bis ins Licht der Ägäis – Stephan Hermlin. Der Kommunist als Anwalt »spätbürgerlicher Kunst« – Zwischen Kaltem Krieg und »Wandel durch Annäherung«. Die Kultur entzieht sich der Instrumentalisierungsabsicht – Abbruch der Wirtschaftsreform auf Raten. Vorspiel zum Staatsbankrott?
Epilog. Nochmal Heiner Müller, diesmal mit Ulrich Mühe. Hamlet wird zum Sinnbild des Intellektuellen in der DDR. Warum dieser hätte frei sein sollen und es doch – zumeist – nicht sein konnte
Anhang
Anmerkungen
Literaturverzeichnis (Auswahl)
Bildnachweis
Quellen der Motti
Personenregister
Prolog. Fritz Cremer, »Der Aufsteigende«
Sie stand in Wolf Biermanns Arbeitszimmer in der Berliner Chausseestraße 131 auf demselben kleinen Tisch, auf dem er auch das Foto seines in Auschwitz ermordeten Vaters aufgestellt hatte. Die Bronze trägt den Titel »Der Aufsteigende« und ist im Original 2,96 Meter hoch. In ihrer Monumentalität wäre sie dann wohl in die darüberliegende Wohnung durchgestoßen oder, wahrscheinlicher noch, durch ihr Gewicht in die darunterliegende herabgestürzt.
Aus gutem Grund war dies also nur eine Miniatur auf Biermanns Tisch. Verkleinerungsformen haben überhaupt starke Vorzüge, besonders dann, wenn es um monumentale Bronzen geht, noch dazu mit dem Titel »Der Aufsteigende«!
Cremers Skulptur lässt den Widerspruch anschaubar werden, um den es im Folgenden gehen soll. Das selbst Gewollte gilt es ab einem bestimmten Punkt wieder zu verneinen. Das ist so schmerzhaft wie der wachsende Zweifel in aller Hoffnung. Wann ist der Punkt erreicht, da Geist und Macht sich unwiderruflich trennen? Bis wann ist Hoffnung eine reale Möglichkeit, ab wann bloße Illusion?
Wolf Biermann hat aus diesem DDR-Doppelgefühl, das sich für ihn in »Der Aufsteigende« versinnbildlicht, ein Gedicht gemacht. Es erscheint 1968 in dem Band »Mit Marx- und Engelszungen« bei Klaus Wagenbach in Westberlin und beginnt:
Mühsam aufsteigender
Stetig aufsteigender
Unaufhaltsam aufsteigender Mann
Mann, das iss mir ja ’n schöner Aufstieg:
Der stürzt ja!
Der stürzt ja fast!
Fritz Cremer schuf »Der Aufsteigende« in den Jahren 1966/67. Die Figur steht heute vor dem UNO-Gebäude in New York, zwei weitere Abgüsse sind vor der Kunsthalle Rostock und im Skulpturenpark Magdeburg zu sehen. In diese Bronze geht all das ein, worüber in der DDR 1965 gestritten wird. Was ist der Mensch in der Geschichte? Ihr bewusster Gestalter, ihr blindes Opfer – oder beides zugleich?
Die Skulptur zeigt einen Mann mittleren Alters, wie er auch in der Häftlingsgruppe seines Buchenwalddenkmals stehen könnte. Kein Optimist, ein gebrochener Mensch: ein Leidender. Seine nackten Füße tasten unsicher nach einem Weg – ob er abwärts oder aufwärts geht, wird erst später zu entscheiden sein. Der Gehende selbst weiß es nicht. Aber seine himmelwärts erhobenen Arme, die den Kopf zu bergen versuchen, zeigen seine Schutzlosigkeit, sein Ausgeliefertsein. Da geht einer, die Hand hilfesuchend zum Himmel erhoben, als ob nur von dort noch Hilfe kommen könnte, doch der Glaube hat ihn verlassen.
Welcherart dieser merkwürdig stürzende Aufstieg, der hier zu besichtigen ist, denn sei, darüber hat Wolf Biermann seine Vermutungen angestellt:
Wohin steigt dieser da?
Da oben, wohin er steigt
was ist da? Ist da überhaupt oben?
Du, steigt der auf zu uns?
Oder steigt er von uns auf?
Geht uns der voran?
Oder verlässt er uns?
Verfolgt er wen?
Oder flieht er wen?
Macht er Fortschritte?
Oder macht er Karriere?
Die beiden letzten Fragen ließen sich vielleicht so beantworten: Wohl keines von beiden, es sei denn, der Fortschritt bestünde darin, auf jede Art von Karriere zu verzichten. Später wird Biermann Grund haben, an seinem Freund Fritz Cremer zu zweifeln, den »wir alle mit Vorsicht bewunderten, weil er mutig war, aufsässig, aber gleichzeitig mit festen Stricken gebunden an das Regime«. Wie immer, wenn Mensch und Geschichte aufeinanderstoßen, wird es auf komplizierte Weise dramatisch.
Erklärt es etwas, wenn man Stephan Hermlin liest, der bereits 1968 notierte, er finde »bei Cremer Verfinsterungen, Anmut, ein nicht gängiges, zurückgenommenes Pathos, die Neigung zur Parabel, eine helle, schneidende Sinnlichkeit, plebejische Noblesse«?1 Wir ahnen: Der Aufsteigende ist kein Held, es sei denn einer nach verlorener Schlacht. Das ist Cremers Realismus.
Da steht jemand wie Herakles am Scheideweg. Soll er nun rechts oder links an der Wegkreuzung abbiegen? Am Ende scheint die Richtung, die er nimmt, gleichgültig, wichtig ist nur, dass er sich entscheidet. Denn welchen Weg er auch gehen wird, wenn es aus eigenem Entschluss heraus geschieht, ist eines ohnehin klar: Diesem Aufstieg, der den Sturz in sich trägt, kann nur noch ein Gang ins Ungewisse folgen, allein.
So sehen wir in »Der Aufsteigende« einer Geburt zu: der des Alleingehers.
Warum zeigt sich in dieser Bronze der innere Widerspruch der DDR? Warum ist es überhaupt so entscheidend, über das zu reden, was im Bereich von Kunst und Literatur entstand, welches Kräfteverhältnis zwischen Kultur und Politik existierte – und welche Rolle der Intellektuelle im Staate spielte? Man muss sich die Lage vergegenwärtigen: Anders als die Bundesrepublik war die DDR ihrer Geburt nach eine Gesellschaft auf ideeller Basis. Was immer auch passierte, es resultierte nicht aus Marktzwängen und Kapitalverwertungslogik, es war zuvor gedacht und geplant worden: der deutscher Zukunftsstaat sollte jenseits der Herrschaft des Kapitals entstehen! Diese Vision trägt eine lange Reihe von Sozialutopien in sich, von Thomas Morus’ »Utopia« bis zu Campanellas »Sonnenstaat« – auch Fichtes Vision eines »geschlossenen Handelsstaates« gehört in die Vorgeschichte der DDR. Da konkurrierte von Anfang an die freie Assoziation aller mit einem sektenhaften Regime, das sich auf die Herrschaft der von der Sache Überzeugtesten, der Eiferer und Fanatiker gründete (im Fortgang allerdings immer mehr der Zyniker und Virtuosen des Apparats).
Wofür steht eine solche Diktatur aus dem Geiste der Moral? Um diese Fragen dreht sich der Streit – auch darum, ob man nicht anstelle der für jeden Demagogen missbräuchlichen Moral tragfähigere Elemente für die Konstruktion der sozialistischen Gesellschaft suchen sollte: Marktgesetze etwa für die Wirtschaft, oder Rechtsnormen, die das Verhältnis von Bürger und Staat über das bloße Strafrecht hinaus regeln.
Was nun – Mitte der 60er Jahre – für die einen notwendige Reform ist, wird in den Augen der anderen zur Aufweichung unantastbarer Grundprinzipien, zum Verrat. Wer etwas verändern will, steht sofort im Verdacht, ein Agent des Klassenfeindes zu sein, ein Reformist, ein Renegat.
Dieser Generalverdacht gegen jedes schöpferische Moment in der Gesellschaft droht den alleingängerischen Gedanken sofort wieder an der Mauer der Kollektivität zu erdrücken. Aber noch – so zeigt Biermanns Cremer-Gedicht – gibt diese kulturelle Avantgarde den Kampf um die Deutungshoheit der eigenen Angelegenheiten nicht auf.
Das sozialistische Menschenbild wird folgerichtig zum Casus belli der inneren Verfassung des Staatswesens. Wohin geht die Reise im Namen des Kommunismus?
Eine Diktatur des Proletariats scheint unvereinbar mit dem grundlegenden Marx-Satz im »Kommunistischen Manifest«: »Die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung der Freiheit aller.« Da scheinen von Anfang an – bereits in der Theorie also – unauflösbare Widersprüche auf.
Genau deshalb greift der vor allem unter Künstlern und Intellektuellen geführte Streit um den richtigen Entwicklungsweg des Sozialismus so tief ein ins Selbstverständnis der DDR-Gesellschaft.
Ist die DDR ein Resultat der Aufklärungsgeschichte? Ja, auch das. Aber was von einer geistigen Elite gedacht wird, prallt immer sofort auf den Machtanspruch der herrschenden Partei. Die intellektuelle Avantgarde trägt darum eine schwere Last. Sie muss Alternativen wachhalten, ein Bewusstsein des Möglichen gegen die Diktatur des Wirklichen wecken. Die Idee des Sozialismus erweist sich dabei als okkupiert von der Ideologie als bloßer Legitimationstheorie bestehender Machtverhältnisse. Aber auch diese sind Teil der europäischen Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts. Sie werden nach dem Untergang Nazideutschlands in der sowjetischen Besatzungszone durch die Siegermacht gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung installiert – sind Resultat des Kalten Kriegs.
Mitten in der DDR existiert die Idee vom »anderen Deutschland« – als oppositionelles Minderheitenprojekt in Konkurrenz zum anderen Minderheitenprojekt, dem des Machtanspruchs der SED. Auch darum trifft der Streit um die Rolle von Kunst und Literatur in der Gesellschaft immer sofort den Lebensnerv des Staates.
Dieser Kulturkampf tobt Mitte der 60er Jahre in der DDR. Nein, er tobt nicht laut, er schleicht eher auf leisen Sohlen durch die Hinterzimmer der Macht. Dann dringt er schließlich doch nach außen. Jeder kann im Dezember 1965 wissen, dass hier und jetzt über die Ankündigung »Stalin verlässt den Raum« entschieden wird. So hatte Stefan Heym eine Rede im Dezember 1964 genannt, die den Charakter eines Manifests bekommen sollte. Lasst uns den Raum desinfizieren, den Stalin verlassen hat!, forderte er darin. Aber stimmt der Befund denn, hat Stalin ihn überhaupt verlassen?
Es ist ein Kampf der Ideologie gegen die Kultur, der Kultur um ihr geistiges Überleben – und um ihre Gestaltungsmöglichkeiten in der Gesellschaft. Es sind Künstler wie der Bildhauer Fritz Cremer, die auf der Notwendigkeit des Widersprechens bestehen, so wie 1964 in seiner Rede auf dem 5. Kongress des Verbandes Bildender Künstler: »Wir brauchen die Erkenntnis, daß der Zweifel, die Kritik, wie dies schon bei Marx geschrieben steht, ein Grundelement historisch-materialistischen Denkens ist. Wir brauchen auch in der Kunst die Herausforderung zu diesem Zweifel an jedermann, weil dieser eine ständig sich erneuernde Überprüfung des jeweils Erreichten darstellt. … Wir brauchen das Recht, die Pflicht und die Verantwortung zu dieser zweifelnden Kritik, und wir brauchen nicht das Vorrecht einzelner dazu.«2
Nach Cremers Rede, die die Autonomie der Kunst fordert, kocht die Kampagne gegen ihn hoch, wie Brigitte Reimann in ihrem Tagebuch notiert. »Sie wollen die Maler zwingen, eine Entschließung gegen den ›Parteifeind‹ Cremer zu unterschreiben. … Noch weigern sich die Maler, aber wahrscheinlich werden sie doch mürbe diskutiert.«3
Denn Cremer lehnt hier nicht weniger ab als – zuerst einmal in Kunstdingen – die führende Rolle der Partei. Der Künstler stellt die Machtfrage. Genauer, es wird gefragt, wer eigentlich in welchen Belangen die Macht im Lande hat – und wer sie haben sollte.
Bis die SED-Führungsclique zum Gegenschlag ausholen wird, vergeht noch ein ganzes Jahr. Denn nicht nur zahlreiche Künstler und Schriftsteller denken wie Cremer, sondern sogar einige der von Ulbricht neu eingesetzten Funktionäre, die sich nicht länger als ideologische Wächter verstehen.
Erich Honecker wird dann auf dem 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965 das Prinzip Zweifel und Kritik in einen »Skeptizismus« umdeuten, der kleinbürgerlich sei und den man darum energisch bekämpfen müsse. Kleinbürgerlich? Cremer sagt: »Wir brauchen keine Verhaltensweisen, die jeder kleinsten Regung von irgend etwas Neuem, Unbekanntem mit politischen Verdächtigungen begegnen. Wir brauchen wahrhaftig und tatsächlich die Abschaffung dieses dogmatischen Teufels. … Wir brauchen die Einsicht, daß Dekadenz kein Begriff an sich ist. Wir brauchen die Einsicht, daß spätbürgerliche Kunst generell nicht gleichzusetzen ist mit dem Begriff Dekadenz. Wir brauchen die Einsicht, daß sich unsere Kunst an zivilisierte Menschen, Alphabeten und nicht Analphabeten wendet. (Beifall)
Wir brauchen die Einsicht, daß Formalismus ein legitimer Fachbegriff ist und nicht als politisch diffamierender Begriff angewendet wird. (Beifall).«4
Dies wird zur Programmschrift einer neuen Kunst, fordert die »unbedingte Eigenverantwortlichkeit des Künstlers«5, setzt dabei ein mündiges Publikum voraus. Die von Cremer wiederholte Grundthese lautet: Der Zweifel ist der Motor des Fortschritts.
Die Ideologiewächter sind verblüfft von dem, was hier der Vorzeigekommunist Cremer wagt: ein Loblied auf den kritischen Geist der eigenen Sache gegenüber. Das ist unerhört, arbeitet doch eine ganze Kaste von Politbürokraten daran, dem Volk die Skepsis auszutreiben. Es soll optimistisch sein und an den Sieg des Sozialismus glauben, vor allem aber keinerlei Zweifel an der führenden Rolle der SED haben, wobei ja nicht die Partei führt, sondern nur das Politbüro dieser Partei. Den Ideologiewächtern um Erich Honecker fällt nichts anderes ein, als eine Kampagne gegen den über Nacht zum Feind und Verräter erklärten Fritz Cremer anzuzetteln.
Aber die Debatte ist in der Welt. Es wird erbittert darüber gestritten, wie es weitergehen soll – auch mit Fritz Cremer. Und dann erhält er, statt bestraft zu werden, 1965 den Vaterländischen Verdienstorden! Daran wird deutlich, wie schnell in dieser Zeit die politischen Kräfteverhältnisse wechseln – im Zentrum der Auseinandersetzung steht nicht allein die 1963 begonnene Wirtschaftsreform, sondern eben auch die Frage nach der Stellung der geistigen Elite in der Gesellschaft.
In »Der Aufsteigende« spielt sich dieser Kampf um die Bewegungsrichtung vor aller Augen ab. Es ist ein erbittertes Ringen, mit sich selbst zuerst, aber auch mit den Widerständen der Welt. Der Abschied von der triumphierenden Geschichtsauffassung soll unumkehrbar sein.
Dies ist aber nicht nur ein Thema, in dem es um das Gestern geht. Denn als ich vor einigen Jahren in Berlin eine Ausstellung über den Alltag in der DDR6 sah, die, auf jeden ordnenden Gedanken verzichtend, Agitation und Kunst, viel wertlosen Ramsch und einige Kostbarkeiten in gebührender Lieblosigkeit zur Illustration der – den Geschichtsprozess verschlagwortenden – These vom »Unrechtsstaat« versammelte, da stand ich auch plötzlich vor einer Figur, die zu Fritz Cremers Buchenwalddenkmal gehört, das er von 1952 bis 1958 schuf, und vom Ettersberg auf Weimar herabblickt. Ein großes, die Zeiten überdauerndes Kunstwerk, das von Schmerz und Leid kündet, den Opfern des KZ Buchenwald gewidmet. Doch diese Figur wurde in der Ausstellung als Beleg für »verordneten Antifaschismus« präsentiert, inmitten von serienmäßig produzierten Stalin- und Leninköpfen aus Gips oder Stein. Da schien es mir, als ob der so lange geführte Kampf um die Autonomie der Kunst in der DDR jetzt erst verloren wäre, als ob die Ideologen nun endgültig gesiegt hätten.
Fritz Cremers »Der Aufsteigende« aber ist ein Verlierer mit Zukunft. Wolf Biermanns Gedicht weiß auch von solch Optimismus der anderen Art:
Dieser Fleischklotz strebt auf
Dieser Koloß steigt und steigt
– das ist eben ein Aufsteigender!
Heiner Müller hat ein starkes Unbehagen empfunden, angesichts der Verdammungswut notorischer Kommunistenhasser, die unmittelbar nach der Wende (erst danach, nicht davor!) auch Cremer jenen Ideologen um Honecker zuschlugen, die lebenslang seine schlimmsten Feinde waren. Aber wozu differenzieren, auf die Unterschiede im Detail achten, wo man doch freie Hand im Entsorgen eines insgesamt unliebsamen Gesellschaftsexperiments hatte! Müller schrieb im September 1993 zum Tode Fritz Cremers: »Seine Arbeit war ein Kampf gegen das Vergessen: von den Zusammenbrechenden unter der Last der von den jeweils Stärkeren geschriebenen Geschichte zu den Aufsteigenden gegen ihren Alptraum. Seine Skulpturen sind im Wortsinne Denkmäler, für Monumente hatte er keinen Sinn, für die Sieger keinen Blick.«7
Es gibt fast zwanzig Jahre nach »Der Aufsteigende« eine andere Skulptur Cremers, die sehr zornig wirkt. 1982 wurde sie auf der 9. DDR-Kunstausstellung in Dresden präsentiert. Sie heißt »Sich vom Kreuz Lösender« und zeigt Jesus, der vom Kreuz herabsteigt. Genug gelitten, genug angebetet worden? Was jetzt noch folgt, ist ein einsamer Kampf jenseits der Ideologien, um die sich die Kollektive scharen.
Diese Skulptur vom herabsteigenden Jesus habe ich mit siebzehn Jahren in der Ausstellung als das gesehen, als was sie wohl auch gemeint war: ein Akt der energischen Selbstbefreiung, das Zerbrechen einer Rolle, die man nicht länger mehr spielen will.
Der Aufstieg
… der Dialog mit den Toten darf nicht abreißen, bis sie herausgeben, was an Zukunft mit ihnen begraben worden ist.
Heiner Müller, 1986 im Gespräch mit Wolfgang Heise
Das Schicksalsjahr 1965
Es gehört zu den eher stillen Jahren, jedenfalls auf den ersten Blick. Halbzeit zwischen 1961 und 1968 und doch dramatischer Höhepunkt der 60er Jahre nach dem Mauerbau und vor dem Prager Frühling und dessen gewaltsamer Niederschlagung. 1965 ist noch offen, wohin die Reise geht. Es gärt im Innern, aber nach außen scheint lange alles ruhig.
Und doch, in diesem Jahr entscheidet sich das weitere Schicksal des 1963 begonnenen Reformversuchs in der DDR.
Der Westen, so scheint es, hat das Jahr 1965 verpasst – vielleicht war man dort nicht auf eine »Reform von oben« vorbereitet gewesen, vielleicht wollte man auch einfach das, was als Verbesserung des Sozialismus in der DDR gedacht war, nicht wahrhaben, erst recht nicht unterstützen. Noch ist in Westdeutschland von Entspannungspolitik nicht die Rede. Die Regierenden in »Pankow« versucht man in einer antikommunistischen Tonart, die mitunter die Vorgeschichte derer verrät, die sie anschlagen, gleichsam verbal zu exekutieren. Es herrscht kalter Krieg auf der Grenze zum heißen. Man schreibt – nicht allein bei Springer – nur von der Ostzone, und wenn man die DDR bei ihrem Namen nennt, dann ausschließlich in höhnischen Anführungszeichen.
Das weckte lange den Trotz derer im Osten, die mit Adenauers westdeutscher Restauration nichts zu tun haben wollten. Nein, bis Mitte der 60er Jahre war die Bundesrepublik auch für enttäuschte Sozialisten zumeist keine Alternative, erst recht nicht für Künstler, denn was Bundeskanzler Erhard, selbiger, der kritische Autoren als »Pinscher« beschimpfte, über moderne Kunst zu sagen hatte, das klang nicht gerade verheißungsvoll. So rief er am 29. Mai 1965 auf dem Landesparteitag der baden-württembergischen CDU in Ravensburg völlig unverblümt aus: »Ich kann die unappetitlichen Entartungserscheinungen der modernen Kunst nicht mehr ertragen. Da geht mir der Hut hoch.«1 Immerhin, von entarteter Kunst zu sprechen, davor bewahrte Ulbricht sein politischer Instinkt.
Aber wäre mit Walter Ulbricht denn zu rechnen gewesen, wenn es um mehr Freiheiten in der DDR ging? Für die Künstler im Lande war Ulbricht ein Feindbild. Sein kleinbürgerlicher Kunstgeschmack macht ihn auf diesem Gebiet zum Dogmatiker. In Kunstdingen erwiesen er und seine Frau Lotte sich als nicht lernfähig, auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik dagegen schon. Denn Ulbricht versuchte sich mit dem 1963 beschlossenen Neuen ökonomischen System der Planung und Leitung (NÖSPL), später auch Neues ökonomisches System (NÖS) genannt, ernsthaft aus dem Schatten Stalins freizumachen.
Die 60er Jahre sind eine Zeit der wirtschaftlichen Experimente. Gesucht wird eine Form der »geregelten Marktwirtschaft«, ein Drittes, jenseits der bisherigen Kommandowirtschaft des Plans wie auch der freien Marktwirtschaft. Ulbricht setzt auf Experten statt Funktionäre, auf eine Jugend, die fähig ist, die Macht in ihre Hände zu nehmen.
Der Generationenkonflikt, zugleich der Schlüssel zur Reformpolitik der 60er Jahre in der DDR, wird zum neuralgischen Punkt jenes Kulturkampfes, der auf dem 11. ZK-Plenum 1965 kulminieren wird.
Ab Anfang der 60er Jahre versucht sich eine junge Generation von Künstlern und Intellektuellen energisch aus der ideologischen Umklammerung zu befreien. Der utopische Überschuss soll Neues ermöglichen, wenn Gegenwart zu vergreisen beginnt. Eine Strukturreform von bislang ungekanntem Ausmaß, vor allem in der Ökonomie, aber auch des politischen Systems im Ganzen, scheint plötzlich möglich.
Eine Vielzahl von Forschungseinrichtungen entsteht, lauter Laboratorien der Zukunft, so die Vision Ulbrichts und seines Stabes. Er weiß, dass er diese Pläne jenseits des eingefahrenen Apparats realisieren muss.
Kybernetik ist so ein umkämpftes Feld. Der Kopf dieser kybernetischen Forschung, der Philosoph Georg Klaus, erlebt gleich mehrfach das Gefühl einer Achterbahnfahrt. Die Funktionäre winken derartige Aktivitäten mehrheitlich als Kuriosum durch. Günter Mittag, zentraler Wirtschaftslenker unter Honecker, war Anfang der 60er Jahre noch Mitarbeiter Erich Apels gewesen, dem Chef der Wirtschaftsreform. Aber dann lief er zu den Dogmatikern über und schrieb später leichthin über allerlei »Allotria«, das in den 60er Jahren getrieben wurde. Scharlatane hätten es geschafft, sich des alternden Walter Ulbricht für ihre obskuren Ideen zu bedienen.
Tatsächlich wurde von 1963 bis 1967, also zwischen dem 6. und 7. Parteitag der SED, in »strategischen Arbeitskreisen« über Kybernetik, Modelltheorie, Praxeologie, Operationsforschung etc. nachgedacht. Man gründete eine Akademie für »Marxistisch-Leninistische Organisationswissenschaft« in Berlin Wuhlheide, forschte über solche futuristische Themen wie »komplexe Systemautomatisierung in Großvorhaben« oder über »Fließverfahrenszüge«. Es fanden Schulungen leitender Kader des Ministerrates statt, die allerdings verständnislos auf die mathematischen Formeln blickten, die Schwung in die sozialistische Produktion bringen sollten.
Der Reform-Ökonom Herbert Wolf erinnert sich an diesen Versuch, mittels »Heuristik« aus Führungskadern avantgardistische Reformdenker zu machen: »Aber Ulbricht, der die Anwendung dessen für die Tätigkeit der ›Baumeister‹ einer neuen Gesellschaft als erfolgversprechend ansah und deshalb die Schulung organisieren ließ, hatte keine Ahnung davon, daß 90 % der Anwesenden sich keineswegs als Baumeister in diesem Sinne fühlten (und fühlen konnten), daß aus ihrer Sicht ein eigenes Denken, ein schöpferisches und produktives gar, im Staatsapparat keinen einzigen Tag seit Fassung der Reformbeschlüsse in Mode gekommen war, ganz zu schweigen vom Erkennen oder gar Aussprechen von Problemlagen, samt Angebot von Lösungen hierfür. Außerdem war das natürlich auch eine rein intellektuelle Überforderung; denn selbst im Kreise von Wissenschaftlern wäre eine solche Angelegenheit nicht mit ein paar Vorträgen und Fragestunden abzutun gewesen.«2
Warum ist der Streit um die Kybernetik in den 60er Jahren von solch entscheidender Bedeutung für die DDR? Der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener hatte den Begriff 1948 geprägt. Es ging ihm um Systeme, die sich – zumindest teilweise – selbst steuern können. Ohne die Kybernetik wäre die Entwicklung moderner Rechner und der virtuellen Web-Welt undenkbar gewesen. Für den Marxismus-Leninismus und seine Lehre von der gesetzmäßigen Entwicklung der Geschichte zum Kommunismus war die Kybernetik eine Möglichkeit, aus der geschlossenen Welt der Dogmatik ins Freie des Experiments zu gelangen. Philosophen wie Peter Ruben entwickelten den Kybernetik-Gedanken auf die Gesellschaft bezogen weiter und kamen zur »Praxisphilosophie«, die für alle Hüter des dialektischen Materialismus purer Revisionismus war und von einem bestimmten Zeitpunkt an nur noch in Verbindung zum »jugoslawischen Weg« gebracht und damit diskreditiert wurde.
Besonders interessant an der Kybernetik erschien Denkern wie Georg Klaus das Phänomen der rückgekoppelten Systeme. Was passiert, wenn man mit diesen nun die starre Planwirtschaft aushebelt, ein dynamisches Übergangsfeld aus Markt- und Planwirtschaft schafft, das sich größtenteils selbst regeln kann? Eine verführerische Perspektive tat sich da auf. Klaus verglich bereits 1961 die Bedeutung der Kybernetik mit den »Entdeckungen eines Kopernikus, eines Darwin und Marx«. Gemeint ist damit die wahrhaft revolutionäre Einsicht, dass sich hochkomplexe Systeme (auch soziale Systeme) nicht mehr zentral steuern lassen. Ulbricht, von diesen Überlegungen überzeugt, räumte der Entwicklung von Steuerungssystemen darum Priorität ein. Auf dem 6. SED-Parteitag 1963 wurde sogar eine »Kommission für Kybernetik« eingesetzt.
Erste Erfolge, die auf dieser breiten Grundlagenforschung basierten, zeigten sich 1967, als der Großrechner Robotron »R300« in Serie ging – damals eine Entwicklung auf Weltniveau. Doch nach Ulbrichts Sturz und dem Kurswechsel auf dem 8. SED-Parteitag 1971 wurde die Kybernetik umgehend lächerlich gemacht und die Forschung gestoppt. Das hatte ideologische Gründe, denn nach dem Prager Frühling wollte die SED-Spitze kein Nachdenken mehr über sich selbst steuernde Systeme. Der neue Generalsekretär Erich Honecker erklärte dann auch in seiner Rede auf dem 8. Parteitag in scharfer Diktion: »Nun ist endlich erwiesen, dass Kybernetik und Systemforschung Pseudowissenschaften sind.«3
Welch ein Affront gegen Ulbricht (ab 1971 nur noch Staatsratsvorsitzender), der dem Parteitag demonstrativ ferngeblieben war. Kaum also hatte Stalin, wie von Stefan Heym erhofft, zumindest halb den Raum verlassen, kehrte er schon wieder zurück.
1963 beginnt Stefan Heym den Roman »Die Architekten« zu schreiben, den er drei Jahre später abschließt. Er verfasst ihn auf Englisch und schleust das Manuskript zu seinem Verlag Cassel’s in London. Dort lehnt man die Veröffentlichung jedoch ab. Man verstehe nicht, worum es Heym in dem Buch überhaupt gehe. Erst 1999 wird Heym das Manuskript selbst ins Deutsche übertragen, 2000 endlich erscheint es bei Bertelsmann.
Worum also ging es Heym? Um eben jene Baumeister-Frage. Welches Bild projiziert eine Gesellschaft von sich in die Zukunft, und welche Köpfe sind es, die diese Aufgabe übernehmen? Meistens, so Heym, bekommen sie diesen Auftrag von irgendjemandem übertragen, oder aber sie reißen ihn auf verschiedene Art und Weise an sich.
Da liegt es nahe, an Hermann Henselmann zu denken, der sich als Chefarchitekt Berlins (also quasi als »Staatsarchitekt« der DDR) den jeweils herrschenden Ideologien unterordnete, vom Zuckerbäckerstil der Stalin-Allee in den frühen 50er Jahren bis zum Funktionalismus des Leipziger Universitätshochhauses in den 60er Jahren – und als Opportunist aller Macht dabei doch auch immer versuchte, eigene Ideen durchzuschleusen.
Ein Architekt, so wusste Henselmann, braucht einen Bauherrn. Für große repräsentative Projekte ist das der Staat.
Brigitte Reimann wird sich 1965 mit »Franziska Linkerhand« ebenfalls diesem Thema zuwenden. Denn wie man etwas in einer Gesellschaft baut, das zeigt, wie man in ihr leben will. Der Streit um Ornament und Funktion am Bau mündet letztlich in eine Frage nach dem Menschenbild. Wer soll in welchem Haus wohnen?
So gleicht die Situation in den 60er Jahren der DDR dem Richtungsstreit der 20er Jahre in der Sowjetunion um die Fortführung der Neuen Ökonomischen Politik (NÖP). Und Ulbricht, der diese Auseinandersetzung damals bereits miterlebt hatte, stellt sich diesmal auf die Seite Bucharins, des Hauptopponenten von Stalins Ideologie des sich »verschärfenden Klassenkampfs«, die den Terror gegen die eigene Bevölkerung legitimierte.
1929 hatte Stalin in einer Rede über »rechte Abweichler« im Politbüro der KPdSU Bucharin an den Pranger gestellt, was einem bloß noch für einige Jahre ausgesetzten Todesurteil gleichkam, wie dieser sehr wohl verstand.
Nun die gleiche Konstellation – nur jetzt mit dem vormaligen Stalinisten Ulbricht in der Rolle des »rechten Abweichlers«?
Es gibt in diesen Jahren auf der einen Seite zweifellos einen utopischen Überschuss, Raum für Experimente. Auf der anderen Seite wird weiterhin mit Verboten regiert. Und beide Tendenzen laufen in Ulbrichts Regierungsstil zusammen. Ernst Bloch, Verkörperung des »Prinzip Hoffnung«, hatte 1961 der DDR den Rücken gekehrt, ebenso 1963 Hans Mayer. Für beide Intellektuelle, die mit großen Erwartungen aus der Emigration in den Osten Deutschlands kamen, war die DDR mit ihrem Anspruch, das bessere Deutschland zu sein, gescheitert. Der Leiter des Aufbau-Verlages Walter Janka und der Philosoph Wolfgang Harich saßen seit 1957 im Zuchthaus. Ihr Verbrechen: über ein demokratisches Deutschland nachgedacht zu haben. Auch das passiert in der ersten Hälfte der 60er Jahre: Robert Havemann wird zur Unperson erklärt, Wolfgang Langhoff darf das Deutsche Theater nicht mehr leiten, und Wolf Biermann erhält Auftrittsverbot.
Man vertrieb, so scheint es, systematisch diejenigen unter den einstigen Mitstreitern für ein sozialistisches Deutschland, die einen weiten Horizont und eine eigene Handschrift besaßen. Und das unter maßgeblicher Mithilfe Ulbrichts, der andererseits wiederum die Funktionäre und den Apparat hasste und in den 60er Jahren energisch versuchte, die DDR auf eine belastbarere ökonomische Grundlage zu stellen, um in der Gesellschaft jene Dynamik zu wecken, die sie zum Überleben in direkter Nachbarschaft zum westlichen Deutschland brauchte.
Ein Widerspruch, der schwer zu erklären – und für die Beteiligten noch schwerer auszuhalten war. Friedrich Dieckmann resümiert den Geist Anfang der 60er Jahre so: »Es ist nicht anders: Ulbricht und Biermann ziehen an einem Strang, nur weiß Biermann das nicht.«4 Dieckmanns Erklärung dafür gibt der staatspolitischen Räson ihren Raum: »Ulbricht kann es sich nicht leisten, von der Kunst, also von unten, unterstützt zu werden; dabei könnten sich Ventile öffnen, die nicht leicht wieder zu schließen wären.« Daraus folgert er: »Ulbricht kann Verbündete, Vorprellende in der künstlerischen Sphäre nicht nur nicht brauchen, sie wären eine politische Gefahr für ihn.«5 Diese Überlegungen sind von einer tiefgreifenden Erfahrung mit dem staatssozialistischen System und dem daraus folgenden Problem einer von Ulbricht gewollten »Reform von oben« geprägt. Wir wissen heute, dass diese gründlich misslang. Aber musste sie vielleicht auch deshalb misslingen, weil sie letztlich eben diesen quasi anarchistischen Impuls »von unten« (Biermann!) abwehrte, die freien Geister im Lande nicht ansprach?
Ist das eine romantische Vorstellung, die nicht mit den harten Fakten des Politischen, auch des Weltpolitischen (es herrscht immerhin Kalter Krieg) rechnet – oder sollte man im Gegenteil sagen, es sei jener vielleicht einzig rettende Weg für die DDR gewesen, der paradoxerweise erst nach dem Mauerbau offenstand: die Verbindung eines reformierten Sozialismus, den Ulbricht gegen Widerstände im Apparat forcierte, mit der Intelligenz und Phantasie jener Elite, um die Ulbricht hätte werben müssen, um den Kampf mit dem Apparat zu gewinnen?
Er tat es nicht, weil der Machtpolitiker in ihm Angst vor unberechenbaren Folgen hatte. Eine massenhafte Freisetzung des Visionären, die Selbstübernahme der eigenen Angelegenheiten – für Ulbricht lag darin ein zu hohes Risiko, das der durch die Stalinsche Schule gegangene Funktionär in ihm nicht eingehen wollte.
Die Auseinandersetzungen über den neuen Kurs eskalieren im Dezember 1965 auf dem 11. Plenum des ZK der SED. Eine Gruppe um Erich Honecker, Sicherheits- und Kaderchef im Politbüro, startet einen verdeckten Angriff auf die Reformpolitik des 6. SED-Parteitags vom Januar 1963 – mit Rückendeckung Leonid Breschnews, des neuen Generalsekretärs der KPdSU in Moskau. Man sucht Stellvertreterschauplätze, meidet die von Ulbricht entschieden verteidigte Wirtschaftsreform, weicht aus in die Jugend- und Kulturpolitik. Dort beschwört man Misswirtschaft und Krise, fordert schnelles und hartes Eingreifen. Ulbricht, selbst Dogmatiker in Sachen Kultur, unterbindet den Angriff nicht, sondern taktiert, hofft, das Ablenkungsmanöver könne der Wirtschaftsreform nützen. Er bemerkt nicht sofort, worauf dieser Angriff zielt: auf die Reformpolitik im Ganzen.
So ist das Jahr 1965 eines der folgenreichen Entscheidungen. Die wichtigste, die einem Paradigmenwechsel gleichkam, war nicht weniger als die Verabschiedung des zentralen Leninschen Dogmas aus »Die große Initiative«. Sie lag bereits drei Jahre zurück und markierte den Beginn der Reform. Ulbricht, der sich von den Mängeln des sowjetischen Wirtschaftsmodells lösen und eigene Wege gehen wollte, hatte mit seinem Wirtschaftsberater Wolfgang Berger den entscheidenden Schritt gewagt. In einem Interview am 14. Dezember 1962 sprach er erstmals davon, das Primat der Politik (ein Kernsatz des Leninismus) müsse durch ein Primat der Ökonomie ersetzt werden. Ein Tabubruch, der bei anderen kommunistischen Spitzenfunktionären erst einmal zu Sprachlosigkeit führt. Nach der Ablösung Chruschtschows durch Breschnew im Herbst 1964 aber beginnen sie massiv diese neue Politik zu stören, sammeln sich um Erich Honecker, der Ulbricht stürzen will. Wollen wir etwa »sozialistische Millionäre« dulden?!, so agitieren sie nun gegen Ulbrichts Position. Aber der rückt nicht davon ab, der Markt müsse das Kriterium des Plans sein.6
Das Jahr 1965 wird zum Jahr der Entscheidung über diese Politik. Viele Hoffnungen liefen darauf zu, von ebenso vielen Befürchtungen begleitet.
Siegfried Seidel, damals Mitarbeiter des führenden Wirtschaftsreformers Erich Apel, schreibt rückblickend, dass, »wenn es je eine kleine Chance gegeben hat, die DDR ökonomisch attraktiv zu machen, sie in den Jahren 1963–1965 bestand«7.
Was er daraus folgert, greift weit aus in den utopischen Raum und liegt doch einige Jahre im Bereich des Möglichen: »Wenn die DDR den Kurs der Jahre 1963–1965 weitergegangen wäre und gemeinsam mit der CSSR 1968 eine Entwicklung zur Erneuerung des Sozialismus (eine vorgezogene Perestroika) vollzogen hätte, wäre es auch für die Sowjetunion schwieriger geworden, mit militärischen Mitteln diesen Prozeß zu stoppen.«8
Erich Apels mysteriöses Ende
Am 3. Dezember 1965, morgens gegen 9 Uhr, betritt Erich Apel, Chef der Staatlichen Plankommission, sein Arbeitszimmer im Haus der Ministerien. Apels Überzeugung: Die Großindustrie soll nach marktwirtschaftlichen Maßstäben arbeiten, Kredite aufnehmen können und Gewinne wieder selbständig investieren. Die Preise sollen sich am Marktwert orientieren, die Reform der Industriepreise ist bereits im Gange.
Walter Ulbricht weiß, die DDR kann nur überleben, wenn sie sich wirtschaftlich stärkt, gegenüber dem Westen konkurrenzfähig wird. In diesem Punkt ist der SED-Chef und Staatsratsvorsitzende politischer Realist. Der kommunistische Parteifunktionär und vormalige Reichstagsabgeordnete Ulbricht hat seine Erfahrungen im parlamentarischen System der Weimarer Republik gemacht. Debatten schreckten ihn darum nicht, anders als Erich Honecker. Er ist zwar rhetorisch für seine Zuhörer allein schon durch seinen sächsischen Singsang eine Zumutung, jedoch macht er in den 20er und frühen 30er Jahren in direkter Konfrontation mit Joseph Goebbels, dem Berliner Gauleiter der NSDAP, durchaus erfolgreich Politik. Ulbricht führt in Versammlungen die Regie, am liebsten aus dem Hintergrund. Am Ende fasst er dann die Diskussion persönlich zusammen – natürlich in seinem Sinne.
Wenn er trotzdem eine Mehrheit gegen sich weiß, die er nicht dominieren kann, stellt er sich umgehend an ihre Spitze und bekämpft seine Kontrahenten von dort aus. Das nennt man politisches Talent.
Ins sowjetische Exil geflüchtet, überlebt er das »Hotel Lux«, erfährt dabei, wie potentielle Opfer zu Mittätern gemacht werden. Er kennt das stalinistische System genau, war selbst dessen Teil.
Als die 6. Deutsche Armee unter Generalfeldmarschall Paulus in Stalingrad eingekesselt wird, bekommt Ulbricht den Marschbefehl. Am 29. November 1942 fährt er zusammen mit den Schriftstellern Willi Bredel und Erich Weinert nach Stalingrad. Sie sollen vor den deutschen Linien die eingekesselten Truppen zur Kapitulation bewegen. Dazu müssen sie mit ihren Lautsprechern in die vordere Frontlinie. Kaum beginnen sie zu sprechen, werden sie auch schon mit Maschinengewehren beschossen. Weihnachten 1942, im Propagandaeinsatz vor den deutschen Linien, kommt es auch zur ersten Begegnung mit Nikita Chruschtschow, Mitglied des Politbüros der KPdSU und des »Kriegsrates der Stalingrader Front«. Diese Begegnung schafft die Grundlage für ihr späteres Vertrauensverhältnis. Man isst und redet zusammen und Chruschtschow spottet: »Na, Genosse Ulbricht, es sieht nicht so aus, als ob Sie sich heute Ihr Abendbrot verdient hätten. Es haben sich keine Deutschen ergeben.«9
Ulbricht beobachtete Stalins Mechanismen der Machtsicherung – permanente Kontrolle durch den Apparat, Stigmatisieren von echten oder willkürlich ausgewählten Außenseitern, Rituale der Selbsterniedrigung, die sogenannte Selbstkritik. In etwas abgeschwächter Form (der politische Tod eines Widersachers reichte ihm, der physische ist nicht notwendig) würde er sie später in der DDR kopieren. Ulbricht, der politische Überlebenskünstler, hatte die Abrechnung mit dem »Personenkult« nach dem 20. Parteitag der KPdSU 1956 und die vorsichtige Liberalisierung der sowjetischen Gesellschaft – als es im SED-Politbüro um Karl Schirdewan plötzlich eine ernsthafte Opposition gegen ihn gab – durch geschicktes Taktieren politisch überstanden. »Stalin ist kein Klassiker mehr«, lautete das magere Fazit, mit dem Ulbricht seine Genossen über den 20. Parteitag der KPdSU informierte, auf dem Chruschtschow erstmals über Stalins Verbrechen gesprochen hatte.
Erich Apel wird Ulbrichts Mann für das, was unter Chruschtschow an eigenständiger Entwicklung in der DDR möglich scheint. Als Wirtschaftsorganisator ist er ein hervorragender Fachmann, innerhalb der Parteinomenklatura jedoch ein Außenseiter, dem man misstraut.
Sein Werdegang prädestiniert ihn erst einmal nicht für eines der höchsten Ämter. Von 1939 bis 1945 hatte Apel als Betriebsingenieur mit Wernher von Braun an der Raketenproduktion in Peenemünde gearbeitet, seit 1943 als Leiter eines Entwicklungsbetriebes. Nach dessen Zerstörung durch alliierte Luftangriffe wurde er zur Leitung der Fabrik Linke-Hoffmann nach Breslau abkommandiert, die Teile der A-4-Rakete produzierte.
Mit der allerdings nicht offen, sondern hinter vorgehaltener Hand verbreiteten Unterstellung, er habe auch den Einsatz von KZ-Häftlingen in Peenemünde zu verantworten, versuchen fortan seine politischen Gegner im ZK ihn zu diskreditieren.10
Ende 1946 kam Apel in die Sowjetunion – diese Praxis der Inbesitznahme von Fachleuten durch die Siegermächte war stillschweigender Teil der Reparationsleistungen. Auf der Insel Gorodomlia leitete er nun die Werkstätten des Raketen-Versuchsbetriebs. Der Aerodynamiker Werner Albing schreibt in seinem Erinnerungsbuch »Gorodomlia. Deutsche Raketenforscher in Rußland«: »Apel ist ein sehr geschickter Organisator mit diplomatischen Fähigkeiten.«11 Diese Organisationsfähigkeit, die unter schlechten ökonomischen Bedingungen auch Improvisationsfähigkeit erforderte, prädestiniert ihn später zum Wirtschaftsorganisator eines ganzen Landes, das mit dem permanenten Mangel zu rechnen hat.
Er muss aus dieser Zeit starke Fürsprecher gehabt haben, denn 1953, nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion, macht er in der DDR sofort Karriere, wird im gleichen Jahr stellvertretender Minister und zwei Jahre später Minister für Schwermaschinenbau. Als Leiter der Staatlichen Plankommission ist er Mitglied des ZK der SED und Kandidat des Politbüros. 1964 bekommt er für seine Verdienste den Vaterländischen Verdienstorden der DDR.
Das für Mitte Dezember 1965 geplante 11. ZK-Plenum der SED soll nun der auf dem 6. Parteitag der SED beschlossenen und seit zwei Jahren vorangetriebenen Wirtschaftsreform die Bühne bereiten. Apel hat alles vorbereitet, er ist der wichtigste Mann des Plenums, dessen Verlauf auch über sein eigenes politisches Schicksal entscheiden wird.
Die große Auseinandersetzung zwischen Reformern und Dogmatikern steht bevor. Er selbst hat mit den Dogmen der Planwirtschaft fast vollständig gebrochen. Statt sozialistischen Wettbewerbs, der im Grunde nur eine Fortsetzung des sowjetischen »Subbotnik«-Prinzips (»freiwillige« Sonnabend-Arbeit zum Aufbau des Sozialismus) ist und an die Moral der Arbeiter, Höchstleistungen zu vollbringen, appelliert, favorisiert er ein Leistungsprinzip, das auf ökonomischen Interessen basiert und dabei sogenannte »ökonomische Hebel« einsetzt.
Legitimiert werden derartige Experimente durch einen Artikel des sowjetischen Wirtschaftsprofessors E. G. Liberman, der 1962 in der »Prawda« das bisherige System der Leitung und Planung kritisierte. Darin heißt es: »Was für die Gesellschaft nutzbringend ist, muß auch jedem Betrieb nützlich sein und umgekehrt, was nicht vorteilhaft für die Gesellschaft ist, muß äußert unvorteilhaft für die Belegschaft eines Betriebes sein.«12
1964 erscheint Apels Programmschrift »Aktuelle Fragen der ökonomischen Forschung«. Diese schafft die programmatische Voraussetzung der NÖSPL-Politik. Sie ist weitgehend frei von ideologischen Floskeln, eher eine trockene Ökonomen-Lektüre. Aber im Rückblick scheint es unerhört, was hier zu lesen ist: »Bei den vorgeschlagenen Preisveränderungen als erste Etappe der Industriepreisreform handelt es sich um die bisher größte Veränderung auf dem Preisgebiet, die wir in der Deutschen Demokratischen Republik durchführen.«13
Ein wichtiges Ziel von NÖSPL ist es, wegzukommen von der sogenannten »Tonnenideologie«, der schwerindustriellen Ausrichtung der Wirtschaft, für die es der DDR an jeglichen Voraussetzungen (Rohstoffen) fehlt und diese darum in ständiger Abhängigkeit von Importen, vor allem aus der Sowjetunion, hält. Die Wirtschaft der DDR soll leichter und intelligenter werden, wie Apel an einem Beispiel erläutert: »Große Veränderungen ergeben sich zum Beispiel im Preisgefüge für Formgußerzeugnisse. Das Gewicht des Gußstückes verliert seinen bisher bestimmenden Einfluß auf die Preise. Damit wird das bisher volkswirtschaftlich schädliche Interesse der Betriebe an hohen Stückzahlen beseitigt. Indem die Preisbildung für Formgußerzeugnisse das Schwergewicht auf Kompliziertheitsgrad und Qualität des Stückes legt, wird letztlich auch die ökonomische Quelle der sogenannten Tonnenideologie beseitigt.«14
Letztlich zielt das auf eine Überwindung der von Apel als entwicklungshemmend erkannten Bilanzwirtschaft, bei der für jedes zu produzierende Teil einer Maschine zuvor Menge, Kosten und Beschaffenheit im Plan aufgelistet werden musste, was in der Praxis nicht funktionieren konnte. Aber wozu gibt es den Markt?
Die nun folgende Ankündigung bedeutet im Prinzip einen Systemwechsel: »Ein Grundproblem der Praxis der Preisbildung besteht darin, ständig zu gewährleisten, daß der Preis in Annäherung an den Wert gehalten wird …«
Der Preis jedoch im Verhältnis zum Wert erfordert zwingend den Markt als Regulator. Und da sind wir mittendrin in der Welt des Kapitals. Der Maßstab für den Wert ist die Zeit, wie Apel in seinem Grundkurs der Neuen Ökonomischen Politik fortfährt. Es klingt wie eine Zusammenfassung des ersten Bandes von Karl Marx »Das Kapital«: »Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie zu andrer Produktion, materieller oder geistiger. Ökonomie der Zeit, darein löst sich schließlich alle Ökonomie auf.«15
Ein Programm mit weitreichender Wirkung zeigt sich hier. Aber wenn sich durchsetzen sollte, was hier gewollt ist, wozu dann noch die Funktionäre und Agitatoren, all die Leute, die nichts können als sich an ihre Ideologie klammern? Zumal auch viele Angehörige der geistig-kulturellen Elite einem »ethischen Sozialismus« anhingen. Haben wir nicht Werte jenseits der ökonomischen Effizienz, die doch bloß in Konsumideologie mündet, fragen sie und verkennen den Ernst der Lage.
Apels engster Mitarbeiter Günter Mittag wird bald den Kurswechsel vollziehen. Er läuft zur »FDJ-Fraktion« um Erich Honecker über, der dabei ist, seine früheren Zentralratsmitglieder aus der FDJ-Zeit ins Machtzentrum einzuschleusen, von Paul Verner über Hermann Axen bis Heinz Keßler und Joachim Herrmann. Honecker bereitet nun gegen Ulbricht und NÖSPL den stillen Staatsstreich vor. Die Bühne dazu soll ihm das bevorstehende 11. ZK-Plenum bieten.
NÖSPLs Affront gegen die Funktionärskaste ist gewollt, nicht nur von Apel, auch von seinem Schutzpatron Ulbricht. Fachfragen sollen von Fachleuten, qualifizierten Wissenschaftlern und nicht Parteifunktionären behandelt werden. Alles, was möglich ist, muss geschehen, um Dynamik in die Wirtschaftsentwicklung zu bringen. Chruschtschow scheint damit einverstanden gewesen zu sein. Allerdings hat Chruschtschow 1964 auch andere, innenpolitische Probleme: vor allem eine Missernte, die seinen politischen Gegnern im Politbüro Rückenwind gibt.
Doch dann passiert das Unerwartete, und Erwin Strittmatter notiert am 15. Oktober 1964 ahnungsvoll in sein Tagebuch: »Chruschtschow zurückgetreten? Bald wird man’s wieder hören: ›Der Führer ist weg – es lebe der Führer!‹ ›Unverbrüchliche Freundschaft!‹ ›Klarer Kurs!‹ Politische Schamlosigkeiten. Keine spürbare Verlegenheit. Nur still, nur still, damit die Regierten nicht stutzen!« Zwei Tage später: »Die ersten ›Treueerklärungen‹ für Breschnew. Wir natürlich bei den ersten ›Treueerklärern‹«.16
Der neue Mann im Kreml heißt nun also Leonid Breschnew, Vertreter des militärisch-industriellen Komplexes des Donezk-Beckens. Wirtschaftliche Reformexperimente stehen für ihn nicht auf der Tagesordnung und Autonomiebestrebungen der Satellitenstaaten erst recht nicht.
Breschnew wird die DDR so fest an die Sowjetunion binden, dass ihr fast keinerlei Freiheiten mehr bleiben. Sein Vorgänger Chruschtschow ging noch davon aus, dass es irgendwann wieder eine deutsche Einheit geben würde, und plante dann, die DDR als Verhandlungsmasse zum eigenen Vorteil einzusetzen – so würden es 1989 auch Gorbatschow und sein Außenminister Schewardnadse halten.
Breschnew jedoch zementiert die Teilung wie für die Ewigkeit. Darin findet er immerhin einen begeisterten Unterstützer: Erich Honecker. Ihn wird Breschnew – hinter Ulbrichts Rücken – bald schon zu seinem engsten Vertrauten und potentiellen Ulbricht-Nachfolger aufbauen.
Nach dem Ende der Ära Chruschtschow bleibt noch monatelang unklar, ob Leonid Breschnew wirklich der neue starke Mann in Moskau sein und es zur Renaissance stalinistischer Machtstrukturen kommen würde. Der spätere KGB-Chef Juri Andropow (1983 kurzzeitig bis zu seinem Tod 1984 in der Breschnew-Nachfolge Generalsekretär des ZK der KPdSU) ist bereits zu dieser Zeit Kopf der Reformkräfte und ein ernst zu nehmender Konkurrent. Doch im Herbst 1965 hat sich Breschnew schließlich durchgesetzt, er gibt den machtpolitischen Ton nun deutlich vor.
Das passiert in den folgenden Jahren auf allen Gebieten: Die Entwicklung der DDR-Wirtschaft weg von der Schwerindustrie soll abgebremst, die Westausrichtung der Wirtschaft verhindert werden. Die Sowjetunion macht kaum einlösbare Vorgaben, was wann wie gebaut und wo verkauft werden soll. Die DDR muss vor allem ein billiger Zulieferer für die Sowjetunion bleiben, nicht für Westdeutschland. Mancher in der DDR – auch unter den Spitzenfunktionären – spricht da offen von Ausbeutung, selbst in der SED-Presse ist der Ton, die Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und der DDR betreffend, kühler geworden, wie der sowjetische Botschafter Pjotr Abrassimow moniert. Erst sein inniger Vertrauter Erich Honecker ändert das.
Planungschef Apel widersetzt sich bei einem Treffen offen dieser imperialen Kreml-Doktrin und Breschnew gibt Ulbricht zu verstehen, dass er mit diesem Menschen nicht mehr zusammentreffen möchte – ein Eklat! Ulbricht lässt Apel in der Schlussphase der Verhandlungen aus dem Spiel. Setzt Ulbricht denn überhaupt noch auf Apel? Das Schema, nach dem ein durch die Stalinsche Kaderschule gegangener Funktionär handelt, deutet sich bereits an: niemals wird er einem zur »Unperson« Gewordenen beistehen, selbst dann nicht, wenn er selbst ihn in jene Lage brachte, die ihm nun zum Verhängnis wird.
Im November 1965 besucht Breschnew die DDR – man spricht vor allem über das Wirtschaftsabkommen 1966 bis 1970, doch statt Apel ist sein Mitarbeiter Günter Mittag nun bei den Gesprächen dabei. Auch an Ulbrichts Sturz wird bereits gearbeitet, doch so geschickt, dass selbst der Staatsratsvorsitzende und Erste Sekretär des ZK der SED es nicht ahnt, der ständig mit Intrigen gegen sich rechnet.
Erich Honecker, sein engster Mitarbeiter und eifriger Organisator im Politbüro, probt bereits die Rolle des Brutus. Aber ist Ulbricht denn ein Cäsar?
Der Vertrag über die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion soll an diesem 3. Dezember unterzeichnet werden. Das Treffen mit der sowjetischen Delegation ist auf 11 Uhr angesetzt. Es ist ein unfairer Vertrag, der nur auf Druck des mächtigen Verhandlungspartners zustande kam. Apels hartnäckiger Widerstand gegen die überzogenen Forderungen als Gegenleistungen für Rohstofflieferungen war wenig erfolgreich. Die DDR hat gegenüber der de facto immer noch ihre Rolle als Besatzungsmacht ausspielenden Sowjetunion keine Verhandlungsposition. Der Kreml droht unterderhand mit Sperrung der Rohstofflieferungen und außerdem: Hat man nicht eine halbe Million Soldaten der Roten Armee in der DDR stationiert? Falls jemand an Konterrevolution denken sollte.
Der Vertrag ist nicht zu vermeiden. Ulbricht beugt sich dem Druck und sucht gleichzeitig nach Hintertüren, um zu retten, was von der Reform zu retten ist. Es gibt weniger Rohstoffe aus der Sowjetunion als von der DDR erwartet. Im letzten Moment reduziert Breschnew einige der Forderungen. Leises Aufatmen, trotz der schweren Bürde, in den nächsten Jahren einen Großteil der Waren, die man auch im Westen gegen Devisen verkaufen könnte, nun in die Sowjetunion liefern zu müssen. Im Grunde zahlt die DDR so immer noch Reparationen, kauft von der Sowjetunion Rohstoffe über dem Weltmarktpreis und verkauft Waren an sie unter Weltmarktpreis. Das ist nicht Bündnispolitik, sondern fortgesetzte Besatzungspolitik, zu der die SED-Spitze gute Miene machen muss.
Das Handelsabkommen zwischen der DDR und der Sowjetunion hat von 1966 bis 1970 ein Volumen von 60 Milliarden Mark (das ist die Hälfte des DDR-Außenhandels). Diese Zahlen bringt »Der Spiegel«, der auch die Posten im Detail auflistet: »Alles was sich auch im Westen gut verkaufen ließe, geht in den nächsten fünf Jahren zu Vorzugspreisen an die teuren Genossen in der Sowjetunion: 339 Schiffe, über 8000 Eisenbahnwagen, 100 000 Tonnen Walzwerkausrüstungen, komplette chemische Anlagen und Konsumgüter.«17
Was aber geschieht an diesem Morgen des 3. Dezember gegen 10 Uhr in Apels Büro im Haus der Ministerien? Die offizielle Version: Erich Apel erschießt sich, eine Stunde vor der geplanten Vertragsunterzeichnung. Die Kugel kam aus seiner Dienstpistole. Er ist sofort tot. Sein Nachfolger als Chef der Staatlichen Plankommission, Gerhard Schürer, der nun bis zum Ende der DDR in seinem Arbeitszimmer residiert, wird Besuchern immer wieder die Stelle zeigen, an der die Kugel in die Wandvertäfelung einschlug.
Dies ist aber nur die eine Version. Denn es bleiben Zweifel am Selbstmord. Hat er sich wirklich selbst erschossen? Monika Kaiser hat für ihre umfangreiche Dokumentation »Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker« sämtliche noch existenten Dokumente zu Apels Tod eingesehen und mit noch lebenden Zeugen gesprochen. Ihr Fazit: Die Umstände sprächen »eher gegen die Variante vom Selbstmord«18. Dokumente existieren auffallend wenige, und der Ungereimtheiten sind viele. So soll Apel noch gegen 9.30 Uhr mit seinem Stellvertreter Gerhard Schürer telefoniert und ihn gefragt haben, ob er ihn zur Vertragsunterzeichnung begleiten wolle. Dieser habe – bereits das ist seltsam – unentschlossen reagiert, man habe sich schließlich für den Nachmittag verabredet. War nicht im Vorhinein die Zusammensetzung der Delegation beschlossen worden? Und wie kommt es, dass der von Breschnew in der Schlussphase der Verhandlungen persönlich ausgeschlossene Apel den Vertrag mitunterzeichnen soll? Gewiss, er ist der Chef der Staatlichen Plankommission, aber was sagen die Russen dazu?
Apel habe, so erinnert sich Schürer, am Telefon Optimismus verbreitet und gesagt: »Unter den gegebenen Umständen haben wir das doch ganz gut hinbekommen.« Tief deprimiert scheint er jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht gewesen zu sein. Bleibt als Erklärung für den Griff zur Pistole nur die Möglichkeit einer Kurzschlusshandlung.
Um 10 Uhr wird aus Apels Büro die im Haus befindliche Poliklinik angerufen, der Planungschef habe plötzlich einen Herzanfall erlitten. Das ist noch merkwürdiger. Ob sich jemand erschossen oder einen Herzanfall bekommen hat, das sollte man sofort erkennen. Es scheint also niemand einen Schuss gehört zu haben – doch im Vorzimmer sitzen Apels Sekretärin und sein persönlicher Referent Horst Böttcher. Aber all das ist nicht – zumindest nicht gründlich – untersucht worden, es scheint auch keinen Obduktionsbericht zu geben. Nur ein handschriftlicher Bericht jenes Doktor Schulte, Chef der Betriebspoliklinik im Hause der Ministerien, der Apel auffand, hat sich erhalten. Darin heißt es, er habe Apel in seinem Schreibtischsessel halb liegend gefunden, den Kopf nach hinten hängend, »mit frischen Blutaustritten an beiden Ohrgängen und den Mundwinkeln, und mit frischem Blut auf der Brust und an der rechten Hand. In beiden Schläfengegenden waren Ein- und Ausschußöffnungen feststellbar, offensichtlich hervorgerufen durch eine Revolverkugel. Eine Pistole fand sich in der Hand.«19
Mehr an Aufzeichnungen über den gewaltsamen Tod eines der höchsten Regierungsbeamten der DDR gibt es nicht? Das scheint ungewöhnlich.
Apels Referent Böttcher teilte später Apels Witwe mit, Ulbricht habe nach der Todesnachricht spontan die Einsetzung einer Mordkommission verlangt, was aber dann wohl nicht geschehen sei. In vergleichbaren Fällen wie dem Selbstmord des Ministers Gerhart Ziller (ein Vorgänger Apels im Amt) wurden immerhin umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Und Apel hatte nicht einmal einen Abschiedsbrief hinterlassen.
Statt dessen erklärte der damalige Regierende Bürgermeister Westberlins Willy Brandt: »Er ist nicht schweigend gestorben. Wir alle werden noch von ihm hören, von dem, was ihn bewegte.«20 Das ließ auf weitere Enthüllungen schließen – besaß der Westen etwa Zeugnisse von Apels Hand?
Böttcher erklärte viele Jahre später, er könne nicht mit Sicherheit sagen, ob Apel zum Zeitpunkt seines Todes allein im Zimmer gewesen sei, denn man hätte durch eine Hintertür jederzeit unbemerkt direkt zu Apel kommen können. Allerdings war das Haus der Ministerien streng bewacht, und wohl nur Profikiller eines Geheimdienstes konnten hier unbemerkt eindringen – aber vielleicht ja nur in einem solch unübersichtlichen Gebäudekomplex.
Stefan Heym hat sich an Apel erinnert. Den sah er, wenn er, was häufiger geschah, Robert Havemann in Grünheide traf. Das Grundstück hatte ihm Apel 1964 nach seiner Entlassung von der Humboldt-Universität vermittelt. Das konnte man als Akt der Solidarität verstehen. Das Nachbargrundstück gehörte Apel selbst, er traf sich hier gelegentlich mit Havemann – von Nachbar zu Nachbar –, auch noch nach dessen Abstempelung zum Dissidenten. Heym, zu Besuch bei Havemann, fiel dabei auf, wie groß die Sicherheitsvorkehrungen um Apels Haus waren.
Fraglos war Apel ein gefährdeter Mann mit vielen Feinden. Als sein wichtigster hatte sich Breschnew zu erkennen gegeben, aber auch ein Teil des SED-Parteiapparats hinter dem Sicherheitschef Erich Honecker sah in Apel einen Staatsfeind.
Noch schien nichts entschieden. Es gab wirtschaftliche Erfolge in den beiden Jahren der NÖSPL, die Stimmung im Lande war Reformen gegenüber positiv – das kommende Plenum mit Apel als Hauptperson in Sachen Wirtschaftsreform hätte in seinem Verlauf weiteren Aufschluss über die Erfolgschancen gegeben. Apel war bekannt für sein charismatisches Aufreten, was ihn von den meisten anderen Parteifunktionären unterschied.
Reformer und Dogmatiker stehen sich kräftemäßig 1965 etwa gleich stark gegenüber – und Ulbricht selbst steht immerhin an der Spitze der Reformer. Aber Ulbricht ist bekannt als schwankendes Blatt im Winde, das sich mit den Mehrheiten dreht und dabei immer an der Spitze zu bleiben versucht. Zudem hat sich Ulbricht bei Künstlern und Schriftstellern mittlerweile so gründlich unbeliebt, geradezu verhasst gemacht, dass ihm unter diesen niemand eine wirkliche Reform zutraut. Damit kommt ihm ein wichtiger Partner bei seiner Reformpolitik abhanden.
Abb. 2: Wolfgang Mattheuer: Kain, 1965, Staatliche Galerie Moritzberg, Halle
Apel, so scheint es, war entschieden in seiner Position, das hatte er bei den Verhandlungen zum deutsch-sowjetischen Wirtschaftsvertrag wiederum gezeigt. Kein Mann, auf den Breschnew setzen konnte. Apel gehörte noch zur Ära Chruschtschow, der mehr Mut zu Neuem gefordert hatte. Das berichtete auch der Regisseur Kurt Maetzig, der nicht für übergroßen Mut bekannt war, wenn es um politisch brisante Themen ging. Er verfilmte Manfred Bielers bereits verbotenes Buch »Das Kaninchen bin ich« über einen moralisch verkommenen DDR-Staatsanwalt, der – je nach politischer Wetterlage – mal überharte, mal auffallend milde Urteile fordert. Dass Maetzig dies überhaupt wagte, hat mit der direkten Ermunterung Chruschtschows auf einem Empfang zu tun. In Gegenwart Ulbrichts sagte Chruschtschow zu Maetzig, die Künstler müssten auch einmal was riskieren. Derart ermutigt, geradezu beauftragt, ging Maetzig dann ans Werk.
Es war immer noch ein Nachklang von Chruschtschows Entstalinisierungspolitik, die Freiräume – mal größer, mal kleiner – auch in der DDR schuf. Sekundiert vom »Bitterfelder Weg«, dem Blick auf die harten ökonomischen Tatsachen, war das Selbstbewusstsein der Autoren und Künstler gewachsen. Sie wollten mitreden darüber, welche Art Sozialismus in der DDR entstand.
Nicht wenigen SED-Funktionären schien da etwas in Gang geraten zu sein, das sich ihrer Kontrolle entzog. Und so riefen sie in alter stalinistischer Manier nach einem Tribunal zur Abstrafung. Aber ganz so einfach ging das nicht mehr wie noch Anfang der 50er Jahre bei den Kampagnen gegen den »Formalismus« in der Kunst.
Honecker wusste, dass er zuerst einmal den Krisenfall ausrufen, einen Notfall beschwören musste, der sofortiges Eingreifen notwendig machte. Und er sammelte fortwährend Fakten, mit denen sich ein solcher konstruieren ließ, suchte Anlässe für eine spürbare politische Kurskorrektur.
Die in Gang gesetzten ökonomischen Reformen standen vor der Hürde, ab einem gewissen Punkt eine politische Dimension zu bekommen. Das erkannten die Hardliner um Honecker sofort. Sie suchten nach Sündenböcken, denen sie NÖSPL als konterrevolutionäres Handeln unterschieben konnten. Sie wussten, dass sie Ulbricht, den Initiator dieser Politik, noch nicht offen angreifen durften, sondern auf ihre Seite hinüberziehen mussten. Und wieder stießen sie dabei auf Kunst und Literatur, ein Thema, bei dem Ulbricht regelmäßig den Dogmatiker hervorkehrte. Auf diesem Weg, so hofften seine Gegner, könnte sich Ulbricht noch mehr bei den Künstlern, den Autoren, Verlagsleitern, Lektoren, Musikern, Malern und Redakteuren verhasst machen.
Woher aber kommt jener kleinbürgerlich anmutende Puritanismus in Ulbrichts Äußerungen über Kunst? Aufgewachsen im Leipziger Naundörfchen, einer dem Berliner Scheunenviertel ähnlichen Gegend mit Bordellen, Kneipen und Schmutz aller Art, hat Walter Ulbricht – wie viele Arbeiterkinder der Jahrhundertwende – ein Idealbild von Gesundheit, Fleiß, Sauberkeit und Humanität entwickelt. Die Arbeiter-Bildungsvereine veranstalteten regelmäßig »Kampfabende gegen Schundliteratur«. Und Ulbricht wurde zum begeisterten Leser von Goethe und Schiller. Faustens Vision, »auf freiem Grund mit freiem Volke« zu stehen, wird er – in einem tiefen Missverständnis der Federführung des Teufels in dieser »Faust«-Szene – als Vision seines Sozialismus auffassen. Darum spricht er dann häufig von einer Fortsetzung des Stückes in einem dritten sozialistischen Teil. Faust gehört in die DDR! Es war Anna Seghers, die bei einer der »Beratungen« Ulbrichts mit Künstlern auf ihre sanft-feenhafte Weise das nötige dazu sagte: Faust, das verstehe sie ja durchaus – aber was wird aus Mephisto?
Die Kehrseite von Ulbrichts simpler »Faust«-Auffassung, die allerdings aus echter Klassik-Begeisterung erwuchs, bekamen dann immer diejenigen Künstler zu spüren, die die Abgründe, die verborgene Nachtseite in all dem klassischen Licht, die Negativität in aller Dialektik des Fortschreitens sichtbar machten, so wie Wolfgang Heinz und Adolf Dresen in ihrem »Faust«-Projekt am Deutschen Theater Ende der 60er Jahre. Von der skeptischen Deutung des Faust fühlte sich Ulbricht höchstpersönlich angegriffen.
Die Schwester Walter Ulbrichts wird die Bildungseuphorie im Elternhaus dann so schildern: »Wir waren alle sehr strebsam. Wir haben als Kinder enorm gearbeitet für die Schule. Bei uns zu Hause wurde nie Schund gelesen, niemals. Nur die Werke unserer Klassiker, nur das wahrhaft Edle und Gute haben wir gelesen.«21
Diese Aversion gegen »Schund und Schmutz« ist tief in Ulbrichts Generation der Arbeiterfunktionäre verwurzelt, sie führte dann in den 50er und 60er Jahren zu jenen Kampagnen gegen den Einfluss »westlicher Dekadenz«, gegen die es ein »positives Menschenbild im Sinne der Klassiker« zu stellen gelte. Manches erinnerte dann nicht nur in der Rhetorik, sondern auch in der Verbotspraxis an die Verfolgung der »entarteten Kunst« unter Hitler.
Kafka etwa war kein Optimist und darum unter Ulbricht lange tabu. Er schildert nicht nur die dunklen Labyrinthe der Seele, wie es bereits die Romantiker taten, sondern auch jene anonymen Menschenvernichtungsapparate, wie sie die Bürokratien der Macht erzeugen. Ulbricht durfte sich hier zurecht angesprochen fühlen.
Es bedurfte dringend solch weltbürgerlicher Autoren wie Stephan Hermlin, der herrschenden Weltanschauungssimplizität etwas entgegenzusetzen. Er tat dies bereits 1947, als er in seinem Kafka-Aufsatz schrieb: »In der Dämmerung des großen Zuchthauses Welt lauschte der Gefangene Franz Kafka auf die Klopfzeichen, die durch die Wände zu ihm drangen. Er lauschte auf ihre verwirrende Fülle. Aber da war es schon Nacht.«22
Mit dem Ruf »Unsere DDR ist ein sauberer Staat!« wird Honecker in seiner Rede auf dem 11. ZK-Plenum durchaus den Nerv Ulbrichts treffen. Bloß keinen Schund und Schmutz!, ruft das ehrgeizige Kind in ihm, das vor allem eins will: raus aus dem Naundörfchen mit seinen Huren und Zuhältern.