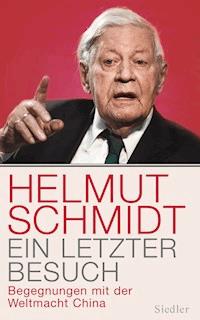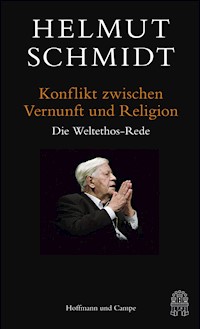11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Wenn es um Prinzipien der Politik und der Moral geht oder um das eigene Gewissen, dann ist man niemals außer Dienst.« - Die Bilanz eines großen Staatsmannes.
In seinem Buch über die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Kanzleramt beschreibt Helmut Schmidt die umwälzenden historischen Entwicklungen seit dem Ende des Kalten Kriegs, er macht sich Gedanken über die gegenwärtige Politik und die Zukunft Deutschlands, und er spricht über sehr Persönliches: über prägende Kriegserfahrungen, über eigene Fehler und Versäumnisse, seinen Glauben und das Lebensende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Helmut Schmidt
Helmut Schmidt
Außer Dienst
EINE BILANZ
Verlagsgruppe Random House
Erste Auflage
Copyright © 2008 by Siedler Verlag, Müncheri,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
ISBN 978-3-641-01182-6V002
www.siedler-verlag.de
Vorrede
Gegen Ende des Lebens wollte ich einmal aufschreiben, was ich glaube, im Laufe der Jahrzehnte politisch gelernt zu haben. Denn vielleicht könnte doch einer von den Jüngeren daraus einen Nutzen ziehen. Die meisten meiner Weggefährten haben schon endgültig ihre Adresse gewechselt; ihnen habe ich vor zwölf Jahren in dem Band »Weggefährten« meinen Dank abgetragen. In dem hier vorgelegten Buch geht es in erster Linie um persönliche Erfahrungen. Sie werden nicht chronologisch vorgetragen, eine Autobiographie war nicht beabsichtigt. Ebensowenig wollte ich eine systematische, nach Themen geordnete Darstellung versuchen. Viele Einsichten, die ich im Laufe meines Lebens gewonnen habe – auch und gerade in den letzten 25 Jahren »außer Dienst«–, verdanke ich Menschen, die einen bleibenden Eindruck auf mich machten; meine Erinnerungen an sie sind untrennbar verbunden mit den Themen, die uns beschäftigten. Auch bitte ich den Leser zu berücksichtigen, daß mir in der Rückschau nicht alles gleich wichtig war. Weil mir an bestimmten Erkenntnissen mehr liegt als an anderen, unterscheiden sich die einzelnen Kapitel durch unterschiedliche Gewichtung; gelegentliche Überschneidungen waren hier und da unvermeidlich.
Nach dem Ende des Hitlerschen Weltkriegs begann ich, mich politisch zu engagieren. Berufspolitiker wurde ich zwar mehr durch Zufall, aber nachdem ich es einmal geworden war, bin ich es aus eigenem Willen geblieben. Als ich 1987 nach drei Jahrzehnten als Bundestagsabgeordneter aus dem Parlament wieder ausschied, hatte ich allerdings nicht das Gefühl, aus dem Dienst am öffentlichen Wohl entlassen zu sein. Der Titel dieses Buches enthält deshalb ein Quentchen Selbstironie. Ich habe mich auch nach dem Ausscheiden aus allen öffentlichen Ämtern nicht wirklich »außer Dienst« gefühlt, denn das Bewußtsein eigener Mitverantwortung ist mir geblieben. Der Wechsel vom Politiker zum publizistischen Autor hat daran nichts geändert.
Schon vor langer Zeit habe ich mir den alten römischen Satz zur Richtschnur gemacht: Salus publica suprema lex. Inzwischen habe ich begriffen, daß die Maxime vom öffentlichen Wohl als dem obersten Gebot für manche Politiker – und ebenso für manche Manager – nicht zu gelten scheint; sie räumen ihrer persönlichen Geltung, ihrer persönlichen Macht oder auch ihrem persönlichen Reichtum offenbar vorrangige Bedeutung ein. Zwar kann man aus Gründen der Vernunft und der Moral zu durchaus verschiedenen Meinungen darüber gelangen, was in einer konkreten Situation im Sinne des Gemeinwohls geboten ist. Aber – und auch das habe ich im Laufe des Lebens gelernt – sowohl die Demokratie im Inneren als auch der Friede im Äußeren verlangen die Bereitschaft zu Kompromiß und Toleranz.
Die Verantwortung eines Politikers ist nicht abstrakt. Vielmehr ergibt sie sich immer wieder aufs neue sehr konkret und oft bedrückend. In jeder Lage, vor jedwedem Problem, in jedem Streit, immer wieder muß er eine Antwort auf die Frage finden: Was ist hier und jetzt meine Aufgabe und meine Pflicht? Was ist meine Pflicht, wenn zwei oder mehr Interessen miteinander kollidieren? Hat etwa ein persönliches Interesse oder das Interesse meiner Partei Vorrang? Und wenn das Interesse der Nation Vorrang hat, was liegt dann konkret im Interesse der Nation?
Fragestellungen dieser Art haben im Westen unseres Landes erbitterte Streitigkeiten ausgelöst – vom Schuman-Plan 1950 und dem Beginn der europäischen Integration über die Hallstein-Doktrin, den NATO-Beitritt, die Notstandsgesetzgebung, die Ostpolitik, die Helsinki-Schlußakte und den NATO-Doppelbeschluß bis hin zur Vereinigung der beiden deutschen Nachkriegsstaaten. In Ostdeutschland war es sehr viel schwieriger, sich ein eigenes Urteil zu bilden. In Westdeutschland war man sich seit den späten fünfziger Jahren einig über die Zugehörigkeit zur Europäischen Gemeinschaft. Gleichwohl konnten sich viele 1989 nicht vorstellen, daß die Regierungen Frankreichs, Englands, Italiens oder Hollands und Dänemarks die Vereinigung der beiden deutschen Staaten mit tiefer Skepsis betrachteten und sie ablehnten. Es waren die Vereinigten Staaten von Amerika, die aus strategischem Interesse gegenüber der damals noch existierenden Supermacht Sowjetunion und gegenüber dem Kommunismus schließlich die Zustimmung unserer Nachbarn zur deutschen Einheit herbeigeführt haben.
Damals wußten wir in Deutschland sehr wenig von der Geschichte und von den Interessen unserer Nachbarn, insbesondere unserer Nachbarn im Osten, und ihren Erfahrungen mit uns Deutschen. Wir wissen heute immer noch zu wenig von den Polen und Tschechen, aber auch von Franzosen und Engländern, den Holländern, Belgiern und Dänen. Auf der anderen Seite sieht es zumeist nicht besser aus. Es ist ein vielen europäischen Völkern gemeinsames Phänomen, daß ihnen die bösen Erfahrungen, die sie im Laufe der Jahrhunderte mit ihren Nachbarn gemacht haben, meist am besten im Bewußtsein haften.
Haben wir Deutsche aus unserer Geschichte genug gelernt? Gelingt es uns wenigstens, das große Glück der Wiedervereinigung in einen ökonomischen und zugleich sozialen Erfolg umzumünzen? Warum sind wir fähig, im Export Weltmeister zu sein, aber zugleich unfähig, im eigenen Land eine gefährliche Massenarbeitslosigkeit zu bewältigen? Ist die politische Klasse in Deutschland nicht in der Lage zu erkennen, was das öffentliche Wohl gebietet? Oder mangelt es ihr an der Courage, den Wählern unpopuläre Wahrheiten zuzumuten? Oder weigert sich der Wähler, solchen Wahrheiten ins Gesicht zu sehen? Oder alles zugleich?
Wissen wir eigentlich, wer wir sind? Wissen wir, wer wir sein wollen? Die heutigen Deutschen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von ihren Vorfahren; ein Vergleich mit dem 19. und 20. Jahrhundert, mit Wilhelminismus, Nazi-Zeit und vierzig Jahren kommunistischer Herrschaft im Osten offenbart gewaltige Wandlungen unserer rechtlichen und politischen Kultur. Auch unsere soziale und ökonomische Kultur hat enorme Veränderungen durchgemacht; diese Veränderungen haben das Denken vieler Menschen und ihr Verhalten beeinflußt. Wir sind gereift.
Wir sind nicht mehr dieselben, aber dürfen wir deshalb sagen: Wir sind wesentlich anders geworden? Wir haben schwere Beschädigungen unserer Seele davongetragen und daraus gelernt, aber wie weit haben wir auch unser geschichtliches Bild von uns selbst revidiert? Welches Bild von uns haben wir heute? Die Wunden jedenfalls, die Deutschland seinen Nachbarn zugefügt hat, sind nur zum Teil ausgeheilt; sie könnten wieder aufbrechen. Wir Deutschen bleiben eine gefährdete Nation – gefährdet sowohl von innen als auch von außen.
Zweimal innerhalb des 20. Jahrhunderts haben die Deutschen eine weltpolitische Führungsrolle angestrebt, beide Male sind sie damit jämmerlich gescheitert. Weil unsere politische Klasse und weil die Nation als Ganze die Konsequenzen daraus gezogen haben, muß eigentlich keiner unserer Nachbarn den Verdacht hegen, es könnte ein drittes Mal einen Versuch geben. Die Epoche der beiden Weltkriege und des anschließenden Kalten Krieges zwischen Ost und West erscheint endgültig überwunden. Die seit dem Schuman-Plan des Jahres 1950 schrittweise vollzogene Einbettung der westlichen Teilnation in den gemeinsamen Markt und später ganz Deutschlands in die Europäische Union hat uns vor riskanten Alleingängen bewahrt.
Seit sechzig Jahren trete ich für die Selbsteinbindung Deutschlands in die Gemeinschaft der europäischen Völker ein. Dabei hat mich nicht Europa-Idealismus geleitet, sondern meine Einsicht in das strategische Interesse unseres Volkes. Auch im 21. Jahrhundert kann die vernünftige Abwägung unseres strategischen Interesses zu keinem anderen Ergebnis gelangen. Deshalb setze ich meine Hoffnung auch für morgen auf die fortschreitende Vertiefung der europäischen Integration und auf stetige deutsche Mitwirkung.
Die Nationen Europas spüren gegenwärtig vielerlei Gefahren – auch Gefahren von außerhalb Europas. Deshalb wollen ihre politischen Führer die Nationen enger zusammenbinden. Aber die nationalen Traditionen der Europäer – ihre unterschiedlichen Sprachen, ihre jeweilige Nationalgeschichte, ihre verschieden gewachsenen politischen Strukturen – stehen diesem Willen im Wege. Deshalb bleibt die Errichtung der Europäischen Union ein langsamer und mühevoller Prozeß. Er könnte schwere Rückschläge erleben. Er könnte auch fehlschlagen.
Wir Deutschen, in der Mitte des Kontinents lebend, sind stärker als alle anderen Nationen darauf angewiesen, daß die Union zum Erfolg geführt wird. Ungeduld und Übereifer können den Erfolg gefährden. Und ein deutscher Führungsanspruch, auch ein unausgesprochener, könnte ihn unmöglich machen. Haben alle Deutschen das endlich verstanden?
Erste Überlegungen zu diesem Buch gehen zurück in das Jahr 2003. In den folgenden Jahren wurde die Arbeit mehrfach unterbrochen; einzelne Kapitel wurden umgeschrieben. Für Kritik und Anregungen habe ich meiner Frau Loki zu danken sowie Jens Fischer, Thomas Karlauf, Birgit Krüger-Penski, Heike Lemke, Ruth Loah, Marcela Masiarik, Rosemarie Niemeier,Armin Rolfink und Theo Sommer.
Helmut Schmidt
Hamburg, im Juli 2008
I
ERFAHRUNGEN VERÄNDERN MASSSTÄBE
Freunde und verläßliche Partner
In der Politik hat man es mit Menschen zu tun. Manche von ihnen sind bedeutend und treffen wichtige Entscheidungen. Einige halten sich nur für bedeutend, treffen aber gleichwohl wichtige Entscheidungen. Einige stehen zu ihrem Wort, andere nicht. Manche reden heute so, aber morgen reden sie anders. Wieder andere wollen ihr Versprechen halten, können es aber nicht erfüllen; denn jeder Politiker hat zu Hause eine Basis, bei der er zuweilen Rückversicherung nötig hat – in seinem Wahlkreis, in seiner Partei, in seinem Staat. In der Demokratie ist kaum jemals ein Politiker in seinen Entschlüssen völlig frei. Immerhin habe ich es sowohl in der Innen- als auch in der auswärtigen Politik mit einer Reihe von Politikern zu tun gehabt, auf deren Wort ich mich verlassen konnte – gar nicht anders als im täglichen Leben auch.
In der eigenen Partei trifft man naturgemäß mehr Frauen und Männer, deren Urteil man vertraut, auf deren Wort man baut. An erster Stelle will ich hier meinen Kabinettskollegen Hans-Jochen Vogel nennen. Schon in den späten sechziger Jahren sind mir Vogels charakterliche Qualitäten und seine Fähigkeiten als herausragend erschienen. »Macht muß dienen«, hat er einmal gesagt, und danach hat er stets gelebt und gehandelt. Weil er selbst das tat, was er von anderen forderte, ist ihm eine ungewöhnlich hohe Glaubwürdigkeit zugewachsen. Für mich war er ein wichtiger persönlicher Ratgeber, besonders in den schwierigen Zeiten des RAF-Terrorismus. Als unverzichtbare Instanz achtete er strikt darauf, daß keiner unserer Schritte den Rechtsstaat beschädigen konnte. Ich wußte, daß ich seiner Nachdenklichkeit und seiner stringenten Klugheit voll vertrauen durfte.
Ebenso galt das für Herbert Wehner. Ich habe Wehner in den späten vierziger Jahren in Hamburg kennengelernt, etwas näher dann ab 1953, als ich erstmals im Bundestag saß. Seit dieser Zeit habe ich ihn fast wöchentlich getroffen. Man merkte ihm an, daß er eine schwierige und möglicherweise auch schuldbelastete persönliche Geschichte hinter sich hatte. Die Folge war eine zerklüftete Persönlichkeitsstruktur. Aber Wehner hatte Autorität, ich möchte sie die Autorität des gebeutelten Lebens nennen. Sein Herz hing elementar an der Sache der Arbeiter. Der Artikel 20 des Grundgesetzes, der vom »demokratischen und sozialen Bundesstaat« spricht, war ihm zum Kern seiner eigenen Politik geworden. Wehner war ein strenger Moralist. Sein sehr bescheidener persönlicher Lebensstil entsprach dieser Moralität ebenso wie seine im verborgenen ausgeübte vielfältige Hilfsbereitschaft.
Wehner wollte Staat und Gesellschaft menschlicher machen. Deshalb setzte er alles daran, die Sozialdemokratie als regierungsfähig zu erweisen und an die Regierung zu bringen. 1969, am Ende der Großen Koalition, konnte er zufrieden sein; die führenden Sozialdemokraten hatten ihre Tauglichkeit als Regierende wirksam unter Beweis gestellt. Wehner war in diesen drei Jahren Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen gewesen, ein Amt, das er sicherlich gern ausgeübt hat, zumal er auf diesem Posten ungezählten Menschen helfen konnte, die wegen der Zweiteilung Deutschlands in Not geraten waren. Gleichwohl hat er 1969 zugestimmt, sein Ministeramt aufzugeben und als Vorsitzender in die Bundestagsfraktion zurückzukehren. Ich hatte diesen Wechsel, der für Wehner eine ziemliche Zumutung gewesen ist, zur Bedingung für die Übernahme des Verteidigungsministeriums gemacht, zu der Brandt und Wehner mich drängten. Ich wußte, in meiner Partei würden sich alsbald linke Kräfte regen und mir Knüppel zwischen die Beine werfen. Ich wußte aber auch, Herbert Wehner als Fraktionsvorsitzender würde mir den Rücken freihalten. Und das hat er getan.
Während der dreizehn Jahre der sozialliberalen Koalition habe ich mich auf Wehner verlassen können, trotz erheblicher Unterschiede in unseren persönlichen Vorgeschichten, im Urteil und im Temperament. Wir waren weder enge persönliche Freunde, noch haben wir in Fragen des persönlichen Stils oder der Wortwahl übereingestimmt – aber darauf kam es gar nicht an. Es wäre eine irreale, geradezu absurde Vorstellung, unter den Führungspersonen an der Spitze eines Staates oder auch einer Partei müßten persönliche Freundschaftsverhältnisse bestehen. Was vielmehr zählt, sind Loyalität, Solidarität, Zuverlässigkeit – das gemeinsame Ziehen am gleichen Ende des Strangs, zum gleichen Ziel und Zweck.
Zuverlässigkeit gehört, mit gewissen Einschränkungen, auch im Umgang mit Politikern anderer Parteien zu den Grundvoraussetzungen. Auch dort traf ich Menschen, deren klare Linie ich zu schätzen wußte, darunter zwei der führenden Oppositionspolitiker der sozialliberalen Koalition, Rainer Barzel und Walther Leisler Kiep, später Richard von Weizsäcker, besonders wegen seiner bahnbrechenden Rede am 8. Mai 1985. Auch die Verläßlichkeit Wolfgang Mischnicks an der Spitze der freidemokratischen Fraktion und die Geradlinigkeit seines Parteifreundes Josef Ertl will ich hier dankbar erwähnen; auch wenn Ertl und ich bisweilen aneinandergerieten, bin ich ihm gegenüber immer bei der Anrede »Bruder Josef« geblieben, worauf er frotzelnd mit »Bruder Helmut« antwortete.
Manchmal ist man darauf angewiesen, sich auf einen Menschen zu verlassen, den man gar nicht kennt. Wer in einem Verkehrsflugzeug sitzt, muß sich zum Beispiel auf den Piloten und die Airline verlassen. In der Regel aber verläßt man sich lieber auf Menschen, die einem vertraut sind. Ebendeshalb habe ich in großer Zahl alte Verbindungen gehalten. Das gilt für Freundschaften aus der Schulzeit, aus der Zeit als Soldat, aus der Studienzeit in den unmittelbaren Nachkriegsjahren, als ich im Hamburger SDS aktiv war; es gilt ebenso für zahlreiche Verbindungen aus der gemeinsamen politischen Arbeit, von den Anfängen in der Hamburger SPD in den vierziger und fünfziger Jahren bis in das Bonn der achtziger Jahre. Man kann sich immer noch aufeinander verlassen, selbst wenn manchmal Jahre vergehen, bis man sich wieder sieht; und man kann immer noch manches Wichtige gemeinsam zustande bringen.
Manchen Menschen, von denen ich gelernt habe, bin ich allerdings erst nach meinem Ausscheiden aus dem Amt begegnet, viele habe ich erst außer Dienst wirklich kennengelernt. Wer eine Zeitlang im Fokus des öffentlichen Interesses stand und sich dabei ein gewisses Ansehen erworben hat, der dürfte es in der Regel leichter haben, mit jemandem bekannt zu werden und ins Gespräch zu kommen, der ihn interessiert. Menschliches Interesse, Neugier und eine gewisse geistige Beweglichkeit sind hilfreiche Voraussetzungen – der Gesprächspartner muß spüren können, daß ich aus Interesse für ihn oder für seine Sache auf ihn zugehe. Damit aus einer bloßen Bekanntschaft aber mehr wird, muß das Gespräch auch für den Partner interessant sein, er muß etwas Wissenswertes zurückbekommen. Ist erst einmal eine Basis geschaffen,werden sich beide beim nächsten Treffen sofort erinnern, dieser Mann oder diese Frau ist ernst zu nehmen und ehrlich, und sogleich mit Offenheit das Gespräch wieder aufnehmen.
Da ich oft ungeduldig gewesen bin, bisweilen von nahezu unhöflicher Direktheit, mein Gegenüber zum Widerspruch provozierend, habe ich die Eingangsfloskeln solcher Gespräche gern abgekürzt. Bevor mein Gegenüber widersprechen konnte, mußte er nachdenken, und während er noch antwortete, dachte er weiter nach. So kann ziemlich schnell ein in die Tiefe gehendes Gespräch zustande kommen. Allerdings muß ich gestehen, daß ich mir mit meiner Entschiedenheit nicht nur Freunde gemacht habe.
Offenheit und Respekt vor dem anderen sind entscheidende Voraussetzungen für das Entstehen einer zuverlässigen Freundschaft. Vor einigen Jahren erhielt ich einen Brief meines Freundes George Shultz, den ich 1972 kennengelernt habe, als er unter Nixon Finanzminister war. Aus Empörung über den Watergate-Skandal war er zurückgetreten und in die Industrie gegangen, 1982 berief ihn Ronald Reagan zum Außenminister. In seinem Brief kam Shultz auf eine Unterhaltung zurück, die wir einige Wochen zuvor gehabt hatten – der Anlaß ist mir entfallen–, und schrieb dann: »You are as sharp as ever.« Das war durchaus als Kompliment zu verstehen, denn auch Shultz hat stets Klartext gesprochen. Von ihm habe ich am meisten über die politische Mentalität der amerikanischen Nation gelernt. In seiner Person verkörperten sich für mich auf vorbildliche Weise drei amerikanische Tugenden: common sense, fairness und patriotism.
Man muß nicht immer gleicher Meinung sein. Manches von dem, was Henry Kissinger in seinen Jahren als Nixons Sicherheitsberater machte, hat mir nicht gefallen, wie umgekehrt er möglicherweise mit mir als dem damaligen deutschen Verteidigungsminister nur teilweise einverstanden war. Dennoch dauert unsere gegenseitige persönliche Hochschätzung – und ich scheue, was mein Verhältnis zu ihm betrifft, nicht das Wort Faszination – nun schon ein halbes Jahrhundert; immerhin kennen wir uns seit 1958. Mein Eindruck damals: Dieser junge Assistant Professor in Harvard, als jüdischer Deutscher geboren, hat eine stupende analytische Urteilskraft, und er hat Substanz. Das haben alsbald rasch nacheinander Nelson Rockefeller, Richard Nixon und Gerald Ford erkannt. Seit 1976 ohne öffentliches Amt, gleichwohl in der ganzen Welt als außenpolitischer Analytiker anerkannt, ist Kissinger noch immer der inoffizielle Doyen der strategischen Denker Amerikas. Von ihm habe ich viel darüber gelernt, wie anders die Welt aussieht, wenn man sie von der amerikanischen Warte aus betrachtet. Fährt man allerdings über die Grenze nach Kanada – das hat mir später mein Freund Pierre Trudeau vermittelt–, erscheint die Welt abermals anders.
Die Welt mit den Augen der anderen zu betrachten, mit den Augen der Mitspieler und Gegenspieler – und unter dem Aspekt ihrer Interessen–, ist eine Kunst, die man nur im Gespräch mit Menschen anderer Kulturkreise erlernen kann. Das komplexe strategische Problem des Dauerkonflikts zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn habe ich durch den Austausch mit Nahum Goldman, Moshe Dayan, Anwar as-Sadat und König Fahd verstehen gelernt, und vielleicht verstehe ich es besser als manche Araber oder Israelis, die nur ihre eigene Sicht der Dinge kennen und wegen ihrer Vorurteile über die Gegenseite nur selten zu einem objektiven Urteil gelangen. Mein Freund Lee Kuan Yew in Singapur hat mich veranlaßt, mich wenigstens mit den Grundzügen der chinesischen Geschichte und des Konfuzianismus vertraut zu machen. Von zahlreichen Besuchen in Japan wußte ich, daß viele japanische Politiker gegenüber China unter einem kulturellen Minderwertigkeitskomplex leiden, den sie gern hinter einem betonten Nationalismus gegenüber China (und auch gegenüber Korea) verstecken; mein Freund Takeo Fukuda war in seiner offenen Haltung gegenüber China eine seltene Ausnahme. Von dem Koreaner Shin Hyon-Hwak habe ich viel über die für das koreanische Volk leidvolle Geschichte der japanischen Unterdrückung gelernt. Kontinuierlich über anderthalb Jahrzehnte sich erstreckende Gespräche mit Deng Xiaoping haben mich den Wiederaufstieg Chinas nach dem Tode Mao Zedongs besser verstehen lassen; Deng hat eine schier unglaubliche staatsmännische Leistung vollbracht – trotz der Tienanmen-Tragödie!
Eine wesentliche Voraussetzung für den regelmäßigen Austausch mit Freunden in aller Welt ist das Reisen. Davon habe ich auch nach dem Ausscheiden aus öffentlichen Ämtern ausgiebig Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit zu reisen besteht erst seit etwa einem halben Jahrhundert. Noch bis tief in das 20. Jahrhundert konnte nur der wirklich Wohlhabende verreisen. Es gab allerdings Ausnahmen, etwa die Wanderschaft der Handwerker, und es gab Auswanderung. Millionen Europäer sind nach Nordund nach Lateinamerika ausgewandert; sie nahmen Teile ihrer angestammten Kultur mit, aber weil die ganz anderen Lebensverhältnisse sie zur Anpassung zwangen, mußten sie manche Maßstäbe ersetzen. Einige schrieben zuweilen einen Brief an die Verwandten in der alten Heimat, der Brief brauchte viele Wochen; der Briefwechsel blieb spärlich und schlief spätestens in der zweiten Generation meist ein. Es gab weder Luftpost noch Radio, weder Fernsehen noch Internet, deshalb blieb in Europa die Kenntnis über Amerika ziemlich gering; sie beschränkte sich auf die lesenden Schichten. Mit der Ausnahme des afro-amerikanischen Jazz erstreckte sich der Einfluß der nordamerikanischen Kultur auf Europa vor dem Ersten Weltkrieg im wesentlichen auf technische Methoden der industriellen Produktion. Erst in den zwanziger Jahren, mit der rasanten Entwicklung neuer Verkehrs- und Kommunikationstechniken, weitete sich der kulturelle und der politische Einfluß der USA aus und übernahm nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa westlich des Eisernen Vorhangs eine dominante Rolle.
Meine Generation ist die erste gewesen, für die eine Reise auch dann denkbar wurde, wenn man nicht zur Oberschicht gehörte. Noch für meine Eltern, die in Hamburg zum beamteten Mittelstand aufgestiegen waren, ist Innsbruck das am weitesten denkbare Urlaubsziel gewesen – ein einziges Mal im Leben waren sie dort, mit der Eisenbahn. Schon Wien oder gar Italien oder Frankreich lagen außerhalb ihrer Reichweite. Für meine Generation war es zunächst Hitlers Krieg, der uns zum erstenmal auf ausländischen Boden führte. Als dann im Laufe der fünfziger Jahre für viele eine Auslandsreise erschwinglich wurde, setzte ein in dieser Breite nie dagewesener kultureller Austausch mit dem Ausland ein. Damals öffnete sich unser geographischer und geistiger Horizont.
Noch in den ersten Nachkriegsjahren hatte man sich eine Marktwirtschaft und freie Preise kaum vorstellen können; es war normal, daß man nicht nur Geld, sondern auch eine Lebensmittelkarte brauchte, um Brot und Wurst zu kaufen. Es war normal, daß man Wohnraum von einer Behörde zugeteilt bekam. Auch der Schwarzmarkt war normal. Kurz vorher war es noch normal gewesen, Befehle zu befolgen und andere Befehle insgeheim zu umgehen.
Binnen weniger Jahre veränderten sich nicht nur die ökonomischen Umstände, sondern vor allem das gesellschaftliche Wertesystem. Mit einem Mal kamen geistige und moralische Maßstäbe zur Geltung, die vorher nicht öffentlich formuliert und propagiert worden waren. Das Zusammentreffen der ungewohnten Freiheiten und der aufgestauten Neugier mit dem Tatendrang, es besser zu machen, hat die Kriegsgeneration angetrieben. Wir hatten mit Glück überlebt. Nun endlich wollten wir unser Leben selber in die Hand nehmen. Aber dazu mußten wir sehr vieles erst noch lernen.
Ich erinnere, als sei es gestern gewesen, wie ich heute vor sechzig Jahren bei einem Besuch der National Gallery am Trafalgar Square in London in einem Saal voller Gemälde aus vergangenen Jahrhunderten plötzlich auf ein ganz modernes Bild stieß. Es war der erste El Greco meines Lebens (genaugenommen war es wohl ein Bild aus seiner Schule). Für mich, der ich außer den deutschen Expressionisten noch die französischen Impressionisten liebte (und dazu Caspar David Friedrich), war dieses 350 Jahre alte Bild, Christus im Garten Gethsemane, eine Offenbarung. Ein Jahrzehnt zuvor hatten die Nazis meine Idole Ernst Barlach und Käthe Kollwitz, Emil Nolde und Ernst-Ludwig Kirchner als »entartete Kunst« verächtlich gemacht – für mich ein Signal ihrer Verrücktheit. Jetzt begriff ich, daß meine künstlerischen Maßstäbe zwar nicht falsch gewesen waren, wohl aber allzu einseitig. Ich bin dem genialen Greco alsbald weiter nachgegangen und ihm über das ganze Leben treu geblieben. Später habe ich mit Goya und den japanischen Holzschnittmeistern Hokusai und Hiroshige ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei aller Fremdartigkeit der asiatischen Kultur begriff ich unmittelbar: Auch in einer anderen Kultur kann große Kunst entstehen.
Ein vergleichbares Erlebnis hatte ich während des Krieges gehabt, als ich als Kurier eine Aktentasche voller Papiere nach Paris bringen mußte. Bis dahin kannte ich als Großstädte nur Hamburg, Bremen und Berlin. Das Bremer Rathaus, die backsteingotischen Kirchen Norddeutschlands und Schinkels Neue Wache Unter den Linden waren die mich prägenden architektonischen Erlebnisse gewesen. Nun wirkte die Stadt Paris auf mich als ein überwältigendes Gesamtkunstwerk: die großartigen Uferstraßen entlang der Seine, Notre Dame im Osten, der Arc de Triomphe im Westen, die Place de la Concorde, die großen und kleinen Paläste, die breiten Boulevards und die schmalen Bistros in den Nebengassen. Ich war ein junger Soldat der deutschen Besatzungsmacht, aber Paris weckte in mir das Gefühl neidvoller Bewunderung. In späteren Jahren bin ich häufig dort gewesen, ich habe dort Freunde gewonnen, aber der erste Eindruck hat sich immer wieder bestätigt. Trotz der unerfreulichen Banlieue, trotz der heute schon aus allen Nähten platzenden Ring-Autobahn Périphérique ist Paris für mich der Maßstab für eine Weltstadt geblieben. Die Kultur der Franzosen, das verstand ich schon bei meinem ersten, sehr kurzen Besuch, als ich zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahre alt war, ist der unsrigen wohl ähnlich, sie ist aber doch sehr anders, und jedenfalls haben wir Deutschen keinerlei Grund zur Überheblichkeit.
Meine vielen Reisen haben mir bestätigt, wie wichtig es ist, das eigene Land von außen zu betrachten und seine Institutionen und Gesetze mit denen anderer Staaten zu vergleichen. Diese Einsicht hat dazu beigetragen, daß ich auch später, nach dem Ausscheiden aus öffentlichen Ämtern, noch vieles gelernt habe und manchmal besser über die Welt informiert war, als ich es während meiner aktiven Zeit gewesen bin. Der Terminkalender eines Bundeskanzlers oder auch eines Bundesministers läßt nur wenig Zeit für die Vorbereitung auf den jeweils nächsten Termin. Man wird von morgens um neun bis nachts um zwölf von einem Gespräch zum anderen gehetzt und muß sich im Laufe eines Tages mit sechs, sieben, acht verschiedenen Partnern über völlig verschiedene Themen unterhalten. Zwischendrin muß man mal eben in den Bundestag und eine kleine Rede halten. Man ist angewiesen auf die Briefings durch die Mitarbeiter und hat nur selten Gelegenheit, sich über die Dossiers hinaus eigene Informationen zu beschaffen. Einen Großteil seiner Zeit verbringt man unterwegs, oft im Flugzeug, was aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen eine zusätzliche Belastung bedeutet.
Heute habe ich sehr viel mehr Zeit. Das ist ein Grund, weshalb ich mich oft besser unterrichtet fühle als früher: Wer Zeit hat, Dinge aufzunehmen und zu verarbeiten, erweitert seinen Horizont. Der andere Grund ist: Das Spektrum der Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ist sehr viel breiter geworden. Zwar habe ich mir auch im Amt die Gesprächspartner selbst ausgesucht und sie mir nicht vom Auswärtigen Amt oder sonstwem vorschreiben lassen, aber viele Termine waren durch das Amt vorgegeben und gar nicht zu umgehen. Heute kann ich mir meine Gesprächspartner nach eigenen Interessen und Vorlieben auswählen. Hinzu kommt nicht zuletzt, daß ich älter geworden bin und meine Urteilskraft – wie ich hoffe – zugenommen hat. Nur durch regelmäßiges Reisen lernt man auch den rapiden Wandel verstehen, dem große Teile unserer Welt unterworfen sind. Ich habe zum Beispiel Shanghai vor dem großen Umbruch noch deutlich vor Augen; wie es aussah, wenn am späten Nachmittag Millionen Menschen zu Fuß durch die Straßen gingen. Heute fährt man mit dem Auto, sogar mit der Magnetschwebebahn durch Shanghai.
Ein chinesisches Sprichwort sagt: «Einmal sehen ist besser als hundertmal hören.« Nach diesem Motto habe ich es mir schon früh zur Pflicht gemacht, nach meinen Reisen einen Bericht zu schreiben und diesen an das Auswärtige Amt zu schicken. Der Außenminister Gerhard Schröder interessierte sich immer dafür und bat mich nach Lektüre bisweilen zum Gespräch. Ich schrieb diese Berichte aus Schuldigkeit sowohl gegenüber dem Land, das ich gerade besucht hatte, als auch gegenüber dem Auswärtigen Amt; mein Außenminister sollte zumindest über die gleichen Informationen verfügen wie ich. Erst als Joseph Fischer ins Amt kam, habe ich diese Praxis eingestellt.
Heutzutage hat ein jüngerer Bundestagsabgeordneter sehr viele Möglichkeiten, ins Ausland zu reisen, und ich kann jedem nur dringend empfehlen, diese zu nutzen. Ich meine nicht Urlaubsreisen, sondern Reisen zu Treffen und Konferenzen, zum Studium und zum Austausch mit Partnern aus anderen Völkern und Staaten. Wenn sich dabei auch ein Urlaubstag einschieben oder der Besuch sich mit der Besichtigung von Landschaften und Sehenswürdigkeiten kombinieren läßt, so ist das erfreulich, aber es sollte nicht zur Hauptsache werden. Viele unserer Politiker haben einen Eindruck von unseren Nachbarländern und von den USA; aber einer, der niemals China und Indien, niemals Rußland, Lateinamerika und Afrika erlebt hat, ist für seinen politischen Beruf eigentlich nicht zureichend ausgerüstet.
Ich will in diesem Zusammenhang noch eine weitere Empfehlung für junge Politiker der nachfolgenden Generation aussprechen, muß dabei aber zugleich ein eigenes Versäumnis einräumen. Als ich es in den siebziger Jahren begriff, war es zum Nachholen des Versäumten längst zu spät. Ich spreche von dem schwerwiegenden Mangel, der französischen Sprache nicht mächtig zu sein. Mein Freund Valéry Giscard d’Estaing und ich haben immer nur englisch miteinander sprechen können; sein Deutsch war minimal, mein Französisch gleich Null. Bei Gegenständen, deren Behandlung schwierige Fachausdrücke erforderte, waren wir auf unsere Dolmetscherinnen angewiesen. Ich habe das als erhebliche Beeinträchtigung empfunden. Weil meine ansonsten vorzügliche Lichtwarkschule in Hamburg nicht allzuviel Wert auf Sprachen gelegt hatte, verfügte ich zunächst nur über Schulenglisch und über Anfangsgründe im Lateinischen. Ich hätte als junger Abgeordneter, noch keine vierzig Jahre alt, meine Freizeit nutzen sollen, Französisch zu lernen und anzuwenden. Als ich mit fünfzig Jahren Minister wurde, war es dafür zu spät, auch gab es keine Freizeit mehr. Ich konnte nie mehr nachholen, was ich in jüngeren Jahren versäumt hatte.
Im 21. Jahrhundert, in dem die Entfernungen noch viel mehr zusammenschrumpfen werden, wird Englisch für viele Berufe zu einer selbstverständlichen Voraussetzung werden. Ein deutscher Politiker aber, der als Fremdsprache allein das Englische einigermaßen beherrscht, kann sich nur mit Einschränkungen überall verständlich machen. Jungen Deutschen, die begabt genug sind und den Willen zum Lernen haben, stehen – fast ohne Ausnahme – alle Schulen und Hochschulen offen. Wer die Angebote nicht nutzt, parallel zu seiner speziellen Berufsvorbereitung mindestens zwei lebende Fremdsprachen zu erlernen, läuft Gefahr, für immer zweitrangig zu bleiben.
Erfahrungen aus der Wirtschaft
Im Rückblick auf lange Jahre in der Regierung, auf dreißig Jahre im Bundestag und auf sechs Jahrzehnte politischen Engagements stelle ich fest: Ich habe in diesen Jahren vieles gelernt. Einige wichtige Einsichten habe ich jedoch erst in dem Vierteljahrhundert seit meinem Ausscheiden aus der aktiven Politik gewonnen. Auch deshalb unterscheiden sich am Ende meines Lebens manche Einsichten von denen am Beginn meines politischen Engagements. Wenn ich im Laufe der Jahre manches dazugelernt habe, so verdanke ich das in erster Linie den Menschen, denen ich zugehört habe, darunter auch vielen, die durchaus anderer Ansicht waren als ich. Im folgenden soll von Persönlichkeiten die Rede sein, deren ökonomische und unternehmerische Erfahrungen für mich wichtig wurden.
Volkswirtschaftliche Zusammenhänge lernte ich zuerst begreifen in den vier Jahren, die ich als junger Mann in der von Karl Schiller geleiteten hamburgischen Behörde für Wirtschaft und Verkehr gearbeitet habe. Zunächst war ich sein persönlicher Referent, dann wurde ich Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung und zuletzt, 1952, Leiter des Amtes für Verkehr. Dessen umfangreichste Aufgabe war eine Verwaltungsaufgabe, nämlich Führerscheine auszugeben und einzuziehen. Aber zum Amt gehörten nicht nur die Hamburger Hochbahn, die Straßenbahn und die S-Bahn, sondern auch der Flughafen und alles, was mit dem Luftraum zusammenhing. Immerhin kann ich mich rühmen, daß ich 1952 zusammen mit Wolf Loah im Raum Kaltenkirchen nördlich von Hamburg einen Großflughafen geplant habe. Daraus ist nichts geworden, weil sowohl die Hamburger als auch die Schleswig-Holsteiner zu kleinkariert waren; die Hamburger hatten Angst, daß ihr ganzes Geld nach Schleswig-Holstein geht, und die Kieler Politiker meinten, Kaltenkirchen würde doch nur den Hamburgern nützen. Statt des einen haben wir heute gleich drei Weltflughäfen: einen in Kiel, einen in Lübeck und einen in Fuhlsbüttel.
Bei der Neugründung der Lufthansa sammelte ich auch erste Erfahrungen über Hamburg hinaus. Neben dem Bund, vertreten durch den Verkehrsminister Seebohm, waren die Länder Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg beteiligt, und jeder musste ein Stück vom Kuchen abbekommen. Daß Frankfurt das Zentrum des Verkehrs werden würde, war geographisch unausweichlich. Als Ausgleich erhielt Nordrhein-Westfalen die Hauptverwaltung, die noch heute in Köln sitzt, und die technische Basis ging nach Hamburg, wo sie auch geblieben ist.
Kaufmännische oder unternehmerische Erfahrung hat mir bis in die achtziger Jahre gefehlt. Allerdings erhielt ich erste, noch bescheidene Einblicke als Aufsichtsratsmitglied der Firma Auer-Druck, die der Hamburger SPD gehörte und unter anderem die Tageszeitung »Hamburger Echo« herausgab. Deren Redakteure wollten eigensinnig immer noch die gleiche Zeitung machen, die sie bis 1933 gewohnt gewesen waren. Aber für eine solche Zeitung gab es immer weniger Leser, und deshalb war ihr Ende schließlich unvermeidlich. Tradition ist etwas Wichtiges, aber es ist nicht der Hauptzweck des Lebens. Einer der Redakteure war übrigens Herbert Wehner, der einmal einen ganzseitigen Artikel über einen Kongreß der finnischen Holzarbeitergewerkschaft schrieb. Später mußte auch die von dem Journalisten Heinrich Braune sehr viel besser gemachte Boulevardzeitung »Hamburger Morgenpost« verkauft werden. Gelernt habe ich dort, daß es sinnlos ist, am Markt etwas verkaufen zu wollen, was das Publikum nicht haben will. Jahrzehnte später übernahm ich den Vorsitz im Verwaltungsrat der Kreditanstalt für Wiederaufbau; die KfW war damals keine Geschäftsbank, sondern eher eine Verwaltungsbehörde, ein verlängerter Arm des Finanzministeriums – deshalb habe ich dort nichts Wichtiges dazugelernt.
Eigene unternehmerische Erfahrungen habe ich erst nach meiner Zeit in öffentlichen Ämtern erwerben können,von 1983 an, als mein früherer CDU-Bundestagskollege und späterer Freund Gerd Bucerius mich zum Herausgeber und (für einige Jahre) zu einem von zwei Geschäftsführern des ihm gehörenden Verlages der Wochenzeitung DIE ZEIT machte. Wir kannten uns seit 1949. Nach 1953 haben wir gemeinsam mit zwei weiteren Politikern aus Bremen und Hamburg den Wiederaufbau der deutschen Seeschiffahrt durchsetzen können, zunächst gegen den Willen der Alliierten. Meine Kollegin in der Geschäftsführung der ZEIT war die umsichtige Hilde von Lang, von der ich vieles lernte; auch der temperamentvolle Verleger-Eigentümer selbst war jeden Tag im Geschäft und nahm aktiv an allem Anteil. Meine Aufgabe lag auf der publizistischen Seite, in der Zusammenarbeit mit der Redaktion unter Theo Sommer.
Inzwischen sind Marion Gräfin Dönhoff und Gerd Bucerius schon seit einigen Jahren nicht mehr unter den Lebenden, die Chefredaktion hat mehrfach gewechselt, der Verlag wurde an die Holtzbrinck-Gruppe verkauft. Der publizistische Erfolg ist der ZEIT gleichwohl treu geblieben; kaufmännisch ist sie, nach einer kurzen Verlustperiode, schon lang wieder aus den roten Zahlen heraus. Jedoch erinnere ich mich deutlich an die Zeiten, in denen wir mit Besorgnis Woche für Woche Auflage und Umsatz verfolgten und mit Bangen der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz entgegensahen. Damals habe ich das immer wiederkehrende Risiko des unternehmerischen Eigentümers begriffen. Vor allem aber habe ich gelernt, wie man eine Zeitung macht; und ich habe gelernt, daß ein Journalist nicht populistisch nach Tagesapplaus gieren darf, gleichwohl aber interessant zu lesen sein muß.
Politiker und Journalisten leben in einer antagonistischen Symbiose: Einer kann nicht leben ohne den anderen. Aber sie sind einander nicht besonders wohlgesinnt und beobachten sich gegenseitig mit unterschwelligem Argwohn. Dabei sind ihnen mindestens zwei Probleme gemeinsam. Zum einen sollen sie schon heute über Themen und Sachverhalte reden oder schreiben, die sie erst morgen oder übermorgen ausreichend verstehen; zum andern sind beide darauf angewiesen, ihr jeweiliges Publikum zu faszinieren. Beide Berufe sind deshalb großen Versuchungen ausgesetzt – sei es mit Blick auf Wählerstimmen, sei es mit Blick auf Auflage oder Einschaltquote. Beide sind Teil der politischen Klasse, aber in beiden Berufen reicht die Spannweite vom Staatsmann bis zum Delinquenten.
Als ich 1983 von der aktiven Politik in die ZEIT wechselte, haben einige Journalisten von einem Wechsel auf die »andere Seite der Barrikade« gesprochen. Ich habe das keineswegs so empfunden. Vielmehr war das Angebot des Verlegers ein Glücksfall für mich. Ich habe in dem »Seitenwechsel« auch deshalb kein Problem gesehen, weil es für mich hier wie dort in gleicher Weise geboten erscheint, für Durchsichtigkeit und Überblick einzutreten. Auf beiden Feldern soll man das eigene Urteil plausibel begründen können – und dabei wahrhaftig bleiben. Ein Journalist, der seiner Verantwortung nicht gerecht wird, kann die Demokratie genauso beschädigen wie ein verantwortungslos handelnder Politiker.
Ich habe sowohl in Deutschland als auch in anderen Staaten eine größere Zahl von Journalisten kennenlernen dürfen, die aus Verantwortungsbewußtsein eine Information für sich behielten und sie nicht öffentlich verwertet haben. Als ich Ende 1969 als Verteidigungsminister die Befehlsgewalt über die Bundeswehr übernahm, fand ich zum Beispiel Pläne zu militärischen Vorbereitungen für einen Atomminengürtel quer durch Deutschland (Atomic Demolition Means, ADM). Die Löcher waren schon gebohrt. Weil das Militär eine politische Kontrolle seiner potentiellen atomaren Verteidigung verhindern wollte, waren die Pläne vor dem Bundestag geheimgehalten worden. Von diesen Atomminen hatten einige Journalisten gehört – und haben geschwiegen. Sie haben auch geschwiegen, als sie später erfuhren, daß mein amerikanischer Verteidigungsminister-Kollege Melvin Laird und ich gemeinsam die Einsatzvorbereitungen ganz leise beendet und annulliert haben – zum Entsetzen der militärischen Führung (mit Ausnahme des Generalinspekteurs Ulrich de Maizière). Wären die Pläne publik geworden, wäre es zu einem entsetzten Aufschrei der Angst in der öffentlichen Meinung in Deutschland und zu großer Verstimmung in unserem Verhältnis zu den USA gekommen. Aus Verantwortungsbewußtsein hat niemand darüber berichtet.
Ein anderes Beispiel war der Freikauf von Gefangenen aus der DDR, den Rainer Barzel als junger Bundesminister mit der DDR eingefädelt hatte und den alle nachfolgenden Bundesregierungen fortgesetzt haben. Auch davon haben einige Journalisten gewußt; hätten sie darüber berichtet, wäre Honecker öffentlich bloßgestellt worden und hätte die Praxis des Freikaufs unterbunden. Ein drittes Beispiel war die Geheimhaltung der Entsendung der GSG 9 nach Mogadischu, von der einige Journalisten durch Zufall erfahren hatten. Wenn sie darauf beharrt hätten, ihr Wissen in der Zeitung zu veröffentlichen, wäre die Befreiung des von islamistischen Terroristen gekaperten Flugzeugs gescheitert – mit tödlichen Folgen für sehr viele Menschen.
Mancher Journalist neigt jedoch aus Geltungsbedürfnis oder zwecks Steigerung der verkauften Auflage und der Einschaltquote zu Grenzüberschreitungen. Dabei wird immer häufiger auch die Privatsphäre von Personen verletzt, die auf der öffentlichen Bühne stehen. Vor allem tendieren manche Massenmedien dazu, einen geringfügigen Anlaß zu einem Skandal aufzubauschen. Nach der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 konnte man erleben, wie einige Journalisten (und auch manche Politiker) sich darüber aufregten, daß der gerade eben aus dem Amt geschiedene Bundeskanzler Schröder ein Aufsichtsratsmandat im Bereich des russischen Gazprom-Konzerns angenommen hatte. Vielleicht hätte er damit noch ein oder zwei Jahre warten sollen, aber im Prinzip erschien mir die Aufregung abwegig.
Ich selbst habe nach dem Ausscheiden aus dem Amt ohne Bedenken eine Reihe von Aufsichtsrats- und Beiratsmandaten übernommen. Bei den Beiräten handelte es sich um kanadische, amerikanische, belgische, saudi-arabische und deutsche Firmen mit zumeist erheblichem internationalen Ansehen; sie waren global tätig, und ihre Beiräte waren international zusammengesetzt. Man wurde um sein Urteil gebeten, man blieb persönlich unabhängig (die Honorierung war überall ganz bescheiden), man traf interessante Menschen und lernte nebenbei, wie ein multinationaler Konzern funktioniert, wie er funktionieren muß und warum Multinationalität notwendig ist. Auf diese Weise habe ich sowohl den Niedergang der PanAm (Pan American World Airways) miterlebt als auch den Aufstieg der weltweit tätigen Deutschen Handelsfirma Otto-Versand.
Meine Aufsichtsratsmandate hatten verschiedene Ursprünge. Bei der tüchtigen Maschinenbaufirma Körber AG hat mich der Eigentümer-Unternehmer, mein Freund Kurt Körber, als Vertreter der Anteilseigner berufen. Gleichwohl habe ich mich einmal in einer Streitfrage zwischen Vorstand und Belegschaft auf die Seite der Belegschaft gestellt. Bei der Deutschen Airbus hatte mich der Senat der Stadt Hamburg als Anteilseigner entsandt. Ich erlebte dort, wie ein international tätiges Unternehmen durch eine Dollar-Abwertung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir mußten auf dem internationalen Markt der Luftfahrtindustrie den Airbus gegen US-Dollar verkaufen; das letzte Flugzeug einer größeren Bestellung wurde erst nach einigen Jahren geliefert und bezahlt, aber inzwischen war der DM-Gegenwert des vereinbarten Dollar-Preises deutlich geringer als beim Abschluß des Liefergeschäftes. Die Löhne und Kosten hatte die Firma aber bis zum letzten Flugzeug in DM finanzieren müssen – also machte man einen Verlust. Ich sah mich in meiner Überzeugung bestätigt, eine umfassende, starke gemeinsame europäische Währung herzustellen; auch die bis dahin unzureichende privatwirtschaftliche Kurssicherung wurde neu geordnet.
Bei der Volksfürsorge AG wurde ich von den Anteilseignern und der Belegschaft gemeinsam berufen. Ich habe dort zum wie derholten Mal erlebt – es war noch vor den amerikanischen Wirtschaftsprüfungsskandalen der New Economy–, daß ein Vorstand nur ungern die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wechselt, die ihn von Gesetzes wegen zu prüfen hat. Ich habe in drei Gesellschaften einen Wechsel der Wirtschaftsprüfer verlangt – allerdings in allen Fällen vergeblich. Inzwischen haben Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber erkannt, daß ein regelmäßiger Wechsel geboten ist, um ein ansonsten mögliches Zusammenspiel zwischen Unternehmensvorstand und Wirtschaftsprüfer zu unterbinden.
Meine Erfahrungen in diesen drei Gesellschaften zusammenfassend und verallgemeinernd, darf ich sagen: Wenn ein Vorstand sich mit seinem gewählten Betriebsrat nicht einigen kann, liegt die größere Schuld meist beim Vorstand. Sofern es um die Existenz der Firma und die Erhaltung von Arbeitsplätzen geht, haben die gewählten Betriebsräte im übrigen meist mehr ökonomische Vernunft als die oft stark an Macht- und Prestigefragen orientierten hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionäre, die im Aufsichtsrat sitzen; allerdings sind diese oft eloquenter als die Betriebsräte. Insgesamt habe ich keinen Grund gehabt, meine Vorstellung vom Prinzip der Mitbestimmung als einem wichtigen Faktor des sozialen Friedens einzuschränken. Die propagandistisch-polemische Kritik an den Gesetzen zur Betriebsverfassung und zur Mitbestimmung durch unternehmerische Verbandsfunktionäre und einige neo-liberale Wortführer läßt mich immer noch ebenso unberührt wie ehedem.
Mein Aufsichtsratsmandat in der Ruhrkohle AG hat mich eine wichtige Einsicht auf einem ganz anderen Felde gewinnen lassen. Wohl auf Vorschlag meines Freundes Adolf Schmidt, damals Vorsitzender der Bergarbeitergewerkschaft, war ich von der Belegschaft als Vertreter der Arbeitnehmerseite bestellt worden. Ich habe dieses Mandat besonders gern angenommen, hatte ich doch zu Zeiten der Großen Koalition in Bonn aus Überzeugung an der Zusammenfassung aller Steinkohlebergwerke in der Ruhrkohle AG mitgewirkt. Und ich war an dem sogenannten Jahrhundert-Vertrag beteiligt, der 1980 für anderthalb Jahrzehnte die Verstromung eines Teils der geförderten Kohle und damit den Absatz sicherte. Ich hatte viele Male Bergwerke besucht, war in vielen Gruben eingefahren und hatte – von der Staublunge bis zum täglichen Unfallrisiko – eine klare Vorstellung von der Schwerstarbeit unter Tage.
Ich wußte zwar, daß an der Ruhr die Kosten und die Preise unwirtschaftlich hoch waren und die Förderkapazität zu groß, so daß weitere Zechen stillgelegt werden mußten; ich kannte die Gesetze, die für soziale Verträglichkeit sorgten, indem sie die betroffenen Bergleute vorzeitig in Rente schickten. Jetzt aber erlebte ich diese Vorgänge hautnah, jedes Jahr erneut. Da es eine ähnliche »soziale Abfederung« massenhaft auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen gab, in denen Arbeitsplätze abgebaut wurden, ahnte ich in den späten achtziger Jahren erstmals etwas von der unvermeidlich drohenden Überforderung unserer Sozialversicherung. Für die Ruhrkohle AG sah ich damals keinen Ausweg; vielmehr habe ich im Interesse der betroffenen Kumpels an der Frühverrentung mitgewirkt.
Um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung besser zu verstehen und für die Lösung einzelner Probleme gerüstet zu sein, habe ich schon früh das Gespräch mit urteilskräftigen Menschen aus der Wirtschaft gesucht, ja, ich habe solche Gespräche, die oftmals unter vier Augen geführt wurden, nahezu systematisch herbeigeführt. Dabei ist mir klargeworden, daß Unternehmer und Manager keineswegs einem mehr oder minder einheitlichen Typus angehören. Sie unterscheiden sich in ihrer Urteilskraft ebenso voneinander wie andere Menschen auch.