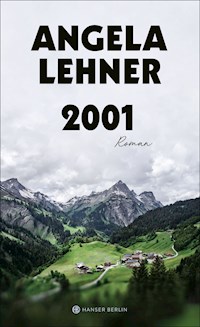
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach ihrem Debüt „Vater unser“ das neue Buch von Angela Lehner: Ein großer Roman über Freundschaft und die Abgehängten in der österreichischen Provinz im Jahr 2001 – voller Komik und mit einem unverwechselbaren Sound. Es ist das Jahr 2001, und im Tal ist alles wie immer. Die Berge sind schroff, die Touristen unersättlich, die Jugendlichen auf der Suche nach Alkohol und Abenteuern und die Eltern abwesend. Eine Zukunft hat hier keiner, am allerwenigsten Julia, die in der Hauptschule zum sogenannten Restmüll gehört, was ihr egal ist – denn für sie zählt nur eins: Hip-Hop und der Zusammenhalt ihrer „Crew“. Bis ihr Geschichtslehrer eines Tages die ganze Klasse zwingt, an einem politischen Experiment teilzunehmen, und damit eine Lawine an folgenschweren Ereignissen lostritt. 2001 ist ein Roman über Freundschaft und das Einbrechen der Weltpolitik in eine Jugend ohne Gott – geschrieben von einer der originellsten Autorinnen unserer Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Es ist das Jahr 2001, und im Tal ist alles wie immer. Die Berge sind schroff, die Touristen unersättlich, die Jugendlichen auf der Suche nach Alkohol und Abenteuern und die Eltern abwesend. Eine Zukunft hat hier keiner, am allerwenigsten Julia, die in der Hauptschule zum sogenannten Restmüll gehört, was ihr egal ist — denn für sie zählt nur eins: Hip-Hop und der Zusammenhalt ihrer »Crew«. Bis ihr Geschichtslehrer eines Tages die ganze Klasse zwingt, an einem politischen Experiment teilzunehmen, und damit eine Lawine an folgenschweren Ereignissen lostritt.2001 ist ein Roman über Freundschaft und das Einbrechen der Weltpolitik in eine Jugend ohne Gott — geschrieben von einer der originellsten Autorinnen unserer Gegenwart.
Angela Lehner
2001
Roman
Hanser Berlin
JÄNNER
1
Unsere Stadt heißt Tal und das ist alles, was man wissen muss. Ich setze die Kapuze auf, schiebe Cypress Hill in den Discman und marschiere los.
People always gotta see your smile, kommt es durch die Kopfhörer. No matter what you just been through.
Ein grüner Traktor mit einem Anhänger voller Schnee überholt mich und drückt mit seinen überdimensionalen Reifen einen Kuhfladen auf der splittbedeckten Straße platt. Sogar jetzt, wo die Kühe eigentlich ihren Winterschlaf halten müssten, füllen sich die Straßen und Wege wie von Zauberhand mit Mist. Kacke ist hier allgegenwärtig. Und selbst, wenn unsere Stadt im Tourismusführer als Winterwonderland verkauft wird, weiß ich, dass das ganze Tal, die angezuckerten Berghänge, die riesigen Mehrfamilienhäuser mit den dunklen Holzvertäfelungen und die Menschen in ihnen, in Wirklichkeit mit Kacke ausgestopft sind.
So you wanna be a Rap Superstar. Ich zünde mir eine Zigarette an und drehe die Musik lauter. Ich gestikuliere auf dem schmalen, rutschigen Gehsteig zum Text mit, sodass bei jeder Berührung meiner Ellenbogen der Schnee aus den abgestorbenen Thujahecken segelt. Die ersten besseren Häuser tauchen auf. Sie sind weiß gestrichen, haben graue Kunststofffensterrahmen und flache Dächer. Die Leute, die in ihnen wohnen, kennen die Namen ihrer Architekten auswendig. Vor so einem Haus steht der Messdiener auf einem Scheißhöckerchen und malt mit Kreide das »C«, das »M« und das »B« auf den Türrahmen. Neben ihm stehen drei Kinder in bunt glitzernden Zigeunerkostümen.
Die heiligen drei Könige sind in Tal immer spät dran. Eigentlich sollten sie bis sechsten Jänner durch sein mit ihren Haussegnungen und Teufelsaustreibungen. Es gibt aber nicht so viele Kinder, denen der Pfarrer glaubt, dass sie die Kirchenspenden auch abliefern. Und weil es im Tal einen Notstand an heiligen, anständigen Kindern gibt, müssen die wenigen eben alle kirchlichen Verpflichtungen erledigen: Am Neujahrstag mit der Peitsche in den Wind hineinschnalzen, zu Ostern die Leute mit der Ratsche in die Kirchenbank schicken und im Dezember als Engel verkleidet neben dem Nikolaus herlatschen, weil den keiner mögen würde, wenn sein einziger Sidekick der Krampus wäre.
Bei so einem Umzug könnten meine Crew und ich niemals mitmachen. Nicht einmal Krampusse dürfen wir sein. Solche wie uns, hat der Obmann gesagt, als wir letzten Herbst mit ein paar Kuhglocken beim Trachtenverein angetanzt sind, und auf meinen Bruder und mich gezeigt, könne er nicht gebrauchen; und so einen wie den, dabei hat er auf den Tarek gezeigt, schon gar nicht. Im Tal bleiben die Engel und die Krampusse unter sich, die Goldhaubenfrauen vererben ihre Hüte an die Töchter, und die Arbeiter der Milchfabrik ihre Stellen an die Söhne.
Comin’ up in the world don’t trust nobody.
Der Song ist vorbei, als ich das blau umrahmte Ortsschild erreiche. Willkommen in Tal steht darauf. Bis vor ein paar Wochen stand darunter noch Dobrodošli. Das steht da jetzt nicht mehr.
»Welcome, welcome«, sag ich und werfe den Tschickstummel auf einen gefrorenen Kuhfladen am Wegrand.
2
»Also, Julia.«
Herr Brandstätter seufzt.
Er ist unser Geschichtslehrer und Klassenvorstand. Andere Lehrer gehen mit ihrer Klasse ins Billardcafé an der B 100 oder machen Wandertage zur Römerausgrabungsstätte, aber mit dem Brandstätter: nix.
Einmal hat er gesagt, er hätte auch den Betrieb seiner Eltern übernehmen können, und dabei ausgeatmet, wie er jetzt ausatmet, als er mich von seinem Pult aus prüft. Er hat ein Bein über das andere geschlagen und schaut mich böse an.
»Nur die Jahreszahlen«, sagt er.
»Äh.«
Ich schaue auf die Tischplatte.
Dorthin, wo Andreas letztes Jahr Julia, du Runzelfut geschrieben hat, als ich an einem Tag nicht da war.
2Pac 4Ever, steht hier jetzt mit Kugelschreibermine ins Holz geritzt, kein Runzelfut mehr, aber auch keine Jahreszahl, von keinem Krieg.
Nadja, die mit verschränkten Armen neben mir sitzt, ist auch keine Hilfe. Das kommt halt davon, wenn die Lehrer den Banknachbarn bestimmen.
»Äh«, sag ich noch einmal.
Der Brandstätter nimmt einen Zipfel seines Schals in die Hand und sagt: »Also bitte.«
Eigentlich muss er fast schreien, damit alle es hören. Das Klassenzimmer ist nicht groß, aber mit Schülern vollgestopft. Immerhin sind wir der Restmüll.
War schon wer beim Restmüll?, fragen die Lehrer sich gegenseitig am Gang, wenn sie die Schüler in der Pause nach unten treiben. Der Restmüll blockiert noch die Umkleiden, sagen die Muskelprotze aus dem Sportzweig, wenn wir ein bisschen länger brauchen, um uns aus den vollgeschwitzten KiK-Leggings zu schälen.
Natürlich sind wir in der Hauptschule eh alle zweite Wahl, aber der Restmüll ist noch einmal ein Schicksal für sich. Das Schulsystem ist ja ein einziges Siebverfahren. Nach der Volksschule wird man das erste Mal durch dieses Sieb geschüttelt und oben — im Gymnasium — bleiben nur die Arztkinder, die Lehrerkinder oder solche, die den Erwachsenen schon früh vorlügen, Lernen würde ihnen Spaß machen. Der Rest sickert in die Hauptschule, in die Sprach- oder Sportklassen, und wenn man kein Italienisch kann und schlecht im Sichbewegen ist, rutscht man eben noch einmal durch und landet im Restmüll. Dort muss man nichts Besonderes mehr leisten, außer existieren, aber auch das ist manchmal schwer.
»Sag mir halt irgendeine Zahl«, sagt der Brandstätter. Mittlerweile steht er direkt vor unserem Tisch. »Wann war denn der Erste Weltkrieg ungefähr?«
»Hmm«, sag ich und nicke ein bisschen, als würde mir die Zahl langsam einfallen. Aber mein Kopf ist leer. Ich bin, wenn es um Zahlen geht, ein bisschen behindert. Das hat der Mathelehrer aus der zweiten Leistungsgruppe auch gesagt, bevor er mich in die dritte zum Kelomat geschickt hat.
»Hofer«, hat er gesagt, »wenn es um Zahlen geht, bist du einfach ein bisschen behindert.«
Und er hat ja recht. Wenn ich rechnen soll oder eine Jahreszahl sagen, geht meinem Hirn ganz schnell das Benzin aus. Ich kann sofort aufzählen, welche zehn Songs gestern bei VIVA die meistgewünschten waren, aber wie viele Einwohner in unserer Stadt wohnen und wie hoch unsere Stadt liegt — keine Chance, so was merke ich mir nicht. Einmal hat mich mein Bruder gefragt, was ich glaube, wie viele Kilometer der Mond von der Erde entfernt herumschwebt, und wie ich geschätzt hab, hat er so gelacht, dass er sich ein bisschen in die Unterhose gepisst hat.
Jedenfalls wird der Brandstätter langsam grantig, und wenn der Lehrer grantig wird, sagt man halt was. Irgendwas. Mir fällt ein, dass wir in der letzten Stunde vor den Weihnachtsferien im Geschichtsbuch Fotos gesehen haben von einem Schlachtfeld mit so Leichen. Und wahrscheinlich war das dann vom Ersten Weltkrieg. So lange gibt es Fotos ja noch nicht, jetzt ist 2001, dann rechne ich da einfach ein paar Jahre weg.
»1786«, sag ich. Das ist meine Spezialität beim Zahlenraten: Ich klatsche hinten immer mein Geburtsjahr dran, das gibt dem Ganzen einen realistischen Touch.
»1786!«, ruft der Brandstätter und reißt die Augen auf. Die halbe Klasse lacht, obwohl die es wahrscheinlich auch nicht besser wissen.
»Achtzehnhundert …«, fange ich leise an.
»Achtzehnhundert!«, ruft der Brandstätter, und ich mache den Mund zu.
Meine Banknachbarin hebt die Hand. Ihr Shirt hat unter den Armen Schweißflecken. Das finde ich komisch an ihr: Die hat immer so brave Sachen an, Kleider und Rollkragenpullover, eine Brille hat sie auch, aber die Haare kleben ihr meistens wie ein Helm um den Kopf, und ich glaube, sie wäscht sie auch nicht öfter, als ich Geschichte lerne.
»Nadja«, sagt der Klassenvorstand jetzt.
»Neunzehnhundertvierzehn bis neunzehnhundertachtzehn«, sagt sie und verschränkt die Arme wieder auf dem Tisch.
Es klingelt, der erste Schultag in diesem Jahr ist vorbei. Brandstätter trägt Nadja einen Einser ein, mir einen Fünfer, und wie er das Klassenzimmer verlässt, kommt Melli von der letzten Reihe vor und gibt Nadja eine Kopfnuss.
»Aufpassen, Bitch«, sagt sie, schiebt die Hände in die Jackentaschen und geht raus.
Tarek und Bene setzen ihre Winterhauben auf und folgen ihr. Andreas rempelt meine Banknachbarin im Vorbeigehen mit dem Rucksack an und bellt ihr ein »Mongo« entgegen. Nicht, dass er und ich so gute Homies wären, aber dem Andreas ist jede Ausrede zum Stänkern recht.
3
»Gemma«, schreien die Lehrer auf dem Gang, wenn sie uns aus den Klassen scheuchen. »Gemma«, sagt man hier auch zum Vieh, wenn man es in Herden zusammentreibt. Und in der Viertelstunde große Pause ist es genau das: ein erzwungener Almabtrieb. Man darf gar nicht im Gebäude bleiben, egal, ob die Sonne herunterknallt oder ob es schneit. Wir Schüler tröpfeln aus den Klassen in die Gänge und fließen als zäher Strom das Treppenhaus hinunter. Im Erdgeschoss, vor dem Tor, gibt es immer Stau. Hunderte Stimmen schwellen zu einem Dröhnen an, das einem die Trommelfelle nach innen stülpt; der Moment, wenn man endlich nach draußen gespuckt wird und wieder frei mit den Armen rudern kann, ist ein Kurzurlaub für die Seele.
»Julia!«
Melli hebt die Hand und umarmt sich dann wieder in ihrer roten Etnies-Snowboardjacke selbst. Trotz der Kälte stehen sie, Bene und Andreas in Hauspatschen unter der Kastanie.
»Scheiß auf Gayschichte«, sagt Melli, als ich hingehe. Beim Sprechen kommen ihr Wölkchen aus dem Mund und sie hält ihr Hauswürstel zwischen Zeige- und Arschlochfinger, als wäre es eine Tschick. In der anderen Hand hat sie ein Vinschgerl. Melli hat immer die geilste Jause dabei, manchmal sogar eine Specksemmel vom Speckeck Egger.
Die Urlauber wollen immer nicht glauben, dass wir Einheimischen den Speck nicht zu dunklem Hausbrot essen, sondern lieber mit hellen Semmeln, aber was wissen die Touris schon. Wer eine Specksemmel vom Speckeck Egger hat, ist auf dem Schulhof der King.
Ich schäle mein Emmentalerbrot aus der Alufolie und knülle sie zu einem Ball, den ich gegen die Backsteinmauer werfe.
»Ja, scheiß drauf«, sag ich. »Der Gartenzwerg nervt.«
Ich nehme einen so großen Bissen, dass gleich die Hälfte vom Brot weg ist.
Bene reißt sein Twix auf: »Warum nennt ihr ihn eigentlich immer Gartenzwerg? Der Brandstätter ist doch groß.«
Melli beginnt zu grinsen, weil wir in der Crew ja ständig Witze darüber machen, was für ein Soletti der Bene selbst eigentlich ist.
Wenn sie nebeneinanderstehen, hat mein Bruder einmal gesagt, schauen Bene und Julia aus wie der Pinky und der Brain. Und dabei — an dieser Stelle hat Michael lachen müssen und mit dem Finger auf seinen Kopf gezeigt —, dabei, hat er weitergesprochen, ist es, was den Grips angeht, gerade umgekehrt.
Und er hatte mit beidem recht: Erstens bin ich wirklich einigermaßen unterzentimetrig unterwegs und zweitens ist der Bene ein echtes Brain. Aber obwohl er das Hirn vom Restmüll ist, gibt es mit ihm immer Konflikt. Er war zum Beispiel vorher auch schon in der Sprach- und der Sportklasse. Aber irgendwie, irgendwo, irgendwann haben sich die Burschen immer zusammengetan und den Bene verdroschen. Einen Konflikt gab es, hat der Brandstätter gesagt, und Bene im selben Jahr in unsere Klasse gebracht, als Melli von der alten Restmüllklasse rückwärtsgekommen ist.
»Ja, der Brandstätter ist vielleicht äußerlich ein Riese«, sag ich jetzt zu Bene und zeige auf meine Brust. »Aber hier drin ist er ein Gartenzwerg. Und darauf kommt es an.«
Ich schaue zu Tarek. Er ist zwar einer von uns, in den Pausen bekommen wir ihn aber trotzdem kaum zu sehen. Er lehnt dann immer neben irgendwelchen Tussis aus Parallelklassen, streicht sich die dunklen Haare zurück und flüstert ihnen etwas ins Ohr, dass sie kichern müssen; oder so wie heute, sogar so laut lachen, dass man es noch auf der anderen Seite des Hofes hört.
Obwohl Melli mit sechzehn eine der ältesten an der Schule ist, ist Tarek noch älter als sie. Er war zwar von Anfang an in unserer Klasse, aber vorher hat halt immer irgendwas nicht gepasst mit den Formularen und der Hin- und Herzieherei. Seit der Kebabladen von Tareks Eltern aber ein fixer Bestandteil der Taler Fußgängerzone geworden ist, ist Tarek selbst ein fixer Bestandteil vom Restmüll geworden.
Das letzte Crew-Mitglied in der Schule ist Andreas. Er motzt eigentlich immer wegen irgendetwas herum, und dass er im Gesicht fast kein Fleisch hat und deswegen ausschaut wie ein lebendiger Totenkopf, macht ihn auch nicht unbedingt sympathischer. Auch jetzt steht er mit zusammengebissenen Zähnen da, und man weiß nicht so genau, ob er uns überhaupt zuhört oder in Gedanken wieder mal in einer ganz anderen Welt unterwegs ist.
Zur Crew gehört Andreas vor allem, weil er der Bruder von Hannes ist und Hannes der beste Freund von meinem eigenen Bruder Michael. Unsere Brüder gehen ins Gymnasium, drüben, überm Fluss. Aber das ist was ganz anderes. Jedenfalls sind Tarek, Bene, Melli und Andreas die wichtigsten an der Schule. Auf den Rest scheiße ich. Ernsthaft, ich weiß von den meisten hier nicht einmal, wie sie heißen. Obwohl ich schon seit Jahren mit ihnen in die Klasse gehe, kenne ich zum Beispiel nicht einmal die richtigen Namen der drei Oberländerinnen, die gerade vorbeigehen und »Griaschte« zu mir sagen. Auf den ersten Blick sehen sie exakt gleich aus, wie Drillinge. Alle haben sie denselben Braunton in den Haaren und den Augen. Alle sprechen sie in einem Dialekt, den man nur die halbe Zeit versteht. Aber wenn man genau schaut, merkt man, dass eine etwas kleiner ist, eine etwas größer, und die dritte etwas hübscher als die beiden anderen. Deswegen sind die drei für mich die kleine, die große und die hübsche Oberländerin. So unterscheide ich die Leute, so komme ich zurecht. Wozu sich also Namen merken? Namen merken braucht nur Hirnbenzin, und man muss schließlich haushalten mit seinen Ressourcen.
Vor dem Hof fährt der Tal Milch-Transporter vorbei. Das Logo sind zwei weiße Bergspitzen vor einem blauen Hintergrund, dahinter geht die Sonne auf. Morgens bringt der Tal Milch-Lieferant immer zwei Paletten voller Mini-Tetrapaks in die Schule. Die Besseren haben ja ein Getränke-Abo. Da zahlt man bei Schulanfang vierhundert Schilling, und dann bekommt man jeden Tag zur Pause frische Fruchtmolke geliefert. Mango oder Maracuja. Wenn ich Durst habe, trinke ich am Restmüll-Waschbecken. Aber das macht nichts. In Österreich könnte ich ja sogar aus dem Klo trinken, und das Wasser wäre noch immer besser als das, was in Amerika aus der Leitung kommt.
»Gemma!«
Es hat geklingelt. Die Musiklehrerin hält das Glastor auf und scheucht uns ins Gebäude zurück.
»Willst?«
Melli hält mir ihre unberührte Jause hin. Ungläubig schaue ich das gute Vinschgerl an.
»Danke«, sag ich und nehme es.
Melli dreht sich um, rempelt wie beiläufig den Typen mit dem Schnurrbart aus der Sport an, läuft mit wehenden Haaren auf das Tor zu und dann, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, nach oben.
4
»Sehenswürdigkeit«, sagt die Deutsche.
Ich wünschte, ich hätte ein Rad. Dann müsste ich mich nicht in der Fußgängerzone von Touris anreden lassen.
»Äh«, überlege ich. »Sie können zum Museum gehen. Das ist am Berg droben.« Ich strecke die Hand aus und zeige in die Richtung.
»Was?«, ruft die Deutsche und lehnt sich zu mir.
Die Canon, die ihr an einem breiten Band vom Nacken baumelt, schlägt ihr zweimal gegen die Brust. Ihr Mann tupft sich mit einem Tempo-Taschentuch Schweißtropfen von der Stirn, weil er seinen Skianzug natürlich auch auf dem Marktplatz anhaben muss. Als ob einem in Österreich zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Piste oder eine Schlittenbahn unterkommen könnte; oder eine Langlaufloipe, auf der wir Einheimischen uns jodelnd zwischen Lebensmittelladen und Hausarzt hin- und herbewegen. Rundherum sind lauter Klone von den beiden. Pärchen und Familien mit Brillenkordeln um den Hals, damit es ihnen die Oakleys beim Carven nicht vom Gesicht schnalzt. Einige haben sogar noch ihre Skischuhe an und rumpeln damit von einem Souvenirgeschäft ins nächste.
Jetzt wissen sie wieder alle nicht, was sie tun sollen. Am ersten Tag machen sie Hüttengaudi, am zweiten gehen sie Ski fahren, am dritten haben sie dann Muskelkater und suchen nach Kultur.
»Wie bitte?«, sagt die Deutsche noch einmal besonders deutlich.
Sicherheitshalber schaue ich mich um. Man weiß ja nie, wer gerade vorbeikommen und mitkriegen könnte, wie man sich zum Deppen macht. Ich räuspere mich.
»Sie können zum Museum gehen. Das ist am Berg droben«, sag ich — diesmal auf Hochdeutsch. Ich verstehe ja nicht, warum mich die Frau, wenn sie so gut Deutsch kann, nicht versteht, wenn ich im Dialekt rede. Aber so sind sie halt, die Deutschen, deswegen mag sie ja keiner.
»Ach so.« Sie lacht. »Da waren wir schon. Wissen Sie vielleicht was anderes Nettes?«
Ich überlege. Ein bisschen bin ich irritiert, weil die »Sie« zu mir sagt.
»Ja«, sag ich, »im Sommer kann man Minigolf spielen. Macht Spaß.«
Ich gehe zur Unterführung, die keine ernstzunehmende Unterführung ist, sondern so eine unter einem Haus hindurch. Wenn man durch die Unterführung geht, geht man an den Senfter-Schaufenstern vorbei. Der Senfter ist das einzige Fotogeschäft in Tal. Die Mitarbeiter gehen auf den Abschlussbällen und Firmenfeiern mit Kameras herum und machen Fotos von den Leuten. Ein paar Tage später tun sie die mit Stecknadeln auf die Papptafeln im Schaufenster, und man kann sich Abzüge machen lassen. Einmal war ich zum Beispiel mit Melli auf dem HAK-Ball, und da haben sie ein Foto von uns gemacht. Ich habe mir für zehn Schilling einen Abzug davon gekauft und jetzt hängt er im Keller über meinem Bett. Heute hängen im Schaufenster lauter Leute, die ich nicht kenne. Im zweiten Fenster schaue ich mir ein bisschen die erotischen Fotos an. Ein Mann und eine Frau mit Tribal-Tattoos umarmen ihre nackten Oberkörper. Das Gesicht vom Mann und das Arschgeweih von der Frau schauen in die Kamera.
Mit geducktem Kopf gehe ich am Himmel vorbei. Neben dem Eingang der Dorfdisko verblasst seit Jahren ein Poster, auf dem in derselben fetten weißen Schrift Rock gegen Oben steht, in der die Würstelbude am Großparkplatz ein halbes Grillhendl für siebzig Schilling anpreist. Das Tal geht gern in den Himmel feiern. Es soll nett sein dort, sogar eine meterhohe falsche Palme steht wohl in der Mitte des Lokals. Im Himmel flattern aber auch immer Engel in Springerstiefeln durch die Gegend. Selbst jetzt, am helllichten Tag, stehen ein paar von ihnen vor dem Lokal. In ihrer Mitte lehnt ein Typ in Lederjacke, der mit seinen abstehenden roten Haaren eins zu eins aussieht wie Chucky — die Mörderpuppe. Chucky hebt den Blick und grinst auf eine Weise, dass es mich schüttelt.
Der Lidl ist im Winter der beste Ort in Tal. Wahrscheinlich der einzige Ort, an dem dann keine Touris herumwuseln. Die Touristen gehen nicht in den Lidl. Sie wollen im Urlaub aus Prinzip mehr Geld ausgeben, etwas gönnen wollen sie sich. Wintersport ist teuer genug, da kann man es nicht riskieren, sich das edle Bonzen-Gefühl durch eine eingeschweißte Bergsteigerwurst vom Discounter zu versauen. Man isst dann luftgetrockneten Speck, luftgetrocknetes Rindfleisch oder luftgetrocknetes Gemüse. Was genau man isst, ist im Grunde egal, solange es von einem österreichischen Bauernhof kommt, oder luftgetrocknet oder kaltgepresst ist.
Ich kaufe Nudeln, Faschiertes und Knoblauch. Heute kochen wir Spaghetti Bolognese. Es ist unsere Lieblingsspeise, wir pressen immer viel Knoblauch rein. Normalerweise soll da ja nur eine Zehe rein, laut Rezept, aber mein Bruder und ich nehmen eine ganze Knolle. Wir mögen das.
Auf dem Heimweg gehe ich wieder über den Marktplatz. Die Deutsche von vorhin redet gerade mit der Kellnerin vom Taler Hof, und wie ich vorbeigehe, höre ich sie Minigolf sagen. Als ich eine Tschick anzünde, kommen mir zwei Bullen entgegen. Kurz wollen meine Finger zittrig werden, aber das lasse ich nicht zu. Langsam gehe ich ihnen entgegen. Man vergisst das manchmal, dass die Menschen einem die eigenen Sünden nicht ansehen können. Die wissen nicht, dass ich fünfzehn bin, sag ich mir und nehme einen besonders tiefen Zug, die wissen das gar nicht. Ich warte, bis sie vorbei sind und überquere den Platz.
Der Il Gelato ist im Winter ein Teegeschäft. Dann interessiert sich keiner dafür, weil sich niemand für Tee interessiert. Aber im Sommer, da geht es vor dem Geschäft ab. Im Sommer ist der Il Gelato der Hotspot, und irgendwie, irgendwann werden alle Tourikinder von der riesigen Theke mit den vielen bunten Eissorten angezogen wie Motten vom Licht. An der Eingangstür sammeln sie sich dann als Tourikinderschwarm und wischen mit ihren verschwitzten Griffeln das Glas schmierig. Die meisten nehmen einen Schokoneger. Das ist die Spezialität vom Il Gelato. Der tunkt die Eiskugel, wenn man will, für zehn Schilling noch einmal in flüssige Schokolade, die aber sofort fest wird, weil das Eis ja so kalt ist. Trotzdem schmilzt es. Und wenn die Tourikinder nicht schnell genug sind, rinnt ihnen die Suppe nach wenigen Minuten schon über die braungebrannten Hände und sie beschweren sich bei ihren Eltern.
An der Senfter-Kreuzung hupt jemand.
»Scheiß Itaker! Sogar im Winter!«, höre ich einen wütenden Ausruf.
Zwei lachende Radfahrer in bunter Funktionskleidung rollen in die Fußgängerzone. Stimmt, denke ich und lasse die Tschick auf den Boden fallen.
Schlimmer als die Piefke sind nur noch die Itaker.
5
Die Katze schlägt den Kopf gegen das Küchenfenster. Sie stellt sich auf und schmiert ihre fleischigen Pfotenknödel über die Scheibe.
»Alter, was ist los?« Michael nimmt die Fernbedienung und dreht VIVA leiser. Er sitzt mit einer Hand in der Jogginghose da und stinkt bis in die Küche herüber nach Restalkohol.
»Die Katze«, sag ich.
Die Küche ist nur ein kleiner Verschlag am Wohnzimmer dran. Es gibt keine Tür, aber einen Tisch mit vier Stühlen. Ich nehme die Plastikschale mit dem faschierten Fleisch und steche das Messer in die straff darübergezogene Frischhaltefolie. Sofort breitet sich ein Geruch aus, der schlimmer ist als der Restalkgestank meines Bruders. Die Katze mit ihren Katzensuperkräften riecht das Fleisch durchs Fenster. Sie dreht jetzt völlig durch und schlägt den Kopf ein paar weitere Male gegen die Scheibe. Dort, wo sie mit der Nase angekommen ist, ziehen sich schon dünne Schleimspuren übers Glas.
»Ja, Mann!«, sag ich zur Katze, und mein Bruder dreht VIVA wieder lauter.
Die Katze ist vor ein paar Wochen aufgetaucht. Schön ist sie wirklich nicht. Es ist so ein Viech, wo man keinen zu fragen braucht, ob er es vermisst. Das Fell ist schwarz-weiß und auch in der Sonne bleibt es stumpf. Sie ist abgemagert und einer der Hinterfüße fehlt ihr. Vielleicht hat ein Hund ihr den Fuß abgebissen. Sie kommt sicher von einem der Bauernhöfe, die hier überall und besonders an den Rändern zu finden sind. Die meisten Bauernkatzen kommen aber so weit gar nicht. Es ist ja billiger, so ein paar Katzen in einen Sack reinzutun, da sieht man auch nicht, wer wer ist, als die Mutterkatze kastrieren zu lassen. Sagen einem alle Bauern. Wenn eine Katze tot ist, legt man sie mit der Mistgabel auf den Misthaufen.
Ich drehe mich zum Herd und mache das Sonnenblumenöl in den Topf. Obwohl die Flasche noch ziemlich voll ist, kann man sie eigentlich gar nicht in die Hand nehmen, ohne dass die dünnen Plastikwände unter den Fingern einknicken. Mit dem Gejammer der Katze im Nacken schäle ich eine große Zwiebel. Das Messer ist zu stumpf, aber ich habe im Late-Night-Shopping-TV einen Trick gesehen: Ich nehme einen der dreckigen Teller aus der Abwasch und ziehe die Klinge ein paarmal über den grauen Ring auf der Hinterseite. Danach geht das Schneiden leichter.
In der Schule haben wir einmal in der Woche Kochen. Dort hat die Lehrerin gesagt, dass man beim Schneiden die Finger abwinkeln soll, damit man sich nicht versehentlich die Kuppen absäbelt. Das ist wichtig, hat sie gesagt, weil einem Menschen ja nichts nachwächst, außer einmal die Zähne. Deswegen grabe ich jetzt die Nägel in die Zwiebel hinein. Am Anfang schneide ich noch feine Stücke, aber wie ich merke, dass ich schon langsam weinen muss, hacke ich nur noch ein paarmal auf dem Plastikbrett herum. Mittlerweile raucht das Öl. Als ich die Zwiebeln hineintue, spuckt es mir Tröpfchen auf die Unterarme.
»Aua«, murmle ich beleidigt.
»Was?«, schreit Michael über das Gedudel vom Fernseher herüber.
»Nix«, sag ich und fülle einen Topf mit Wasser.
Dann gehe ich ins Wohnzimmer. Auf dem Diwan unter dem Fenster kann man nicht sitzen, und auf der Couch hat sich mein Bruder breitgemacht. Er ist mit seinen Arschbacken in die Kuhlen geschmolzen, die diese sich mühselig über Jahre ins Futter gedrückt haben. Ich lasse mich neben ihm auf die Armlehne sinken. Auf dem Bildschirm wollen drei Typen mit Sonnenbrillen unbedingt wissen, wer zum Teufel ihre Hunde rausgelassen hat. Das Video endet und jetzt kommt ein Song von OutKast. Mein Bruder und ich beginnen sofort zu nicken. Man wartet ja den ganzen Tag, dass gute Musik kommt. Da muss man dann bereit sein. Aus der Küche zischen die Zwiebeln, aber ich höre nicht hin. Sie zischen noch lauter.
»Julia«, sagt mein Bruder genervt.
»Ja«, sag ich zurückgenervt und gehe in die Küche.
Die Zwiebeln sind jetzt unten schwarz und oben roh. Egal. Ich nehme das Fleisch aus der Plastikschale. Unten klebt ihm noch sein vollgeblutetes Always Ultra. Ich tue es herunter und lasse den Fleischblock ins Öl platschen. Dieses Mal bin ich vorbereitet und trete einen Schritt zurück, bevor die Terrortropfen mich erwischen können. Aus der Tasse, in der das Besteck steht, nehme ich mir einen Löffel zum Umrühren. Bevor ich anfange, überlege ich es mir anders und kletzle noch einmal ein bisschen Faschiertes vom Fleischblock. In den Handflächen forme ich einen rosanen Ball und gehe damit zum Küchenfenster, wo die Katze noch immer randaliert. Ich öffne es einen kleinen Spalt und haue den Fleischball in den Hof. Die Katze humpelt ihm hinterher.
»Da Quasimodo«, sag ich und drehe den Griff wieder herum.
Zwanzig Minuten später sitzen Michael und ich vor dem Fernseher und essen Spaghetti Bolognese. Auf dem Couchtisch steht eine dritte Portion bereit.
»Alien Ant Farm — Smooth Criminal«, ruft mein Bruder. Er hat recht. Ich warte auf das nächste Bild. VIVA spielt einmal in der Stunde für ein paar Sekunden die Top-40-Hits oder aber Videos zu einem bestimmten Thema an. Man sieht dann unter dem aktuell laufenden Song kleine Ausschnitte der nachfolgenden Musikvideos in der Warteschleife. Michael und ich haben es uns zu einem Wettkampf gemacht, wer mehr Lieder anhand der kleinen Vorschauen erkennt. Mein Bruder ist mir heute schon um zwei voraus. »Enya«, rufe ich, »Only time.«
Aus der Küche hört man ein Klatschen. Wir lachen. Um zu testen, ob die Nudeln al dente sind, werfen wir immer eine Probespaghetti an die Decke. Wenn sie kleben bleibt, kann man essen. Drinnen ist grade die heutige Nudel auf den Boden gefallen. Manche bleiben aber auch hängen und runzeln sich über die Wochen zusammen wie vertrocknete Regenwürmer.
6
In der Schule gibt es drei Leistungsgruppen. Während der Nebenfächer hockt man zusammen in der Restmüllklasse, aber für die Hauptfächer muss man wandern. Für die Besseren wird der Unterricht in den oberen Stockwerken abgehalten. Die Räume schauen dort in Richtung Süden und die Sonne scheint einem den ganzen Tag lang ins Gesicht. Da bekommen die besonders Tüchtigen schon einmal einen Vorgeschmack auf ihr späteres Leben. Mit den sinkenden Leistungsgruppen geht es dann Stock für Stock abwärts. Andreas und ich müssen in unseren Hausschuhen manchmal sogar bis ganz hinunter in die Kellerräume schlurfen, wo es nach feuchter Wäsche riecht und man durch die Wände Geräusche aus den Schülerküchen hört.
Aber in Englisch ist alles anders. In Englisch bin ich sozusagen ein Superhirn. Gemeinsam mit Bene betrete ich jetzt das Klassenzimmer unterm Dach, in dem der Englischunterricht der ersten Leistungsgruppe abgehalten wird. Die Klasse ist gleichzeitig so etwas wie das Wohnzimmer der Direktorin. Hier steckt hinter dem Kasten, in dem das Radio und der Videorekorder eingesperrt sind, eine englische Flagge. An der Wand hängen zerronnene Wasserfarbengemälde von Rosensträußen, und neben dem Platz, an dem Bene und ich immer sitzen, gibt es ein Bild von einer roten Katze, die angezogen ist wie ein Kriegsgeneral und unter dem Arm klemmt ihr ein metallener Helm mit einem Dorn am Scheitel.
Direktorin Schanovsky ist ungefähr so alt wie eine Mumie aus der Römerausgrabungsstätte, sie trägt Kostüme in Zuckerlfarben und ist ein Fan von der Queen, in England drüben. Wenn die Direktorin Englisch redet, klingt sie, als wäre sie verkühlt, und zu Weihnachten bringt sie Kekse mit, die Shortbread heißen.
Schriftliche Prüfungen gibt es bei der Schanovsky nicht. Hauptsache, wir bemühen uns, sagt sie immer. Wenn man ehrlich ist, ist unsere einzige Leistung, dass wir ihr Geschichten auf Englisch erzählen. Die Leute unten lernen jeden Tag Vokabeln und bekommen von den Lehrern trotzdem noch zu hören, dass sie für die erste Leistungsgruppe nicht gut genug sind. Und in Wirklichkeit fressen wir unterm Dach einfach nur Schanovskys Butterkekse. Aber das dürfen die anderen nicht erfahren, da sind wir heroben uns alle einig.
»God Save the Tal«, sagt Schanovsky, als sie eintritt.
Wir stehen auf und begrüßen sie mit einem »Goodmorning, Ma’am«.
Benes und meine Stuhllehne knallen gegen die Hinterwand. Wir setzen uns in Englisch immer in die letzte Reihe. Das ist wichtig für meinen Auftritt.
Als erstes ruft Schanovsky einen bulligen Typen aus der Sport auf.
»My friend and I play tennis in Tal. I am a fan from Anna Kournikowa«, sagt er und die anderen Sport-Typen kichern.
Bene bläst neben mir Luft durch die Nase.
Die Direktorin hört dem Sportler ein bisschen zu, schickt ihn dann auf seinen Platz zurück und lässt den Blick über die Reihen gleiten.
»Anybody else?«
Ich melde mich nie von selbst. Und die Schanovsky versucht erst mal immer, den anderen auch eine Chance zu geben. Nur ist das, was die erzählen, meistens so langweilig oder anstrengend, dass die Schanovsky Sehnsucht nach einer Mexalen bekommt. In solchen Momenten sucht sie meinen Blick und sagt: »Tell us a story, Julia.«
Und dann kommt mein Auftritt. Ich lasse mir dabei jeweils Zeit beim Aufstehen und setze ganz langsam die Kapuze auf. Dann gehe ich in Zeitlupe vor, damit im ganzen Publikum die Spannung steigt. Vorne angekommen beginne ich dann sofort zu rappen. Ich rappe etwas von M. O. P. oder N. W. A — ganz egal. Denn alles, was aus meinem Mund herauskommt, ist sowieso um Welten besser als das, was die faden Taler Kinder der Schanovsky erzählen könnten.
Manchmal, wenn ich mich besonders ins Zeug lege oder in den Text hineinsteigere, lachen die anderen. Sie schauen mich an und flüstern sich etwas zu. Aber denen bläst Bene durch einen ausgehöhlten Fineliner eine feuchte Papierkugel an die Wange. Oder er steht auf und boxt ihnen in den Oberarm. Das Armgeboxe befürwortet die Schanovsky nicht, aber sie ist trotzdem auf meiner Seite. Das weiß ich, seit mir in der dritten Klasse einmal so eine Ratte aus der Italienischklasse eins reindrücken wollte. Frau Direktorin, hat er gesagt, die Julia hat sich diese Geschichten ja gar nicht selber überlegt, die plappert nur die Lieder nach, die sie im MTV hört.
Aber die Ratte hat nicht mit der Reaktion der Direktorin gerechnet. Wenn die Kinder im Deutschunterricht einen Einser für das Nachplappern vom Erlkönig kriegen, hat die Schanovsky nämlich gemeint, dann kann genauso gut die Hofer Julia einen Einser für das Nachplappern von Murder Was the Case bekommen.
Heute ist nicht so ein Tag übrigens, wo ich einen Auftritt habe. Vorne steht mittlerweile die große Oberländerin.
»… and my favourite Joker at the Millionenshow is the telephone joker«, sagt sie. »But you must not forget to tell your telephone joker to be at home. Because if they are not, it is very bad.«
Bene gähnt. Und als es zur Pause klingelt, zwinkert Schanovsky ihm und mir zu und wünscht uns viel Spaß gleich, was wir beide komisch finden.
7
Der Brandstätter führt etwas im Schilde. Als er hereinkommt und die Tür hinter sich schließt, sind seine Wangen rot, die Augen glitzern verdächtig. Unter dem Arm klemmt ihm ein hellgrüner Graceland-Schuhkarton.
»Klasse«, sagt er. »Es gibt fabelhafte Neuigkeiten.«
Er stellt den Karton auf das Pult und klatscht in die Hände. »Ich hab einen ganz besonderen Einfall gehabt, für euch, für uns. Eine bahnbrechende Idee für unseren gemeinsamen Unterricht. Und das Beste ist: Die Direktion hat das Ganze sogar schon autorisiert.«
Die zwinkernde Schanovsky in ihrem Dachboden-Palace fällt mir wieder ein.
»Was hat der Trottel jetzt wieder vor?«, sag ich.
»Pscht«, macht Nadja neben mir und verschränkt die Arme.
»Hier«, sagt Brandstätter — mit der flachen Hand tätschelt er feierlich die autorisierte Schachtel —, »ist die Zukunft eurer Noten drinnen, die Zukunft Europas. Eigentlich sogar die Zukunft der ganzen Welt.« Er kann nicht anders und muss noch einmal klatschen, weil die Freude rausmuss. Aber die Klasse interessiert es nicht, hinten wuselt es.
»Melanie!«, ruft Brandstätter und drückt seinen eigenen Handrücken, als stellte er sich vor, es wäre Mellis Hals. »Aufpassen jetzt.«
Melli nimmt den Ellenbogen von Tareks und Benes Tisch in der letzten Mittelreihe, wirft die Haare zurück und dreht sich vor.
»Ich hab eh aufgepasst«, sagt sie. »Im Deichmann ist die Zukunft von Europa drinnen.«
Es lacht und wuselt wieder.
»Sehr amüsant«, sagt Brandstätter. »Und jetzt hört’s einmal zu. Das ist nämlich ein einmaliger Versuch, den ich mit euch vorhab. Ein Experiment sozusagen. Ein so lässiges Experiment hat es im Tal noch nie gegeben. Im ganzen Land noch nicht! Und wenn ihr gescheit mittut …«, jetzt grinst der Brandstätter richtig, »wenn ihr gescheit mittut, müsst ihr nie wieder einen Geschichtstest schreiben. Ja, ihr habt richtig gehört: Keinen Test, keine Prüfung — und ihr bekommt alle einen Einser.«
Ich finde, der Brandstätter klingt jetzt ein bisschen wie die alte Zeugin, die den ganzen Tag mit ihrem hässlichen Pudelhund im Park herumgeht und einem erzählt, dass der Jahve sich um alles kümmern wird und das Paradies auch noch kommt. Das Paradies glaube ich der Zeugin nicht, und dem Brandstätter erst recht nicht. Immerhin halten wir aber jetzt den Mund und hören uns an, was der Gartenzwerg zu sagen hat.
Der nimmt den Deckel von der Schuhschachtel, taucht die Hand hinein und lässt dann viele kleine Papierschnipsel zurück in die Kiste segeln.
Nadja hebt neben mir einen einzelnen Finger. Wir anderen zeigen mit dem Peace-Zeichen auf, die Streberin glaubt, den Mittelfinger nicht nötig zu haben: »Ist das eine Tombola, Herr Professor?«
»Fast — nur viel besser«, sagt der Brandstätter mit Schafsblick.
»Hier drinnen, Kinder«, sagt er und schaut uns einem nach dem anderen ins Gesicht, »sind die Namen der großen Akteure unserer Zeit. Die Namen der bedeutendsten Akteure in Politik und Kultur.«
Überall schnellen Hände mit dem Peace-Zeichen hoch.
Die schöne Oberländerin sagt: »Was ist ein Akteur?«, und die übrigen sinken wieder nach unten.
»Eine gute Frage, Theresa«, sagt Brandstätter und beginnt lächelnd zwischen den Pulten umherzuspazieren. »Das ist ein wichtiger Mensch. Eine Persönlichkeit, die was zu sagen hat, die was gestaltet. Und jeder von euch zieht jetzt gleich so einen Namen. Und dann werdet ihr für den Rest des Schuljahres im Geschichtsunterricht selbst zu diesem Akteur. Wie ein Schauspieler, der eine Rolle spielt, versteht ihr?«
Der Brandstätter schaut den Restmüll an und der Restmüll den Brandstätter. Draußen fährt ein Auto vorbei.
»Fuck!«, schreit die Schlange, und die Klasse samt Klassenvorstand zuckt zusammen. Ihr Handy macht das Snake-Verlierer-Geräusch. Andreas, der in der Türreihe direkt hinter ihr sitzt, schaut drein, als wollte er sie erschlagen.
Die Schlange hat ihren Namen übrigens nicht, weil sie ein schlechter Mensch wäre. Sie ist einfach ein 3210-Opfer, ihr ganzes Leben richtet sich nach der kleinen Schlange auf dem grünen Nokia-Display. Im Flur rempelt sie die Leute an, weil sie beim Gehen auf ihr Telefon starrt, und mindestens einmal am Tag wird sie von den Lehrern ermahnt, weil sie das Snake-Spielen nicht einmal im Unterricht bleiben lassen kann. Dass es mittlerweile schon ein 3310er gibt, ist der Schlange egal. Ihr Lebensziel, hat sie einmal verkündet, ist der Snake-Perfect-Score von 2008 Punkten. Wenn auf dem Handybildschirm nichts mehr zu sehen ist als die Schlange selbst, also alles schwarz, und sie als letzten Akt sich selbst frisst, dann erst ist das Spiel wirklich gewonnen und die Schlange frei.
»Mein Gott, ihr seid’s einfach unmöglich«, regt Brandstätter sich auf. Mit Riesenschritten geht er zur Schlange und nimmt ihr das Handy weg. Die schaut weiterhin auf ihre Handfläche, dort, wo eben noch das Nokia gelegen hat, hebt dann träge den Kopf und sagt: »Heyy…«
»Könnt’s ihr jetzt bitte einmal mittun? Ist das zu viel verlangt?«, ruft unser Klassenvorstand. Fast klingt er ein bisschen verzweifelt. »Jetzt hört’s halt einmal zu. Wir haben hier die Chance, miteinander Geschichte zu schreiben, versteht ihr? Geschichte!«
In der nachfolgenden Stille hört man die Schlange angestrengt mit den Armen nach ihrem Handy rudern. Brandstätter schüttelt den Kopf und gibt es ihr zurück.
Für einen Moment schließt er die Augen, dann setzt er ein Lächeln auf, das so falsch ist wie der angeblich Selbstgebrannte, den die Touriguides den Urlaubern nach ihren Wanderausflügen und Rafting-Touren andrehen.
Brandstätter marschiert vor die Tafel und dreht sich zur Klasse.
»Also«, sagt er und atmet tief durch, »versuchen wir es noch einmal: Am Anfang jeder Geschichtsstunde gibt es ab sofort ein Akteurs-Referat. Während des Semesters kommt jeder einmal dran.«
Er macht einen Schritt auf unser Pult in der ersten Mittelreihe zu und zeigt mit der Hand auf mich. »Also Klasse! Wie viel Referate muss zum Beispiel die Julia halten?«
»Nadja?«, sagt er, weil diese aufgezeigt hat.
»Nur ein einziges Referat muss die Julia halten«, sagt sie.
»Super, Nadja«, sagt der Brandstätter. »Und danach diskutieren wir. Entweder über das eben Gehörte oder aber über ein Thema, das tagespolitisch gerade aktuell ist. Da kann man ja flexibel sein, aber«, jetzt wackelt der Brandstätter mit dem Zeigefinger, »jeder in seiner Rolle. Deswegen ist es ab sofort wichtig für euch, die Augen offen zu halten. Ihr merkt euch bitte, welchen Akteur ihr verkörpert, und dann schaut ihr, wo euch der begegnet. Im Fernsehen zum Beispiel, oder in der Zeitung. Oder im Internet! Ihr schaut euch an, was euer Akteur so macht, was der so sagt. Und in der Stunde verhaltet ihr euch dann, wie er sich verhalten würde. Ihr vertretet seine Po—si—tion.«
Die Deutsche in der Latzhose muss ein bisschen kichern, weil der Brandstätter »Po« gesagt hat. Er tut, als würde er es nicht mitbekommen, und spricht etwas lauter weiter.
»Das nennen wir eine kleinschrittige Erarbeitung, versteht’s ihr? Wir erarbeiten uns gemeinsam die Welt der Politik und Kultur. Ein Paradigmenwechsel ist das, was das Lernen betrifft. Das Ende des Frontalunterrichts. Wisst ihr, wie super das ist? Ihr unterrichtet euch gewissermaßen selbst.«
Er schaut uns erwartungsvoll an: »Das ist von jetzt an eure Aufgabe in der Geschichtsstunde: Input«, Brandstätter legt die linke Hand über die rechte Faust, »und Output.« Jetzt breitet er die Arme aus.
»Besonders aufregend wird das Ganze natürlich«, spricht er gut gelaunt weiter, »wenn ihr nicht überall gleich eure Rollen herumposaunt« — die Deutsche muss wieder lachen —, »weil, wenn ihr gut recherchiert und euren Akteur glaubhaft spielt«, sagt der Brandstätter, »wird man alleine anhand des Disputs erkennen, wen ihr darstellt! Also: Pssst.«
Er hält sich einen Finger vor die Lippen, und Nadja neben mir tut es ihm gleich. Langsam schüttle ich den Kopf. Eigentlich gehören sie beide verdroschen.
»Gibt es jemanden, der das noch immer nicht verstanden hat?«, fragt unser Klassenlehrer.
In der Klasse bleibt es — abgesehen vom monotonen Klicken der 3210-Tastatur aus der Türreihe — still. Natürlich bleibt es still. Würden die Lehrer so eine Frage ernst meinen, würden sie umgekehrt fragen: nämlich ob es eigentlich überhaupt irgendjemand begriffen hat.
»Super«, antwortet er sich jetzt selbst.
»Ja, Katja?«
Die Latzhosen-Deutsche in der Fensterreihe hat die Hand gehoben.
»Und wer sind Sie? In diesem ›Experiment‹?«
»Ich bin der Herr Brandstätter«, sagt der Brandstätter, »und ich bleibe der Herr Brandstätter.«
Er nimmt den Schuhkarton und hält ihn ihr unter die Nase. Dann geht er langsam durch die Reihen und lässt alle einen Zettel ziehen. Bene zieht, liest und beugt sich zu Tarek, um zu schauen, wen er bekommen hat.
»Ist das nicht super?«, sagt Brandstätter und hält mir als letztes die Schachtel hin.
»Nein«, sag ich und nehme mir einen Zettel.
Brandstätter verdreht die Augen. Dann schüttelt er zufrieden den Karton, dass man drinnen die übriggebliebenen Zettel herumfliegen hört.
»So«, sagt er. »Wie gesagt: Wenn ihr brav mitmacht, gilt das als Ersatzleistung für alle Prüfungen. Also strengt euch an. Und nicht vergessen«, Brandstätter beendet den Satz, indem er die Lippen spitzt und sich wieder den Zeigefinger davorlegt.
»Ja, Julia?«, sagt er dann und nickt in meine Richtung, weil ich das Peace-Zeichen gemacht habe.
»Was«, sag ich und knülle mein Papier in der Faust zusammen, »ist ein UNO?«
8
Es ist Wochenende und wir gehen shoppen. Ich patrouilliere mit der Tschick im Anschlag, während Melli hinter mir eine Zeitung aus der durchsichtigen Plastikhandtasche der Straßenlaterne fischt.
Ich schaue zur anderen Straßenseite, schaue auf den verblassenden Smoke weet everyday-Schriftzug auf dem Gehsteig vor dem Lackner-Haus, den wir dort letztes Jahr hingemacht haben. Es ist unser einziges Tag, das wir je bereut haben. Bene hat uns dafür ausgelacht, er war bei der Aktion ja nicht dabei.
Weed, ihr Idioten, hat er gesagt, Weed mit d, nicht mit t.
Wir haben uns überlegt, es auszubessern, aber das kann man nicht. Man kann nicht einfach mit der Spraydose hingehen zu einem alten Tag und bei der Rechtschreibung nachhelfen. Das wäre peinlich.
Die arme Lackner, haben die Leute auf der Straße gesagt, wegen des Schriftzuges vor ihrem Haus. Aber die Leute kennen die Lackner nicht.
Am Anfang haben wir noch ganz normal Grüß Gott zu ihr gesagt. Wir sind vorbeigegangen und haben den Lackner-Schädel mit den violetten Zuckerwattehaaren in ihrem Garten über dem Gemüsebeet schweben sehen. Grüß Gott, haben wir gesagt, und die Lackner hat nie geantwortet. Aber geschaut hat sie. Aufgerichtet hat sich die Alte, die Hand mit der erdigen Harke in die Hüfte gestemmt und geschaut. Und das war eben am Anfang. Letztes Jahr im Herbst ist das Ganze dann gekippt.
Es war eher so ein unsympathischer Herbst, wo die Blätter sich in Matsch verwandeln, bevor sie überhaupt orange werden können, und die Nebelschwaden das Tal von oben versiegeln wie so ein Tupperware-Verschluss. Aber obwohl das Wetter herumgehurt hat wie sonst was, waren es gute Tage, weil nämlich Taler Messe-Woche war. Und die Taler Messe ist schon eine super Sache, da ist richtig was los. Sogar wenn man kein Geld hat, um mit dem Autodrom zu fahren. Sogar wenn man sich die Zuckerwatte nicht leisten kann und den Türkischen Honig nicht. Es gibt riesige Zelte und überall stehen Buden mit bunten Lichtern und düdeln dahin. Und nach und nach füllt sich das Tal mit besonderen Gerüchen wie von gegrilltem Mais, Kinderponyreitbahnholzspähnen und erbrochenen Karamellapfelresten.
Tarek hat ja das Talent, dass er sich so richtig benehmen kann. Das kommt der ganzen Crew zugute. In der Schule macht er, was die Lehrer ihm sagen. Und wenn Verwandte zu ihm heimkommen, verbeugt er sich und gibt ihnen einen Kuss auf die Hand. Danach legt er sich ihre Hände an die Stirn und seine Verwandten segnen ihn. Deswegen bekommt er oft Geld geschenkt.
Im echten Leben, das sagen wir seinen Eltern aber nicht, ist Tarek eine richtige Sau. Es gibt echt keinen, und die Typen wissen das genau, die Typen zählen da mit, der schon so viele Weiber aus der Gegend hergenommen hat wie Tarek. Letzten Monat hat er bei einem Schützenfest zum Beispiel sogar eine Studentin aus Hinterfeld gefingert, die weit über zwanzig war.
Jedenfalls, weil Tarek zum richtigen Zeitpunkt das Maul halten kann, ist er reich und unser Crew-Hauptsponsor. Er sponsert vor allem meinen Bruder und mich, und neuerdings auch immer öfter Hannes und Andreas. Wir sind Tarek dankbar, wegen ihm können wir eben doch hin und wieder Autodrom fahren oder gebrannte Mandeln essen. So etwas ist dann schon ein glücklicher Tag, das muss man sagen. Und dann kommt eine Lackner und macht es kaputt.
Wir waren auf dem Heimweg von der Messe damals, die komplette Crew. Und als wir am Haus der Lackner vorbei sind, hat Michael eine Zigarette weggeschnippt. Nicht einmal in ihren Garten hinein, einfach auf die Straße. Und da hat sie es zum ersten Mal gesagt. Leise, dass nur ich es hören konnte: Klumpert.
Ich habe nichts gesagt. Ich wollte nicht, dass Michael auszuckt, oder schlimmer: Tarek. Er hätte der Lackner zwar nichts getan, Tarek hat ein großes Herz. Aber weil er ein Tschusch ist, muss er aufpassen. Weil er ein Tschusch ist und volljährig, muss der Tarek ganz gewaltig aufpassen. Deswegen habe ich an dem Tag so getan, als hätte ich nichts gehört, aber der Vorfall hat mir die Taler Messe im Herzen kaputtgemacht.
Und in der Woche drauf hat die Lackner es wieder getan. Nur Melli und ich sind diesmal vorbeigegangen. Jede von uns einen Stöpsel im Ohr und Melli das Miniradio in der Hand: FM4 auf Anschlag. Irgendein Nachbar ist an ihrem Gartenzaun gelehnt, und da hat sie es wieder gesagt. Ganz deutlich diesmal: Klumpert.
Ey, hab ich gerufen und mich umgedreht. So schnell, dass es Melli den Stöpsel aus dem Ohr gerissen hat. Der Nachbar hat geschaut und die Lackner hat geschaut, hat mich von oben bis unten gemustert, als ob ich etwas Dreckiges wäre. Als ob ich so ein Kuscheltier wäre, das ein Kleinkind den ganzen Nachmittag durch den Sandkasten gezogen und dann abgeschleckt hat.
Danach habe ich nichts mehr gesagt, aber seitdem hat die Lackner keinen schönen Garten mehr. Seitdem gibt es auf dem Gehsteig vor ihrem Haus ein Tag und die Blumen entlang des Weges wollen nicht mehr wachsen. Die Leute lassen die Hunde an den Zaun urinieren, habe ich die Lackner zu jemandem sagen hören. Und der Blumenkasten vor der Haustür fällt dauernd um.
Ich starre auf den verblassenden Smoke weet everyday





























