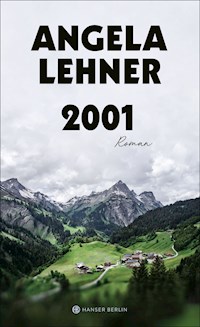Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Polizei hat sie hergebracht, in die psychiatrische Abteilung des alten Wiener Spitals. Nun erzählt sie dem Chefpsychiater Doktor Korb, warum es so kommen musste. Sie spricht vom Aufwachsen in der erzkatholischen Kärntner Dorfidylle. Vom Zusammenleben mit den Eltern und ihrem jüngeren Bruder Bernhard, den sie unbedingt retten will. Auf den Vater allerdings ist sie nicht gut zu sprechen. Töten will sie ihn am liebsten. Das behauptet sie zumindest. Denn manchmal ist die Frage nach Wahrheit oder Lüge selbst für den Leser nicht zu unterscheiden. In ihrem fulminanten Debüt lässt Angela Lehner eine Geistesgestörte auftreten, wie es sie noch nicht gegeben hat: hochkomisch, besserwisserisch und zutiefst manipulativ.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Die Polizei hat sie hergebracht, in die psychiatrische Abteilung des alten Wiener Spitals. Nun erzählt sie dem Chefpsychiater Doktor Korb, warum es so kommen musste. Sie spricht vom Aufwachsen in der erzkatholischen Kärntner Dorfidylle. Vom Zusammenleben mit den Eltern und ihrem jüngeren Bruder Bernhard, den sie unbedingt retten will. Auf den Vater allerdings ist sie nicht gut zu sprechen. Töten will sie ihn am liebsten. Das behauptet sie zumindest. Denn manchmal ist die Frage nach Wahrheit oder Lüge selbst für den Leser nicht zu unterscheiden. In ihrem fulminanten Debüt lässt Angela Lehner eine Geistesgestörte auftreten, wie es sie noch nicht gegeben hat: hochkomisch, besserwisserisch und zutiefst manipulativ.
Angela Lehner
Vater unser
Roman
Hanser Berlin
Vor allem aber gabst du den Menschen die Treue
daß sie ihren Weg fanden
und nicht einander verloren.
Wenn aber einer wegging
so folgten ihm die Tränen und erreichten ihn
und segneten ihn.
Und sein Irrweg war eine Heimkehr
Christoph Zanon, Schattenkampf
Teil 1
Der Vater
Fahrt
Man hat mir die Hände auf dem Rücken verbunden. Ich lehne mit dem Kopf an einer blickdichten Scheibe. Obwohl niemand raucht, erzählen mir die Sitzpolster von vergangenen Nikotingenüssen. Vor mir ist ein Gitter. Und davor sitzt eine Beamtin, deren Pferdeschwanz im Fahrtwind tänzelt.
Die Klimaanlage ist aus. Ich bin überrascht. Hätte ich die österreichische Polizei einschätzen müssen, hätte ich gesagt, dass die die Klima einschalten und gleichzeitig das Fenster runterkurbeln würden. Aber nein. Haben sie gar nicht gemacht. Ganz vernünftig sind die.
»Entschuldigung«, sag ich, »ich hätt gern etwas zu trinken.«
Keine Reaktion. Das ist mir unangenehm. Ich warte eine halbe Stunde und versuche es noch einmal.
»Verzeihung«, sag ich, »Durst.«
»An Durst hat’s«, vernehme ich eine Stimme aus der Fahrerkabine.
»Ah, iatz hat’s an Durst?«, sagt eine andere.
»Richtig«, sag ich, »einen Durst hab ich.«
Die Polizisten bemurmeln sich untereinander. Von vorne höre ich ein »In Ordnung«. In Ordnung, denke ich mir, ist doch ganz in Ordnung diese Polizei. Was haben denn immer alle?
Fünf Minuten später halten wir vor einer Esso-Tankstelle. Die Polizisten beraten sich via Funk mit der Zentrale, dann steigt die pferdeschwänzige Beamtin aus und öffnet mir die Tür. Sie hat ein aufgemaltes Gesicht und bunte Nägel. Im Geiste nenne ich sie Maria. Neben Maria erscheint die andere Stimme aus der Fahrerkabine. Der Beamte ist klein und bullig wie ein Eierbecher.
Der Eierbecher geht jetzt in die Tankstelle. Erst als er über das Walkie-Talkie das Okay gibt, setzen wir anderen uns in Bewegung. Gut organisiert, diese Polizei, muss man schon sagen.
Die Polizistin gräbt mir ihr Nageldesign so tief in den Oberarm, dass ich fürchte, die kleinen Plastikglitzersteine könnten ihren Weg in meinen Organismus finden. Sie verbietet mir das Sprechen und bringt mich in eine Toilette. In der Kabine zieht sie mir die Hose runter und setzt mich auf die Kloschüssel. Ich krümme meine Hände zu Fäusten, damit die Finger den Toilettensitz nicht berühren, und versuche, nicht an Feuchtgebiete zu denken.
»Entschuldigung«, sag ich von unten zu ihr, »Durst hab ich.«
Sie ist überrascht, erinnert sich dann: »Ah, an Durst!«
Sie stellt mich wieder auf und zieht mir die Hose nach oben.
»Danke«, sag ich. Und als ich den Ansatz eines goldenen Kettchens an ihrem Schlüsselbein erkenne: »Vergelt’s Gott.«
Ich werde in den Verkaufsraum der Tankstelle gebracht. Keine anderen Gäste. Die Verkäuferin zieht den Kopf in ihren grauen Pullover zurück wie eine Schildkröte. Maria hält mir eine Mineralwasserflasche ins Gesicht. Ich lehne mich vor und trinke aus einem roten Strohhalm.
»Ist Ihnen nicht heiß?«, frage ich die Verkäuferin nach einer Weile.
Sie schüttelt den Kopf und deutet auf einen Tischventilator neben der Kasse. Ich nicke und schaue mich um. Mein Blick trifft auf einen kleinen Altar, der auf einer leeren Villacher Bier-Kiste eingerichtet ist. Auf einem handbestickten Tischtuch liegt ein Rosenkranz neben einem gerahmten Porträtfoto von Jörg Haider. Darüber hängt ein kleiner Jesus auf einem Kreuz herum.
»Mein Gott«, sag ich, »sind wir in Kärnten?«
Die Verkäuferin nickt. Ich leere die Flasche in drei Zügen.
Vier Stunden später biegen wir in die Hütteldorfer Straße ein und jemand fängt zu summen an. Der Himmel wird schon kitschig, als das riesige, vergitterte Gelände vor uns auftaucht. Der Eierbecher steigt aus und streckt den Rücken durch. Formulare werden ausgefüllt, und ich lasse den Blick über Wien schweifen. Sommerabende versöhnen mich immer mit dem Leben.
Neue Menschen in neuen Uniformen übernehmen und ich nicke meinen Polizisten ein letztes Mal zu. Ein Mann führt mich über das Gelände. Unsere Schritte knirschen auf Kieselsteinen. Meine Beinmuskulatur ist die Steigung nicht gewohnt, und ich merke, wie ich mich bemühen muss, mitzuhalten. Unsere Schuhspitzen werden mit jedem Schritt staubiger. Ich denke gerade, dass sich der Sommer aus der Erde holt, was er braucht, da biegen wir in einen asphaltierten Weg ein. Ein paar Meter geradeaus. Dann bleiben wir vor einem weißen Haustor stehen. Über dem Eingang lese ich die Nummer Fünfzehn. Der Pfleger beginnt, an einem großen Schlüsselbund herumzunesteln.
Ich schaue mich auf dem Anstaltsgelände um — nur ein wenig, ich will noch nicht alles sehen — und entdecke zehn Meter entfernt ein Grüppchen joggingbehoster Menschen im Gemüsebeet. Eine Frau mit breiten Schultern redet auf ein paar von ihnen ein, während andere die Ernte auf ein am Boden ausgebreitetes Tuch legen.
»Das ist aber pädagogisch wertvoll hier«, sag ich zu meinem Wächter.
»Is scho recht«, sagt er.
Das sagt er wahrscheinlich öfter. Mir steigt ein vertrauter süßlicher Duft in die Nase. Ich höre Unmutsrufe und drehe mich wieder zum Beet. Ein etwa zwanzigjähriges Mädchen mit abstehenden Ohren stampft die säuberlich auf Tüchern ausgelegte Tomatenernte der Reihe nach mit dem Fuß platt. Sie schreit und legt sich die verbundenen Handgelenke an den Kopf, auf dessen Spitze ein brauner Haarknoten sitzt. Die Pflegerin stoppt das Tomatenmädchen, redet aufgebracht auf es ein. Da nähert sich den beiden eine weitere Gestalt. Sie hebt ihren dünnen Arm und legt die Hand auf die Schulter des Mädchens. Sie senkt den Kopf und flüstert ihm etwas zu. Es hört zu schreien auf. Da hebt die Gestalt ihren Blick und trifft auf den meinen. Sie erstarrt. Der Pfleger schiebt mich durch das mittlerweile offene Tor. Unsere Schritte hallen von den Wänden.
»Jemand, den Sie kennen?«, fragt er.
»Ja«, sag ich.
Ich bin nackt. Ausziehen musste ich mich hinter einem Paravent. Lustig eigentlich, dass das Ausziehen versteckt werden muss, aber das Nacktsein kein Problem ist. Eine Schwester hat mich untersucht und ist dann hinausgegangen. Mich hat sie in einem Behandlungszimmer voller Skalpelle und Operationsscheren allein gelassen. Ich frage mich, ob ich mich wieder anziehen kann, setze mich dann aber, wie ich bin, auf die Untersuchungsliege und lasse die Füße baumeln. Ich will nicht, dass irgendjemand denkt, ich würde mich für meine Nacktheit schämen. Die Tür öffnet sich, und die Schwester kommt mit einem Arzt zurück. Er ist um die fünfzig und hat eine Halbglatze. Als er mich sieht, bleibt er stehen. Er fragt die Schwester im Flüsterton, ob die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien. Dann wendet er sich an mich:
»Wollen Sie sich nicht anziehen, Frau Gruber?«
»Nein, ist in Ordnung«, sag ich und schlage die Beine übereinander.
»Gut«, sagt der Arzt und kommt auf mich zu, um mir die Hand zu schütteln. Er schaut mir in die Augen: »Doktor Korb mein Name. Ich bin hier der leitende Psychiater.«
Am Ende des Satzes hebt er die Stimme, als würde es sich um eine Frage handeln.
»Schön«, sag ich und nicke interessiert.
Der Arzt zieht sich einen Hocker heran und setzt sich vor mich. Als er merkt, dass sein Kopf genau auf der Höhe meines Schoßes ist, steht er wieder auf.
»Ja«, sagt er, »Frau Gruber«, und sieht dabei die Schwester an, die regungslos neben der geschlossenen Tür steht, als wäre sie eine Topfpflanze.
»Ja«, sag ich.
»Ich komme später noch einmal vorbei«, sagt er und geht zur Tür. Als er die Klinke nach unten drückt, besinnt er sich, dreht sich um und nickt mir zu. Ich nicke zurück. Dann geht er, und die Schwester folgt ihm. Bevor die Tür ins Schloss fällt, rufe ich laut: »Doktor!«
Ich rutsche von der Liege. Der Arzt kommt wieder herein. Hinter ihm sehe ich den Kopf der Krankenschwester ins Zimmer lugen. »Ja?«, sagt er und bremst sie mit der flachen Hand aus. Ich räuspere mich: »Ich habe eine Frage.«
Doktor Korb nickt: »Ja?«
»Ich möchte wissen, ob jemand namens Bernhard Gruber Patient hier ist.«
Er mustert mich. Zögert. Er will was sagen, doch ich schneide ihm das Wort ab.
»Das ist mein Bruder«, sag ich. »Ich glaub, ich habe ihn vorhin im Garten gesehen.«
Er schaut mich an, legt den Kopf schief. Dann nickt er. »Gut«, sagt er, »wir kümmern uns darum.« Er wechselt einen Blick mit der Schwester. »Gut«, sagt er, wieder an mich gewandt, »sonst noch was?«
»Nein«, sag ich. Er runzelt die Stirn und schaut auf den Boden. Dann nickt er und geht hinaus. Kurz bevor die Tür ins Schloss fällt, hält er sie noch einmal von draußen auf.
»Und ziehen Sie sich bitte etwas an«, höre ich ihn sagen.
Zimmer
Das Zimmer ist nicht grauslicher als jedes andere Krankenhauszimmer auch. Das Unpersönliche ins Maximum getrieben, sodass sich niemand an etwas stoßen kann. An einem Einrichtungsgegenstand zum Beispiel. Rechts neben dem Eingang ist eine Schrankwand, auf der gegenüberliegenden Seite ein Bad. Zwei Krankenhausbetten nebeneinander, beide unbenutzt; ich werde alleine in diesem Zimmer wohnen. In der Ecke ein kleiner Fernseher mit einem Gestell an die Decke geschraubt. Daneben eine Kamera. Am Anfang wird man mich filmen nachts. Ich weiß Bescheid, ich musste unterschreiben. Ich trete ans Fenster und gebe mir nicht die Blöße, daran zu rütteln. Der Ausblick ist schön. Auf andere Pavillons, auf Wiesen, auf Wien. Ein schöner Ort, denke ich. Ohne zu klopfen, kommt eine Schwester herein und gibt mir ein Wäschebündel. Sie erklärt mir in Wir-Sätzen die kommenden Tage. Ich nicke. Als sie geht, bitte ich sie, zukünftig anzuklopfen.
Der Himmel ist mittlerweile schwarz geworden. Ich sortiere das Wäschebündel am Bett auseinander. Zwei Handtücher, zwei mintgrüne Jogginganzüge. Anstaltskleidung, die aussieht, als wäre sie aus Einweg-Handtüchern genäht worden. Anstaltskleidung, die in der normalen Welt sofort als solche erkennbar wäre. Unsägliche Unterwäsche. Nur für die Anfangszeit, hat Doktor Korb gemeint.
Die Dusche ist ein graues Viereck, das in den Boden eingelassen ist. Die quadratische Form spiegelt sich im metallenen Gestänge auf der Decke wider, von dem ein weißer Duschvorhang herunterhängt. Obwohl die Luft schon stickig ist, dusche ich warm. Während das Wasser über meine trockenen Haare perlt, dann zwischen sie drängt, fahre ich mit dem Fuß die Duschtasse ab. Kleine graue Noppen, die mich am Ausrutschen hindern sollen. Als ich fertig bin, werfe ich das nasse und das trockene Handtuch über das Metallgestänge.
Um zweiundzwanzig Uhr ist Schlafenszeit. Ausreichend Schlaf sei das erste Prinzip für eine gesunde Psyche, hat man mir erklärt. Man wird das schon wissen, denke ich mir, während ich im Dunkeln zur Kamera hochstarre und überlege, ob ich eine kleine Showeinlage bringen soll, wenn ich schon gefilmt werde. Ein bisschen Masturbieren vielleicht.
Kurz vor Mitternacht stürmt ein Schwesterich das Zimmer. Ich habe im Schlaf geschrien. Wir beruhigen uns beide, ich mich schneller als er, dann schlafe ich wieder ein. Um eins weckt er mich erneut, als er kontrolliert, ob ich schlafe. Um drei wache ich durch einen Knall aus dem Bad auf. Ich denke an die Kamera und lasse mir nichts anmerken. Ich will heute Nacht mit niemandem mehr sprechen müssen.
Als ich am Morgen das Bad betrete, liegen meine Handtücher und der Duschvorhang als Haufen auf dem Boden. Die Duschstange biegt sich in zwei Teilen nach unten. Dort, wo die Stange zerborsten ist, fahre ich mit dem Daumen das spröde Material nach. Sollbruchstelle.
Bernhard treffen
Mittlerweile bin ich seit zwei Tagen hier und habe meinen Bruder nicht wiedergesehen. Ich hatte schon meine erste Gruppensitzung, aber jetzt streike ich. Ich sage nichts mehr, bevor ich Bernhard nicht getroffen habe. Doktor Korb weiß das. Er hat mich in ein Behandlungszimmer bringen lassen, in dem ich seit einer halben Stunde mit einem Pfleger warte. Ich sitze auf einem Drehstuhl und schraube mich abwechselnd hoch und runter. Das eine Nasenloch des Pflegers ist verstopft und pfeift bei jedem Atemzug leise. Er merkt nicht, wie ich minütlich gereizter werde. Dann taucht Korb endlich auf. Er sagt irgendetwas, aber ich höre nicht hin. Hinter ihm kommt die ausgemergelte Gestalt aus dem Garten herein: Bernhard. Er ist so groß geworden — und so dünn. Er trägt einen Jogginganzug, dessen Ärmel hochgekrempelt sind. Ich kann eine abgeklebte Kanüle in seiner Armbeuge erkennen. Kurz schaut er mich an, dann auf seine Füße. Er streicht sich eine nicht vorhandene Haarsträhne hinters Ohr.
Ich grinse.
»Hallo«, sag ich ganz überschwänglich und stehe auf.
Ich breite die Arme aus, aber mein Bruder bewegt sich nicht. Ich merke, wie seine Kiefer mahlen. Er schaut Doktor Korb an. Dieser kneift lächelnd die Augen zusammen, und Bernhard setzt sich langsam in Bewegung. Er kommt mir entgegen, als wäre er ein Kalb auf dem Weg zum Schlachter. Zwanzig Zentimeter vor mir bleibt er stehen. Ich umarme ihn umständlich. Es ist furchtbar peinlich. Man könnte meinen, wir seien zwei flüchtige Bekannte, die sich zufällig auf der Straße begegnet sind.
»Na?«, sag ich und trete einen Schritt zurück. Ich bemühe mich, mein Grinsen zu halten. Bernhard öffnet den Mund und schließt ihn wieder. Er räuspert sich und versucht es noch einmal: »Hallo Eva«, sagt er. Er holt tief Luft: »Wie geht es dir?«
»Eh gut«, sag ich und lächle. »Dir auch?«
Bernhard nickt: »Ja.«
Dann dreht er sich wieder zu Korb. Der schaut zwischen uns beiden hin und her und notiert sich etwas auf seinem Klemmbrett. Ich überlege, was ich als Nächstes sagen soll. Langsam vergeht mir das Lächeln. Ich ärgere mich, dass mein Bruder nach all der Zeit nicht einmal kurz Smalltalk mit mir führen kann.
»Warum bist du hier?«, frage ich, und Bernhard dreht sich wieder zu Doktor Korb.
»Kannst du kein Deutsch?« Doktor Korb stellt sich anders hin, aber Bernhard reagiert nicht.
»Brauchst du einen Dolmetscher, oder was?«, sag ich und merke selbst, wie ich wütend werde.
»Hä?«, rufe ich.
»Das reicht«, sagt Doktor Korb und macht die gleiche Geste in meine Richtung, die er vor ein paar Tagen zur Krankenschwester hin gemacht hat. Der Pfleger stellt sich zwischen mich und Bernhard. Der wirkt erleichtert und trottet zum Ausgang. Doktor Korb geht hinterher und legt ihm eine Hand auf die Schulter. »Das haben Sie gut gemacht«, höre ich ihn sagen. Sie verlassen das Zimmer. Ich lache laut auf. Es ist unfassbar. Der Pfleger schaut mich ernst an.
»Pscht«, sagt er.
»Pscht?«, fahre ich ihn an.
Er zuckt zusammen und weicht zurück. Ich nutze die Gelegenheit und laufe aus dem Zimmer. Am Gang drehe ich mich erst nach rechts, dann nach links. Ich sehe meinen Bruder und Doktor Korb am Ende des Flurs stehen.
»Bernhard«, schreie ich, so laut ich kann.
Die beiden drehen sich erschrocken zu mir um.
»Und«, rufe ich, »wie findest du das Wetter?«
Bernhards Angst
Bernhard ist der einzige Mensch, dessen Furcht für mich schlimmer ist als meine eigene. Als Kind hat er mir einmal erzählt, dass er Angst hätte, mit dem Gesicht in den großen Kaktus am Treppenabsatz zu fallen. Er ging deswegen immer, mit der linken Hand ganz vorsichtig am Geländer dahingleitend, sehr langsam nach unten. Rauf ging es schneller. Auf dem Hinterkopf habe er ja keine Augen, die ihm der Kaktus ausstechen könnte, hat er mir erklärt. Ich lachte damals; und noch heute, wenn die Mutter davon spricht, lache ich. Wenn sie von den alten Ungeschicklichkeiten erzählt, um die heutigen zu übertünchen. Ich lache meinen dummen Bruder aus, der vor allem Angst hat. Es ist leicht, die Mutige zu sein neben einem solchen Feigling. Als Kind wäre ich die Erste gewesen, die Bernhard auf dem Schulhof verprügelt hätte, wäre er nicht mein Bruder gewesen. So verprügelte ich ihn zu Hause, wenn es die Eltern nicht sahen, und in der Schule tat ich das Gleiche mit allen, die ihm zu nahe kamen.
Was ich Bernhard nie sagen werde, ist, dass irgendwann auch mir bange wurde, wenn ich den Kaktus sah. Dabei saß auf seiner dicken Spitze sogar ein kleiner bunter Sombrero. Nicht, dass ich mich davor gefürchtet hätte, mich zu verletzen. Nein, der Gedanke an den blonden Haarschopf meines Bruders, sich devot vor einer Topfpflanze duckend, machte mich krank.
Bernhard hat am ersten April Geburtstag. Bernhard, unser wandelnder Aprilscherz. Wenn er Geburtstag hat, dauert die Nacht elfeinhalb Stunden. Wenn ich Geburtstag habe, ist sie ein bisschen kürzer. Der Vater und ich haben uns darüber gestritten, damals, ob der Tag mit der Dämmerung beginnt oder erst, wenn man die Sonne sieht. Für mich beginnt er mit der Dämmerung. Danach hat der Vater angefangen, mich zu wecken. Jeden Tag um halb fünf stand er in seinem hellblauen Pyjama, der ihm wahrscheinlich vor Bernhards Geburt einmal gepasst hat, an meinem Bett. Jedes Mal schloss ich die Augen gleich wieder, und jedes Mal klopfte er mir mit einer gelben, nach Nikotin stinkenden Fingerspitze so lange an die Stirn, bis ich sie offen ließ. Wenn es ein Morgen war, an dem meine Lider noch öfter zufielen, wanderte seine Hand immer wieder zur Brusttasche des Pyjamas, unter der sich viereckig das Zigarettenpäckchen abzeichnete. Das war bei ihm schon ein Reflex. Irgendwann schlug ich die Decke zurück und hob die Beine aus dem Bett. Bis heute schaffe ich es nicht, in einem Zug aufzustehen. Wenn die Füße den kalten Holzboden berührten, fuhr ich mit den Händen über die Oberschenkel und kratzte mir sämtliche Mückenstiche des Vortages auf. Und selbst wenn keine Stiche da waren: Immer musste ich mich kratzen. Ich erinnere mich an keinen Morgen meines Lebens, an dem ich nicht roten Dreck unter den Fingernägeln gehabt hätte.
Der Vater hatte Geduld. Mit verschränkten Armen stand er da, bis ich so weit war. Wir gingen gemeinsam nach unten, vorbei am Kaktus ins Erdgeschoss. Immer musste ich erst aufs Klo. Dort schlief ich wieder ein. Als ich schließlich ins Esszimmer kam, sah ich ihn durch die Terrassentür; wie er wieder und wieder an der Zigarette zog und in den Himmel starrte. Heute frage ich mich, ob ich auf dem Klo kürzer geschlafen habe, als ich denke, oder ob er sich einfach eine nach der anderen anzündete, bis ich kam. Wir sprachen nie, doch ich wusste, wo ich mich hinzusetzen hatte: mit Blick Richtung Osten, auf den noch grauen Himmel zwischen den Berghängen. Nach dem Rauchen verschwand der Vater immer in der Küche. Ich hörte Sachen umfallen, er war nicht besonders geschickt, und dann das Piepen der Mikrowelle. Er setzte sich neben mich, stellte mir Kakao hin, den ich nie trank, und wir schauten so lange in den Himmel, bis wir die Sonne orange glühend aufsteigen sahen.
Eines Tages kamen wir nach unten, und meine Mutter erwartete uns. In ihrem weißen Frottee-Bademantel saß sie mit einer Tasse Tee da — und wartete. Sie hatte das Radio eingeschaltet. Ich setzte mich neben sie, und der Vater ging den Kakao holen. Dann schauten wir zu dritt aus dem Fenster, während Bernhard oben schlief. Der Moderator sagte, dass Lady Di bei einem Autounfall verunglückt sei. Die Mutter stellte das Radio wieder aus, und wir gingen hoch. Der Vater weckte mich nie wieder.
Büro
Wer nicht mehr neu ist, braucht auch nicht mehr in den grünen Papierhandtuchanzügen herumzulaufen. Stattdessen habe ich ein ansehnliches Repertoire an Jogginganzügen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht: Den ganzen Tag in Gummizug-Hosen flanieren und zu den Fütterungszeiten im Aufenthaltsraum abhängen. Urlaub in Lignano ist auch nicht viel anders.
Meine Schritte hallen durch den Gang. Und es hilft nichts, man muss es sagen: Der Gang ist schon schön. Da herrscht noch der Glanz anderer Zeiten. In den Patientenpavillons hört das ja gleich auf mit dem Schein, sobald man das Stiegenhaus verlässt und durch die Stationstür geht. Da beginnt der Plastikboden, und womit könnte man besser ausdrücken, dass man am Boden der Tatsachen angekommen ist, als mit Plastikboden; ja, Plastikboden ist eigentlich tatsächlich der Boden der Tatsachen. Aber hier auf den Gängen im ambulanten Therapiegebäude gibt es kein Plastik. Die blauen Ornamente begleiten einen vom Erdgeschoss über vier Stockwerke hinweg. Bis ins Dachgeschoss, wo Doktor Korb sein Büro hat. Bevor ich eintrete, bleibe ich stehen und luge in das Zimmer. Doktor Korb nickt mir, eine Hand an der Türklinke, zu.
Ich trete über die Schwelle, mache ein paar Schritte, bleibe mitten im Raum stehen und warte. Er schließt die Tür, geht an mir vorbei zu den Sitzmöbeln, bedeutet mir dann wieder mit einem Nicken, dass ich weitergehen soll. Als führte er mich an einer unsichtbaren Leine. Und genau wie ein braves Hündchen trotte ich seiner Halbglatze hinterher und mache Platz. Auf einem Diwan, der mit speckigem Leder bezogen ist. Die eine Seite flach, auf der anderen bäumt sich in elegantem Bogen eine Lehne auf. Als hätte sich ein Ohrensessel mit einem Bett gepaart. Ich rücke ein Stück nach rechts, und einer der Knöpfe, die sich in gleichmäßigen Abständen auf dem Speckbezug verteilen wie Fettaugen auf einer Wurstscheibe, gibt ein Geräusch von sich. Ich rücke noch ein Stück weiter, um Missverständnisse zu vermeiden. Doktor Korb setzt sich mir gegenüber in einen Ohrensessel, der im gleichen Stil gehalten ist wie der Diwan.
Hinter ihm steht ein großer Schreibtisch, Mahagoni, denke ich. Nicht, dass ich wüsste, wie Mahagonimöbel aussehen, aber wenn sie tatsächlich existieren, dann wohl in diesem Büro. Regale aus demselben Holz, Bücher, Zertifikate. An der gegenüberliegenden Wand eine Vitrine. Flaschen voller bernsteinfarbenem Alkohol. Ich schnaube und merke, wie Doktor Korb mich beobachtet. Da entdecke ich auf dem niedrigen Tisch zwischen ihm und mir ein Schälchen mit bunten Holzfrüchten. Ungläubig nehme ich einen rot bemalten Holzapfel und rieche daran. Badezimmer, denke ich und freue mich. Ich schaue zu Doktor Korb hinüber und halte den Apfel in die Höhe.
Er verzieht keine Miene. Er scheint den Apfel nicht lustig zu finden und auch nicht die kleine Holzbanane oder die blaue Himbeere, die genauso groß wie die Banane ist. Die Holzfrüchte, den bernsteinfarbenen Alkohol, sein ganzes klischeedurchtränktes Büro: nichts davon findet dieser Korb lustig. Kurz frage ich mich, ob ich ihm eine Freude machen und mich über den Diwan werfen sollte, wie eine Diva im Schwarz-Weiß-Film. Ein Handgelenk an der Stirn, das andere am Bauch, seufzen. Nur um das Bild eines Psychiater-Büros für ihn zu komplettieren. Vollendung, denke ich mir, ist immer ausreizbar.
Korb bleibt stumm, und ich höre eine Uhr ticken, nach der ich mich nicht mehr umzudrehen brauche. Die Lücken im Kopf haben sich geschlossen, spätestens seit den Holzfrüchten weiß ich alles über diesen Raum.
Nach einer weiteren Minute sagt Korb: »Guten Tag.«
Ich wundere mich.
»Guten Tag«, sag ich.
Dann nickt Korb und sagt wieder: »Guten Tag.«
Ich lächle, vielleicht steckt doch Humor in diesem Menschen. Ich hebe die Hände neben die Ohren und beginne, mit ihnen zu wackeln, während ich auf dem Diwan von links nach rechts schaukle: »Gutentag, Gutentag, ich will mein Leben zurück«, sag ich.
Stille. Dann notiert Doktor Korb sich etwas auf dem Klemmbrett.
»Wissen Sie«, sag ich, »die richtige Lampe fehlt noch.«
»Wie bitte?«, Korb hebt den Kopf.
»Na ja, im Zimmer hier: eine Lampe.«
»Soll ich das Licht einschalten?«, fragt er.
»Nein«, sag ich und komme nicht umhin, die Augen zu verdrehen. Schließlich ist es helllichter Tag. Die Sonne knallt durch die Fenster herein, und auch Doktor Korb schwitzt unter seinem weißen Arztkostüm wie die Neueinlieferungen in ihren Papierhandtuchanzügen.
»Für den Schreibtisch«, sag ich und deute überflüssigerweise mit dem Kinn zum Tisch, als wüsste er nicht selbst, wo er steht.
»So eine kleine grüne«, sag ich und beuge mich nach vorne. Ich lege die Hände auf den Couchtisch und fahre dann in der Luft die Form der Lampe nach. Auch imaginäre Lampen müssen auf echten Tischen stehen.
»So«, sag ich, »hier golden und da oben grün.« Ich ziehe die Hände auseinander: »Grünes Glas.« Ich richte mich wieder auf und rutsche auf dem Diwan nach hinten: »Wie in den Bibliotheken«, sag ich, »in den alten. Am Heldenplatz zum Beispiel.«
Korb schaut zur Seite, nickt. Einen Moment lang befürchte ich, er könnte gleich wieder »Guten Tag« sagen. Deswegen beschließe ich, die Situation selbst zu retten. Ich starte die Therapie einfach mal alleine, der Arzt kann ja später einsteigen.
»Ich bin Eva Gruber«, sag ich. »Mit meiner Familie ist es schwierig.«
Doktor Korb nickt. Das ist zumindest ein Anfang.
»Mein Vater«, sag ich, »hat sich umgebracht.«
Er nickt wieder.
»Und meine Mutter ist ja auch tot.«
Der Arzt zieht die Augenbrauen zusammen.
»Meinen Bruder«, sag ich, »hab ich alleine großgezogen.«
Ich lege den Kopf schief und schwelge in der Erinnerung: »Jaja«, sag ich, »das waren noch Zeiten.«
Ich lehne mich vor und schaue dem Psychiater in die Augen: »Wir haben wirklich ein inniges Verhältnis, mein Bruder und ich. Ich habe ihn ja gewissermaßen alleine am Leben erhalten. Wissen Sie, an meinen metaphorischen Zitzen hab ich ihn gesäugt, wie bei diesen Wölfen in Rom.«
Mit der Hand mache ich eine kreisende Bewegung vor meiner linken Brust: »Wissen Sie, was ich meine?«
Der Arzt hebt den Blick von meiner Brust und schaut mir ins Gesicht: »Was?«
»Wölfe in Rom«, sag ich, »sind Sie total ungebildet, oder was? Diese Legende. Die Menschen haben an den Zitzen von dem Wolf getrunken, in Rom; oder die Wölfe an den Zitzen von den Menschen. Umgekehrt würde es aber mehr Sinn machen. So ein Wolf hat ja mehr Zitzen zum Andocken.«
Wieder lasse ich meine Hände vor den Brüsten kreisen und denke nach. »In Deutschland«, sag ich, »soll es ja auch wieder Wölfe geben.«
»Frau Gruber«, unterbricht Doktor Korb mich.
»Ja?«, sag ich und lasse die Hände sinken.
»Wissen Sie, warum Sie hier sind?«, fragt er.
»Ja«, sag ich und stecke die Hände in die Hosentaschen. Es ist beruhigend zu sehen, dass der Arzt jetzt auch an der Therapie teilnimmt.
»Können Sie mir dann bitte in eigenen Worten erzählen, warum Sie hier am OWS aufgenommen wurden?«
»OWS« ist Slang für Otto-Wagner-Spital, die Leute hier nutzen es wie Studierende die Wörter »Bib« oder »Stip«. Das OWS ist die Hood vom Korb. Darum merkt er nicht, dass er Slang redet. Er schaut mich abwartend an.
»Hergekommen bin ich mit der Polizei. Vor drei Tagen.« Ich nicke: »Fast schon vier Tage bin ich da.«
Korb stimmt mir zu.
»Richtig«, sagt er, »wir sind uns also einig, seit wann Sie da sind und wie Sie hergekommen sind. Das Warum müssten wir noch klären.«
Ich nehme das Gummiband, das ich ums Handgelenk trage, und binde mir die Haare zusammen. »Also, die Polizei hat mich geholt. Ich war da sehr kooperativ, muss ich sagen. Ich bin eingestiegen, und dann hat man mich hergebracht. Gut«, sag ich, weil mir die Therapie jetzt schon auf die Nerven geht. Ich klatsche mir mit den Händen auf die Schenkel: »War auch ein bisschen viel heute. Wir sehen uns ja morgen wieder.«
Ich lächle Korb an, stehe auf und gehe zur Tür. Ich drücke die Klinke nach unten, aber die Tür bewegt sich nicht: abgesperrt. »Korb«, sag ich und drehe mich um, »das wäre so ein cooler Abgang gewesen. Sie haben es mir versaut.«
»Frau Gruber«, sagt er, »das ist keine Show, das ist Ihre Therapie.«
»Ja«, sag ich und gehe zum Diwan zurück, »wenn das meine Show wäre, würde es auch bessere Snacks geben.« Ich deute auf die Schüssel mit den Duftfrüchten.
»Warum sperren Sie überhaupt die Tür ab?«, ich fläze mich wieder auf das Möbel. »Das ist ja schon grenzwertig. Ein grenzwertiger Mensch sind Sie.«
»So ist das bei mir«, sagt Korb und lehnt sich jetzt ebenfalls entspannt zurück. Es ist, als hätte sich gerade was aufgelöst zwischen uns. »Sie können auch gern zum Kollegen wechseln. Bei mir bleibt die Tür zu.«
»Schon gut«, sag ich und hebe die Hände, »kein Grund, gleich beleidigt zu sein.«
Korb hält wieder das Klemmbrett im Anschlag und wartet, dass ich weiterspreche. Na gut, denke ich.
»Na gut«, sag ich und seufze, »ich hab also eine Kindergartenklasse erschossen. Sie wissen schon«, sag ich, »mit einer Pistole.«
Langeweile
Ich starre in der Dunkelheit an die Decke und kann mich nicht erinnern, wie hoch sie ist. Ich hebe den Kopf leicht an und fasse nach dem Polster. Ich ziehe ihn unter mir hervor und werfe ihn in die Luft. Ohne dass ich gehört hätte, wie er gegen die Decke schlägt, trifft er irgendwo neben mir mit einem dumpfen Schlag auf den Boden. Mit Blick auf das blinkende Kameralicht verschränke ich die Hände hinter dem Kopf. Ich will keine Aufregung, mir ist nur fad.
Hier gehört die Langeweile zum Tagesgeschäft. Natürlich, hin und wieder fürchtet man sich auch. Zum Beispiel, wenn nachts ein Irrer eingeliefert wird und herumschreit. So ein Alkoholiker, der dann beim Empfang steht und »Sau« und »Schwein« ruft. Manchmal folgt auf die Schreie ein Wumms. Ein Geräusch, als hätte sich ein junges Kalb auf die Seite gelegt. Mein Lieblingsteil ist, wenn nach dem ersten Wumms noch ein zweiter folgt, dann hat es nämlich nach dem Betrunkenen noch die Schwester umgelegt. Oder einen Security. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die Securitys hier ausgebildet sind. Ob sie tatsächlich Krisenmanagement-Training hatten oder ob sie halt mit learning by doing versuchen, dem Wahnsinn irgendwie beizukommen.
Jedenfalls, vor den anderen Irren hab ich schon Angst hin und wieder, aber im Normalfall ist es ganz okay mit denen, deswegen langweilt man sich schnell. Das Entertainment-Programm ist hier ja auch sehr beschränkt. Unsere Station ist eine smartphonefreie Zone. Ein Unikum am OWS, das Korb durchgesetzt hat. Damit man überhaupt einmal zur Ruhe kommen kann. In der Früh die Morgenaktivierung, also eine Runde flott in der Gruppe auf dem Klinikgelände herumgehen. Nachdem man sich aktiviert hat, erst mal aufs Klo und dann Frühstück. Danach beginnt der individuelle Stundenplan, irgendeine Kunsttherapie, Mittagessen. Am Nachmittag Gesprächstherapie und Besuchszeit. Wenn jemand kommt. Um spätestens zweiundzwanzig Uhr ist Nachtruhe. Außer es ist Champions League. Da darf’s auch mal eine halbe Stunde länger sein. Man lebt ja nicht unter Unmenschen.
Im Prinzip hangelt man sich von einer Mahlzeit zur nächsten. Deswegen ist es wichtig, dass das Essen schmeckt. Berta, die Frau mit dem Tantenbusen, die das Frühstück ausgibt, hat mir das erklärt: Den Leuten ist eh schon fad genug, da kann nicht auch das Essen noch fad sein.
Manche Patienten quält der erzwungene Stillstand, ich sehe es ihnen an. Getrieben wälzen sie sich über die Gänge. Hin und her, immer die gleiche Strecke, wie Hamster in Rädern. Was würden diese Leute draußen tun, einfach wandern, immer weiterwandern?
In meiner Kindheit gab es so eine Frau. Wenn man mit dem Auto vom Dorf in die Stadt fuhr, sah man sie gehen. Auf einem kleinen, ausgetretenen Pfad neben der Landstraße trottete sie stets im selben Tempo dahin. Abgetragene Jacke. Zu beiden Seiten der Straße befanden sich die Pfade. Wege, die sich die Frau über die Jahre freigetreten hatte. Wann immer ich heute solche Trampelpfade neben Straßen sehe, stelle ich mir Frauen vor, die tagaus, tagein wie Duracell-Hasen im Leerlauf strampeln.
»Warum werfen Sie mit Polstern herum?«
Der Nachtpfleger steht im Zimmer. Nach der Dunkelheit rammt sich das Licht der Energiesparlampe in meine Netzhaut hinein wie ein Stemmhammer. Ich schließe die Augen und wende den Kopf ab. Hinter den geschlossenen Lidern sehe ich das Echo der Glühbirne noch mehrmals bunt aufleuchten. Dann schaue ich zur Decke und erschrecke mich. Wie tief sie doch tatsächlich hängt.
»Hallo?«, sagt der Pfleger und macht einen Schritt auf mich zu.
»Polster«, sag ich.
»Was?«, sagt der Pfleger.
»Polster«, sag ich noch einmal und drehe den Kopf zu ihm: »Singular. Nicht Polstern. Nur einer.«
»Was?«, sagt er wieder, denkt dann kurz nach und fragt: »Warum? Warum werfen Sie den Polster durch die Gegend?«
»Einmal«, sag ich, »einmal hab ich einen Polster in die Luft geworfen.«
»Aber warum?«, fragt er und spricht jede Silbe betont langsam aus.
»Ich hatte Lust drauf«, sag ich. »Ist das verboten?«, frage ich.
»Allerdings ist das verboten«, sagt er. »Sie können nicht in der Nacht einfach Sachen durch die Gegend werfen.«
»Ah so«, sag ich, »Entschuldigung.«
Der Pfleger schüttelt den Kopf und geht zum Polster. Er hebt ihn auf und reicht ihn mir, dann stemmt er die Hände in die Hüften: »Brauchen’s was zum Schlafen?«
Ich schüttle den Kopf: »Nein, danke.«
Er geht zur Tür.
»Und die Bettdecke?«, frage ich.
Er dreht sich um: »Wie bitte?«
»Darf ich die Decke durch die Gegend werfen?«
»Nein«, sagt er, »wenn Sie die Decke nicht wollen, dann legen Sie sie zusammen und tun sie in den Schrank oder auf das andere Bett.« Er überlegt kurz. »Sie sollten aber auch im Sommer nicht ohne Decke schlafen. Man schwitzt und dann verkühlt man sich was.«
Ich nicke.
»Gute Nacht«, sagt er, schaltet das Licht aus und geht hinaus. Als die Tür ins Schloss fällt, höre ich vom Gang gedämpft seine Stimme.
»Hatte Lust drauf«, sagt er, »die spinnt.«
Leuchtröhren
Es ist nicht mehr ganz so heiß. Was im August bedeutet, dass es auf die Nacht zugeht. Da darf man nach dem Licht nicht gehen. Das Licht erzählt einem im Sommer allen möglichen Scheiß.
Bernhard muss noch hier draußen sein. Erst vor wenigen Minuten habe ich ihn um eine Ecke huschen sehen. Er versteckt sich vor mir, so wie er sich schon die ganze Woche versteckt hat. Ich streife über leere Asphaltwege, rieche Fleisch. Irgendwo in den angrenzenden Schrebergärten feiert jemand ein Grillfest. Eine Irrenanstalt, die so groß ist, dass neben den Prachtgebäuden in der ersten Reihe, neben dem funkelnden Direktionsgebäude, wo vor gar nicht allzu langer Zeit ein funkelnder Direktor saß und den Daumen nach oben und unten drehte, neben den vierundzwanzig vierstöckigen Patienten-Pavillons — sechsundzwanzig, wenn man die forensischen mitzählt —, neben den ehemaligen fancy Lungenheil-Pavillons, die Rosenvilla oder Karlshaus heißen, neben der Großküche, der Wäscherei, dem Hubschrauberlandeplatz, neben dem ich weiß nicht wie viele Hektar großen Waldgelände — dass neben alldem auch noch Schrebergärten für die normalen Menschen in dieses Monstrum von Anstalt integriert sind: die Irrenanstalt als Naherholungsgebiet.
Da kann man in seinem Gärtchen sitzen und Würstel grillen, hin und wieder stolpert vielleicht ein Wahnsinniger oder Drogensüchtiger herein und ersäuft im Planschbecken für die Enkelkinder, aber das ist nicht so schlimm. Einer der Pfleger, die den ganzen Tag in ihren Golfwägelchen übers Gelände flitzen, wird schon kommen und ihn herausfischen. Oder auch nicht. Es gibt ja auch schlimmere Arten zu sterben als im Grünen umhüllt von Käsekrainerduft.
Ich bemerke eine Bewegung an einer Häuserecke. Als ginge es um einen Sekundensieg bei den Olympischen Spielen, sprinte ich los.
»Hey«, schreie ich und biege um die Ecke. Zwei Spaziergänger zucken zusammen.
»Scheiße«, rufe ich, und die Spaziergänger zucken noch einmal. Ich zwinge mich, die Wut hinunterzuschlucken, und spucke auf den Boden.
Eine ganze Weile laufe ich kreuz und quer auf dem Gelände herum. Längst habe ich den Überblick verloren. Gleich wird sich die Sonne verabschieden; ich merke es an der Art, wie sie die Dinge nur noch von der Seite anstrahlt. Da sehe ich zwischen den Wipfeln der Nadelbäume etwas funkeln. Eine güldene Kirche taucht oben am Hang auf. Ein kleines Kreuz, das auf der fetten Kuppel lächerlich wirkt. Ich steige zu dem Plateau hinauf, stelle mich an dessen Rand und halte mir die Hände als Lautsprecher an den Mund: »Bernhard!«