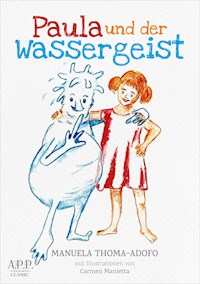Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: 33 Grausamkeiten
- Sprache: Deutsch
Nach „33 Grausamkeiten - K(l)eine Gute Nacht-Geschichten“ präsentiert Manuela Thoma-Adofo nun „33 Grausamkeiten II – (Alp)-Träume für jedermann“. Bitterböse rachsüchtig und unterhaltsam lustig, geht es weiter mit Kurzgeschichten und schwarzhumoriger Poesie. Auch hier wieder manchmal abstoßend und immer anziehend. Wer „33 Grausamkeiten Teil I“ gemocht hat, wird diesen zweiten Teil lieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Carmen, Ronny, Angela und Cecilia
Inhalt
Freundinnen
Reingelegt
Böse Zellen
Vaterschaft
Gertrud
Gut aufgehoben
Das Testament
Das Enkelchen
Der Pyromane
Der Lottogewinn
Die Putzfrau
Wachtmeister Claus
Schluss machen
Schön sein
TV Star
Der Makler
Halteverbot
Ehebruch
Männer
Essgewohnheiten
Alte Bekannte
Das lange Warten
Timo der Trickser
Ruhe in Frieden
Der Schuldige
Skorpion
Der Rastplatz
Die Beichte
Biomüll
Die Krankheit
Petri Dank!
Hausgäste
Vorurteile und andere politisch unkorrekte Lügen
Deutschland
Bayern
Vorurteile über Rassen und Länder
Vorurteile gegenüber Homosexuellen
Die Leiden der jungen M. oder der Beginn der Diät
Danke!
Freundinnen
Mathilda, Johanna, Christine und Sophia lernten sich wenige Tage vor dem Tod von Sophias Mann kennen.
Heinz war cholerisch, attraktiv und ein notorischer Ehebrecher. Aber mit achtundsechzig Jahren definitiv zu jung, um von einem Wagen überfahren zu werden. Zwei Mal.
Der Lenker des Wagens beging Fahrerflucht und wurde auch nach langen Ermittlungen nicht gefunden. Und Sophia war ab diesem Zeitpunkt Witwe und schrieb sich im Sportstudio ein.
Die vier Frauen waren vom Wesen her völlig unterschiedlich. Sophia eher lebensfroh und aktiv, Mathilda ein wenig melancholisch und verschlossen. Christine saß am liebsten mit einem Glas Wein vor einem guten Buch, und Johanna war weltoffen und dachte über ein Studium der Kunst nach.
Leider hielt Johannas Mann den Gedanken daran, dass seine Frau mit über fünfzig Jahren noch die Schulbank drückte, für albern und stellte sich quer. Johannas Kinder – sie hatte einen Sohn von dreißig Jahren und eine Tochter von achtundzwanzig – fanden ihre Idee gar nicht schlecht. Aber alle wussten, dass Gerd seine Wünsche oder sein Missfallen mit Öffnen oder hartnäckigem Schließen des Geldhahnes durchsetzte. Vielleicht war es damals ein Fehler gewesen, das Studium abzubrechen, bloß weil er ihr versichert hatte, immer für sie zu sorgen.
Gerd liebte es zu wandern. Johanna hatte sich daran gewöhnt und ging mit. Gerd wollte es so. Sie erklommen gemeinsam Pässe und steinige Wege, die Johanna ein Gräuel waren.
Es war ein großer Zufall, dass sie bei einer dieser Bergtouren Sophia begegneten. Sophia war schon immer gerne Wandern gegangen, aber ihr Mann Heinz – Gott hab ihn selig – hasste Bewegung in freier Natur.
Sophia schloss sich Johanna und ihrem Mann an, und so schwiegen sie gemeinsam, bis sie eine besonders kitzelige Strecke eroberten.
Keiner wusste, wie es kommen konnte, aber Gerd rutschte offenbar an der steilsten Stelle der Tour aus und stürzte mindestens zwanzig Meter in steiniges Gelände.
Johanna blieb oben sitzen, während die wendige Sophia hinabstieg, um zu schauen, ob man dem armen Gerd noch helfen müsse. Als sie nach oben rief, dass jede Hilfe zu spät käme, zog Johanna das Handy aus der Tasche und wählte weinend die Nummer der Bergrettung. Bergluft gibt vielen Wanderern ein Gefühl von Freiheit. Johanna hatte das früher nie so gespürt.
An Gerds Grab stand Johanna vor einem Kranz mit weißen Rosen. Gerd hasste weiße Rosen. Er fand sie unnatürlich. Aber sie konnten ihn ja jetzt nicht mehr stören. Und Johanna nahm sich vor, sein Grab jedes Jahr aufs Neue mit diesen Blumen zu dekorieren.
Bei der Beerdigung fand Johanna Stütze in ihren drei Freundinnen. Sie standen gemeinsam vor dem Grab. Alle in Schwarz. Vier Frauen mitten im Leben. Und Schwarz stand ihnen außerordentlich gut.
Schon im darauffolgenden Herbst verunglückte Christines Ehemann Ferdinand.
Ferdinand war Hobbyflieger. Seine Eta stand im Hangar, und er liebte sie mehr als seine Tochter oder seine Frau. Wichtig war ihm aber auch, wie er auf alle Frauen im Segelflieger-Club wirkte. Er konnte von Glück reden, dass keiner der gehörnten Ehemänner ihn je mit einer fremden Ehefrau in einer der Hallen erwischt hatte. Die Chancen dafür standen nicht schlecht, aber er war in diesen Dingen eben ein Glückskind. Und so feierte sich Ferdinand immer noch als den begehrenswertesten Segelflieger seiner Region. Christine wusste von seiner Umtriebigkeit und hatte sich damit abgefunden.
Sie genoss die langen Gespräche mit Mathilda, Sophia und Johanna. Sie gaben ihr Kraft und Zuversicht.
So kam es auch, dass sie die hübsche, noch nicht lange verwitwete Sophia mit zum Flughafen brachte. Es brauchte nicht viele Worte, und Ferdinand hatte nur noch Augen für die junggebliebene Witwe. Er fragte sie, ob er ihr mal sein Flugzeug zeigen solle und freute sich, dass Christine ihm keine Szene machte.
Zu dritt liefen sie um das fast zehn Meter lange und über dreißig Meter breite Flugzeug herum. Ferdinand checkte alle wichtigen Steuerteile und demonstrierte sein Fachwissen vor Sophia. Christine folgte den beiden mit wenigen Metern Abstand. Auch sie checkte die Maschine. Sie wollte sicher gehen, dass ihrem Mann nichts passierte, was nicht in ihre Lebensplanung passte.
Mehrfach fragte Ferdinand nach, ob Sophia mit ihm eine Runde drehen wollte. Aber sie schüttelte nur lachend den Kopf. Dann halfen die beiden Frauen Ferdinand das Flugzeug nach draußen zu schieben.
Christine überlegte noch, ob sie eines der Funkgeräte mitnehmen sollte. Einfach, um noch ein bisschen in Verbindung zu bleiben. Letztendlich entschied sie sich aber dagegen. So ein Segelflug war doch erst dann richtig schön, wenn man ihn in aller Stille verfolgen konnte.
So saß sie neben Sophia in einem der Liegestühle und beobachtete das konstante Aufsteigen ihres Mannes. Als sie die Unruhe im Tower und unter den anderen Seglern bemerkte, konnte sie Ferdinand schon gar nicht mehr sehen. Sie holte zwei Gläser Champagner für sich und ihre Freundin. Sie stießen miteinander an und wünschten dem Piloten dort oben eine gute Zeit.
Dass Ferdinand vergessen haben musste, sowohl das Höhenruder als auch die Trimmflosse ordentlich zu überprüfen, traf alle überraschend. Letztendlich wurde es aber seinem Interesse an Christines Freundin zugeschrieben.
Genau das hatten die anderen Clubmitglieder hinter vorgehaltener Hand oft schon kommen sehen. Sein Sinn für Frauen würde ihn noch einmal Kopf und Kragen kosten. Und so war es nun auch.
Er hatte keine Chance. Die Thermik war grandios, und er trieb höher und höher. So lange, bis die Thermik sich dann für eine andere Richtung entschied. Steuern ließ sich der Gleiter aber nicht. Sein Flugzeug und seine Leiche wurden wenige Stunden gefunden, nachdem er Sophia zum Abschied, vor den Augen seiner Frau, schelmisch auf den Po geklopft hatte.
Schon eine Woche später hatte sich Christine aus dem Segelfliegerclub abgemeldet. Was sollte sie dort noch?
Wieder standen die vier Freundinnen gemeinsam am Grab und gaben sich Halt.
Christine trug ihren neuen Lippenstift und sah mit dem neuen Kurzhaarschnitt ganz bezaubernd aus unter ihrem zarten schwarzen Schleier.
Mathildas Mann Paul mochte die Freundinnen seiner Frau nicht. Er mochte generell kaum etwas, wofür sie sich begeisterte. Aber drei Frauen, die ihr Leben ohne die starke Hand eines Mannes bestritten, waren ihm suspekt. Immer wieder wies er Mathilda darauf hin, was für ein Glück sie habe, dass es die Gatten der drei anderen seien, die verstorben waren. Dass sie noch einen Mann habe, der mitten im Leben stehe und seine besten Jahre noch vor sich hätte.
Bei dieser Prognose stellten sich Mathildas Nackenhaare auf, und sie suchte Trost bei Christine, Sophia oder Johanna.
Vor ein paar Jahren war das noch anders. Da hatten sie sich sogar ein Hobby geteilt.
Mathilda und ihr Mann hatten den Bootsführerschein gemeinsam gemacht. Mathilda fand den Gedanken, ein eigenes Boot über den See zu steuern, romantisch. Sie freute sich, als Paul sich bereit erklärte, dieses Boot zu kaufen. Dass er dafür ihre Lebensversicherung, die den Kindern zu Gute kommen sollte, auflöste, verletzte sie aber sehr.
Ihr Mann brachte seine Gedanken bei einem Abend mit gemeinsamen Freunden auf den Punkt.
»Ich schwöre euch, dass ich mindestens zehn Jahre länger leben werde als unsere Mathilda hier. Und so lange kann ich auch noch für sie sorgen.«
Zumindest entschied er sich nicht für einen dieser hässlichen Plastikkähne, sondern wählte ein wunderschönes Riva-Boot. Es war eine Aquarama. Und es war ein Schmuckstück.
»Master Paul« hatte ihr Mann das Boot taufen lassen. Der Name prangte hinten, oberhalb der Leiter, in messingfarbenen Buchstaben. Mathilda fand diese Bezeichnung abstoßend und arrogant.
Für Paul kam ein Umtaufen nicht in Frage. Abgesehen davon, dass er der Meinung war, so etwas brächte Unglück, gefiel ihm seine Namenswahl absolut. Mathilda wollte keinen Streit und verzichtete auf weitere Kritik. Aber immer wenn sie aus dem Wasser kletterte und über diese zehn Buchstaben hinweg stieg, widerte es sie an.
Sie hatten beide den Bootsführerschein gleichzeitig bestanden. Sie selbst sogar mit einer weitaus besseren Punktzahl als ihr Mann. Und dennoch ließ er es nicht zu, dass sie das Ruder übernahm. Autos, Boote und alle anderen Fahr- und Flugzeuge seien nichts für Frauen. Es war seine Riva. Und dass er das Boot von ihrem Geld gekauft hatte, tat hierbei nichts zur Sache.
An guten Tagen genoss es Paul, das Boot zu verlassen und im See zu schwimmen. Wenn, und nur für den Fall, dass ihm im Wasser etwas passiere, dürfte Mathilda den Motor anlassen und ihm zu Hilfe kommen. So sagte er stets, wenn er ins Wasser glitt. Dass Mathilda das Boot nicht verlassen durfte, während er sich im Wasser befand, war für ihn eine Selbstverständlichkeit.
Es war ein Freitag im letzten Sommer, an dem ihn eines der Leihboote nur knapp verfehlte. Mathildas Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie erkannte, dass ihr Mann das Boot rechtzeitig hatte kommen sehen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er es nicht im letzten Moment wahrgenommen hätte.
Aber man konnte nicht alles haben. Das Leihboot hielt sich immer noch in Sichtweite auf. Die Situation machte Mathilda gleichermaßen Angst wie Mut. Die drei Personen an Bord der weißen Yacht waren von hier aus kaum zu erkennen.
Paul war gute dreißig Meter vom Boot entfernt, als sie die Treppe hochklappte.
Es gab kein Zurück mehr. Es waren hier draußen keine weiteren Boote in Sicht, und Mathilda startete den Motor. Sie fuhr nicht schnell. Sie fuhr nur weit genug weg, bis sie seine wütenden Schreie nicht mehr hörte. Nach einer Stunde rief sie die Polizei. Die Treppe trieb schon lange wieder im Wasser, und ihre Verzweiflung war echt.
Sie haben seine Leiche nie gefunden. Und sie haben ihr auch keine große Hoffnung gemacht. Hier, an dieser Stelle, war die Strömung stark und das Wasser tief. Sie sagten, der See werde sich um ihn kümmern. Und Mathilda wusste, dass sie Trost und Zuverlässigkeit bei ihren Freundinnen finden würde.
Es wäre ihr nicht Recht gewesen, ihn irgendwo dort unten zu wissen. Irgendwie war es ihr wichtig, dass sie wusste, wo er war.
All das war nun fast ein Jahr her. Sie war drüber weg, und seine Lebensversicherung würde bald an die Kinder ausgezahlt werden.
Die Sonne schien auf das Innenleben der Yacht und auf den hinteren Ruhebereich. Gleich nach Pauls Tod hatte Mathilda das Boot restaurieren lassen. Das ursprünglich türkise Kunstleder wurde entfernt und die Messingbuchstaben ebenfalls. Nun strahlte die Lady M. in edlem Holz und beeindruckendem Weiß.
Sophia und Johanna lagen auf ihren großen Badelaken. Sie trugen bunte Einteiler und Sonnenhüte, die ihnen Schatten spendeten. Johannas Bildband der Kunst lag auf der hinteren Bank. Sie hatten das Erscheinen des Buches zu viert gefeiert, und jede war stolz darauf, wie schnell und souverän Johanna in ihrem Studium Erfolge sammelte.
Sophia wirkte entspannter als in der ersten Hälfte ihres Lebens. In ihrem orangefarbenen Badeanzug sah sie aus wie ein junges Mädchen. Sie lachte viel und laut, und es gab kaum einen Abend, an dem nicht irgendein Mann der Damengruppe eine Runde Champagner spendierte, in der Hoffnung, dass Sophia sich mit einem Lächeln bedankte. Sie hatte es geschafft, sich noch mit fast sechzig Jahren als Yogalehrerin zu etablieren. Der Sport bekam ihr gut, und ihr Körper war beneidenswert gut definiert.
Als Johanna und Sophia merkten, dass sie bald wieder in den Hafen einfuhren, begannen sie, ihre Sommerkleider überzuziehen und die Laken zusammenzulegen.
Sie kamen nach vorne zu Mathilda und Christine. Gemeinsam standen sie an Bord des schönen Bootes, das nun Mathilda gehörte. Der Wind bewegte das leicht ergraute wellige Haar der Frau hinter dem Steuerrad, und ein entspanntes Lächeln spielte um ihre Lippen. Auf der großen, roten Tonne, die die Einfahrt in den Hafen markierte, saß eine Möwe.
Rechter Hand konnte man schon die bunten Fahnen an den Anlegestellen sehen. Die Flaggen waren im vergangenen Jahr erneuert worden. Die Piratenflagge hatten die vier Frauen für die Hafenbesitzerin gekauft. Sie wehte neben den anderen im Wind und gab den Fahnen etwas Humoriges.
Paul hätte sich über den Mangel an Ernsthaftigkeit sicher beschwert. Er nahm immer alles zu ernst. Sogar den Spaß.
Er konnte sich nie mal ein bisschen gehen oder treiben lassen. Umso ironischer war es, dass ihm nun quasi gar nichts anderes mehr übrig blieb.
Die vier Frauen nickten der roten Tonne kurz zu. Die Möwe zeigte sich unbeirrt.
»Schön, er hat Gesellschaft.« Christine nippte an ihrem Chardonnay.
»Rot steht ihm gut.« lächelte Christine.
Alle vier Frauen lachten und prosteten sich ein letztes Mal vor dem Anlegen zu.
Mathilda steuerte die »Lady M.« sicher und souverän in den Hafen. Gemeinsam legten die vier Freundinnen an und halfen sich gegenseitig aus dem Boot.
So wie in den letzten Jahren auch.
Reingelegt
Was für ein Spaß. Gleich sollte es losgehen. Die Kameras und Mikrofone waren installiert und in Betrieb. Die Szenen waren arrangiert und der Gast geradezu perfekt. Genau der Typ Mensch, der sich überall einmischt. Mitte 50, einsam und optisch derart durchschnittlich, dass er auf den ersten Blick geradezu langweilig wirkte.
Alles lief wie geschmiert. Seit fünfzehn Jahren wurde die Sendung nun schon vom gleichen Team produziert.
Gut, es gab schon mal einen anderen Kameramann. Der Hodenkrebs hatte Sergio gnadenlos dahingerafft. Einer der Co-Produzenten hatte sich vor vier Jahren betrunken mit seinem Alfa um den Baum gewickelt, und der ein oder andere technische Mitarbeiter war nach einem Verhältnis mit der Frau des Regisseurs fristlos gekündigt worden. Aber was soll´s? So ist das Business. Heute hier und morgen dort. Zuschauerzahlen und Quoten waren wichtiger als der eigene Puls und Blutdruck. Und sowohl die Zahlen als auch die damit einhergehenden Quoten waren nach wie vor stabil und hoch.
Die Sendung wurde in all den Jahren weder konzeptionell noch inhaltlich überarbeitet oder verändert.
Never change a running system, hieß es. Der Spruch war hier absolut angebracht. Und Reingelegt war ein überaus gewinnbringendes Produkt. Ein funktionierendes Team bildete gemeinsam mit kostengünstig arbeitenden Jungschauspielern ein Konglomerat, das effizienter nicht sein konnte.
Gregor, der im Nachbarzimmer die Regie führte, kaute auf den Nägeln. Es war nach all den Jahren immer noch ein Ausdruck seiner Nervosität. Hin und wieder warf er den beiden Jungs am Mischpult hinter den fünf Monitoren einen aufmunternden Blick zu. Dann hob er sich an seinen Armlehnen aus dem Stuhl, beugte sich vor, setzte sich zurück und lehnte sich wieder an. Es konnte losgehen. Der Produktionsassistent, der auf einem der beiden rollbaren Flightcases saß, hörte auf, mit seinen Händen auf die Oberschenkel zu trommeln, und blickte fasziniert zu den Bildschirmen.
Zwei Kameras fingen den Platz ein, an dem der Schauspieler gleich in Aktion gehen würde. Eine weitere erfasste den ganzen Raum. Die wichtigsten beiden Kameras hielten den Gast aus unterschiedlichen Blickwinkeln im Bild.
Noch war alles ruhig. Das spätere Sendungs-Opfer saß ahnungslos am Tisch und verspeiste unauffällig seine Nudeln.
Mit einem »Go« öffnete sich die Tür der Wirtschaft, und ein junger Mann mit Jeans und Lederjacke betrat den Gastraum. Zielstrebig steuerte er den Tisch neben dem Gast an und ließ sich auf die Bank fallen.
Die beiden Kameras, die auf den Herrn hinter den Nudeln gerichtet waren, zeigten noch keine größere Reaktion an.
Der Mann schaute nur kurz auf und blickte gleich wieder auf seine Spaghetti.
Nach nicht ganz dreißig Sekunden begann der Mann in der Lederjacke lauthals nach der Kellnerin zu rufen. Und als diese ihm zu verstehen gab, dass sie sich gleich um ihn kümmern werde, fluchte er und forderte eine sofortige Bedienung.
Wieder passierte nichts.
Dann kam die Kellnerin und brachte dem Gast hinter den Nudeln ein Glas Limonade. Sie lächelte ihn an und schüttelte mit dem Kopf, als der Gast hinter ihr sie aufforderte, jetzt sofort zu kommen, um seine Bestellung aufzunehmen.
Die junge Frau drehte sich um und stellte sich mit ihrem Block in der Hand vor den neuen Gast.
»Ich will ein Bier und ein Schnitzel mit Pommes. Aber pronto!«
Der Kerl legte einen Fuß auf den Stuhl vor ihm und klatschte in die Hände.
Die Kellnerin schrieb die Bestellung auf und bat ihn, den Schuh vom Polster zu nehmen.
Sie tat das nett und freundlich und gut hörbar für den Herrn, der nur einen Tisch weiter saß. Aber dieser hob wieder nur kurz den Kopf.
»Verzisch dich in die Küche, Schnittchen. Den Stuhl kannst du ja später wieder sauber machen. Und jetzt hopp!«
Die junge Frau drehte sich um und warf den Gast am anderen Tisch einen entschuldigenden Blick zu.
Dann ging sie zügig in Richtung Küche.
Der Mann am Tisch daneben blieb seltsam ruhig. Aber es konnte nicht mehr lange dauern. Sein Blick sprach Bände. Ständig pendelten seine Augen mittlerweile von seinen Spaghetti hinüber zum anderen Tisch, wo der junge Mann die hübsche blonde Kellnerin schikanierte.
Mit einem Teller und einem Glas Bier in der Hand kam sie zurück. Sie sah irgendwie ein bisschen ängstlich aus.
In der Regie beglückwünschte man sich kurz zur Auswahl dieser talentierten Jungschauspielerin. Man nahm ihr voll und ganz die verängstigte Bedienung ab. Ihre Blicke wirkten nervös hilfesuchend.
Am Tisch stellte sie Teller und Glas ab.
»Recht so?«
»Was heißt hier Recht so? Das ist ein Pils. Ich hatte ein Weizen bestellt.«
Der Kerl nahm das Glas und stellte es weiter von sich entfernt auf den Tisch. Dabei spritzte die Hälfte des Getränks auf die Schürze der Kellnerin.
»Ich will jetzt mein Weizen, du dusselige Schnecke. Aber hurtig.«
Um seine Sätze zu unterstreichen, stand er sogar kurz und bedrohlich auf.
Wenn der Gast am Nachbartisch nicht bald eingriff, mussten sie ein bisschen aggressiver an die Sache herangehen. Sie wollten ja auch nicht ewig warten. Es gab heute noch zwei weitere Folgen zu drehen, und wenn sie sich in dem Mann geirrt haben sollten, dann war es besser, rechtzeitig abzubrechen und auf ein anderes Opfer zu warten. Dann würde in ein paar Wochen jemand anderes über den Bildschirm flimmern und darauf hingewiesen werden, dass er oder sie soeben medientechnisch aufs Glatteis geführt wurde.
Sobald alles im Kasten war, kamen sie immer mit der großen Kamera. Alle würden lachen und klatschen. Der ungewollte Darsteller wurde darauf hingewiesen, dass er reingelegt worden war. Dann wurde er freundlich umarmt und man zeigte ihm, wo sich die Kameras befanden, die ihn in den letzten Minuten aus allen möglichen Perspektiven aufgezeichnet hatten.
Die Kellnerin kam zurück. Ihr Schritt war zaghaft und der Blick zu dem Gast am Nachbartisch hätte die Herzen jedes Mannes gebrochen, der auch nur den geringsten Impuls verspüren konnte, einem Menschen zur Seite zu stehen. Der Mann mit der Lederjacke stand auf, schaute auf das Glas in ihrer Hand und schlug mit beiden Händen auf den Tisch.
Dann ging alles ganz schnell. Keiner wusste, an welcher Stelle der Punkt erreicht war. Aber der untersetzte, unauffällige Mann stand plötzlich zwischen der jungen Frau und dem Schauspieler, der hier die Rolle des rüden Gastes gab.
Er sagte kein Wort. Seine Bewegungen waren schnell, aber kaum wahrnehmbar. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, wandte er sich nach wenigen Sekunden wieder ab und ging zurück auf seinen Platz.
Der junge Schauspieler drehte sich langsam um. Das Bild wirkte irritierend. Was spielte er da? Mit seinen Bewegungen nahm er der Szene die Dynamik. Das war nicht gut. Dann senkte er den Blick und nahm die Hände von seinem Bauch. Das große Messer steckte unterhalb seiner Rippenbögen. Der nach unten weisende Griff bedeutete, dass sich die Klinge mitten in seinen oberen Organen befinden musste. Im Raum herrschte unfassbare Stille. So lange bis der junge Mann nach vorne auf die Knie fiel und die Schauspielerin, die bis gerade eben die hilflose Kellnerin gespielt hatte, in einen langen lauten hysterischen Schrei ausbrach.
Felix hatte alles richtig gemacht. Das wusste er. So hatte er es in der Therapie gelernt. Er war ganz ruhig geblieben. Diese Spaghetti hier waren die ersten seit sieben Jahren in der geschlossenen Anstalt. Er hat es nicht angefangen. Er hat sich nicht provozieren lassen. Erst als es gar nicht mehr anders ging, hat er sich an seine Möglichkeiten erinnert. Er darf keine Menschen verletzen. Das weiß er. Aber in solch einem Fall muss er doch reagieren. Der Mann hat der Frau weh getan, und man tut keinen Frauen weh. Das hatte er nun doch gelernt. So heißt es immer. Man bringt seine Mutter nicht um und man wirft seine Schwestern auch nicht aus dem Fenster. Ja, er hatte in der Vergangenheit Fehler gemacht. Aber er hatte es sich eingeprägt. Ein Mann muss Frauen beschützen.
Und er, Felix Gerdes, hat alles richtig gemacht. Er hat diese junge Frau, die ihm so lieb das Essen gebracht und ein paar freundliche Worte mit ihm gewechselt hat, beschützt. Er ging zurück auf seinen Platz und griff nach seiner Gabel. Die Spaghetti waren einfach zu lecker. Und dieser ganze Betrieb und diese hektischen Leute, die aus allen möglichen Räumen liefen, würden ihn nicht davon abhalten, seine Mahlzeit zu beenden.
Böse Zellen
Zum dritten Male schob sie die Schubladen ihres Schreibtisches zu. Mit den Händen auf den Schenkeln schloss sie die Augen und überlegte fieberhaft, wo er sein könnte.
Dann ging ihr der Gedanke durch den Kopf, dass er auch keinem Arzt oder Sanitäter in die Hände fallen würde, wenn sie selbst ihn nicht fände. Einen Moment war sie beruhigt, aber dann wurde sie doch wieder nervös.
Ihr Organspendeausweis musste unbedingt vernichtet werden. Sie hatte das Formular gleich, als sie wieder draußen war, mit bestem Willen ausgefüllt. Sie wollte gut sein. Nach all dem Schaden, den sie angerichtet hatte. All dem Blut, das an ihren Händen klebte. Es war nicht so, dass sie ihre Taten bereute. Aber es reizte sie nicht mehr zu töten.
Body Memory nannten sie es in diesem Artikel. Sie hatte vorher schon davon gehört, aber sich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Sie war in der Praxis ihres Therapeuten auf die medizinische Abhandlung gestoßen. Im Anschluss hatte sie sich beinahe vierundzwanzig Stunden am Stück alle Informationen darüber im Internet angesehen.
Wenn es wirklich so war, dann würde sie mit ihrer Hilfe nichts als Schaden anrichten. Gar nicht auszudenken. Ihre Lunge, ihr Herz, Leber, Niere, Netzhaut. Alles Top in Schuss. Und alles wiederum tödlich. Nicht für den Empfänger. Für sein Umfeld.
Schon häufig hatte man gehört, dass Organempfänger Eigenarten ihres Spenders annahmen. Eigenarten.
Waren Impulse, die einen zum Serienmörder werden lassen, Eigenarten?
Hier ging es nicht darum, dass ein Einzelgänger zum Partylöwen, ein Tierfreund zum Hundehasser wird.
Was, wenn sich Körperzellen nicht umprogrammieren ließen?
So wie ihr Kopf? Wenn alle angelegten Impulse angelegt blieben?
Ihr Vater starb in lebenslanger Haft. Selbst im Gefängnis hatte er versucht, einen der jüngeren Zellengenossen zu töten. Als der Junge zwischen seinen Händen schon blau anlief, wurde er von dessen Liebhaber überrascht.
Man fand später Teile des Gehirns ihres Vaters an der Wand und am Boden.
Paola wusste nicht, ob Sträflinge für Organspenden zur Verfügung ständen. Aber sie glaubte nicht. Dieser Artikel regte sie unfassbar auf.
Es war egal, wie gut sie sich im Griff hatte. Wie gut sie heute die Dinge und ihre Taten verstand. Vierzehn Jahre Gefängnis und vier Jahre Therapie hatten ihr zwar die nötige Kontrolle über ihren Geist verschafft, aber ihre Organe und Zellen waren – wenn es denn stimmte – noch ganz anders programmiert. Ihren Kopf konnte sie steuern, aber tief drinnen war alles wohl noch beim alten.
Paola wollte die Suche nach dem Ausweis nicht eher abbrechen, als dass sie ihn finden würde. Finden und vernichten.
Ohne dieses Dokument würde sie sich sicherer fühlen.
Mittlerweile stand ihr der kalte Schweiß im Nacken. Ihre Hände waren kalt, und ihr Hals war trocken. Durch die Müdigkeit hatte sie schon seit Stunden rasende Kopfschmerzen. Und ihr Gesicht fühlte sich taub an. Sie lief vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer und von dort aus ins Bad. Eine eigenartige Panik überkam sie, und sie drückte den roten Knopf ihres Notrufgerätes. Ihr Therapeut und die Klinik würden gleich über Lautsprecher zu hören sein. Sie würde ihnen sagen, dass etwas nicht stimmte. Dass sie Hilfe brauchte. Der Schmerz in ihrem Kopf explodierte.
Als sie vor dem Gerät im Flur stand, traf es sie wie ein Schlag. Und genau das war es auch. Ein Schlaganfall.
Sie stürzte zu Boden und riss dabei zwei der Schubladen aus der Kommode mit sich. Unter all den gesammelten Post- und Visitenkarten segelte auch das kleine dreifarbige Dokument herab. Ihr Organspendeausweis.
Er kam auf ihrer Brust zu liegen, und sie versuchte danach zu greifen. Aber sie hatte ihre Hände nicht mehr unter Kontrolle.
Auf ihrem Notrufgerät rief jemand ihren Namen, aber Paola konnte nicht antworten. Ihr fielen keine Worte mehr ein, und ihr Mund brachte nur noch gurgelnde Geräusche hervor.
Sie fühlte sich hilflos und verraten. Der Raum um sie herum schien sich zu weiten. Und sie hatte den Eindruck, dass nach und nach alle ihre Mordopfer um sie herum standen und auf sie hinab blickten. Es waren mehr Seelen, als sie in Erinnerung hatte. Sie hatte tatsächlich einige vergessen. Ihr Gesicht verzog sich zu einem schiefen Lächeln.
Als wenig später ihre Tür aufgebrochen wurde, waren schon so viele Hirnzellen beschädigt, dass Paola auf keine Ansprache mehr reagierte. Der Notarzt ließ Paola in den Krankenwagen bringen. Den Organspendeausweis nahm er mit. Er war beeindruckt von der Frau, die offenbar trotz ihrer Probleme die Weitsicht hatte, sich als Organspenderin erkennen zu geben. Die Patientin war Mitte vierzig, und ihr Körper schien unverletzt. Sie würde vielen Menschen helfen können.
Hermann erwachte aus seiner Narkose. Er wusste seinen Namen und warum er operiert worden war. Das helle Licht blendete, aber es störte ihn nicht weiter.
Für die nächsten Jahre würde er keine Probleme mehr mit Tachykardien und Bradykardien haben. Keine ständige Sorge, dass die alte Pumpe einfach aufgab. Das neue Herz schlug vorbildlich.
Er hatte es geschafft.
Mit seinen 38 Jahren und einem funktionierendem Herzen hatte er eine Lebenserwartung von gut achtzig Lenzen. Hermann lächelte.
Rund um ihn summten, sirrten und pfiffen allerlei Anzeigen und Geräte. Es machte ihm nichts aus.
Bevor er in den OP-Raum geschoben wurde, hatte er noch gehört, dass mehrere Transplantationen anstanden. Offensichtlich war jemand gefunden worden, dessen Organe nun bei diversen Empfängern eingesetzt werden sollten.
Hermann war dankbar.
Eine Krankenschwester betrat sein Zimmer, und sein erster Gedanke war »Geiler Arsch!«
Seinen zweiten Gedanken konnte er sich selbst nicht erklären. Der war nämlich: »Wie wird sie klingen, wenn man ihr eines dieser eigenartigen Messinstrumente in den Hals rammt?«
Dann schlief Hermann ein. Wieder lächelte er. Dieses neue Herz schenkte ihm viele Jahre eines neuen Lebens. Und eine völlig neue Energie. Er hatte Zeit.
Vaterschaft
Zum dritten Mal nimmt Silvio das Schreiben in die Hand. Dann rauft er sich die Haare und wirft das Dokument wütend auf den Glastisch zurück, auf dem auch seine Zigaretten und die Autoschlüssel liegen.