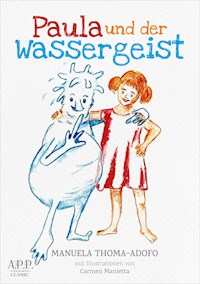Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
33 Grausamkeiten … ist eine kleine Sammlung von liebenswerten, widerwärtigen, erotischen, verdorbenen, bösartigen und überraschenden Kurzgeschichten aus der Feder von Manuela Thoma-Adofo. Manchmal abstoßend, immer anziehend. Fesselnd und aufregend. Alles in allem kurzweilig und aber definitiv nichts für das sanfte Gemüt oder einen ruhigen Schlaf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Mutti
Inhaltsverzeichnis
Der Amokläufer
Oma Pusch
Schöne Füße
Sein bestes Stück
Das Eisfach im Hotel
Keine Hoffnung
Ein wunderbares Paar
Von Fred und Carla
Die Fütterung
Pechvogel I
.
Pechvogel II
.
Ersatzteillager
Schöne Worte
Die Reisegruppe
Die fröhliche Mareike
Der Spanner
Selber schuld
Auge um Auge
Schlechte Eltern
Die Frau am Fenster
Gefällt mir
Versetzt
Ein gutes Herz
Starbucks
Schwarz & Schwarz
Das Prachtstück
3D / 3F
Der alte Herr Schneider
Die Fotografin
Campingurlaub
In Liebe deine Schwiegermutter
Die sieben Todsünden
Hochmut/Stolz
Geiz/Gier/Habsucht
Unkeuschheit/Wollust
Zorn/Rachsucht
Unmäßigkeit / Völlerei
Neid
Trägheit
Danke!
Der Amokläufer
Er lag bäuchlings auf der Brücke. Sein Kaugummi schmeckte schon schal, und er schob sich einen weiteren Streifen direkt aus der Hülle in den Mund. Er hatte mal gesehen, wie irgendein Fernsehkommissar es so machte. Vielleicht war es auch nur die Wrigleys-Werbung gewesen.
In seiner Hand lagen schon die ersten fünf Steinchen, und mindestens fünfzig weitere hatte er in dem kleinen Lederbeutel, der neben ihm lag, gesammelt.
Wenn es endlich so weit war, wollte er sich vorstellen, dass es die Munition eines Luftgewehrs sei und er ein Heckenschütze, über den man schon in den Zeitungen und im Fernsehen berichtete.
Niemand würde wissen, wer er war und welche Gefahr von ihm ausging, aber jeder würde ihn fürchten. Wobei der Gedanke an sich noch nicht ganz befriedigend war. Denn eigentlich wollte Markus durchaus, dass man wusste, wer er war. Jeder sollte seinen Namen kennen und fürchten. So war es besser.
Markus Felger, der Horror der Straße, der Autobahnkiller, der Sniper. Sein Name und sein Gesicht sollten Angst und Schrecken verursachen. Niemand würde ihn finden, und jeder hätte Furcht, ihm bei Nacht und Nebel über den Weg zu laufen.
Er legte sich auf den Rücken und verschränkte die Hände im Nacken. Diese Idee, diese Vorstellung ließ ihn träumen.
Die Frauen würden vor lauter Angst fast ohnmächtig werden und die Männer hätten Respekt und wechselten die Straßenseite, wenn sie ihn sahen. Alle würden ihn jagen, aber keiner könnte ihn fassen. Weil er schneller, klüger und gerissener war als die Polizei, das FBI, das CIA und der KGB zusammen.
Markus kratzte sich an der Stirn.
Vermutlich würde er auf FBI, KGB und CIA verzichten müssen. Er glaubte nicht, dass es diese Organisationen wirklich gab. So was lief doch immer nur im Fernsehen. Er spuckte seinen Kaugummi aus, drehte sich wieder auf den Bauch und schob einen neuen in den Mund. Das Geräusch eines herannahenden Wagens riss ihn aus seiner Phantasie. Jetzt sollte es endlich so weit sein. Markus schob seine Sonnenbrille zurück auf die Nasenwurzel und brachte sich in Stellung. Sobald das Auto den letzten Markierungspfosten an der linken Seite passiert, würde er loslegen. Ganz schnell hintereinander.
Zackzackzack. Wie ein Maschinengewehr.
Das Auto war nur noch hundert Meter entfernt. Nur noch fünfzig. Markus hob die Hand mit dem Steinchen.
Und ließ sie wieder sinken. Nein, das war nicht das richtige Modell, sagte er sich. Vor Aufregung hatte er auch noch seinen Kaugummi verschluckt. Sein Herz pumpte wie verrückt, und seine Hand zitterte, aber so war das vermutlich bei allen Mördern.
Zumindest am Anfang.
Der Nächste würde es sein. Und dieses Mal hätte er keine Gnade.
Ein BMW Kombi wechselte auf die rechte Spur. Markus kannte das Modell nicht. Er erkannte lediglich, ob ein Wagen ein Mercedes, ein Audi, ein BMW oder ein VW war, und bei den Asiaten tat er sich schon schwer. Von den Marken, die er kannte, konnte er allerdings auch die unterschiedlichen Modelle meist überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Dieser hier war jedenfalls eindeutig ein BMW. Und ein Kombi.
Wieder schob Markus seine Sonnenbrille ein wenig hoch und nahm die Steine in die Hand. Drei. Zwei. Eins.
Er ließ die Handvoll Steine einfach zwischen seinen Fingern hindurch von der Brücke gleiten.
Zu seinem Stolz hatte er den BMW tatsächlich nicht verfehlt. Gut, die Steine waren bloß aufs Dach gefallen und hatten die Scheibe nicht zerstört - sie hatten sie ja noch nicht mal berührt - aber getroffen hatte er. Schnell krabbelte er auf die andere Seite der Brücke.
Der Fahrer des Kombi bremste und zog dann mit eingeschaltetem Warnblinker auf den Standstreifen.
Markus blieb fast die Luft weg. Er sprang auf, griff sich seinen Lederbeutel mit der Munition und rannte, so schnell seine Füße sein Übergewicht trugen, in das angrenzende Waldgebiet. Die Angst, dass der Fahrer ihn gesehen haben könnte, hatte bereits eine Spur in seiner Unterhose hinterlassen, das spürte er. Aber alles in allem war er mit sich zufrieden. Er hatte den Wagen getroffen und den Lenker sicherlich zu Tode erschreckt.
Markus stützte sich atemlos mit den Händen an seinen Knien auf, grinste und versuchte, zu etwas Luft zu kommen. Dann richtete er sich wieder auf.
Er schüttete die verbliebenen Steinchen in das Moos und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann lief er los. Nach dieser Tat brauchte er erst einmal eine Stärkung. Zuhause im Kühlschrank hatte seine Mutter bestimmt noch ein bisschen von dem Makkaroni-Auflauf.
Den hatte er sich verdient. Und auf seinem Weg träumte er weiter von seiner Karriere als Amokläufer.
Jeder würde seinen Namen kennen. Sein Bild. Seine Geschichte.
Monika Felger saß vor dem kleinen Fernseher in der Küche, als ihr Sohn die Wohnung betrat. Sie schaute fern und amüsierte sich oder stritt mit Barbara Salesch und Richter Alexander Hold.
Das Zimmer von Markus hatte sie schon am Vormittag in Ordnung gebracht. Gleich nachdem ihr Sohn das Haus verlassen hatte, räumte sie die benutzten Taschentücher vor seinem Bett fort und stapelte die DVDs mit den Actionfilmen auf dem Nachttisch.
Sie wusste, dass er bis an ihr Lebensende nicht ausziehen würde. Aber was solls. Er war ein guter Junge, und außerdem hatten sie ja nur noch sich selbst.
Obwohl Markus es ihr schon ein paarmal verboten hatte, räumte sie diese scheußliche Pistole, die unter seinem Kopfkissen lag, und das gebogene Messer in dem Lederetui auf den Tisch neben der Tür.
Sie mochte so etwas überhaupt nicht im Haus haben. Aber letztendlich war der Junge ja auch schon bald dreißig. Sie konnte ihm diese Dinge nicht mehr verbieten.
Markus lag auf seinem Bett. Die Erdnussflips, die er sich aus der Vorratskammer mitgenommen hatte, krümelten ein bisschen, aber das war kein Beinbruch. Wenn er so auf dem Rücken lag, wirkte er gar nicht ganz so dick, fand er. Nur ein bisschen stämmig. Vielleicht sogar kräftig.
Seine Waffen lagen rechts und links neben ihm. Mutter begriff einfach nicht, dass seine Pistole und sein Jagdmesser nicht neben der frisch gewaschenen Wäsche liegen sollten, die sie ihm jede Woche auf den Tisch legte. Schon ein paarmal war er ganz nah dran, ihr die Knarre an die Rübe zu halten und sich ein bisschen Respekt zu verschaffen. Dann fiel ihm aber ein, dass er für die kommende Zeit hier alles alleine hätte machen müssen, und er verzichtete darauf.
Es war gar nicht so einfach gewesen, an die Pistole zu kommen. In dem Laden in der Stadt hatten sie allerlei Dinge von ihm gewollt. Seinen Ausweis sollte er zeigen, und von einem Waffenschein hatten sie geredet. Das hatte er natürlich nicht. Also den Waffenschein. Und seinen Ausweis wollte er nicht zeigen. Dann hätten die Falschen ja auch gleich gewusst, dass er bewaffnet war. Das wäre zu doof gewesen. Und doof war er ja nun nicht.
Jeder kannte den Typen mit der Hütte im Wald. Und es war ein offenes Geheimnis, dass er dort nicht nur Holz verkaufte. Der Kerl hatte einen Mords-Spleen und einen Hass auf alle, die keine echten Deutschen waren, so sagte er. Aber jeder wusste auch, dass er selber aus Klagenfurt zugezogen war. Also war er ja selber auch kein Deutscher, sondern Österreicher. Markus war es egal. Er war in Bayern geboren, hier aufgewachsen und nie woanders gewesen. Er war Bayer, und damit war er Deutscher. Der Typ konnte also schimpfen, wie er wollte.
Trotzdem hatte Markus Bammel, als er den Weg zur Hütte ging. Kurz bevor er an die Tür klopfen konnte, wurde diese von so einem spirreligen, kleinen Typen geöffnet, der ohne ihn anzusehen an ihm vorbei lief. Der war vielleicht nervös. Na ja, vielleicht war er Ausländer und hatte eine unschöne Begegnung mit dem Hüttenmann.
Markus erklärte sein Anliegen. Wenn einem schon einer Waffen verkaufte, dann sollte er auch wissen wofür. Denn legal war das, was der Hüttenmann dort oben betrieb, ganz sicher auch nicht.
Der Alte hat nur gelacht und etwas gefaselt, dass er fürs nächste genug von Amokläufern hätte. Dann nahm er das Geld, gab Markus die Pistole, erklärte ihm ein bisschen was über Munition und Umgang und schickte ihn wieder fort. Das Messer verkaufte er ihm ebenfalls noch.
Auf dem Weg nach Hause hatte Markus das Gefühl, dass jeder sehen würde, was er in seinem Rucksack trug.
Das war nun alles schon vier, fünf Wochen her.
Markus setzte sich auf und zog seinen Computer an sich heran.
Bei Google rief er zum hundertsten Mal alles auf, was ihm zum Thema Amoklauf einfiel. Allein der Begriff machte ihn unglaublich spitz. Das Wort war groß und mächtig. So wie er bald groß und mächtig sein sollte. Emsdetten, Virginia, Winnenden, Ohio, Erfurt und Utoya. Für alle anderen waren es irre Mörder. Für Markus waren es Helden.
So sollte man ihn auch mal finden können. Wenn man bei Google seinen Namen eingab, dann sollte sein Gesicht genau zwischen diesen Menschen auftauchen. Und nicht als stecknadelkopfkleine Fratze zwischen hundert anderen Arbeitern seiner Ladenkette.
Sie würden ihn zwar dann hassen, aber sie würden ihn kennen. Alle da draußen, die ihn bis jetzt nie beachtet hatten. Sein Foto käme bei RTL im Mittagsmagazin und auch bei Exclusiv im Abendprogramm. Günther Jauch, Sandra Maischberger und alle großen Namen würden über ihn sprechen.
Vermutlich würden sie sogar versuchen, Interviews mit ihm in der Gefängniszelle zu erbetteln. Er wäre ein Star. Ein Killer, ein Sniper, ein Amokläufer, aber ein Star.
Jedes Mal, wenn er daran dachte, bekam er eine Erektion und zog sich für ein paar Minuten in das Badezimmer seiner Mutter zurück.
Vielleicht würde er dabei draufgehen. Das war ihm egal.
Dann dachte er an seine Mutter, und wie sie ihn vermissen würde. Tränen stiegen in seine Augen, und er beschloss, doch besser mit dem Leben davon zu kommen. Außerdem könnte er tot auch keine Interviews geben.
Er würde zuschlagen. Jeden töten, der auf seiner Liste stand (und vielleicht noch ein paar mehr), und dann durch einen der Seitenausgänge fliehen. Ja, so war es besser. Man musste ja nicht gleich alles riskieren.
Zehn bis zwanzig Tote würden ihn schon unsterblich genug machen. Da musste er ja nicht dabei sein.
Markus war zufrieden mit seinem Plan.
Es sollte geschehen. Heute Nachmittag würde er, Markus Felger, in die Geschichte eingehen. Unsterblich werden. Gleich nach Dienstschluss würde er die Waffen aus seinem Zimmer holen und in die Einkaufspassage fahren. Dort würde er sein persönliches Feuerwerk abhalten. So wie alle anderen großen Amokläufer vor ihm. Erneut musste er die Toilette aufsuchen.
Die Stunden im Lager des Supermarktes zogen sich wie Kaugummi. Mit jeder Minute, die er seinem Feierabend näher kam, wuchs sein Herzklopfen, aber auch die Lust, sie alle zu töten. Alle, die ihn aus dem großen Supermarkt der Einkaufspassage geekelt hatten. Die dafür verantwortlich waren, dass er nun in diesem winzigen Laden arbeiten musste. Alle, die ihn fett und dämlich genannt hatten. Die hübschen Kassiererinnen, die blöde Witze über ihn rissen, der Lagerchef, der ihn beim Klauen erwischt und angeschwärzt hatte. Sie alle sollten sterben. Und jeder, der ihn aufhalten wollte, ebenfalls. Markus Felger. Morgen würde jeder seinen Namen kennen. Für die Jungs im Knast wäre er ein Held und für die Leute vom Fernsehen eine Sensation.
Punkt 17 Uhr war es dann so weit.
Markus legte seine Schürze ab und zog seine Popeline-Jacke an. Auch die Dienstschuhe stellte er an ihren Platz und zog die weißen Sneaker an, die ihm seine Mutter zum Geburtstag geschenkt hatte.
Das wäre etwas ganz anderes als Steinchen schmeißen und die Kinder aus der Mittelschule zu drangsalieren. Das war ganz großes Kino. Und jetzt würde es passieren.
Sein ganzes Leben zog an ihm vorbei, als er die Hintertür des Ladens öffnete, um zum letzten Mal als Markus Felger, die Flasche, das Weichei, der Niemand den Heimweg anzutreten. Er würde nach Hause fahren und seine Pistole und das Messer holen. Und dann gab es kein Halten mehr.
Die kühle Luft in seinem Gesicht wirkte wie eine erfrischende Dusche, und er schloss erfüllt von Vorfreude und Erregung die Augen. Und so kam es, dass er den Mann, der um die Ecke kam, nicht hatte sehen können. Aus einer Entfernung von wenigen Metern trafen ihn die Schüsse in Körper und Hals. Er begriff nicht was passierte, selbst als er rückwärts zu Boden fiel. Der kleine, dünne Mann mit diesem eigenartigen Lächeln und den beiden Pistolen in den Händen schoss wild um sich. Dann stand er über ihm und richtete noch einmal beide Waffen auf seinen Körper. Und schon wurde es Nacht.
Die ersten Artikel fanden sich schon am selben Abend in den Online-Ausgaben wieder, und morgen würden sie bundesweit in allen Zeitungen erscheinen.
Amoklauf nach Ladenschluss
Am Abend des 12. März kam es in Pullach zu einem schrecklichen Blutbad. Der aus Regensburg stammende Amokläufer Richard H. schoss aus heiterem Himmel und ohne jede Vorwarnung mit zwei Handfeuerwaffen auf unschuldige Passanten und verletzte einige von ihnen schwer. Einer der Verletzten, der Supermarktangestellte Markus F. (28) verstarb noch am Tatort, nachdem er von mehreren Kugeln des Killers getroffen wurde.
Bei Richard H. handelt es sich um einen Bankangestellten, den Freunde und Nachbarn als überaus ruhige und unauffällige Person beschreiben. Er war nicht verheiratet und lebte noch im elterlichen Haus, wo er sich gerne die Freizeit mit Computerspielen vertrieb. Niemand rechnete damit, dass dieser junge beliebte Mann das Potential eines Mörders in sich trug. Der Schrecken sitzt tief. Alle zwölf Personen, die von den Kugeln des Amokläufers getroffen wurden sind soweit außer Lebensgefahr. Außer Markus F.. Ihn erwischte der Killer mit mehr als fünf Kugeln im Bauchraum und am Hals. Er hatte keine Chance. »Das unschuldige Opfer Markus F. war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort«, so die Kripo München. »Es hätte jeden treffen können.«
Neben den Artikeln fanden sich viele Bilder vom Täter. Ein netter junger Mann, dessen Gesicht nun jeder kannte. Aber auch Markus Felger hätte sich auf einem oder zwei Fotos wiedergefunden. Auf denen konnte man seine weißen Turnschuhe sehen, die unter dem Tuch hervorragten. Und mit ein bisschen gutem Willen entdeckte man sogar noch die Blutflecken, die unter dem weißen Laken hervorschimmerten.
Oma Pusch
Oma Pusch, vielmehr Lisbeth Pusch und eigentlich sogar Elisabeth Friederike Pusch, stand an ihrem Fenster.
Der Notarztwagen hatte auf der gegenüberliegenden Straßenseite angehalten, und die Eile der Sanitäter bedeutete nichts Gutes. Nun verhieß die leere Abfahrt des Notarztwagens, dass es hier nichts mehr zu retten gab. Bald würde einer dieser schwarzen oder dunkelgrauen Wagen kommen, und zwei Männer würden eine hölzerne Kiste aus dem Haus tragen. Oma Pusch kannte dieses Schauspiel, und es war immer wieder berührend.
Dieses Mal traf es die Lehrerin aus der Nr. 28. Sie hatte sich erhängt, erfuhr man kurze Zeit später. Jemand hatte ihr Fotos ihres Exmannes mit einer ihrer Schülerinnen zugespielt. Daran war sie dann wohl endgültig zerbrochen. Schon sein Auszug aus der gemeinsamen Wohnung hatte sie schmerzhaft getroffen. Ihr Alkoholkonsum war schon vorher nicht gering, aber nun stieg er sprunghaft an. Dies ließ sich leicht am Altglascontainer im Hof erkennen. Nur sie trank den Gemüsesaft in Flaschen, und wenn die leeren Wodkaflaschen immer neben den leeren Bio-Gemüsesaft -Flaschen lagen, dann brauchte man nicht mehr lange zu kombinieren.
Oma Pusch mochte die Lehrerin. Selbst dann, wenn diese nicht immer nach oben grüßte, wenn sie am Fenster stand. Manchmal ließen Probleme eben nicht zu, dass man den Blick hob.
Dass die Wahl auf Erhängen fiel, sah ihr ein bisschen ähnlich. Ein in der Literatur – nach Gift – häufig gewähltes Werkzeug, um aus dem Leben zu scheiden. Und da es vermutlich zu schwer war an probates Gift zu gelangen, nutzte sie eben ihre Mittel. Zwei aneinander geknüpfte Ledergürtel ihres Mannes. Es wirkte fast ironisch. So kam sie doch bis zuletzt nicht aus seiner Umklammerung.
Die Beerdigung würde aller Voraussicht in der kommenden Woche stattfinden. Oma Pusch schaute auf den Kalender. Sie hatte Zeit. Sie würde hingehen.
Lisbeth verließ ihr Haus nicht sehr oft. Die Nachbarn boten ihr manchmal an, für sie einkaufen zu gehen. Das nahm sie gerne an. Die alten Beine wollten nicht immer so, wie sie es gerne gehabt hätte. Hin und wieder richtete sie sich dann aber doch und lief langsam und bedächtig zum Supermarkt oder zum Friseur oder zum Friedhof.
Schon vor etwa zwölf Wochen konnte sich Oma Pusch ihr hübsches, schwarzes Kleid wieder einmal überstreifen. Da wurde nämlich der junge Mann von nebenan mit laufendem Motor in seiner Garage gefunden. Für Lisbeth stand fest, dass sie auch ihm die letzte Ehre erweisen wollte. Es war einfach zu traurig, dass ihm jemand die Wahrheit darüber gesagt haben musste, dass er seine Kinder vermutlich nie wiedersehen würde. Seine Frau hatte die beiden tatsächlich nicht nur mit in den Urlaub genommen, sondern sie hatte gar nicht vor, aus Neuseeland wieder zurückzukommen. Das mit dem Sorgerechtskampf hätte er sich nie im Leben leisten können. Das konnte Lisbeth ihm in einem Gespräch leider nur bestätigen. So etwas kostete immer ein Vermögen und hatte doch kaum Aussicht auf Erfolg. Manchmal war die Welt aber auch ungerecht. Die Frau, die Oma Pusch mit in ihrem Wagen zur Beerdigung nahm, wirkte auch schon etwas angegriffen. So unfassbar es klang, hatte ihr doch jemand ausgerechnet an diesem Tag einen Zettel in den Mantel gesteckt, auf dem stand, dass sie als Teenager zweimal ein Kind abgetrieben haben soll. Die ungeborenen Babys wurden nach Inhalt des anonymen Zettels sogar vom Onkel der Frau gezeugt. Das war doch unvorstellbar. So eine nette Frau. »Hoffentlich erfährt das die Nachbarschaft nicht.« hatte Oma Pusch ihr besorgt ins Ohr geflüstert. War doch die Wohnung der Frau von einer kirchlichen Organisation zur Verfügung gestellt worden. Und die hätten garantiert nicht gewollt, dass dort eine Kindermörderin lebt. Da mochte man über die Situation denken, was man wollte.
Lisbeth war bei so was durchaus liberal, aber sie hatte da ja kein Mitspracherecht.
Als hätte sie es geahnt, warf sich die Frau wenige Tage nach der Beerdigung des Nachbarn vor den Zug. Während der Beerdigung musste Oma Pusch ständig darüber nachdenken, wie ein Mensch wohl aussah, der von einem IC überfahren wurde. Aufgebahrt werden schloss sich nach so einem Tod sicher aus.
Ein schöner Anblick konnte das auch nicht mehr sein. Und ob auch wirklich alle Teile der Verstorbenen in der Holzkiste lagen, bezweifelte Oma Pusch stark.
Diese Straße brachte vielen Menschen kein Glück. Anderen brachte sie schlichtweg einen viel zu frühen Tod.
Nur ein Jahr zuvor hatte sich das ältere Paar direkt gegenüber mit Rattengift das Leben genommen. Die beiden lebten schon seit über vierzig Jahren in der Dreizimmer-Altbauwohnung, und ein Umzug wäre ihnen noch nicht einmal bei vorhandenen Mitteln zumutbar gewesen. Geschweige denn unter Zeitdruck und Amtsgewalt. Jemand drohte ihnen ebenfalls mit der Kündigung ihrer Wohnung. Erst viel später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Schreiben mit Stempel und Briefkopf der Stadt, um eine üble Fälschung handelte. Die Kündigung der Wohnung war nur ein alberner Scherz. Aber leider war das alte Paar da auch schon tot. Wer auch immer so etwas tat, sagte man in der Straße, musste durch und durch böse sein.
Und Oma Pusch nickte. So etwas konnte man doch nicht machen.
Das Böseste, was in ihrer Straße passierte, war aber, als jemand dem Amt und der Kasse einen Brief schrieb, dass die arme Frau Albert aus dem zweiten Geschoss verstorben sei. Die alte Dame war doch schon über neunzig, bettlägerig und darauf angewiesen, dass man jemanden zur Betreuung schickte. Nach zwei Wochen rief Oma Pusch dann selber das Amt an, um zu fragen, ob denn keiner mehr käme, um die arme Frau Albert zu versorgen. Als dann endlich jemand kam, war die alte Dame leider tatsächlich bereits verstorben.
Oma Pusch trug öfter schwarz, als jeder andere, den sie kannte. Zum ersten Mal trug sie das Kleid, als ihr Mann nach den Folgen eines Fenstersturzes verstarb. Dann hatte sie begonnen, das Kleid aus schwarzer Seide und dem dünnen Wollstoff liebzugewinnen.
Und nun stand Oma Pusch wieder an ihrem Fenster. Die weichen, runzeligen, lieben Arme auf dem buntgemusterten Kissen verschränkt und schüttelte sanft den Kopf. Das Briefpapier, das Stempelkissen, die Polaroidkamera und die Zeitungsausschnitte über diese traurigen Zwischenfälle lagen in der Truhe bei den Nähsachen. Ein Telefon brauchte sie nicht. Es rief ja doch keiner an, und was das Leben an Unterhaltung brachte, spielte sich unter ihrem Fenster ab. Direkt in ihrer Straße. Begleitet von Blaulicht und Leichenwagen.
Schöne Füße
Roger war aufgewühlt. Den ganzen Tag im Büro konnte er die fast kindliche Vorfreude auf seine neueste Errungenschaft kaum kontrollieren. Er zählte die Stunden. Und jede einzelne Minute, die ihn davon trennte, sich seinem Steckenpferd hinzugeben, schmerzte fast körperlich.
Sophia brachte ihm Kaffee. Wie unerträglich unangenehm, schoss es ihm durch den Kopf. Immer wieder, wenn die Gemeinschaftssekretärin den Raum betrat oder sich in seiner Nähe befand, wusste er genau, wie das Gegenteil seiner Leidenschaft auszusehen hatte. Rundlich, klobig, ungepflegt. Der Gedanke, sie so nah zu wissen, oder der Alptraum sie aus welchen Gründen auch immer irgendwann einmal nackt sehen zu müssen, erregte in ihm dasselbe Würgen, das ihn als jugendlichen Firmenbuchhalter nach einer schweren Fischvergiftung für Wochen aus der Bahn geworfen hatte. Mit demselben Ausmaß an Verachtung, das er Sophia und anderen Frauen ihres Kalibers entgegenbrachte, liebte er das Zierliche, vielleicht sogar Knochige mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit. Gepflegt mussten sie sein. Dezent und zart. Er konnte sie stundenlang sehnsüchtig begehren. So wie er im Augenblick sein neues Glück begehrte.
Roger liebte Schuhe. Genauer gesagt, Damenschuhe der Größen 35 bis 38. Höchstens 39. Und er liebte Füße. Die Füße in den zu den Schuhen passenden Größen. Die Frau seiner Träume konnte sich aller abstoßenden körperlichen Mängel erfreuen, wie breite Narben, Hakennase, Haarausfall oder sich gänzlich der Schwerkraft ergebende Hängebrüste. Wenn sie nur so etwas wie Riemchensandalen oder Glattlederpumps an ihren zierlichen, wohlproportionierten und gepflegten Füßen trug. Seine Sammlung an Damenschuhen war an Quantität, aber auch höchstwertiger Qualität kaum zu übertreffen. Und sein Faible für die dazugehörenden Füße stand dem nicht im Geringsten nach. Das letzte Paar, das er sich zugelegt hatte, war sehr dezent verziert und mit einem Hauch von Apricot aufs Verführerischste gestaltet.
Auch die Dunkelbraunen mit der zarten Strassapplikation erregten ihn immer wieder aufs Neue. Er hatte sie im vergangenen Herbst in seinen Besitz bringen können. Herbst, die Zeit, in der er lange suchen musste, um in die Nähe neuer Begierden gelangen zu können. Er fand sie, wie man eine volle Brieftasche neben einer gestifteten Bank im Park findet. Überraschend, zufällig und irritierend aufregend. Sie hatte ihn damals einfach angesprochen und nach dem Weg zur U-Bahn gefragt. Wie aus Reflex war Rogers Blick auf ihre Füße gefallen, und er hatte sich sofort verliebt. Gut, er hatte sie anfangs nicht so gut präpariert, und so sind sie ein wenig nachgedunkelt. Im Großen und Ganzen hatten sie allerdings keinen Schaden genommen, sondern vielleicht sogar noch ein wenig an Raffinesse gewonnen.
Die Exponate, die nicht in Schachteln auf edlen Mahagoniebrettregalen drapierbar waren, schwammen in Gläsern randvoll mit Formaldehyd.
Das zur Abtrennung notwendige technische Material hielt er ebenfalls fein säuberlich unter Verschluss. Getrennt nach Äther, Sägen, Scheren und Nahtmaterial verschiedener Stärken. Auch die Plane, die er für den Abtransport der entstehenden Reste in seinem Kofferraum zu benutzen pflegte, lag ordentlich gereinigt und auf neuen Einsatz wartend auf dem großen Tisch in der Ecke seines Hobbykellers. Roger war vorbereitet. Immer.
In der Enge der Straßenbahn zwang er sich, seinen Blick nicht tiefer als kniehoch sinken zu lassen. Er wollte sich nicht den Appetit verderben lassen. Wenn seine Augen sich dennoch weiter hinabziehen ließen, kniff er sich mit dem Daumennagel fest hinter sein Ohr. Dies war sein alter Konzentrationstrick. Mittlerweile war die Haut dort bereits so vernarbt, dass er schon lange nicht mehr blutete. So wie sich der Herzschlag bei einem ehemaligen Trinker angesichts einer papierverpackten Flasche Wodka beschleunigte, so stieg sein Blutdruck, wenn er an zierliche Füße in filigranem Leder dachte. Er konnte sie fast riechen. Eine junge Frau wurde im Gedränge eng an ihn gepresst. Sie zog sich an den Haltegriffen von Roger fort, in dem Glauben, seine Erektion gelte ihrem jugendlichen Körper.
An der nächsten Station stieg er aus. Es waren nur noch zwei Blocks. Fünfmal schwarz und sechsmal weiß, der Zebrastreifen. Eine Ampel, die Ballettschule, der Bettler, der sein linkes Bein immer so hinlegte, dass es aussah, als hätte er nur ein Rechtes. Gleich war er da.
Dann sah er sie. Für einen kurzen Moment war sein Herz nicht bei seinen Exponaten. Sie war in Begleitung einer älteren Dame, die sicher ihre Mutter sein konnte. Stiefel. Die alte Dame war nicht von Interesse. Er erkannte die junge Frau im Rollstuhl sofort. Die dicke, dunkle Brille in ihrem blassen Gesicht und die Decke über ihren Knien waren neu. So hatte Roger sie noch nie gesehen. Er lächelte sie freundlich an. Im selben Moment machte sich in ihm nahezu zärtliches Verständnis breit. Selbstverständlich konnte sie ihn nicht wiedererkennen.
Sie konnte ihn ja noch nicht einmal sehen. Er sammelte schließlich nicht nur schöne Füße, sondern hatte auch eine Leidenschaft für schöne Augen.
Sein bestes Stück
Sie konnte die beiden aus der Garage kommen sehen. Die wenigen Schritte bis zum Haus liefen die Männer nebeneinander her, als wären sie der Nabel der Welt. Ihr Mann Heinz, groß, früher sicher sportlich, jetzt mit wachsendem Bauchansatz und Stefan, klein, drahtig und mit dem Blick eines Wiesels. In der Garage hatte Heinz seinem Freund die neue Errungenschaft gezeigt. Der weiße Bentley war Heinz´ neues »bestes Stück«. Die genaue Bezeichnung des Wagens lautete Bentley Continental GTC 4.0 V8.
Sie wusste es deswegen so genau, weil Heinz in den letzten Tagen kaum über etwas anderes sprach. Stefan war in der vergangenen Woche bestimmt schon der Fünfte aus dem Freundeskreis ihres Mannes, dem der Wagen präsentiert wurde. Heinz konnte nicht leben, ohne anzugeben.
Für Irina war es durchaus ein schönes Auto, aber eben nur ein Auto.
Beide Männer kamen durch den Eingang in der Küche, ohne sich die Füße abzutreten. Irina schimpfte nicht. Es machte keinen Sinn. Außer einem bösen Blick ihres Mannes und einer Rüge vor Stefan hätte es nichts gebracht.
So kam Heinz lediglich auf sie zu, zog sie demonstrativ kurz an sich heran und schlug ihr auf dem Weg ins Wohnzimmer noch einmal mit der Hand auf den Po. Sie ließ ihn gewähren. Sie hatte schon lange aufgegeben, ihn zu bitten, so etwas zumindest vor Dritten zu unterlassen.
Als sie den Männern Getränke brachte, konnte sie Heinz schwadronieren hören.
»Tja, zu Land, zu Wasser, in der Küche und im Bett. Überall vom Feinsten. Wer kann, der kann. Und ich kann.« Sein Lachen klang schwer.
Wieder schlug er ihr auf den Po, als sie das Tablett nahm und das Wohnzimmer verließ.
So war es wohl. In der Garage stand das, was er als bestes Stück bezeichnete, gleich in mehrfacher Ausführung. Denn der Bentley war lediglich »das neueste beste Stück«.