
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jungbrunnen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Siad, ein junger Krankenpfleger aus Somalia, und seine Tochter Shara warten in Tunesien gemeinsam mit anderen Flüchtlingen aus Afrika, bis Schlepper sie nach Europa bringen. Ihr Ziel ist Lampedusa, das Tor zu einer Zukunft, von der sie sich Sicherheit und Wohlstand erhoffen. Schließlich ist es so weit. Mit 55 anderen Flüchtlingen drängen sie sich in einem kleinen, altersschwachen Kutter. Die Reise wird zum Albtraum: Der Kapitän wurde erpresst und hat keine Ahnung, wie man ein Schiff navigiert. Der Motor fällt aus und während eines Sturmes werden drei Passagiere von Bord gespült. Als sie von der italienischen Küstenwache aufgegriffen werden, taumeln ausgemergelte und halb verdurstete Menschen von Bord. Das vermeintliche Paradies entpuppt sich als Flüchtlingslager. Dort müssen sie unter menschenunwürdigen Bedingungen warten, bis entschieden ist, ob sie einreisen dürfen oder zurückgeschickt werden. Siad und Shara träumen davon, nach Kanada auszuwandern, wo Siad Arbeit als Krankenpfleger finden könnte. Ein Traum, den sie mit aller Kraft verwirklichen wollen. Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien (Ehrenliste)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Robert Klement70 Meilen zum Paradies
EPUB ISBN 978-3-7026-5879-3
Einband: Peter Sachartschenko
Foto: ddp images/AP/Daniele La Monaca.
3. Auflage 2011
© Copyright 2006 by Verlag Jungbrunnen Wien
Alle Rechte vorbehalten – printed in Austria
Robert Klement
70 Meilen zum Paradies
Robert Klement
wurde 1949 in St. Pölten geboren. Nach der Matura besuchte er die Pädagogische Akademie in Krems und absolvierte dort die Ausbildung zum Hauptschullehrer. Er unterrichtete lange Zeit Deutsch und Geschichte. Neben seiner beruflichen Tätigkeit begann er, Reportagen für Zeitungen zu schreiben und arbeitete als freier Mitarbeiter für den ORF. Sein erstes Jugendbuch erschien 1987. Heute arbeitet Robert Klement als Schriftsteller. Er lebt in St. Pölten.
Im Verlag Jungbrunnen ist von Robert Klement der Roman Sieben Tage im Februar lieferbar.
Die Schicksale der handelnden Personen sind nicht erfunden.Der Autor hat mit zahlreichen afrikanischen Bootsflüchtlingen gesprochen und an den Schauplätzen des Romans (Tunesien, Lampedusa, Neapel) recherchiert.
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Die Genfer Konvention
1
Sharas Lieblingsplatz war die kleine Bucht, wo die Wellen sich unablässig an den Felsen brachen. Nur wenige hundert Meter von ihrem Quartier entfernt, befand sich ein breiter Sandstrand.
Dort fühlte sie den Wind und schmeckte das Salz auf ihren Lippen. Möwen ließen sich von den Aufwinden über den Klippen tragen und segelten schwerelos und ohne einen einzigen Flügelschlag. Kleine Krebse liefen geschäftig über den Meeresboden. Die Welt war lebendig in dem hellen Licht und dem Wind.
Heute hatten die Nachbarskinder Shara eine Tauchermaske geborgt. Die Ausbeute konnte sich sehen lassen: In Felslöchern hatte sie einen Seeigel und mehrere Miesmuscheln gefunden. Am Nachmittag brachte sie einen Roten Seestern und wie Phosphor leuchtende Krebse an die Oberfläche. Dann beobachtete sie fasziniert einen Schwarm Fische, der zwischen feuerfarbenen Korallen einen graziösen Reigen tanzte. Immer wieder war Shara Leuchtquallen respektvoll ausgewichen, denn sie wusste, dass deren haarfeine, giftbewehrte Tentakel sie wie eine Stacheldrahtpeitsche verwunden konnten.
Shara befand sich in einer blaugrünen Zauberwelt, in der man für wenige Stunden alle Sorgen vergaß.
Gegen Abend, wenn die Felswände im Licht der untergehenden Sonne glühten, ging sie mit den Kindern ins Dorf zurück. Vorher kletterte sie stets auf den großen gespaltenen Felsen und blickte aufs Meer hinaus.
„Irgendwo dort drüben liegt Europa“, dachte sie.
Feucht und faulig roch es in den engen Winkeln der Altstadt. An jeder Ecke wurde heftig gefeilscht. Die Medina war von der mächtigen tausendjährigen Stadtmauer mit ihren Wehrgängen und eckigen Wachtürmen umgeben. Im engen Gassengewirr konnte man sich kaum orientieren.
Siad stand vor dem Stadttor und blickte sich um. Tatsächlich, dort war der kleine Schusterladen, von dem man ihm erzählt hatte.
„Ich suche den Piraten.“
Der Mann blickte einmal kurz auf und musterte ihn argwöhnisch.
„Den Piraten?“
„Man hat mir gesagt, dass du mich zu ihm bringen kannst.“
„Keine Ahnung, wen du meinst“, knurrte der Schuster und griff wieder zu seinen Werkzeugen.
Er arbeitete an einem Paar babouches, den spitzen, tunesischen Pantoffeln aus feinstem Ziegenleder. Angeblich gab es keine Maschine auf der Welt, die das nur annähernd so gut konnte wie die tunesischen Handwerker. Siad ließ sich nicht abschütteln.
„Aber das ist doch der Schusterladen neben dem Stadttor.“
Der Mann hatte sich abgewandt, würdigte ihn keines Blickes. Plötzlich fiel Siad ein, dass er ja das Codewort nennen musste.
„Happy landing.“
Der Schuster wandte sich ihm jäh zu, seine Züge hellten sich auf. Vorsichtig blickte er sich nach allen Seiten um. Dann rief er seinen kleinen Sohn.
„Das ist Damak, er wird dir den Weg zur Travel Agency zeigen.“
Mit diesen Worten streckte er ihm fordernd eine Hand entgegen. Siad kramte in seiner Hosentasche und holte zwei Dinar hervor.
„Travel Agency“, dachte er und seine Anspannung wuchs.
Der Knabe führte ihn durch ein verwirrendes Labyrinth aus Gässchen, Treppen, Torbögen, alten Höfen und Sackgassen. Diese „Travel Agency“ war nicht leicht zu finden. Hin und wieder sah Siad das Minarett der Großen Moschee, die sich im Zentrum der Medina von Sfax befand. Die Spitze des Marmorturms leuchtete golden in der Nachmittagssonne. Kupferschmiede hämmerten kunstvolle Ornamente in Teller und Kannen. Händler priesen ihre Lederwaren, Teppiche, Kleider und Keramiken. Verhandelt wurde laut und gestenreich. Nach einer Unterführung hielt der Knabe vor einer kleinen Lehmhütte.
Eine Tür aus Wellblech führte ins Innere der Reiseagentur. Sie bestand aus einem einzigen Raum. Auf einem Teppich lag der Länge nach ausgestreckt ein rundlicher Mann mit schwarzen Stoppelhaaren. Er wartete auf Ware.
Der Weg in sein „Büro“ war so gewählt worden, dass der Fremde die Hütte ohne Hilfe garantiert nicht wieder finden konnte. Der Pirat hatte Gründe für diese Vorsichtsmaßnahme. Er schmuggelte hauptberuflich Menschen.
„Ich bin Hassan, das ist unser Travel Agent Ali“, sagte er und zeigte auf einen Mann, der an einem Tisch saß. Dann erhob er sich schwerfällig von seinem Teppich.
Siad war sich bewusst, dass die beiden Menschenschmuggler Decknamen verwendeten. In ihren Djellabas wirkten sie wie gewöhnliche arabische Händler. Aber sie hatten das Kostbarste anzubieten, das auf diesem schmutzigen Markt zu erstehen war. Die Zukunft. Siad nannte Ali seinen Namen. Der blätterte in einem Notizbuch.
„Möchtest du Tee?“
Ohne die Antwort abzuwarten, servierte ihm Hassan eine Tasse Minztee.
„Wie viele Plätze brauchst du?“
„Was soll diese Frage?“, meinte Siad ungeduldig. „Ihr beide müsst doch wissen, dass ich zwei Plätze brauche.“
Die beiden Männer tauschten Blicke. Ali legte das Notizbuch beiseite und holte einen Laptop aus einem Versteck hervor. Leise surrend fuhr das Programm hoch.
„Hier steht etwas von einem Kind. Wie alt ist es?“
„Sechzehn“, log Siad. Seine Tochter Shara wurde demnächst vierzehn, sah jedoch älter aus und er dachte, dass diese Leute bei zu jungen Passagieren eventuell Probleme machten.
„Du musst dich noch etwas gedulden und einige Tage warten.“
„Warten, warten, warten!“, schrie Siad mit einer Stimme schrill vor Ungeduld. „Wie lange sollen wir noch warten? Jetzt haben wir bereits Anfang Oktober. Bald beginnen die Winterstürme, die eine Passage in einem kleinen Boot unmöglich machen. Das Risiko wird immer größer.“
Die Blicke der beiden Männer waren stumpf, fast feindselig. Der „Travel Agent“ zündete sich eine Zigarette an und paffte dichte Rauchwolken, durch deren Schleier hindurch er sagte: „Wir haben im September zwei Boote verloren. Der tunesische Geheimdienst hat sie beschlagnahmt. Wir bemühen uns sehr, Ersatz zu finden. Wir nehmen außerdem nur erstklassige Boote.“
„Die Sicherheit unserer Kunden hat Vorrang“, meinte Hassan mit einem spöttischen Grinsen. „Du willst doch schließlich nicht, dass wir dich und dein Kind in einen Schrottkahn verfrachten.“
Der Lärm aus den Gassen war gewaltig. Die schrillen Rufe der Marktschreier vermischten sich mit dem Gegacker von Hühnern und dem Aufheulen von Mofas. Dazwischen läutete immer wieder Hassans Handy. Siads Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Er erzählte, dass er nicht noch länger warten könne. Täglich drohe eine Razzia der tunesischen Polizei, die Flüchtlinge aus ganz Afrika in ihren Verstecken entlang der Küste aufstöberte. Außerdem habe er nur mehr wenig Geld, um seine Quartiergeber zu bezahlen.
Ali verzog keine Miene. Auf seinen Zügen zeichnete sich eine zynische Selbstgefälligkeit ab. Er drückte hin und wieder einige Tasten und blickte auf den Bildschirm seines Computers.
„Da wäre noch eine Kleinigkeit. Wenn du die beiden Plätze auf dem Boot haben willst, musst du noch 500 Dollar bezahlen.“
Siads Arme und Schultern spannten sich, Zornesröte stieg ihm ins Gesicht.
„Ich habe in Somalia 4.200 Dollar bezahlt. In diesem Preis ist die Überfahrt nach Lampedusa enthalten. Ich zahle euch Gaunern und Halsabschneidern nicht einen Dollar mehr.“
„Wann hast du die Schleusung bezahlt?“, schrie ihn Hassanan.
„Anfang Juni.“
„Na also, das ist fast ein halbes Jahr her. Die Dinge haben sich inzwischen geändert.“
Siad wollte sich auf die Männer stürzen, mit beiden Fäusten auf sie einschlagen.
Ali versuchte zu beschwichtigen.
„Die Verhältnisse sind komplizierter als du denkst, mein Freund. Es gibt ein neues Abkommen zwischen Tunesien und Italien. Unsere Organisation muss der tunesischen Küstenwache immer höhere Bestechungsgelder zahlen.“
Siad konnte sich nur mit Mühe beherrschen. Schweißperlen kollerten über sein tiefrotes Gesicht.
„Wir sind nur kleine Mittelsmänner“, meinte Hassan, der fortwährend in seinem Tee rührte. „Die Tarife werden von der Organisation festgesetzt. Wir haben unsere Instruktionen.“
Um seinen Mund spielte ein höhnisches Lächeln.
Siad sprang auf, packte Ali am Hemdkragen und schüttelte ihn. Hassan versetzte ihm einen Stoß, dass er gegen die Wand taumelte. In Alis Hand blitzte plötzlich eine Pistole auf, die sich seinem Kopf näherte.
„Leute ohne Manieren mögen wir hier nicht.“
Die beiden Männer hielten Siad fest und drückten ihn gegen die Wand der Lehmhütte.
„Niemand wird den Schuss hören. Wir lassen dich einfach verschwinden. Dort draußen liegt ein Teppich, der groß genug für dich ist. Deine Reise endet dann eben im Abwasserkanal nahe der Stadtmauer.“
Sie stießen ihn auf den Stuhl zurück, wo er schluchzend in sich zusammensackte. Siad fühlte sich in einen quälenden Albtraum versetzt. Warum hatte er sich bloß mit diesen Banditen eingelassen? Nun war er ihnen ausgeliefert. Er hatte keine andere Wahl. Er musste zu seiner eisernen Geldreserve in Dollar greifen. Siad öffnete einige Knöpfe, zeigte auf die Innenseite seines Hemdes und ersuchte um ein Messer. Vorsichtig löste er die Nähte des Verstecks und zog die Dollarscheine heraus.
Ali fragte ihn noch, ob er einen Platz am Bootsrand oder in der Bootsmitte wünsche. In der Mitte, wo man weniger leicht ins Wasser falle, sei es eben sicherer, meinte er lakonisch. Doch das würde weitere hundert Dollar kosten.
Siad konnte es sich nicht leisten, auf dieses Angebot einzugehen. Er besaß nun gerade noch fünfzig Dollar. Seine allerletzte Reserve war der goldene Ehering seiner Frau.
Der Schleuser zählte die Scheine und hielt sie gegen das Licht. Dann übergab er ihm eine Karte mit verschiedenen bunten Stempeln darauf.
„Alles klar, du sollst die beiden Plätze haben. Hier ist dein Eintrittsticket für Europa. Du wirst von uns hören.“
„Vorsicht, ein Polizeiwagen!“
Wie ein gehetztes, in die Enge getriebenes Tier kauerte Siad mit seiner Tochter im Ziegenstall. Vor wenigen Sekunden war der Warnschrei in der Barackensiedlung ertönt. Siad hörte die keuchenden Atemzüge seiner Tochter. Schweißtropfen standen auf ihrer Stirn. Shara stieß merkwürdige, spitze Laute aus.
Einige Augenblicke war alles ganz still, eine Stille, in der Siad kaum zu atmen wagte. Dann hörte er das frech-fröhliche Gezwitscher einiger Spatzen, eine Taube gurrte.
„Ihr könnt herauskommen, die Luft ist rein.“
Die beiden atmeten erleichtert auf. Habib, ihr Quartiergeber, kam auf sie zu.
„Es ist alles in Ordnung. Sie haben Jussuf in einer Kneipe aufgegriffen, wo er randaliert hat. Vor seiner Hütte haben ihn die Polizisten aus dem Wagen gestoßen.“
Siad und seine Tochter Shara versteckten sich nun seit fast zwei Monaten nördlich von Sfax und warteten auf ihren Fährmann ins Glück. Das Warten sei schrecklicher als die Flucht durch die Sahara, meinten die meisten Flüchtlinge. Da habe man wenigstens das Gefühl gehabt, Europa täglich etwas näher zu kommen. Nun waren es bloß noch 70 Meilen, doch mit jedem Tag schien ihr Ziel weiter in die Ferne zu rücken.
Habib reichte Siad und Shara zur Beruhigung ein Glas Tee. Die Baracken standen auf einer kleinen Anhöhe. Von hier konnte man auf die ausgedehnten, bis ans Meer reichenden Olivenhaine blicken. Die spitzen, brüchigen Felsen am Ufer leuchteten grell unter dem Blau des Himmels. Shara blickte zur kleinen Bucht, deren Felswände in der flammenden Sonne strahlten. Mit großen Augen starrte sie in jene Richtung, in der sie ihre Zukunft vermutete.
„Wo liegt Europa?“, fragte sie. „Ungefähr da?“
Sie zeigte mit der rechten Hand hinaus aufs Meer. Der Ärmel ihres verschlissenen braunen Hemdes flatterte im Wind. Siad hatte ihr die Richtung schon oft gezeigt, doch Shara wollte es immer wieder wissen. Auf einer Karte des Mittelmeeres hatte sie gesehen, dass die italienische Insel nicht einmal einen Fingernagel weit von der Küste Tunesiens entfernt lag.
Verglichen mit dem schier endlosen Weg durch die Sahara war es bis Lampedusa ein Katzensprung. Mit Schaudern dachte Siad an die Monate vor ihrer Ankunft in Sfax zurück.
Sie waren sieben Fahrzeuge mit jeweils zwölf Leuten gewesen. Zusammengepfercht in Jeeps mussten sie den gefährlichen Landweg über Äthiopien und quer durch die sudanesische und libysche Sahara nehmen. Einige starben und wurden einfach im Sand verscharrt zurückgelassen. Sie fuhren nachts, tagsüber suchten sie Verstecke vor der Sonne und den Helikoptern. Kaum war es dunkel, mühten sie sich weiter auf diesem Ameisenpfad der Armen. Tausende Kilometer durch Afrika, mit nichts als einem Hemd, einer Trainingsjacke, einer abgetragenen Hose und Turnschuhen.
Durch die Sahara gab es fünf Kontrollpunkte von Gendarmen. Jedem mussten die Schleuser 100 Dollar zahlen – pro transportiertem Flüchtling. Dieses Wegegeld war Pflicht. Dann drückten die Ordnungskräfte ein Auge zu.
Oft waren die Flüchtlinge knapp vor dem Verdursten gewesen und hatten der Versuchung nicht widerstehen können, aus Pfützen und Tümpeln zu trinken. Zweimal war ein Fahrzeug ihres Konvois von Räubern überfallen worden. Da wurde ihnen bewusst, dass sie nichts als Freiwild waren. Zum Abschuss freigegeben für Banditen, die sie ungestraft ausrauben und töten konnten.
Siad bewunderte den Mut seiner Tochter. Das Kind, das vor einem Jahr die Mutter und die ältere Schwester verloren hatte, wirkte entschlossen, ließ sich nicht unterkriegen.
Shara erzählte von der Tauchermaske. Sie zeigte ihrem Vater die Muscheln und den Seestern.
„Du solltest dich nicht zu oft am Strand blicken lassen. Sie dürfen uns hier nicht finden.“
„Aber es ist doch egal, ob ich am Strand bin oder in dieser Baracke.“
„Die Straße führt nahe am Ufer vorüber. Gerade hast du gesehen, dass hier Polizeiwagen vorbeikommen.“ Etwas verärgert fügte er hinzu: „Außerdem muss es dir schon längst aufgefallen sein, dass wir Somalis hellhäutiger sind als die Leute hier.“
Seit sechs Wochen fanden sie in dieser Barackensiedlung Unterschlupf. Von der Hektik der Großstadt Sfax war hier nichts zu spüren. Am Vormittag sah man die Frauen am Brunnen des Viertels Trinkwasser schöpfen, das sie in alten Benzinkanistern zu den Hütten schleppten. Zu Tausenden drängten sich die primitiven Unterkünfte ohne sichtbare Ordnung aneinander. Hinter den Verschlägen aus Holz, Blech und Pappe befanden sich kleine Gemüsegärten und Viehställe. Auf den Wegen lagen Müllberge und Autowracks, zwischen denen dürre Hunde und Katzen herumstreunten. Über allem hing der Gestank von Viehmist und Abwässern.
Dreimal am Tag gab es droh, einen Brei aus gemahlener Gerste und Zucker. Die Tunesier waren ein gastfreundliches Volk, doch die Menschen aus dieser Barackensiedlung waren so bettelarm, dass sie die Flüchtlinge nicht wochenlang verköstigen konnten. Habibs Sohn hatte als einer der wenigen Männer der Siedlung einen Job. Er war Liftboy und Kofferträger in einem vornehmen Touristenhotel bei Hammamet. Wenn er einmal im Monat nach Hause kam, wartete die ganze Familie auf seinen Lohn.
Während Siad mit seiner Tochter aufs Meer blickte, zogen übel riechende Rauchschwaden von verbrennendem Abfall über den Hügel. Ein paar Möwen kreisten über frisch angehäuften Müllbergen.
„Bald wird alles anders werden“, meinte der Vater. „Wenn wir erst einmal auf Lampedusa sind, geht es mit uns aufwärts.“
Das Warten zerrte an den Nerven. Besonders in den Nächten meinte Siad oft, vor Angst wahnsinnig zu werden. Er schreckte vom Pfeifen und Quieken der Ratten auf. Das plötzliche Bellen eines Hundes ließ ihn lange nicht mehr einschlafen. Hinter jeder Palme, hinter jedem Strauch vermutete er seine Jäger. Wurzeln schnitten im Mondlicht Fratzen, schienen nach ihm zu fassen. Er lag dann nur still da, horchte auf die Atemzüge seines Kindes und betete, es möge bald hell werden.
Habib hatte ihm gesagt, die Polizei wisse längst, was hier geschehe. Denen würde nicht entgehen, dass sich immer wieder Flüchtlinge entlang der Küste versteckten. „Sie unternehmen nichts, weil sie vom Piraten bestochen werden“, erklärte Habib. Darauf könne man sich aber nicht verlassen. Mindestens dreimal im Jahr durchkämmten Militärpolizisten aus Tunis mit Maschinenpistolen und scharfen Schäferhunden an kurzen Leinen die Barackensiedlungen entlang der Küste. Dabei gingen ihnen hunderte Illegale ins Netz.
Siad war mit dem Tag zufrieden. Immerhin war es ihm gelungen, mit den Schleppern Kontakt aufzunehmen. Er saß vor der Hütte und beobachtete Shara, die mit Tobi spielte. Das drollige Hündchen unterhielt sie mit allerlei Kunststücken. Tobi war ein lustiger Kerl. Er musste etwa drei Monate alt sein, denn die kleinen Zähne waren noch spitz. Besonders gefiel Shara der winzige schwarze Fleck über einem Auge. Sie hatte sofort Freundschaft mit ihm geschlossen, denn sie fühlte, dass er die Mutter ebenso vermisste wie sie. Er ist ganz allein und braucht jetzt besonders viel Liebe, dachte sie. Dann begann sie, Tobi zärtlich hinter den Ohren zu kraulen, und spürte, wie der Hund seine feuchte Nase gegen ihre Hand stieß.
Immer wieder hatte Shara den Vater ersucht, Tobi nach Italien mitnehmen zu dürfen.
„Wir müssen auf Lampedusa vielleicht wochenlang in einem Lager warten. Unmöglich, wir können diesen Hund nicht auf die Insel mitnehmen“, hatte er ihr eingeschärft.
Vielleicht gelang es ihr, Tobi auf dieses Boot zu schmuggeln. Es waren ja bloß zwei Tage bis zu dieser Insel. Vorerst hieß es weiter warten und hoffen. Auf ein Boot, das morgen kommen konnte, übermorgen, in einer Woche.
2
Shara beobachtete, wie der Abend auf die unzähligen Reihen geduckter Holzhütten herabsank. Der weite, von rötlichem Dunst überzogene Himmel wurde dunkel. Eine leichte Abendbrise wirbelte Staub auf, der sich wie ein grauer Schleier über die Baracken legte. Kinder kletterten über zerborstene Lastwagenreifen. Eine Frau erschien vor einer Hütte und warf eine tote Ratte auf den Gehweg.
An jeder Ecke loderten Feuer auf. Die Slumbewohner kochten Tee und Essen. Shara konnte den Abend kaum erwarten. Heute war ein tunesischer Feiertag. Habib hatte eine Ziege geschlachtet und die Flüchtlinge zum Festmahl eingeladen. Sie sollten sich mit ihnen freuen. Während des Essens war auch für Musik gesorgt. Der Nachbar spielte Mandoline, Hassan, sein Sohn, Geige, Habibs Frau Flöte. Er selbst schlug die darbouka, eine mit Tierhaut bespannte Trommel.
In Habibs Hütte lebte auch dessen Vater. Sein weißes Haar hing wirr in die Stirn, in die ein armseliges Leben viele Falten gezogen hatte. Der Alte meinte kichernd: „Diese Insel ist doch bloß ein Fliegenschiss auf der Landkarte. Ihr müsst verdammt aufpassen, dass ihr sie nicht verfehlt. Hoffentlich bekommt ihr einen guten Kapitän.“
Siad erzählte von seinem Zusammentreffen mit den Menschenschmugglern.
„Ich weiß, wer der Pirat ist“, meinte der Alte und ein listiges Lächeln huschte über sein mageres Gesicht. „Man sagt, er habe früher Waffen geschmuggelt. Später war es Haschisch. Heute schmuggelt er Menschen. Das ist weit weniger riskant und bringt obendrein mehr Geld.“
An den Küsten Tunesiens und Libyens wussten alle, dass die Gewinne im Schlepper-Gewerbe höher waren als im Drogengeschäft. Immer mehr Haschischschmuggler stiegen auf Menschenhandel um. Der Pirat war tatsächlich nur ein kleines Rädchen im mächtigen Apparat der Schleppermafia. Er hatte dafür zu sorgen, dass seine Kunden in Tunesien aufgesammelt, verladen und nach Italien gebracht wurden.
Habib warf einen Ast ins Feuer und meinte: „Es ist gefährlich, über diese Leute zu sprechen. Sie haben fast überall entlang der Küste Spitzel. Ein Cousin von mir war unvorsichtig. Sie fanden ihn am nächsten Tag erschossen am Strand.“
Der Alte nahm einen tiefen Zug aus seiner Pfeife und sagte: „Also, obwohl ihre Mittel illegal sind, ihr Anliegen ist gut. Sie helfen den Leuten, dem Elend zu entfliehen. Allein würdet ihr es nicht schaffen. Ihr seid auf diese Gauner angewiesen.“
Es gab sogar Gerüchte, dass Schlepper mittellose Flüchtlinge dazu überredet hatten, sich eine Niere entnehmen zu lassen, damit sie ihre Weiterreise bezahlen könnten. In den Krankenhäusern von Tunis und Tripolis gab es angeblich Ärzte, die mit der Schleppermafia gemeinsame Sache machten.
Sie hatten nur ein Thema hier: Europa, das Paradies der Afrikaner. Shara hatte in den vergangenen Wochen gehört, dass manche Mädchen dort mit 18 schon ein eigenes Auto hätten. Die Straßen seien völlig frei von Müll. Der Vater und die Großeltern hatten ihr immer wieder von Europa erzählt. Auch aus Zeitschriften und dem Fernsehen wusste sie einiges über Italien und Deutschland. Kaum glauben konnte sie, dass sich manche Liebespärchen auf den Straßen völlig ungeniert küssen würden.
In einer der Nachbarhütten hielt sich Stany versteckt. Er war ein lustiger Kerl. Gerade einmal 70 Meilen trennten ihn von seinem Traum.
„Was sind schon 120 Kilometer?“, sagte er und zeigte aufs Meer. „Seit einem Jahr weiß ich, ich will dorthin. Und wenn ich rüber schwimmen muss.“
Zu Hause in Nigeria wartete seine Freundin auf ihn. Wenn er in Europa viel Geld verdient hatte, wollte er sie heiraten. Schon allein die Ankunft in Europa würde ihn zu Hause zu einem angesehenen Mann machen. Lampedusa hielt er wie alle übrigen hier für den Türspalt ins gelobte Land, durch den er hindurchschlüpfen wollte.
Bereits zweimal waren Stanys Fluchtversuche gescheitert. Beim ersten Mal hatte er sich mehrere Monate in den Wäldern Nordmarokkos versteckt. In ständiger Angst vor der Polizei hatte er auf ein Boot gewartet, das ihn nach Spanien bringen sollte. Es war ein jämmerliches Schlauchboot gewesen. Er war an der Küste Andalusiens entdeckt und sofort zurückgeschickt worden.
Dann hatte er sich im Mittelmeerhafen Tanger unter einen Lastwagenanhänger gelegt. Das war extrem gefährlich, denn immer wieder wurden Flüchtlinge zwischen den Achsen der Schwerlaster zermalmt. Und wieder wurde er entdeckt. In Spanien wurde ein Apparat mit vier Kabeln an jeden Lastwagen angeschlossen, mit dem man die Herzfrequenzen versteckter Lebewesen hören konnte.
Europa hatte ihm ein zweites Mal seine Klauen gezeigt!
Kaum wieder in Afrika angekommen, wurde er bei einer Polizei-Razzia gefasst und mit 3.000 Schwarzafrikanern in der alten spanischen Stierkampfarena von Tanger festgehalten, bevor man ihn nach Nigeria abschob. Stany war überzeugt, dass er es diesmal schaffen würde. „Wenn ich erst einmal in Italien bin, steht mir ganz Europa offen“, meinte er.

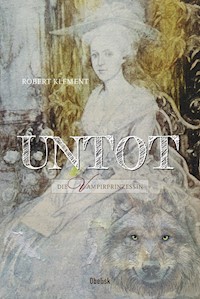

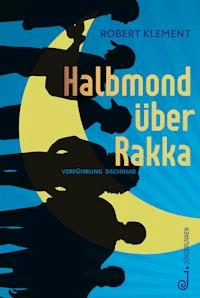














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










