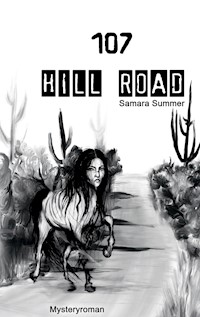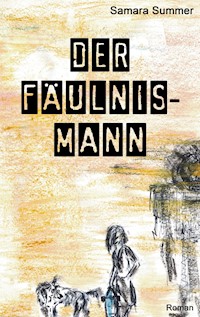Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Meine Damen und Herren, darf ich Sie in ein tropisches Paradies entführen? Ein Eiland von nahezu übernatürlicher Schönheit wartet nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Das (fast) perfekte Reiseziel. Zu wetterfester Kleidung und dem vorsorglichen Abschluss einer Lebensversicherung wird geraten. Ein Roman, inspiriert von der wahren Geschichte des deutschen Abenteurers August Gissler. Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts zum Gouverneur der Kokosinsel ernannt, siedelte dort mit neun Familien und widmete sein ganzes Leben der Schatzsuche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Triggerwarnungen im Anhang
Inspiriert von der wahren Geschichte des deutschen Abenteurers August Gissler, der um die Jahrhundertwende mit neun Familien auf der Kokosinsel siedelte.
Dieser Roman greift nur lose einige Aspekte seiner bewegenden Geschichte auf. Alle Charaktere sowie ein Großteil der Handlung sind rein fiktiv.
Im Anhang habe ich Fakten und Fiktion ausführlich gegenübergestellt. Ich empfehle jedoch aufgrund der Spoiler-Gefahr, diesen erst am Schluss zu lesen.
Diskriminierende Äußerungen und Handlungsweisen der fiktiven Charaktere spiegeln in keiner Weise die Haltung der Autorin wider.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
TEIL 1: Aufbau
I. DER HIMMEL AUF ERDEN
II. IN DEN SAND GESETZT
III. EIN ABENTEUER
IV. ZWEI SAECKE
V. PIONIERGEIST
VI. DURCHS DICKICHT
VII. DER TOTE BAUM
VIII. FIEBER
IX. IN FLAMMEN
TEIL 2: Suche
X. BLUTGOLD
XI. GEISTERGESCHICHTEN
XII. PLAGEN
XIII. GEHEIMNISSE
XIV. FLAECHENBRAND
XV. MAUERN UND EIN HUND
TEIL 3: Niedergang
XVI. DER BRIEF
XVII. ZWEIFEL
XVIII. Seiten
XIX. DIE AUSTREIBUNG
XX. ALAJERO
XXI. BEDINGUNGEN
XXII. DAS VERSCHWINDEN
XXIII. ZUSAMMENBRUCH
TEIL 4: Zugabe
XXIV. UNTER DRUCK
XXV. DER WEINENDE HIMMEL
XXVI. DAS ENDE DES PFADES
EPILOG
Anhang
TRIGGERWARNUNGEN
1. FACTS & FICTION
2. PERSONEN-VERZEICHNIS
3. GLOSSAR
4. DIE AUTORIN
5. DANKSAGUNG
PROLOG
Aus »Das unerbittliche Paradies« von Mary J. Mayer
Arthur ging voraus, ich hinter ihm, dicht gefolgt von Henry, der die übel zugerichtete Leiche auf seinem Rücken trug. Wir waren nass bis auf die Knochen und unsere Mienen sicher finster wie die Nacht. Beinahe hätte ich geschrieben, »unser Trauerzug erreichte die Siedlung«. Diese Formulierung wäre jedoch ganz und gar unpassend gewesen, denn Wut – nicht Trauer – war das vorherrschende Gefühl. Unbändige, verständnislose Wut, um nicht zu sagen: Hass. Zumindest spreche ich damit für mich selbst und wohl auch für Arthur. Bei Henry, der guten Seele, bin ich mir nicht sicher, ob er zu solch scheußlichen Gefühlsregungen überhaupt fähig ist.
Der erste Mensch, dem wir begegneten, war Elizabeth Richardson. Als sie die verbrannten, schwarzen und blutigen Beine entdeckte, die über Henrys Schulter baumelten, stieß sie einen grellen Schrei aus und ließ den Korb fallen, den sie in der Hand getragen hatte.
»Mrs. Richardson«, sagte Arthur zu ihr, sein Tonfall womöglich aggressiver als beabsichtigt, »trommeln Sie sofort alle zusammen! Und beeilen Sie sich!« Das war jedoch kaum mehr vonnöten. Ihr Schrei hatte ohne weiteres Zutun das halbe Dorf herbeigelockt. Die Arbeiter strömten von der Plantage. Die Schulkinder stürmten aus dem Klassenraum, als wir den Dorfplatz erreichten. Wie die Fliegen umschwärmten alle die entstellte Leiche, die Henry behutsam auf der Veranda vor seiner Hütte ablegte. Ich hatte die ganze Zeit nicht hinsehen können und als ich nun einen kurzen Blick auf den weit geöffneten Kiefer erhaschte, den stummen Schrei, musste ich mich erneut abwenden.
Der anschließende Blick in die Gesichter der Siedler schürte meine Wut. Sie glotzten so dumm, so leer, so nichtsnutzig. Ihre schockierten Mienen erschienen mir heuchlerisch. Ich stampfte mit dem Fuß auf, sodass trübes Wasser in alle Richtungen spritzte und rief:
»Glotzt ihr nur! Und nun? Wer tut so etwas? Warum? Warum er? Er hätte keiner Fliege etwas zuleide tun können!«
Morgan Chase, der Einzige, der nicht einmal vorgab, betroffen zu sein, trat aus dem Fliegenschwarm hervor.
»Den Fluch kümmert es nicht, ob er jemandem etwas zuleide getan hat«, behauptete er mit einer Dreistigkeit, die mich erstarren ließ. »Ihr Gatte hat uns auf diese Hölleninsel gelockt und den Fluch über uns alle gebracht. Jeder könnte der Nächste sein. Sie, ich, selbst ein unschuldiges Kind ...«
Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich die paar Schritte zurückgelegt habe, die mich von Morgan Chase trennten, doch ich muss sie irgendwie überwunden haben, denn das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass meine Faust seine Wange traf. Ganz ohne dass ich mich bewusst dazu entschlossen hatte, ihn zu schlagen. Ich wurde zurückgerissen und als ich über die Schulter blickte, sah ich Henry. Arthur tauchte an meiner Seite auf. Morgan Chase hatte die Fäuste geballt. Ich bin mir sicher, dass er nicht gezögert hätte, eine Frau zu schlagen. Doch bevor es dazu kam, zerschnitt ein Schuss die Luft und ließ die Szene einfrieren. Arthur hatte gefeuert. Seine Pistole war hoch erhoben über seinem Kopf, als er rief:
»Kein Fluch hat diesen armen Mann grausam abgeschlachtet, sondern euresgleichen. Ich sehe, was ihr seid. Ihr seid ein Haufen nutzloser Feiglinge, mit einem irrsinnigen Mörder in eurer Mitte! Der Mörder dieses armen Mannes ist ein Familienangehöriger, ein Nachbar. Er ist brutal und gefährlich, doch gleichzeitig ist er feige. Sich an den Schwächsten zu vergreifen, das ist nicht nur unmenschlich, sondern auch derart erbärmlich, dass ich lachen würde, wenn es nicht so tragisch wäre. Ein völlig hilfloses Mitglied unserer Gemeinschaft auf tyrannische Art zu quälen und abzuschlachten, nur um dem Gerede über einen Fluch Gewicht zu verleihen und mich zu demütigen – Das ist so teuflisch, dass die Strafe nur der Tod sein kann. Ich muss über den tollwütigen Hund richten, der dies getan hat und ich muss dafür sorgen, dass er nicht noch mehr unschuldige Menschen anfällt. Ich schwöre außerdem bei Gott: Jeden, der das Wort Fluch noch einmal in den Mund nimmt, werde ich auf ein Floß setzen und aufs Meer hinausstoßen. Ohne Wasser oder Proviant. Also überlegt euch gut, was ihr sagt, bevor ihr eure dreckigen Mäuler öffnet! Und nun zu dir, du erbärmlicher Hund …« Arthur richtete seine Waffe auf die einzige Person, der wir eine solche Schandtat zutrauten.
TEIL 1:
Aufbau
I. DER HIMMEL AUF ERDEN
Eineinhalb Jahre zuvor, 04. Januar 1904
Die Farewell nahm Kurs auf eine weiße Wolke: das neue Zuhause der Siedler. Nein, sie unternahmen keine Reise am Himmel, sondern lediglich auf hoher See. Trotz der frühen Morgenstunde waren alle Passagiere, die nicht an Seekrankheit litten, an Deck des Schoners und beobachteten das fremdartige Objekt am Horizont. Eine Mischung aus Vorfreude, Aufregung und Skepsis lag in der Luft.
Während der letzten zwei Tage hatten die Reisenden nichts als Wasser gesehen. Wasser, das direkt an den Himmel anschloss. Kein noch so winziges Fleckchen Land. Sie hatten diesem Morgen entgegengefiebert, da der Governor ihnen versprochen hatte, sie würden erstmals das Eiland erblicken – Den Himmel auf Erden, ein Paradies aus Sand, Palmen und fruchtbarem Boden. Nun war da nur dieses flauschige wattierte Gebilde. Eine Insel, in Nebeldunst gepackt, gerade so, als habe man sie für den Postversand gepolstert. Dabei waren es die Siedler, die an einen unbekannten Ort gesendet wurden. Angelockt vom volltönenden Ruf des frischgebackenen Governors der Celeste-Insel, Arthur Mayer:
»Werden Sie reiche Plantagenbesitzer im tropischen Paradies; mit Exklusivrecht auf die Suche nach dem größten Piratenschatz der Geschichte!«
Einige der Siedler hatten zunächst an einen Scherz geglaubt, als sie auf das Inserat in der New York Times gestoßen waren. Gleichzeitig hatte das schier unglaubliche Angebot ihre Neugierde geweckt. Sie hatten Mayers Werbevortrag besucht, bei dem er sie schließlich überzeugt hatte. Er war ein guter Redner mit natürlichem Charisma und für alle, denen Worte nicht ausreichten, hatte er mit drei spanischen Goldmünzen aus dem 18. Jahrhundert gewedelt. Diese hatte er eigenhändig ausgegraben – Auf der Insel, der sie nun so nahe waren, und die trotzdem unsichtbar blieb.
Die Kinder starrten das fremdartige Gebilde fasziniert an, lachten und tuschelten dabei. Als sich jedoch über längere Zeit nichts an dem Anblick veränderte, außer dass der Wattebausch allmählich größer wurde, verloren sie die Geduld. Sie ließen sich wieder von den Möwen und Hunden ablenken und setzten ihre Spiele fort.
Als die Farewell am Nachmittag endlich in die Nebelglocke glitt, murmelte eines der Kinder, sie seien soeben durch ein mystisches Zauberportal gesegelt. Niemand widersprach. Alle anderen Passagiere – Kinder und Erwachsene – schwiegen mit offenen Mündern. Die Sicht wurde immer klarer. Und da war sie: die Insel. Sie offenbarte sich in ihrer ganzen exotischen Fremdartigkeit, die Mayer so wortreich angepriesen hatte. Die schwarzweißen Fotografien, die er während seines Vortrags gezeigt hatte, waren diesem Anblick nicht gerecht geworden. All die Farben! Buchten mit cremeweißem Sand, ganze Haine aus hohen Kokospalmen mit langen Wedeln, steile Hänge, zusammengesetzt aus einem Mosaik aller Grüntöne dieser Welt … und Wasser. Wasser stürzte sich kaskadenartig über Basaltfelsen und sammelte sich in Becken, türkisfarben in der Sonne glitzernd. Die Passagiere bekamen beim bloßen Hinsehen Durst.
Unter den Menschen an der Reling befanden sich die Chases. Miranda Chase war eine hochgewachsene Frau, Anfang dreißig, spindeldürr, mit einer energischen Nase, die Haare zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengefasst. Ihr Mann Morgan Chase, den sie knapp überragte, hatte stechend blaue Augen, einen Schnurrbart und dunkelblondes Haar. Er war gutaussehend, besaß aber gleichzeitig die Ausstrahlung eines linkischen Türverkäufers. Er wies derart unbeeindruckt mit der ausgestreckten Handfläche auf das Inselparadies, als handle es sich um eines der Mietshäuser in der New Yorker Nachbarschaft und sagte zu seiner Frau:
»Dschungel, nichts als dichter Dschungel. Siehst du den ganzen Wildwuchs? Das Unkraut sprießt direkt hinter dem Strand aus dem Boden. Ich wüsste nicht, wo wir Platz für unsere Plantagen finden sollten.« Falten bildeten sich auf Mirandas hoher Stirn, als sie erwiderte:
»Governor Mayer wird doch nicht erwarten, dass wir zuerst einen ganzen Urwald abholzen?! Davon war nie die Rede!« Sie sprach den Namen »Mayer« englisch aus.
Eigentlich handelte es sich bei »Arthur Mayer« um einen deutschen Namen. Die amerikanischen Siedler passten ihn jedoch ihrer Muttersprache an, damit er ihnen leichter von der Zunge ging.
»Nein, von Holzfällerarbeit war nie die Rede«, pflichtete Morgan ihr bei. Er redete sich in Rage: »Ich bin mir sicher, dass es vertraglich nicht so festgehalten ist. Denn dafür hätte ich nicht die halbe Welt umsegelt!«
Henry Hightide-Jones, ein hochgewachsener muskulöser Mann, der in zweiter Reihe stand und das Gespräch aufgeschnappt hatte, griff beschwichtigend ein:
»Warten Sie ab, Mr. und Mrs. Chase. Sie haben unser Ziel ja noch gar nicht gesehen. Wir segeln ganz in den Norden, in die Bahia Hermosa.« Morgan versuchte stirnrunzelnd, den melodischen Akzent seines Gegenübers einzuordnen, während er den Mann so ausgiebig von oben bis unten musterte, dass es an Unhöflichkeit grenzte.
»Mr. Jones, richtig?«, fragte Miranda, die kaum weniger auffällig starrte.
»Henry Hightide-Jones«, stellte dieser sich vor und reichte beiden Eheleuten nacheinander die Hand, welche diese nur sehr zögerlich nahmen. Sie blickten tief in seine großen dunklen Augen. Henry war der Farewell erst in Costa Rica, nicht bereits in New York, zugestiegen und die Chases hatten sich wie viele andere Siedler seither von ihm ferngehalten.
»Sie sind also der Angestellte des Governors? Der Costa Ricaner aus der Sklavenfamilie, richtig?«, fragte Miranda. Henry erwiderte ihren direkten Blick standhaft und erklärte mit einem schwachen Lächeln:
»Ich bin eigentlich nicht Arthurs Angestellter, sondern sein Geschäftspartner. Und genau wie meine Eltern es waren, bin ich ein freier Mensch.«
»Ach, Mrs. Chase, meine Liebe, die Sklaverei wurde doch schon vor sehr langer Zeit abgeschafft«, warf die goldgelockte Maddie van Berg ein, die schräg hinter den Chases stand. Sie hielt sich ihren runden Bauch.
»Mrs. van Berg, wir sind hier nicht im zivilisierten New York, sondern in der wilden Bananenwelt«, erinnerte Morgan Chase mit überheblicher Miene.
»Bei allem Respekt, Mr. Chase«, sagte Henry mit beeindruckender Seelenruhe, »die Vorfahren meiner Mutter haben Anfang des letzten Jahrhunderts als freie Menschen geholfen, Cartago gegen die Piraten zu verteidigen. Die Regierung meines Bananenlandes hat das sehr geschätzt. Meine Vorfahren haben genauso viel Anerkennung erhalten wie alle anderen.«
»Sagten Sie Karthago?«, hakte Milton van Berg ein, Maddies Ehemann, der ihr so ähnlich sah, dass die anderen Passagiere ab und an über sie tuschelten. »Der berühmte Hafen der Antike?« Henry zog die Brauen zusammen und erwiderte:
»Hm, eher nicht. Cartago im Central Valley von Costa Rica.« Milton wollte weiter nachfragen, doch Miranda Chase unterbrach ihn ungeduldig, um selbst das Wort an Henry zu richten:
»Schön und gut, Mr. High… äh…«
»Hightide-Jones. Sie können mich aber gerne Henry nennen«, ergänzte dieser.
»Na ja, dann schön und gut, Henry«, setzte Miranda erneut an, »Governor Mayer sagte uns aber doch, Ihr Großvater war ein Sklave. Der Sklave, der heimlich die Schatzkarte gezeichnet hat, die Governor Mayer Ihnen abgekauft hat. Was ist denn nun dran an dieser Geschichte?«
»Eigentlich bin ich immer noch Teilhaber an der Karte. Arthur, ich meine, Governor Mayer und ich, wir sind gleichberechtigte Geschäftspartner«, korrigierte Henry geduldig. Morgan winkte hektisch ab und hakte nach:
»Was ist denn nun aber mit der Großvater-Geschichte? War Ihr Großvater ein Sklave des berühmten Piraten Quentin Roberts? Oder hat Governor Mayer das nur erfunden?« Henry schüttelte den Kopf und erklärte:
»Mein Großvater väterlicherseits musste wirklich einige Jahre als Sklave für Quentin Roberts ackern. Großvater war ein britischer Seefahrer; und man kann sagen, er hatte ziemlich viel Pech. Zuerst war er schiffbrüchig, dann wurde er in letzter Sekunde aus dem Wasser gefischt. Aber eben ausgerechnet von Quentin Roberts, dem brutalsten Piraten im ganzen Pazifik. Roberts hatte natürlich nichts Gutes im Sinn mit den Männern, die er geangelt hatte. Sie wurden gezwungen, als Sklaven für ihn zu schuften. Mein Großvater Hamilton Jones musste mit ein paar anderen den Schatz über die Insel schleifen und verbuddeln. War eine echte Plackerei, nehme ich an. Irgendwann wurde der gute alte Hamilton aber befördert und war dann selber ein richtiger Pirat. So war der Lauf der Geschichte. Braver britischer Seemann, Sklave auf einem Piratenschiff, Pirat.«
»Sie sagen britisch?«, hakte Morgan nach. Die bleichen New Yorker starrten Henry irritiert an.
»Ja, britisch«, antwortete Henry, erneut mit einem Lächeln auf den Lippen. »Wissen Sie, Mr. Chase, das einzig Gute an den Piraten ist, dass ihnen Hautfarbe und Herkunft einerlei sind.«
»Ihr Großvater… der war aber nicht weiß?!«, sagte Miranda ungläubig.
»Weiß wie ein Schluck Milch. Genau wie mein Vater«, bestätigte Henry amüsiert.
»Hättest du das gedacht, Morgan?«, fragte Miranda ihren Mann. »Mr., äh, Henry ist doch eher braun wie ein Schokotörtchen, oder?«
Morgan Chase stimmte nickend zu und betrachtete Henry wie ein Mysterium, das er irgendwie zu fassen versuchte, während dieser versuchte, sich die Kränkung nicht anmerken zu lassen.
Ada Williams sah ihre große Schwester Miranda peinlich berührt an, bevor sie wieder verzweifelt versuchte, einen Blick auf die Insel zu erhaschen. Ihr Rollstuhl stand direkt vor Henry an der Reling und sie stemmte sich mit den Händen auf den Armlehnen auf, um besser sehen zu können.
»Frank, du solltest deine Frau vielleicht mal hochnehmen, damit sie nicht alles verpasst«, sagte Miranda zu Adas Mann, der die Bemühungen seiner Angetrauten standhaft ignorierte. Frank grummelte etwas, und nahm dann, wie ihm geheißen wurde, die zierliche junge Frau mit dem rotblonden Haar auf seinen Arm.
»Das wird was werden mit dem verdammten Rollstuhl«, knurrte er, geradeso als hätte nicht er selbst die Entscheidung getroffen, auf die Insel zu ziehen. »Das verdammte Ding wird einfach im Sand versinken und ich kann dich den ganzen Tag durch die Gegend tragen.«
»Sie sind immer auf den Stuhl angewiesen?«, fragte Maddie van Berg. Frank Williams warf einen Blick über die Schulter und erwiderte zynisch:
»Nein, sie ist nur faul und liebt es, sich herumschieben zu lassen.« Milton van Berg sah seine Frau augenrollend an.
»Was denn?«, verteidigte sich diese. »Vor einiger Zeit gab es in New York eine Kunst-Ausstellung, bei der alle Damen Schiebesessel benutzt haben. Wegen der weiten Strecken.«
»Maddie, Liebes, auf diesem Schiff sind die Strecken wohl keineswegs so weit, dass Mrs. Williams den Rollstuhl bräuchte, wenn sie nicht …«, sagte Milton und verstummte dann.
»Ich kann nicht gehen«, erklärte Ada pragmatisch. Es war das erste Mal, dass sie während der unangenehmen Konversation das Wort ergriff. Sie drehte den Kopf und schaute die Umstehenden reihum an, als sie fortfuhr: »Ich hatte einen Unfall, als ich noch ein Kind war. Seither ist der Rollstuhl mein Begleiter und tut mir gute Dienste. Das wird er auch hier.« Alle starrten Ada an und eine peinliche Stille entstand, auch wenn die Vögel, die über dem Schiff kreisten, sich mühten, diese mit ihrem Geschrei zu füllen.
»Ich bin mir sicher, Sie werden zurechtkommen«, kam Henry Ada zur Hilfe und trat einen Schritt vor, damit sie ihn besser sehen konnte. »Wir werden die Siedlung nicht im Sand bauen, sondern auf der Erde. Die kann man stampfen und Bretter verlegen.« Ada nickte zufrieden und Henry bemerkte, dass er sie etwas zu lange angesehen hatte. Eine schöne neue Welt würde das werden, wenn jeder die alte Unhöflichkeit, die alten Vorurteile und Angewohnheiten mitschleppte. Er schloss seine Augen mit den langen Wimpern für einen Moment.
Der Governor stand mit seiner Frau abseits der Gruppe. Arthur Mayer hatte sich absichtlich abgesondert. Er wollte nicht, dass sie ihm das nervöse Fieber anmerkten, das ihn jedes Mal ergriff, wenn er die Insel sah. Es war ein geradezu intimes Gefühl. Herzrasen, Gänsehaut, vermischt mit Schweißausbrüchen. Es war das Schatzfieber. Er wusste, dass einige der Siedler mehr darauf spekulierten, sich als Plantagenbesitzer eine goldene Nase zu verdienen, und dabei die Schatzsuche nur als eine Art Zusatzangebot sahen. Eine vage Möglichkeit, schnell zu noch mehr Reichtum zu gelangen. Arthur dagegen interessierte sich kaum für die Landwirtschaft. Ganz gleich, ob gewinnbringend oder nicht. Sie war für ihn nur Mittel zum Zweck. Musste dazu dienen, sie durchzufüttern.
Er begab sich bereits zum dritten Mal auf die Insel und er spürte, dass er dem Fund seines Lebens näher war als je zuvor.
Der Präsident Costa Ricas hatte ihn zum Governor des unbewohnten Eilands ernannt, ihm den Grund und Boden gar auf Zeit überschrieben, um darauf eine Siedlung zu begründen. Und noch viel wichtiger: Arthurs Grabungsgemeinschaft, sprich die Menschen an Bord des Schiffes, besaßen das alleinige Recht, nach dem Schatz zu suchen. Falls weitere Glücksritter auftauchen sollten, hatte Arthur als Governor das Recht, sie zu verjagen. Selbstverständlich wäre die Regierung Costa Ricas im Fall einer Bergung des Schatzes zu 50 % am Erlös beteiligt, doch das kümmerte Arthur nicht. Nicht, solange er derjenige war, der als Finder in die Geschichte einging.
Er atmete aus, fühlte, wie seine Finger begannen zu zittern und musste sich abwenden. Dabei bemerkte er einen einsamen Jungen. Statt mit den übrigen Kindern herumzutoben oder bei seinen Eltern zu stehen, kauerte er an der seitlichen Reling. Arthur wusste nicht, wessen Sohn er war. Im Gegensatz zu ihm hatte Henry bereits vor Aufbruch die Namen aller Siedler gelernt. Obwohl die meisten ihn mieden, kannte er jeden Einzelnen mit Vor- und Zunamen. Vermutlich sogar die Namen ihrer Hunde. Henry hatte Arthur ermahnt, sich ebenfalls so früh wie möglich mit den Menschen zu befassen, auf die er künftig angewiesen wäre, mit denen er auf engem Raum zusammenleben würde.
Doch Arthur hatte sich diesen Rat nicht zu Herzen genommen. Stattdessen hatte er sich so gut wie möglich davor gedrückt, sich mit seinen zukünftigen Nachbarn zu befassen.
Sobald sie an Land wären, würde er ihr Anführer sein, ihr Governor. Sie würden hoffentlich all die lästige Feldarbeit für ihn übernehmen, ohne allzu viel zu murren und ihm damit den Rücken bei der Schatzsuche freihalten. So stellte er sich das ideale Verhältnis zu seinen Mitmenschen vor.
Arthur seufzte, ging zu dem schmächtigen einsamen Kind hinüber und räusperte sich:
»Junge, ist dir übel? Die Seekrankheit? Wie heißt du?« Der Bursche hob den Kopf und starrte den hochgewachsenen, athletischen Mann aus dunklen Augen an.
»Ethan, Governor Mayer. Ich heiße Ethan Chase«, sagte er mit leiser, brüchiger Stimme, die Arthur über dem Rauschen der Wellen und dem Geschrei der Vögel kaum verstehen konnte. Arthur ging vor dem Jungen in die Hocke.
»Ich bin nicht seekrank«, fuhr Ethan fort und verkrampfte sich, als fürchte er eine Schelte.
»Warum bist du dann nicht bei den anderen?«, wollte Arthur wissen und seine blauen Augen fixierten Ethan. Dieser war zu schüchtern, um ehrlich zu antworten, nun da Governor Mayer höchstpersönlich das Wort an ihn richtete. Der ranghöchste Mann und noch dazu ein Abenteurer aus dem Bilderbuch: ehrfurchtgebietend, bärtig und mit wildem langem Pferdeschwanz.
»Lass mich raten«, sagte Arthur und wies auf die Siedler, »dir ist es nicht nach diesem hysterischen Menschenauflauf?« Ethan wusste nicht, was er antworten sollte. Er ging davon aus, negativ aufgefallen zu sein, wand sich und überlegte, wie er unbeschadet aus dieser Situation herauskommen sollte. Als Arthur ihm jedoch neckisch zuzwinkerte, nickte er vorsichtig. Dann legte der Governor dem Jungen eine Hand auf die Schulter und erklärte:
»Das kenne ich. Mir geht es genauso. Aber den Anblick da vorne an der Reling, den solltest du dir nicht entgehen lassen. Ein kleiner Ratschlag von Mann zu Mann.« Ethans Miene hellte sich schlagartig auf. Er lächelte.
»Danke, Mr. Governor Mayer. Danke für den Hinweis«, erwiderte er, stand auf und machte sich auf den Weg zu seiner Familie.
Arthur kehrte zu seiner Frau zurück. Die Frau, die er zwei Jahre lang nicht gesehen hatte und die er auch darüber hinaus kaum kannte. Mary J. Blackwell. Nein, Mary J. Mayer. An diesen Namen würde er sich noch gewöhnen müssen. Sie würdigte ihn keines Blickes, hatte einzig und allein Augen für die neue Welt, die sich vor ihr ausbreitete. Ihr Haar, dunkelbraun, kinnlang und leicht gelockt, wehte im Wind. Reglos wie eine Statue stand sie neben ihm, eine natürliche Eleganz ausstrahlend. Perfekt gekleidet: knöchellanger Faltenrock mit Nadelstreifen und eine geknüpfte, cremefarbene Bluse mit leichten Puffärmeln sowie Stehkragen, geziert von einer grünen Brosche. Dazu trug sie Schnürstiefel. Alles in allem vornehm, jedoch nicht zu fein für die wilde Natur. Arthur bewunderte ihre Stilsicherheit, während er befand, dass all die anderen Siedler entweder zu sehr herausgeputzt oder für die feierliche Ankunft zu rustikal gekleidet waren. Er wollte Mary J. ein Kompliment machen, fand jedoch nicht die richtigen Worte. Wie sprach man zu einer Frau wie ihr? Besonders in einer ungewöhnlichen Situation wie dieser. Wenn Arthur sie ansah, hoffte er zumeist nur, sie würde keine Spielchen mit ihm treiben, ihm keinen Ärger machen und ihn nicht von seiner Mission ablenken. Diese Gedanken behielt er selbstredend lieber für sich.
Die beiden hatten sich vor zwei Jahren in Puntaguas, Costa Rica, kennengelernt – und einen Tag nach ihrer ersten Begegnung geheiratet. Dabei hatte es sich jedoch nicht um eine überstürzte Romanze gehandelt. Beim Kuss in der kleinen leeren Kapelle hatten sie darauf geachtet, dass ihre Lippen sich nicht berührten. Kurze Zeit später war Arthur abgereist, um in den Staaten Siedler anzuwerben und den Umzug auf die Insel vorzubereiten. Mary J. hatte solange in ihrem alten Zuhause in Puntaguas ausgeharrt. Sie hatte dort auf ihren verwirrten greisen Vater aufgepasst, der nun in der Kajüte schlief, wie er es während der meisten Zeit auf der Überfahrt getan hatte. Mary J. und er waren der Farewell genau wie Henry erst bei ihrem Zwischenstopp in Puntaguas zugestiegen, zusammen mit Ziegen, Hühnern, Enten und Puten, die Henry in Arthurs Auftrag gekauft hatte.
Eine blondgelockte, offensichtlich schwangere Frau trat zu Mary J. und fragte sie etwas, das Arthur über dem Brausen der Wellen nicht verstehen konnte.
Der Captain manövrierte die Farewell nun in die Meerenge zwischen den vorgelagerten Felseninseln und der Hauptinsel. Der Seegang wurde mit einem Mal deutlich stärker. Mary J. lächelte der blonden Siedlerin, deren Namen Arthur nicht kannte, zu und nickte. Arthur fühlte sich unwohl, verspürte das Bedürfnis, Mary J.s Hand zu nehmen, nur um mehr auszusehen wie ein richtiger Ehemann. Gleichzeitig wusste er, dass er sich dabei nicht weniger seltsam gefühlt hätte.
»Sie beide sind ein ganz reizendes Paar. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?«, rief die blonde Frau mit schriller Stimme, bemüht die dröhnenden Wellen zu übertönen. In diesem Moment hob sich der Bug des Schiffes sehr plötzlich. Nur einen Augenblick später ging es schwungvoll abwärts. Den Passagieren wurde flau. Ein kurzer Aufschrei ging über das Deck und alle griffen schnell nach der Reling. Arthur bekam ein paar Tröpfchen Gischt zu spüren. Mary J. wandte sich der Siedlerin zu und sagte mit ihrer festen, dunklen Stimme:
»Das, meine Beste, erzähle ich Ihnen, wenn wir festen Boden unter den Füßen haben.« Sie sprach mit hörbar spanischem Akzent. Kaum verwunderlich, so hatte die gebürtige US-Bürgerin doch fast ihr ganzes Leben in Costa Rica verbracht.
Dank der Turbulenzen gab sich die blonde Frau nur zu gern mit einer Vertagung des Gesprächs zufrieden. Mary J. hatte die Situation gut gerettet.
Arthur würde später über eine gute Geschichte nachdenken, die sie bei solchen Nachfragen auftischen konnten.
Spätestens wenn ein Schiff in die Meerenge eindrang, machte die Celeste-Insel deutlich, dass sie Gäste nicht mit Sanftmut und offenen Armen empfing. Nur ein erfahrener Captain konnte den Wogen in der engen Passage Herr werden. Gerüchteweise waren bereits über hundert Schiffe an den scharfen Kanten der vorgelagerten Inseln – kaum mehr als große Felsen – zerschellt. Arthur hatte die schwierige Anfahrt im Voraus lieber nicht vor den Siedlern erwähnt. Folglich wurden diese nun überrascht von der Wildheit des Meeres. Einige hatten sich zurückgezogen, Frauen die Arme um ihre Kinder gelegt. Die anderen schielten mit besorgten Mienen von links nach rechts.
»Mr. Mayer, Mr. Governor«, rief die blondgelockte Frau neben Arthur und zog ihn am Ärmel. »Sind wir denn in ein Unwetter geraten? Wird denn alles gutgehen?« Arthur bedachte den stahlblauen Himmel mit einem Lächeln und versicherte ihr:
»Das ist der übliche Wellengang vor Celeste. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Glauben Sie mir, ich war schon zweimal hier. Es ist ein wenig unangenehm für Landratten. Aber das ist reine Gewohnheitssache. Es ist alles in bester Ordnung. Wir werden bald in der Bahia Hermosa ankern. Alles wird gutgehen.« Die Siedlerin nickte unsicher. Sie war etwas grün um die Nase. Aus dem Augenwinkel sah Arthur, wie weitere aufgebrachte Siedler auf ihn zustürmten. Ahnend, dass sie ähnliche Fragen und Beschwerden an ihn richten wollten, berührte er die blondgelockte Frau am Oberarm und rief ihr zu:
»Können Sie mir einen Gefallen tun und das, was ich Ihnen eben gesagt habe, auch den anderen Passagieren mitteilen?« Er wies auf die Männer und Frauen, die sich näherten wie eine Gewitterwolke. Die blondgelockte Frau sah ihn groß an und nickte. Er bedankte sich und sie nahm sich den anderen an. Tatsächlich hielt das die Siedlerwolke von Arthur fern. Sein Blick traf Mary J.s und sie lächelte ihn spöttisch an. Ihr Gesichtsausdruck sagte: »Ein schöner Governor, der sich davor drückt, zu seinen Mitmenschen zu sprechen.« Der Wellengang schien ihr nichts auszumachen. Arthur wandte den Blick von ihr ab. Sollte sie doch denken, was sie wollte.
II. IN DEN SAND GESETZT
04. Januar 1904
Die Bahia Hermosa war ein malerisches Fleckchen Erde. Ganz so wie sich die New Yorker eine einsame Insel im Südpazifik vorgestellt hatten: sanft, sandig, eingerahmt von einem Hain aus Kokospalmen, der Akzente in frischem Grün setzte. Die hohen dürren Stämme zeichneten lange Schatten in den weißen Sand. Einige dieser Palmen würden der Siedlung weichen müssen. La Hermosa, die Schöne, würde das Dorf heißen: die schöne Ortschaft in der schönen Bucht.
Die Farewell ankerte unweit des Sandstrands. Damit war die Anreise jedoch noch nicht geschafft, wie Arthur sehr wohl wusste. Nach dem Passieren der Meerenge stand eine weitere Herausforderung bevor. Das Anlanden mit den kleinen Holzbooten war eine heikle Angelegenheit. Auch dieses Detail hatte Arthur wohlwissend bei seinem Vortrag verschwiegen.
»Aber wir sind doch noch gar nicht da«, sagte Maddie van Berg bestürzt, als die Ankerkette rasselnd heruntergelassen wurde. »Wo ist denn der Hafen?«
»Es gibt keinen Hafen, Liebes«, erklärte ihr Mann.
»Und wie kommen wir jetzt an Land?«, fragte Maddie bestürzt.
»Wie die Piraten, Mrs. van Berg«, sagte Morgan Chase grinsend. Ängstlich beobachtete Maddie, wie die Mannschaft drei Ruderboote hochzog und hielt instinktiv schützend die Hand vor ihren runden Bauch.
»Herrschaften, wir sind bereit, an Land zu gehen. Sechs bis sieben Personen pro Boot, Kinder unter 12 Jahren zählen nur halb. Die alphabetische Reihenfolge und die Verteilung entnehmen Sie bitte den Passagierlisten. Die ersten drei Gruppen dürfen sich nun zu den Leitern begeben«, rief Arthur.
»Unser Gepäck…«, sagte die zierliche Elizabeth Richardson erschrocken. Arthur schüttelte den Kopf.
»Nein, Ihr Gepäck bleibt vorerst auf dem Schiff. Wir werden es später für Sie holen. Zuerst wollen wir Sie und Ihre Familien sicher an Land bringen«, erklärte er und hoffte, dass die Nervosität nicht in seiner Stimme mitschwang. Die Bedingungen zum Übersetzen waren zu dieser Tageszeit nicht optimal. Am späten Nachmittag herrschte bereits Flut, die Wellen waren hoch und ungestüm. Eine Ankunft am Vormittag wäre geschickter gewesen. Doch auf hoher See konnte man nun einmal nicht wählerisch sein. Beinahe drei Tage waren vergangen, seit sie Puntaguas an Costa Ricas Südspitze verlassen hatten. Nun wollte Arthur keine weitere Minute verlieren.
Er würde eines der Boote selbst rudern. Henry und der Captain der Farewell übernahmen die anderen beiden. Alle drei Männer waren erfahrene Seeleute und vertraut mit der Bucht und ihren Strömungen. Die Chases, Miranda, Morgan, der zwölfjährige Ethan und seine beiden kleinen Schwestern, waren Arthurs Boot zugeteilt. Zudem Mary J., die als Frau des Governors über der alphabetischen Reihenfolge stand, sowie ihr verwirrter Vater Liam Blackwell.
Mary J. half ihrem Vater die Strickleiter hinab und in das Boot. Nachdem sie selbst neben ihm Platz genommen hatte, starrte sie Arthur gespannt an. Er erwiderte ihren Blick bemüht standhaft. Arthur wusste, dass er sich nun beweisen musste. Sie wollte wissen, ob sie auf das richtige Pferd gesetzt hatte. Natürlich hatte er mit dem erfolgreichen Anwerben der Siedler und den Reisevorbereitungen bereits gezeigt, dass er nicht nutzlos war. Doch nun sah sie ihn zum ersten Mal in seiner Rolle als Seefahrer und Abenteurer. In Mary J.s Gesicht lag die pure Neugierde, nicht Furcht wie in den Mienen der Chases. Das Boot wurde noch vor dem ersten Ruderschlag von den Wellen senkrecht hochgehoben und sackte dann rasend schnell nach unten. Die Chases klammerten sich an ihre Sitze. Miranda und Morgan klemmten die Mädchen zwischen sich ein, während Ethan, Mary J. und Liam Blackwell sich auf der anderen Bank aneinanderpressten. Mary J. hielt ihren Vater fest, als dieser sich irritiert umsah, zur Insel hinüberzeigte und irgendetwas vor sich hin brabbelte. Arthur war froh gewesen, dass der Greis es geschafft hatte, die Leiter herunterzusteigen und hoffte nun inständig, er würde nicht noch vor dem Anlanden ins Meer stürzen.
Die Bootsführer beobachteten den Seegang konzentriert und tauschten zwischendurch Blicke. Sie mussten die schlimmsten Brecher abwarten und mit den sachteren Wellen übersetzen. Captain Matthews nickte und alle drei Männer warfen sich in die Ruder. Auf den ersten Metern sah es ganz gut aus. Dann prallte eine heftige Welle gegen die kleinen Boote. Sie wurden samt schreienden Passagiere zurück in Richtung der Farewell befördert.
»Alles in Ordnung!«, rief Arthur. »Das ist ganz normal. Noch ein, zwei Versuche und wir haben es geschafft.«
Er sollte recht behalten. Beim dritten Anlauf trugen die Wellen alle drei Boote an den Strand. Als die Passagiere endlich in den weichen Sand traten, zitterten ihre Knie. Sie hatten das Gefühl, der Boden unter ihnen schwanke noch. Mary J. strich ihr Haar glatt und bedachte Arthur mit einem Nicken. Ihre Miene war kühl wie immer, doch er gab sich mit dem unterschwelligen Lob zufrieden. Die erste Prüfung hatte er bestanden. Nun musste er dieses Kunststück nur noch um die zwölfmal wiederholen, um die restlichen Siedler und ihr wichtigstes Gepäck anzulanden. Am nächsten Morgen, bei Ebbe, würden er, Henry und Captain Matthews jede Menge damit zu tun haben, Baumaterial, Möbelstücke und Nutztiere nachzuholen. Lediglich die Hunde durften direkt mit ihren Herren übersetzen.
Endlich waren alle Siedler an Land, samt Ada Williams‘ riesiger Hund Snooper und ihrem Rollstuhl, dem Greis Blackwell, der hochschwangeren Maddie van Berg, der gichtgeplagten Martha Povich und ihrem schrägen Mann Ivan, den ängstlichen, etwas pikierten Richardsons und all den kleinen Kindern. All jenen, die nicht Arthurs erste Wahl gewesen waren, die er aber hatte mitnehmen müssen, um die vom Präsidenten Costa Ricas vorausgesetzte Siedlerzahl vorweisen zu können.
Captain Matthews verabschiedete sich und kehrte zur Farewell zurück.
Arthur war fürs Erste zufrieden mit sich und der Welt. Eigentlich hätte er völlig erschöpft sein müssen. Das Ruder-Manöver hatte erhebliche Muskelkraft erfordert. Außerdem brannte die Sonne erbarmungslos vom Himmel und löste den Schweiß aus all seinen Poren. Doch er fühlte sich vitaler denn je zuvor. Er spürte eine tiefe Verbundenheit mit diesem Eiland.
Er war auf der Celeste-Insel zu Hause. Nicht nur mehr zu Hause als die Neuankömmlinge, die zum ersten Mal Fuß auf das Land setzten. Auch mehr zu Hause als Henry, obwohl die Geschichte seines Großvaters mit diesem Fleckchen Erde verknüpft war. Sogar mehr zu Hause als all die Brauntölpel, die über ihm am Himmel kreisten und seit Generationen hier brüteten. Woher Arthurs Verbindung zu diesem abgelegenen Ort am Ende der Welt rührte, konnte er nicht sagen.
Er beobachtete, wie die Siedler in kleinen Grüppchen mit Sonnenschirmen über den Strand spazierten, ihre Füße vorsichtig in den kleinen Bachlauf hielten, oder im Schatten der Palmen rasteten und sich Luft zufächelten. Sie alle waren in dieser neuen Welt eindeutig noch nicht zu Hause, wirkten wie ungeladene Gäste. Wie die hilflosen Touristen, die er in belebten Häfen oft beobachtet hatte.
»Die ersten Menschen. Gerade vom Himmel gefallen«, sagte Mary J. mit Blick auf die Siedler, ganz als habe sie seine Gedanken gelesen. Arthur zuckte zusammen, weil er die Anwesenheit seiner Frau nicht bemerkt hatte. Er fragte sich, wie lange sie schon hinter ihm stand.
»Welcher Religion gehören Sie an, Mrs. Mayer, in der die ersten Menschen vom Himmel gefallen sind?«, fragte er lächelnd. Mary J. trat neben ihn und gab trocken zurück:
»Wir wurden katholisch getraut, Mr. Mayer.« Dann fügte sie herablassend hinzu: »Ich habe eine Metapher benutzt. Ich bin Schriftstellerin.«
»Ich weiß. Ich wollte damit nur anmerken, dass diese Metapher womöglich nicht allzu geschickt gewählt war«, sagte Arthur und weil sie dies mit finsterer Miene quittierte, fügte er versöhnlich hinzu: »Das ist jedoch nur meine laienhafte Meinung. Und die Siedler werden schon noch heimisch werden. Ende des 18. Jahrhunderts hat ein britischer Captain europäische Schweine auf der Insel ausgesetzt, denen Klima und Terrain völlig unbekannt waren. Sie haben sich prächtig vermehrt und hinterlassen noch heute überall ihre Spuren.« Mary J. sah ihn für einen Moment abschätzend an, um sich zu vergewissern, dass er die Bemerkung ernst gemeint hatte, bevor sie in Gelächter ausbrach.
»Großartig! Der Governor findet, meine Metaphern seien nicht allzu geschickt gewählt und vergleicht seine Mitmenschen im nächsten Moment mit Schweinen.« Arthur seufzte. Er konnte gut zu Menschen sprechen, jedoch nicht allzu gut mit ihnen. Auf der Überfahrt hatte er lediglich höfliche Floskeln mit Mary J. ausgetauscht.
Als er die Konversation gerade als kläglich gescheitert abhaken wollte, sagte sie:
»Jedenfalls wollte ich sagen: gut gemacht! Das war eine beeindruckende Leistung.« Arthur sah sie überrascht an.
»Das Anlanden?«, fragte er und winkte betont lässig ab. »Ach, das war gar nichts. Nur das übliche Geduldsspiel. Kennt man es einmal, so ist es ein recht langweiliges Prozedere.«
»Mag sein. Meine laienhafte Meinung ist, dass es wild aussah. Sagtest du nicht, die Bahia Hermosa sei die Bucht, in der man am leichtesten anlanden kann?«, fragte Mary J. und fixierte ihn mit ihren dunklen Augen. Arthur nickte und bestätigte:
»So ist es auch. Es gibt auf der ganzen Insel nur zwei Buchten, in denen man überhaupt übersetzen kann. Die Bahia Hermosa ist die sicherere, die gnädigere von beiden, glaub mir.«
»Hm«, machte Mary J. und ließ ihren Blick nachdenklich über den Strand schweifen. »Ob die Insel uns wohl hier haben will?«
»Die Piraten hat sie immer herzlich willkommen geheißen«, erwiderte Arthur.
»Und viel schlimmere Gäste können wir wohl auch nicht sein«, ergänzte Mary J. und ging lächelnd davon.
Henry und Arthur ließen den Siedlern noch ein wenig Zeit zum Flanieren, bevor sie alle zusammentrommelten und anwiesen, ihnen beim Spannen der Zeltplanen im Palmenhain zu helfen. Diese würden ihren ersten provisorischen Regenschutz darstellen.
»Ist das denn wirklich nötig?«, fragte Morgan Chase. »Es sieht überhaupt nicht nach Niederschlag aus.«
»Das Wetter kann hier sehr launenhaft sein und binnen Minuten umschlagen«, gab Arthur zurück.
»Es…«, begann Henry, doch Arthur brachte ihn mit einem Blick zum Schweigen. »Das stimmt«, korrigierte Henry sich kleinlaut.
Insgeheim hatte Arthur aufgeatmet, als die Insel zur Begrüßung ihr schönstes Sonnenstrahlen aufgesetzt hatte. In seinem Werbevortrag hatte er den häufigen Niederschlag als ideal für das Pflanzenwachstum umschrieben. Dabei hatte er verschwiegen, dass die Anzahl der jährlichen Regentage 350 betrug, dass also im Umkehrschluss nur mit rund zwei völlig trockenen Wochen – ohne auch nur gelegentliche Schauer – zu rechnen war. Diese Tage verteilten sich auf die Zeit zwischen Dezember und März. Einen solch sonnenreichen Tag für die Ankunft zu erwischen, war ein Hauptgewinn.
Das paradiesisch tropische Wetter trug mit Sicherheit zur heiteren Stimmung bei, die während des Aufschichtens und Entzündens eines großen Lagerfeuers herrschte. Die Siedler würden die speziellen klimatischen Bedingungen noch früh genug kennenlernen, befand Arthur.
Als die Sonne bereits untergegangen war, war die Feuerglut optimal, um mitgebrachte Vorräte zu grillen. Ausgelassenheit und hoffnungsvolle Freude herrschten beim Essen vor. Es wurde viel erzählt, gescherzt und gelacht. Dazu wurde Wasser aus dem kleinen Bach gereicht.
»Das kristallklarste Wasser auf der ganzen Welt«, erklärte Arthur.
»Ich würde trotzdem einen Schluck vom braunen Wasser bevorzugen«, bemerkte Morgan Chase. Arthur warf ihm einen Blick zu, wohlwissend, dass Morgan vom mitgebrachten Rum sprach. Für Arthurs Geschmack war Morgans Klappe etwas zu groß, sein Vorschlag jedoch nicht schlecht. Er nickte. Henry stand auf, um Arthur zur Hand zu gehen und gab ihm einen Klaps auf den Oberarm.
»Du solltest einen Toast ausbringen«, sagte er. »Ich meine«, er vollführte eine spaßhafte Verbeugung, »Sie sollten einen Toast ausbringen, Mr. Governor, bitte.«
»Hast du schon am Rum genippt?«, gab Arthur zurück. Henry grinste breit und rief:
»Liebe Leute, alle herhören, der Governor möchte eine kleine Ansprache halten. Kommt alle zusammen!«
Während Henry den Rum aus bauchigen Flaschen in Becher goss, mühten sich die Mütter, all die Kinder um das Feuer zu versammeln. Die Kleinen sollten vom Toben am Strand zurückkehren, um den Worten ihres Governors zu lauschen.
»Anna, wo ist Ethan?«, fragte Miranda Chase ihre kleine Tochter. Das blonde Mädchen schüttelte den Kopf und zuckte die Schultern.
»Er wollte nur ein Stück mit Snooper gehen«, teilte Ada mit.
»Und du erlaubst deinem Neffen ganz großzügig, sich am ersten Abend mutterseelenallein auf einer fremden Insel herumzutreiben? Ohne mich zu fragen?«, rief Miranda und stemmte die Hände in ihre schmalen Hüften.
»Entschuldige. Ich habe ihm gesagt, er solle am Strand bleiben und bald wiederkommen«, erklärte Ada.
»Ja? Und siehst du ihn jetzt irgendwo?«, fuhr Morgan sie an. »Der Bengel macht nie, was man ihm sagt, Ada.«
»Was regst du dich auf, Morgan? Snooper ist ein stinkendes Monster. Er wird alles vertreiben, was da draußen lauert«, gab Adas Mann Frank pragmatisch zurück.
»Seien Sie unbesorgt. Auf der Insel gibt es keinerlei gefährliche Tiere. Keine Giftschlangen, keine Raubtiere«, erklärte Arthur.
In diesem Moment ertönte ein tiefes, kehliges Bellen und Snooper, der irische Wolfshund, kehrte von seinem Spaziergang zurück. Allerdings ohne Ethan Chase.
»Verdammter Rotzlöffel!«, rief Morgan, sprang auf und ging in die Richtung, aus welcher der Hund zurückgekommen war. Dabei riss er eine der Fackeln aus dem Boden, die in der Nähe des Lagerfeuers brannten. Einen Moment lang sahen ihm alle nach, während Ada über den langen graufelligen Kopf ihres Hundes strich und sich erneut bei ihrer Schwester entschuldigte.
»Ich werde bei der Suche helfen«, erklärte Henry, die Rumflasche beiseitestellend.
»Nehmen Sie Snooper mit, Mr. Hightide-Jones«, rief Ada. »Er kann Sie zu Ethan führen.« Henry warf der zierlichen Frau einen Blick zu, beeindruckt, dass sie seinen vollen Nachnamen kannte. Vermutlich war sie damit die Einzige, abgesehen von Arthur und Mary J..
»Bloß nicht«, widersprach Frank und erhob sich, um sich Henry anzuschließen. »Das dumme Vieh würde nicht einmal seine eigenen Vorderpfoten finden.« Als Ada zu einem Widerspruch ansetze, würgte Frank sie mit einer Handbewegung ab und erklärte:
»Ada, ich gehe jetzt und bade aus, was du dumme Ziege angerichtet hast. Also halte deinen Mund!« Henry blickte hilflos zwischen den Eheleuten hin und her, dem quadratschädligen, blonden Hünen und der zarten Frau mit dem zerknirschten Blick.
»Mr. Williams«, sagte er dann vorsichtig und wusste im selben Moment, dass er sich lieber zurückgehalten hätte. »Ganz ruhig. Es gibt keinen Grund für Beschimpfungen.« Frank baute sich vor Henry auf und rief:
»Du willst mir sagen, wie ich mit meiner Frau zu reden habe? Halt dich gefälligst raus, ungesitteter Dummkopf!« Arthur sprang auf, zog die beiden auseinander und sagte mit lauter Stimme:
»Meine Herren, es gibt tatsächlich keinen Grund für Beleidigungen und gegenseitige Anschuldigungen! Die Nerven mögen blank liegen nach diesem aufregenden und anstrengenden Tag, aber wir wollen einander respektvoll behandeln und nun gemeinsam den Jungen suchen, anstatt wertvolle Zeit zu vergeuden!« Henry nickte, während Frank etwas grummelte und eine der verbleibenden Fackeln an sich nahm.
Arthur, Henry und Milton van Berg schlossen sich ihm schweigend an. Mary J. griff nach Maddies Hand und wies auf Liam Blackwell, der im Sand am Feuer eingenickt war.
»Sei bitte so lieb und hab ein Auge auf meinen Vater. Falls er aufwacht, sag ihm, dass er auf mich warten und sich nicht von der Stelle rühren soll.« Dann rannte sie den Männern hinterher.
Sie riefen Ethans Namen und wanderten dabei durch den Palmenhain in Richtung des Dschungels. Noch bevor sie Morgan Chase einholten, hörten sie seine Stimme:
»Er ist hier!« Irgendetwas an seinem Tonfall klang seltsam. Frank Williams und die anderen eilten in die Richtung, aus der Morgans Ruf ertönt war. Bald schon sahen sie zwei Silhouetten vor einer niedrigen Felsenhöhle, scheinbar kaum mehr als ein kleines Kriechversteck in einem bewachsenen Hügel. Vater und Sohn standen geduckt nebeneinander, ihnen die Rücken zuwendend. Sie starrten irgendetwas in der Höhle an. Morgan leuchtete mit der Fackel hinein. Als Ethan die Neuankömmlinge über die Schulter anblickte, offenbarte sich ihnen ein großes Veilchen über seinem linken Auge.
»Was ist geschehen?«, fragte Arthur und wies darauf.
»Bin hingefallen«, murmelte Ethan. Niemandem entging der flüchtige Blick, den er seinem Vater zuwarf.
»Jetzt seht euch mal diese Scheiße an«, rief Morgan Chase und stieß seinen Sohn beiseite, damit die Neuankömmlinge neben ihn treten konnten. Mary J. und die Männer drängten sich um den Höhleneingang und steckten die Köpfe zusammen. Als sie erkannten, was Morgan Chase da beleuchtete, zuckten sie erschrocken zurück. Das orangerote Licht der Fackel beleuchtete die ledrig schwarze Haut zweier leidvoll verkrümmter Leichen. Im tanzenden Feuerschein der Fackel konnte man beinahe meinen, sie wänden sich noch immer am Boden, die Hand- und Fußgelenke mit Eisenketten gefesselt. Ihre Münder weit geöffnet, als würden sie schreien, um Gnade rufen, im Feuer, das ihr Fleisch verbrannt und die Ketten geschwärzt hatte.
»Scheint nicht gerade das friedlichste Plätzchen zu sein, das Sie hier haben, Governor Mayer«, sagte Morgan.
»Was ist denen nur zugestoßen, Governor Mayer?«, fragte Milton van Berg.
»Das ist schwer zu sagen«, antwortete Arthur ehrlich. »Vielleicht rivalisierende Schatzsucher. Beziehungsweise ein Streit innerhalb eines Schatzsucher-Trupps. Ich habe von Männern gehört, die ihren Partnern wegen ein paar Goldmünzen die Kehle aufgeschlitzt haben.«
»Und wie viele Münzen braucht es, um jemanden zu fesseln und zu verbrennen?«, wollte Morgan Chase wissen. Henry bemerkte, dass Ethan zitterte, nahm ihn zur Seite, wo er die Toten nicht mehr sehen konnte und legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Das ist zugegebenermaßen ungewöhnlich«, räumte Arthur ein.
»Moment mal, andere Schatzsucher?«, hakte Frank Williams ein. »Wir sollten doch die einzigen Bewohner dieser verdammten Insel sein.«
»Wir sind die Einzigen, die offiziell das Recht haben, hier zu sein«, versetzte Arthur. »Das bedeutet nicht, dass keine anderen kommen werden.«
»Aber Mr. Mayer, Governor Mayer«, wandte Milton van Berg ein, »denken Sie, der Mörder ist noch hier? Mit uns auf der Insel?« Arthur holte Luft, wollte etwas sagen, besann sich und erklärte dann:
»Das halte ich für unwahrscheinlich.«
»Wir sollten jetzt zurück zu den anderen gehen«, sagte Henry, der immer noch bei Ethan stand. »Wir müssen ihnen sagen, dass wir den Jungen gefunden haben.« In Gedanken fügte er hinzu: »Und außerdem sollten wir sie nicht länger alleine lassen.« Als niemand widersprach, machte sich der Trupp auf den Rückweg. Arthur, Henry und Mary J. bildeten die Nachhut.
»Ist dir was am Eingang der Höhle aufgefallen?«, raunte Henry Arthur zu. Dieser nickte und gab leise zurück:
»Er wurde freigeschnitten.« Mit ihren geschulten Augen hatten sie beide erkannt, dass jemand die Ranken gekappt hatte, die zuvor wohl wie ein Vorhang vor der Öffnung heruntergehangen waren. Und diese Triebe hatten noch keine Zeit gehabt, nachzuwachsen.
»Die armen Schweine sind außerdem nicht in der Höhle verbrannt worden«, sagte Arthur leise. Nun nickte Henry. Der Boden war feucht gewesen, von grünem Moos bewachsen, nicht versengt.
III. EIN ABENTEUER
Nacht vom 04. auf den 05. Januar 1904
Nachdem Arthur den am Lagerfeuer Zurückgebliebenen Bericht erstattet hatte, kam bei ihnen sofort dieselbe Frage auf, wie schon bei Milton van Berg zuvor: War der Mörder etwa noch auf der Insel? Ein grausamer, zweifacher Mörder, womöglich sogar mit Komplizen? Arthur versuchte, die Siedler zu beruhigen.
Ethan, der sich zwischen Snooper und Ada gekauert hatte, flüsterte Letzterer etwas zu. Ihre Miene entgleiste und ihre Augen weiteten sich. Mit einem lauten »Scht, scht« brachte sie die anderen Siedler zum Schweigen und verkündete:
»Ethan hat etwas gehört!« Sie sah den Jungen ermutigend an. »Ethan, sag es ihnen.« Er schielte verstohlen zu seinem Vater hinüber, dann wieder zu Ada. Diese nickte ihm zu. Ethan räusperte sich. Dann sagte er mit heiserer Stimme:
»Eine Melodie. Deshalb bin ich dort hin gegangen.«
»Eine Melodie? Was ist das für ein verdammter Unsinn?«, rief Morgan Chase ärgerlich, doch Arthur gebot ihm mit erhobener Hand, zu schweigen.
»Eine Melodie, sagst du, Junge?«, fragte er dann. »Wir müssen genau wissen, was du gehört hast. Hat jemand gesungen?« Ethan schüttelte den Kopf und sah zu Boden.
»Du hast also eine Melodie gehört, aber niemand hat gesungen«, fasste Arthur zusammen. »Hast du dann ein Instrument gehört?« Ethan schüttelte erneut den Kopf.
»Jemand hat gepfiffen«, mutmaßte Ada. Ethan wiegte den Kopf hin und her, nickte dann halbherzig und sagte:
»Es war fast mehr so ein Säuseln.«
»Ethan!«, fuhr Morgan Chase ihn an, »wenn du Unsinn redest, bringe ich deinen Kopf zum Säuseln.«
»Morgan, bitte!«, sagte Ada. »Der Junge hat einen Schock erlitten. Er hat etwas Schreckliches gesehen ... Ethan, sollen wir vielleicht zusammen beten, wäre das was?«, fügte sie mit sanfter Stimme hinzu und nahm die Hand des Jungen. Er nickte dankbar. Die beiden falteten die Hände und murmelten ein Gebet.
»Ich sage nur: Fluch«, murmelte Martha Povich, eine kräftig gebaute Frau mit der wirren Lockenfrisur. Ihre hängenden Backen vibrierten, als sie den Kopf schüttelte.
»Wie bitte?«, fragte Mary J., stemmte die Hände in die Seiten und starrte die Frau an.
»Ein Fluch. Der Schatz und ein alter Fluch«, war die geheimnisvolle Erwiderung, die Martha gestenreich untermalte.
»Sie haben wohl ihre Nase zu tief in den Rum gehängt, während wir den Jungen gesucht haben«, bemerkte Mary J. und einige der Siedler lachten. Die anderen sahen sich bang um.
»Ein Säuseln, Ethan«, sagte Miranda Chase kopfschüttelnd. »Der Wind säuselt.«
»Mr. Mayer, Governor«, rief Maddie van Berg, sprang auf und hielt ihren runden Bauch. »Sollten wir nicht sofort zurück auf das Schiff? Hier ist es nicht sicher!« Einige Stimmen pflichteten ihr bei.
»Nein, Ma‘am, das wäre mit Verlaub das Dümmste, was wir nun anstellen könnten«, erklärte Arthur. »Unser gefährlichster Feind ist kein umherstreifender Mörder, sondern die blinde Panik. Ich verstehe, dass alle aufgebracht und verunsichert sind. Außerdem bedauere ich zutiefst, dass die Insel an unserem ersten Abend eine so unangenehme Überraschung für uns bereithält. Sie fürchten um Ihr ungeborenes Kind, Ma‘am, ich weiß. Wir alle wollen unsere Familien beschützen, für Sie alle ist die Situation unbehaglich und das Terrain fremd. Doch Henry und ich haben schon zahlreiche Abenteuer erlebt und dabei eines gelernt…« Während er sprach, schien Arthur in die Höhe zu wachsen. Alle hingen wie gebannt an seinen Lippen, als er nach einer rhetorischen Pause fortfuhr:
»Wir können uns nur schützen, indem wir unser flaues Bauchgefühl vergessen und uns an die Fakten halten. Also, was sind die Fakten: Zuerst einmal nehme ich nicht an, dass der Mörder noch auf der Insel ist. Die Leichen liegen vermutlich schon wochen- oder monatelang in der Höhle. Der Mörder hat die Menschen auf dieser für Schätze berühmten Insel höchstwahrscheinlich aus Gier getötet. Das führt zu dem Schluss, dass er etwas gefunden hat und darauf bedacht war, schnell zu verschwinden und seine Kostbarkeiten in Sicherheit zu bringen. Und selbst wenn noch jemand hier wäre: Ich habe noch nie von einem Schatzsuchertrupp gehört, der mehr als zehn Mann stark war. Im schlimmsten Fall müssten wir also noch mit acht Männern rechnen. Wir sind 27 Erwachsene, 22 Kinder, die Hunde habe ich nicht gezählt. Wir sind gut bewaffnet und können uns hier in unserem Lager bei der Nachtwache abwechseln. Dann wird uns nicht entgehen, was um uns herum vorgeht. Bei nahender Gefahr können wir schnell genug reagieren. Die einzige Alternative wäre, zu versuchen, zurück zur Farewell zu gelangen, wie die Dame eben vorgeschlagen hat. Was meinst du, Henry, wie stünden unsere Chancen?« Dieser schüttelte seinen Kopf und erwiderte:
»Nicht gut. Gar nicht gut. Bei der Strömung um diese Uhrzeit und in der Dunkelheit wäre das eine halsbrecherische Aktion.«
»Außerdem haben wir hier momentan nur zwei Boote«, mischte sich Mary J. ein. »Wir könnten also nur einen Teil der hier Versammelten auf einmal zur Farewell bringen. Wir würden uns dadurch aufteilen und selbst schwächen.« Arthur sah sie von der Seite an. Dann wandte er sich wieder an die anderen Siedler und sagte:
»Wir teilen nun die Nachtwachen ein. Und vergessen Sie nicht: Früher an diesem Tag hat die Fahrt durch eine Meerenge Sie noch geängstigt. Wir haben diese spielend überstanden. Genauso spielend werden Sie die nächste Episode überstehen. Obgleich diese Sie jetzt noch beunruhigt. Bald schon werden Sie darüber lachen und später können Sie Ihren Enkeln davon erzählen.
Meine Damen und Herren, Sie haben sich auf ein Abenteuer eingelassen, und hier ist es: Ihr ganz persönliches Abenteuer. Darauf trinke ich.« Er hob seinen Becher in die Luft. Die Siedler taten es ihm gleich und der Ruf: »Auf das Abenteuer!«, tönte durch die Nacht.
Morgan Chase und ein ruhiger Kerl namens Hubertus Horn meldeten sich freiwillig für die erste Schicht der Nachtwache. Henry und Arthur erklärten sich gar bereit, mit einer Doppelschicht zu beginnen. Am liebsten hätten sie die ganze Nacht gewacht, doch da sie früh am Morgen beginnen würden, die Ladung zu löschen, mussten sie vorher etwas zu Kräften kommen. Jeder der vier Männer bezog Posten an einer Ecke des Camps. Irgendwann, bereits nach dem ersten Schichtwechsel auf den anderen Positionen, gesellte Mary J. sich zu Arthur. Die Temperatur war angenehm mild. Ein laues Lüftchen wehte vom Meer herüber und brachte einen salzigen Geruch mit. Aus allen Richtungen drangen Geräusche, die Mary J. fremd waren. Verschiedenste Tierlaute: ein Konzert aus Pfeifen, Glucksen, Rufen und Quieken.
»Kannst du nicht einschlafen?«, fragte Arthur. »Du brauchst dich nicht zu sorgen. Wir haben alles unter Kontrolle.«
»Ich sorge mich nicht. Ich möchte nur nichts verpassen«, gab sie zurück.
»Nichts verpassen?«, wiederholte Arthur erstaunt und beobachtete, wie sie zuerst ein Streichholz und dann damit eine Zigarette entzündete.
»Na, all das hier«, erklärte sie und wies mit dem ausgestreckten Arm über den dunklen Strand, das Camp und den Palmenhain. Arthur kniff die Augen zusammen. Womöglich war er einfach schon zu müde. Er wusste nicht recht, wie diese Aussage zu verstehen war.
Mit spitzen Lippen entließ Mary J. eine kleine Rauchwolke in die Dunkelheit. Arthur beneidete sie um die Zigarette, war aber zu stolz, um sie zu fragen, ob sie noch eine für ihn übrig habe. Sie musste diese den Seeleuten abgeschwatzt haben.
»Deine Ansprache war gut. Du bist ein talentierter Redner«, erklärte sie zwischen zwei Zügen. »Aber du bist nicht überzeugt von dem, was du über die Leichen gesagt hast, oder? Dass sie dort wahrscheinlich schon wochen- oder monatelang lägen.« Als Arthur sie erschrocken ansah, winkte sie ab und fügte hinzu: »Keine Sorge. Die Hasenfüße haben es nicht bemerkt. Aber ich durchschaue Menschen.«
»Hm«, machte Arthur nachdenklich. »Ich habe nicht gelogen. Sie könnten dort schon wochen- oder monatelang liegen. Ich glaube nur nicht unbedingt, dass dem so ist.« Er stützte sich auf sein Gewehr. Die Müdigkeit drohte, ihn zu übermannen.
»Warum?«, wollte sie wissen.
»Hast du auf den Höhleneingang geachtet?«, erwiderte Arthur. »Jemand hat die Pflanzenranken gekappt. Kann nicht allzu lange her sein.«
»Aha. Und warum sollte das so zwingend mit den Leichen zusammenhängen?«, fragte Mary J..
»Na, weil …«, begann Arthur und verstummte dann. Die Frage war berechtigt. Warum hatte er sofort vermutet, dass der Mörder die Ranken gekappt hatte? Er kam sich dumm vor. Es konnte genauso gut ein gewöhnlicher Schatzsucher gewesen sein, der sich Zutritt verschafft hatte und ebenso zufällig über den grausigen Fund gestolpert war wie sie selbst.
»Ich vertreibe mir die Zeit gerne mit Kriminalromanen«, erklärte Mary J. schulterzuckend.
»Na ja, die Leichen sahen nicht sehr stark verwest aus. Noch ein Hinweis darauf, dass ihr Tod nicht sehr lange zurückliegt«, fügte Arthur kleinlaut hinzu.
»Wie sehen denn völlig verbrannte Körper aus, wenn sie schon längere Zeit verwesen?«, wollte Mary J. wissen. Noch eine berechtigte Frage, auf die er keine Antwort parat hatte.
»Was meinst du denn zu der ganzen Sache?«, fragte Arthur ausweichend, um den Ball zurück zu spielen.
»Dass diese Insel nichts für Hasenfüße ist«, gab sie zurück.
»Du bist anscheinend kein Hasenfuß. Warum so gelassen?«, fragte Arthur.
»Was habe ich schon zu verlieren?«, antwortete sie. »Ich will einen Schatz finden und ein Buch schreiben. Darüber hinaus habe ich in meinem Leben nicht viel … Hier, die willst du doch«, sagte sie dann und bot ihm den Rest ihrer Zigarette an. Sie hatte seine sehnsüchtigen Blicke bemerkt. Scheinbar entging ihr nichts. Oder er stellte sich in seiner Müdigkeit sehr töricht an. Dankbar nahm er die beinahe aufgerauchte Zigarette und genoss die letzten drei Züge, die herauszuholen waren.
»Was stimmt eigentlich nicht mit dieser Mrs. Povich?«, fragte Mary J. nach einer kleinen Gesprächspause. Arthur zog seine geraden Brauen zusammen.
»Mit wem?«, fragte er.
»Na, eines deiner Schweinchen«, versetzte Mary J. belustigt. »Du solltest wenigstens ihre Namen lernen. Die Dame mit den wirren Locken und den Millionen von Perlen um den Hals.«
»Ah«, machte Arthur und nickte. »Ich weiß nicht. Es ist nicht unüblich, dass die Menschen in Bezug auf eine Pirateninsel von Flüchen sprechen. Und die Povichs – Sie sind ohnehin merkwürdig. Auf eine Art, die ich noch nicht durchschaut habe.«
Zwei Gestalten näherten sich aus Richtung des Camps.
»Die van Bergs«, flüsterte Mary J. Arthur zu. »Sie heißen Maddie und Milton und die Leute tuscheln darüber, ob sie Geschwister sind oder ob alle Holländer gleich aussehen.«
»Stimmt etwas nicht?«, rief Arthur den van Bergs zu, doch sie schüttelten die Köpfe. Milton bedeutete ihm mit einem Finger an den Lippen, dass er die anderen nicht wecken solle.
»Wir konnten einfach nicht schlafen«, erklärte der junge Mann, als er und seine Frau bei den Mayers angekommen waren. »Wissen Sie, Governor Mayer, es war heute wohl einfach ein bisschen viel für uns Stadtratten. Und dann Maddies Gemütsschwankungen.« Er wies auf den runden Bauch seiner Frau. »Sie wissen ja: schwangere Frauen …« Arthur nickte, obgleich er eigentlich nichts darüber wusste. Von diesem Thema hatte er sich mit seinen inzwischen 35 Jahren erfolgreich ferngehalten.
»Daher wollten wir fragen, ob wir uns zu Ihnen setzen dürfen, Governor Mayer. Maddie würde sich in Ihrer Gegenwart sicherer fühlen«, fuhr Milton fort.
»Nur zu«, sagte Arthur nickend. Er fühlte sich von Maddies Vertrauen geschmeichelt. Das junge Paar nahm im Sand Platz, die Rücken an die Stämme der Palmen lehnend. Die van Bergs waren welche von denen, die zu fein herausgeputzt waren. Maddies grünes Seidenkleid hatte bereits stark unter den Bedingungen gelitten.
»Sie schulden mir noch eine Geschichte«, erinnerte Maddie Mary J.. »Wie hat eine elegante Frau wie Sie Governor Mayer kennengelernt?« Die junge Frau realisierte offenbar nicht, dass sie Arthur damit kein Kompliment machte. Seine Lippen kräuselten sich. Nicht nur aufgrund von Maddies Formulierung, sondern auch, weil er sich noch keine passende Geschichte zurechtgelegt hatte. Glücklicherweise hatte die angehende Schriftstellerin Mary J. ihm in Sachen Kreativität etwas voraus.
Sie setzte sich Milton und Maddie gegenüber und erzählte:
»Es war auf einer Gala des Präsidenten von Costa Rica, Jésus Molina. Eine äußerst schicke Gala, zu der ich Vater begleitete.«
»Wie aufregend!«, rief Maddie aus.
»Das Buffet sicherlich«, erklärte Mary J., »jedoch wohl kaum die Gäste. Einer wichtiger als der andere und – was soll ich sagen – einer langweiliger als der andere. Aber dann war da Arthur Mayer. Der große, mysteriöse Mann, der so ganz anders aussah als die befrackten Pinguine. Ich erinnere mich, als sei es erst gestern gewesen. Er trug ganz ähnliche Kleidung wie heute: braune Weste zum cremefarbenen Hemd. Ihn umgab diese anziehende Aura von Abenteuern…«
Arthur stellte fest, dass Mary J. lügen konnte ohne mit der Wimper zu zucken und überlegte, ob ihm diese Eigenschaft Sorgen bereiten sollte. In dieser Situation war sie ihm von Nutzen. Mary J. und er hatten sich nicht nur versprochen, über die tatsächlichen Umstände ihrer ersten Begegnung zu schweigen, sondern dies gar vertraglich festgehalten. Arthur hatte darauf bestanden.
Es war im März 1902 gewesen. Arthur hatte noch keinen Rang innegehabt. Statt Governor Mayer war er bloß Arthur Mayer gewesen, ein Abenteurer und Glücksritter wie jeder andere. Nur womöglich mit einer kleinen Spur mehr Ehrgeiz und Verrücktheit.
Die tatsächlichen Umstände der ersten Begegnung Arthurs und Mary J.s hatten nichts mit einer noblen Gala zu tun: Eines Nachmittags war Arthur in einer leeren, düsteren Hafenbar in Puntaguas über seinen Notizen gesessen. Er hatte sich tief vergraben in Kladden, Kartenfragmenten, Briefen und Logbüchern. Missmutig, verbissen und grimmig, denn er und Henry waren am Vortag von einer gescheiterten Schatzsuche auf der Celeste-Insel zurückgekehrt. Bereits ihr zweiter Versuch.
In diesem ungünstigen Moment war Henry zu ihm getreten und hatte ihm mitgeteilt, dass ihn eine Mrs. Blackwell sprechen wolle.
»Sprich du doch mit ihr«, hatte Arthur geraunt, ohne auch nur aufzusehen.
»Das würde ich ja gerne tun, denn sie ist eine ziemliche Augenweide. Leider besteht sie darauf, mit dir zu reden«, hatte Henry erwidert. Obgleich Arthur und Henry gleichberechtigte Partner bei ihrer Schatzsuche waren, nahmen die Leute stets an, Arthur sei der Boss. Es war sein Name, der im Hafen die Runde gemacht hatte, nicht Henrys.
»Sie möchte dir etwas anbieten«, hatte Henry erklärt.
»Mir etwas anbieten…«, hatte Arthur in abwesendem Tonfall wiederholt. »Henry, ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich arbeite.« Dann hatte er aber doch den Kopf gehoben und beim Eingang der Spelunke eine Frau entdeckt, die ganz offensichtlich nicht an einen solchen Ort gehörte: elegantes, ausgestelltes Kleid aus Seide und Spitze, feine Züge.
»Sag ihr, sie hat fünf Minuten«, hatte Arthur seufzend genuschelt. Ihm hatte der Kopf geraucht und eine kleine Pause war so oder so vonnöten gewesen. Er hatte seine Arme gestreckt und mit dem Nacken geknackt, während Henry die Frau zu ihm geschickt hatte.
»Was ist es, Mrs. Blackwell?«, hatte Arthur schon gefragt, bevor die Dame auf dem Stuhl gegenüber Platz genommen hatte. »Ein ganz exklusives Kartenfragment aus Ihrem persönlichen Erbe? Eine Notiz, die Ihnen ein alter Seebär auf dem Sterbebett überlassen hat?«
»Das ist also das übliche Angebot im Hafen von Puntaguas?«, hatte sie ungerührt zurückgegeben und sich gesetzt.
»Das haben Sie richtig erkannt, Mrs. Blackwell«, hatte Arthur bestätigt und einen Schluck von dem großen Becher Rum genommen, den er bisher, über die Maße in seine Arbeit vertieft, noch nicht angerührt hatte.
»Bitte, nennen Sie mich doch Mary J.«, hatte die Dame freundlich angeboten.
»Mary Jane?«, hatte Arthur nachgehakt. Sie hatte den Kopf geschüttelt und korrigiert:
»Mary J., der Buchstabe J. kommt von Mary Joana.« Arthur hatte sie mit zusammengezogenen Brauen gemustert und wiederholt:
»Mary Joana. Tatsächlich.«
»Arthur… Darf ich Sie Arthur nennen?« Er hatte ihr mit einer Handbewegung bedeutet, fortzufahren. Nur zu gut kannte er diese vorschnelle Freundschaftlichkeit. Unter Schatzsuchern war man immer sofort beim Vornamen, alle waren beste Freunde, aber wenn man nicht wachsam war, dann stießen einem die angeblichen Freunde ein Messer in den Rücken. Das war vielen so gegangen und würde, so schätzte Arthur, in der Zukunft noch vielen so gehen. Er hatte sich geschworen, immer wachsam zu sein.
»Arthur, ich habe nicht irgendein weiteres Schriftstück, das eventuell irgendwann, irgendwie nützlich sein könnte«, hatte Mary J. erklärt und auf den wilden Stapel mit Dokumenten gewiesen. Schnell hatte Arthur das obenauf liegende Notizbuch geschlossen.
»Ich habe für Sie die Idee, die Ihnen helfen wird, aus all diesen Unterlagen endlich etwas zu machen. Ich kann Ihr Leben verändern, denn ich kann Ihnen sagen, wie sie aus diesem ganzen Wirrwarr endlich Wert schöpfen können. Ich kann dafür sorgen, dass Sie Ihren Schatz endlich finden«, hatte Mary J. großspurig behauptet. Aus Arthurs Gesicht hatte die pure Skepsis gesprochen. War diese Frau übergeschnappt? Eine Wahnsinnige?
»Ich weiß, wo die Probleme bei der Schatzsuche liegen«, hatte Mary J. unbeirrt erklärt.
»Ach, tatsächlich«, hatte Arthur geantwortet und einen großen Schluck Rum getrunken.