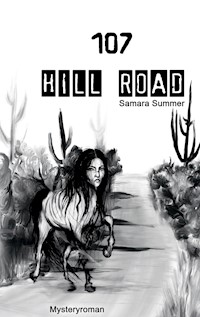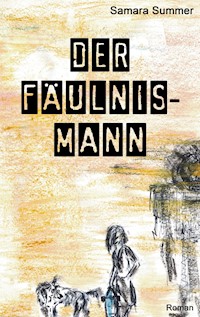
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn dir etwas Schlimmes passiert wäre, würdest du es wissen. Oder? Die Urbex-Fotografin El kommt in einer Waldhütte zu sich, die sie nie zuvor gesehen hat. Sie erinnert sich nur noch, dass sie ein verlassenes Kinderheim erkundet hat - doch das liegt über einen Tag zurück. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? El zieht übergangsweise zurück zu ihren Eltern, wo sie ihrem Erinnerungsvermögen auf die Sprünge helfen will. Doch das Kleinstadtleben hat sie bald fest im Griff, mit einem Laienmusical, einem stinkenden Hund, einem alten Freund und der äußerst anziehenden Nola, die El vielleicht von ihren Problemen ablenken könnte... Wäre da nicht der Fäulnis-Mann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Triggerwarnung findet sich ganz am Ende des Anhangs, da diese kleine Spoiler enthält.
Inhaltsverzeichnis
Sechzehn
Dienstag
Chucky
Mittwoch
Krea- Tief
Donnerstag
Ausgerastet
Wir Muessen Reden
Freitag
Rollen
Samstag
Geister
Sonntag
School's Out
Montag
Ansteckend
Lost Places
Dienstag
Logisch
Offene Worte
Mittwoch
Donnerstag
Schadensbegrenzung
Freitag
Linus
Samstag
Die Buerde
Fast Das Ende
Sonntag
Nola
Scheisse
Montag
Dienstag
Eiter
Mittwoch
Abend Im Park
Donnerstag
Der Anruf
Freitag
Der Mann
Forschung
Samstag
Sonntag
Halleluja
Gefangen
Normal
Epilog
Die nächsten Tage
Vier Wochen später
Anhang
Die Autorin
Danksagung
Triggerwarnung
1: SECHZEHN
Dienstag
Seid ihr schon mal aufgewacht und wart auf einmal wieder 16? Mir ist es passiert. Zehn Jahre einfach ausgelöscht, dachte ich. Ich tastete blinzelnd nach meiner Brille auf dem Nachttisch und strich im Anschluss verwirrt über mein Haar, das ich auf einer Seite kurz rasiert trage. Mein Blick klärte sich und schweifte durch das Jugendzimmer. Alles unverändert. Alles wie damals.
Natürlich war ich nicht wirklich wieder 16, auch wenn es mir im ersten dämmrigen Moment des Erwachens so vorgekommen war. Aber hey – Was denkt ihr denn? Das hier ist keine übernatürliche Geschichte.
Außerdem passte ein Detail nicht. Ich bemerkte, dass sich ein Fremdkörper eingeschlichen hatte, der die perfekte Vergangenheits-Illusion in sich zusammenfallen ließ. Auf dem Schreibtisch stand eine Nähmaschine. Ich meine – eine Nähmaschine. In meinem Zimmer. Mein 16-jähriges Ich hätte damit genauso wenig anfangen können wie das Gegenwarts-Ich. Nadel im Finger, blutroter Faden. Das ist das einzige Kunststück, das ich mit einer Nähmaschine je zustande gebracht habe. Es gab nur eine Person innerhalb dieser vier Wände, die mit diesem Gerät etwas anfangen konnte.
Meine Mutter steckte den Kopf zur Tür herein:
»Hallo Sonnenblume.«
»Hallo Silberdistel.«
»Daran muss ich mich wohl gewöhnen, was?« Sie strich durch ihr von grauen Strähnen durchsetztes Haar. Genau wie ich es vorher mit meinem getan hatte. Eine Geste, die wohl irgendwann von ihr auf mich übergesprungen ist.
»Puh, war schräg, auf einmal hier aufzuwachen. Ich dachte im ersten Moment, ich wäre gekidnappt worden«, sagte ich stöhnend. Sie warf mir einen Blick zu, den ich zunächst nicht deuten konnte. Ärger? Nein, es war Besorgnis. Weil ich das Wort gekidnappt benutzt hatte.
»Hallo? Du musst schon zugeben, dass es verrückt ist, wenn ich hier aufwache und das Zimmer auf einmal wieder aussieht wie damals. Gestern Abend war ich hundemüde. Da ist mir das gar nicht aufgefallen.« Normalerweise blieb ich selten über Nacht, wenn ich zu Besuch war – und wenn, dann breitete ich mich auf der Schlafcouch im Wohnzimmer aus.
Weil meine Mutter mich immer noch schweigend musterte, fuhr ich fort:
»Das mit dem gekidnappt habe ich übrigens nur so dahingesagt. Gott, du hättest dein Gesicht sehen sollen.« Ich lachte ein bisschen zu laut und ein bisschen zu grunzend. Ihre Brauen zogen sich zusammen.
»Ich habe das Zimmer so vorbereitet, damit du dich wohlfühlst«, sagte sie. Humorlos wie immer.
»Das hättest du nicht machen müssen, Mama. Das hier ist dein Nähzimmer, seit ich ausgezogen bin. Ich wette, wenn ich die Schubladen öffne, quellen mir Garne und Stofffetzen entgegen. Du hast dir einen wahnsinnigen Stress gemacht, alles schnell aufzuräumen, oder?«
»Ja, warum nicht?«, sagte sie.
»Na, weil du deine Sachen genauso gut liegenlassen könntest? Es ist euer Haus."
»Aber dein Zimmer. Du wirst eine Weile bleiben und du sollst es gemütlich haben. Darum geht es. Dass du deine Ruhe hast und alle Zeit der Welt.«
Mein Zimmer, mein Gefängnis, dachte ich, aber ich sprach es nicht laut aus, sondern grummelte nur etwas vor mich hin, um meinen Unmut auszudrücken.
»Ellen…«
»Was habe ich verbrochen, um diesen Namen zu hören?«
»El«, korrigierte sie sich, wohlwissend, dass ich meinen vollen Namen hasse. Den Namen, den sie ausgesucht hat. »Ich verstehe nicht, warum du mir dafür böse bist, dass ich für dich aufgeräumt habe.« Ihre Stimme klang säuerlich, aber sie nahm sich sofort wieder zurück und fügte freundlicher hinzu: »Du solltest dringend was essen. Ich wärme das Mittagessen für dich auf.«
»Mittag-Essen?«
»Es ist drei Uhr am Nachmittag.«
»Verdammte Scheiße! Warum hat mich keiner geweckt?«
Willkommen in meinem verdammten Leben. Wie ich schon sagte: Das hier ist keine übernatürliche Geschichte und obwohl das Wort gekidnappt bereits mehrfach gefallen ist, ist es auch kein Thriller. Nur mein stinknormales Leben. Jedenfalls glaubte ich das zu diesem Zeitpunkt noch.
Falls ihr euch außerdem wundert, warum ich so mies drauf war, solltet ihr Folgendes wissen: Ich kann es nicht leiden, wenn Leute sich kümmern. Vielleicht denkt ihr jetzt, dass ich undankbar sei, aber das Problem am Kümmern ist, dass es grundsätzlich mit einer Erwartungshaltung verbunden ist. Die Person, die sich kümmert, erwartet nämlich meistens, dass durch das Kümmern eine schnelle Veränderung eintritt. So habe ich das zumindest immer erlebt.
Es ging mir schlecht, jemand kümmerte sich – und erwartete, dass es mir im Gegenzug ganz schnell wieder besser gehen würde. Aber das funktionierte eben nicht immer so. Dann hieß es: Das bringt wohl gar nichts. Offenbar weißt du das alles gar nicht zu schätzen. Oder: Vielleicht brauchst du professionelle Hilfe.
Nein, verdammt! Vielleicht möchte ich, wenn es mir nicht gut geht, einfach mal spüren, dass sich jemand kümmert, ohne ein schnelles Ergebnis, eine Art Gegenleistung, zu erwarten. Vielleicht möchte ich mich einfach mal zurücklehnen und spüren, dass jemand sich kümmert, auch wenn nicht sofort etwas zurückkommt. Wenn ich wissen würde, dass das erlaubt ist, würde es mir vielleicht gar nicht mehr schlecht gehen. Aber so genau kann ich das nicht sagen, weil ich diese positive Erfahrung nie gemacht habe.
Ich denke, dass die meisten Leute, die sich kümmern – Eltern, Freundinnen, Freunde oder was auch immer – sich gerne selbst auf die Schultern klopfen und sagen: Heute habe ich was bewirkt. Sorry, damit kann ich nicht dienen. Mir ist nicht zu helfen. Zumindest nicht so leicht.
Ich stieg aus dem Bett, starrte die Tapete mit den bunten floralen Ornamenten an und spürte, dass irgendetwas anders war. An mir. Ich blickte an meinem Körper herunter. Dünne Beine ragten aus mintgrünen Shorts. Über dem Hosenbund zeichnete sich die Narbe ab. Darüber wiederum wölbte sich mein kleiner Bauchansatz unter dem kurzen Trägertop. Ich bin von Natur aus schlank, musste noch nie auf meine Linie achten. Deshalb tue ich es auch nicht. Ich liebe Süßkram und Pizza. Aber seit ich die 25 überschritten habe, sieht man das meinem Bauch an. 26 – ganz fieses Alter. Meine Beine, Hüften und Arme waren dünn wie eh und je, aber ein Bauch wie ein Brett – das war Vergangenheit. Irgendwie unproportioniert, dachte ich, als ich mich so von oben herunter anschaute. Im nächsten Moment wusste ich, dass mir diese Erkenntnis nicht wichtig genug war, um etwas dagegen zu unternehmen. Viel zu anstrengend. Ich mag anstrengende Dinge nicht und halte Äußerlichkeiten für überbewertet.
Außerdem wusste ich, dass es etwas anderes war, das mich unterbewusst gestört hatte. Etwas fehlte. Ein Teil von mir. Es fiel mir schließlich wie Schuppen von den Augen: das Mobiltelefon! Ich schielte zum Nachttisch hinüber. Mein Telefon war nicht da. Deshalb hatte ich nämlich auch keinen Weckruf gehabt. Deshalb hatte ich nach dem Aufstehen nicht zuerst die Uhrzeit gecheckt.
Merkwürdig. In den letzten Tagen hatte ich das Teil nicht vermisst. Aber die letzten Tage waren ja auch wie ein Vakuum gewesen. Bitte aus meinem Leben streichen. Danke. Dann können wir ja weitermachen.
Das olle Ding war also weg. Ich war sicher, dass es weg war, weil die Polizistin danach gefragt hatte und ich mich jetzt erinnerte, mich nicht erinnert zu haben. Also ich erinnerte mich daran, ihr mitgeteilt zu haben, dass ich mich nicht erinnerte, wo das Ding geblieben war. War es schlecht, dass es fehlte? Fehlte es mir? Eigentlich nicht. Instagram, Twitter, Linus' Likes, Linus, YouTube, Linus' Kanal, Linus, WhatsApp, fünf Sprachnachrichten von Linus, Linus… Linus, verdammt! Eine Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen. Nein, das Teil und all die damit verbundenen L…, lästigen Störungen fehlten mir ganz und gar nicht. Linus, Linus, Linus. Gerne hätte ich den Namen aus meinem Gehirn gelöscht. Ich wollte nie – nie – wieder von Linus hören. Ich gab ihm die Schuld an allem. An was? Das war eben die Frage. Eine weitere Frage war: Warum gab ich ihm die Schuld? Ich wusste es nicht. Ich wusste in diesem Moment ziemlich wenig. Ich wusste nur, dass ich ihn leid war. Ich berührte wieder mein Haar, ganz wie meine Mutter es tut, und beschloss, mit einfacheren Gedanken anzufangen. Hunger, dachte ich.
Dann mal los, auf ins Kleinstadtleben, sagte ich in Gedanken zu mir selbst. Ich werde euch übrigens den Namen des unbedeutenden Ortes, in dem ich aufgewachsen bin, nicht verraten. Ihr alle kennt kleine Städte, die man eigentlich nicht kennen müsste. In den zwei Altbausiedlungen finden sich Einfamilienhäusern gleich neben frischen lieblosen Blockbauten mit Platz für 12 Partien. Dazwischen gequetscht ist eine Fußgängerzone mit ein paar Einzelhandelsgeschäften und drei, vier Cafés oder Kneipen. Ganz am Rand gibt es noch einen Park, einen neuen großen Discounter und den letzten alten Bauernhof. Alles, was ein Mensch zum Leben so braucht, aber nicht viel mehr.
Auch wo sich der Ort befindet, hat keine Bedeutung für meine Geschichte. Also behalte ich das ebenfalls für mich und ihr müsst gar nicht erst denken: Ach, die da oder: Ach, die dort.
Ich zog die Klamotten vom Vortag an und schlurfte die Treppe hinunter. Es roch halbgut. Nach Lasagne, aber nach Lasagne mit einem Aber.
»Ich hab Lasagne gemacht. Aber nicht das Standard-Rezept, sondern das mit ganz viel ballaststoffreichem Gemüse aus der neuen Futter dich gesund«, erklärte meine Mutter, bevor sie nach dem mikrowellengeeigneten Gefäß griff. Das ballaststoffreiche Gemüse war übrigens nur das eine Aber. Das andere, das größere Aber, war die Gesellschaft. Dass man Konversation und ein Mindestmaß an Sozialverträglichkeit von mir erwartete. Als mir das klar wurde, wurde mir schlecht.
Ich setzte mich wortlos. Irgendwo zu meiner Rechten war ein Mensch hinter einer Wand aus Zeitungspapier verborgen. Mein Vater ist auch nicht gerade der kommunikative Typ. Vor allem nicht, wenn es um schwierige Themen geht, und um seine schwierige Tochter. Vor meinem Eintreffen in der Küche hatte er sich schon mal vorsorglich hinter der Tageszeitung versteckt. Daran hatte sich in den letzten zehn Jahren nichts geändert.
»Du weißt, warum ich dich geweckt habe, Sonnenblume?«, fragte meine Mutter, während sie ein fragiles Gebilde aus Grünzeug, überzogen mit verlaufenem Käse servierte.
»Du hast mich nicht geweckt. Ich war schon wach.«
»Darum geht's nicht, El. Worauf ich hinauswollte: Du weißt, dass du nachher einen Termin bei Dr. Brick hast?«
»Kann ich immer noch so tun, als hätte ich es vergessen, auch wenn du es eben gesagt hast?«
»Paps fährt dich.«
»Großartig. Ist ja auch so weit. Da spare ich mir bestimmt fünf Minuten und jede Menge frische Luft.«
»Ich dachte, es wäre nett. Paps hat sich extra freigenommen.« Ein Gesicht tauchte über der Zeitung auf und gab einen zustimmenden Laut von sich.
»Paps hat sich freigenommen, weil du es so wolltest und wir wissen ja, was passiert, wenn er sich dem Matriarchat widersetzt.« Ich schob den Teller weg. Meine Eltern tauschten einen schnellen ängstlichen Blick. Ich hatte sie empfindlich getroffen. Wenn ihr denkt, meine Bemerkung sei nur ein belangloser Scherz gewesen, täuscht ihr euch. Meine Eltern hatten sich ein Jahr zuvor schrecklich schlimm gestritten. Der Auslöser dafür war die dominante Art meiner Mutter gewesen und das Ganze war völlig eskaliert, bis sie schließlich einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Um ein Haar hätten sie sich dann scheiden lassen. Ich zielte also bewusst unter die Gürtellinie. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte ich sie an meiner Misere teilhaben lassen.
Es war mein Arschloch-Ich in Reinform. Das Ich, das ich nicht kontrollieren kann. Weil ich – bis auf ganz wenige Ausnahmen – nicht so gut mit Menschen kann, bin ich am liebsten für mich. Das bedeutet nicht, dass ich still und schüchtern bin. Ich finde nur, die Welt verdient es nicht, ständig von mir bereichert zu werden. Wenn ich mich in die Ecke getrieben fühle, gehe ich automatisch in die Offensive. Das passiert beispielsweise, wenn mich die Erwartungen anderer erdrücken. Mein Mund öffnet sich dann von ganz alleine – und was herauskommt, ist oft nicht gerade freundlich. Wie meine Anspielung auf das Matriarchat. Aber statt etwas gegen meine Unverfrorenheit zu unternehmen, sagte Paps nur:
»El, du redest über mich, als wäre ich nicht im Raum.«
»Oh mein Gott, die Zeitung – Sie spricht«, gab ich zurück und riss in gespieltem Entsetzen die Augen auf. Nur die obere Hälfte seines Gesichts war hinter dem Blatt zu sehen.
»Auch eine Zeitung hat Gefühle«, gab er zurück. Ich seufzte und musste zugeben:
»Der war nicht schlecht, Paps.«
»Also läufst du nachher lieber?« Er nahm den praktischen Teil des Gesprächs wieder auf.
»Nein«, sagte ich. »Du darfst mich gerne fahren mit deinem schicken neuen Auto. Das ist es doch, was du hören willst, oder?«
»Gefällt dir der Benz? Ich wollte schon lang einen Benz.«
»Ich weiß, Paps, ich weiß.« Er hat überhaupt keine Ahnung von Autos. Aber ein Benz ist eben ein Benz – und irgendwo muss das hart verdiente Geld ja hinwandern. Das Leben meiner Eltern erscheint mir schon immer leer und manchmal fürchte ich mich davor, mich ebenfalls in eine große Leere hineinzumanövrieren. Dann denke ich wiederum, dass alles andere mit viel zu viel Anstrengung verbunden ist.
In dem Moment fiel meiner Mutter ganz offensichtlich etwas ein. Man kann es deutlich sehen, wenn ein Gedanke hinter ihrer Stirn einschlägt.
»Übrigens, eine gute Nachricht, El. Dein Freund…« Fast hätte ich laut geschrien. Die Worte dein Freund provozierten einen schwer unterdrückbaren Impuls. Vermutlich hätte ich geschrien, wenn mein müdes Gehirn diesen Impuls nicht so langsam an meine Stimmbänder weitergeleitet hätte, dass ich – noch bevor ich schreien konnte – den Wortanfang Be vernahm. Meine Mutter war nicht im Begriff von Linus zu sprechen, wie ich zunächst befürchtet hatte. Dann hätte ich ganz sicher geschrien. Aber es ging um einen anderen Freund. Der ganze Satz lautete:
»Übrigens, eine gute Nachricht, El. Dein Freund Benjamin kommt morgen hier an.«
»Ben? An einem Mittwoch? Er arbeitet doch.«
»Er hat eine ganze Woche frei.«
»Warte mal, Mama, du hast doch nicht etwa Ben gebeten, sich wegen mir freizunehmen, oder?«
»Nein, ach was. Er besucht seine Mutter, das ist alles.« Ich sah sie an, dann meinen Vater:
»Paps?«
»Ja, denke, er besucht Gabriella.« Er war schon wieder hinter der Zeitung verschwunden.
»Ich glaube einem Menschen, der sich im Sportteil versteckt, kein Wort.«
»Na ja«, meine Mutter knickte ein. »Ich habe eben mit Gabriella gesprochen und da kamen wir drauf, dass es ganz gut passt, weil er ihr sowieso helfen wollte, den Flur zu renovieren.«
»Oh Mann!« Ich vergrub mein Gesicht in den Händen. »Das heißt, du hast nicht nur mit Ben über mich gesprochen, sondern auch mit Gabriella. Konntest du nicht vielleicht gleich Flugblätter in der ganzen Nachbarschaft verteilen?«
»Ich habe gar nicht viel gesagt. Nur dass du herkommst, weil es bei dir gerade nicht so gut läuft. Die nette Ärztin, die dich entlassen hat, hat gemeint, es wäre gut für dich, wenn du selbst entscheiden kannst, wann und mit wem du über das Ereignis sprichst.«
Ich glaubte ihr – und das machte mich traurig. Weil es mir bewusst machte, dass es einen ärztlichen Rat brauchte, damit sie meine Privatsphäre nicht mit Füßen trat. Meine Wünsche – die zählten gar nichts.
»Aber du freust dich doch, Ben zu sehen, oder?«, mutmaßte sie.
Ich dachte darüber nach. Ben zu sehen, klang wirklich nicht übel. Aber wie war es, Ben in dieser Situation zu sehen? Sie hatte ihm gesagt, dass es bei mir nicht gut lief. Ich überlegte, wie das klang. Erbärmlich. Aber wenigstens nicht so verrückt wie die ganze Wahrheit. Damit konnte ich mich arrangieren. Dann fiel mir etwas Lustiges an ihrer Formulierung auf:
»Eigentlich passt das mit dem nicht gut laufen überhaupt nicht. Ich bin ja richtig gut gelaufen«, warf ich ein. »Man kann ja vieles sagen, aber in der Situation bin ich echt gut gelaufen.« Ich sah meiner Mutter an, dass sie noch nicht bereit für diesen Scherz war. Es war mir egal. Ich wollte Witze darüber machen. Am liebsten wollte ich den ganzen Tag alleine in meinem Zimmer herumsitzen und Witze machen, über die nur ich selbst lachen konnte. Ja, das wäre mir in dieser Situation am liebsten gewesen.
2: CHUCKY
Mittwoch
Zweites Mal Erwachen im Jungendzimmer. Dunkle, runde Augen waren das Erste, was ich sah. Sie waren über mir und starrten in mein Gesicht. Ich wusste, dass sie nicht real waren. Sie waren bloß eine Einbildung. Das war mir klar, weil ich unfreiwillige Expertin für Mindfuck bin. Es ist nämlich so, dass ich früher oft Dinge gesehen haben, die nicht da waren. Als Kind habe ich mir vorgemacht, ich hätte übernatürliche Fähigkeiten. Ich nannte es: den besonderen Blick. Ich dachte, ich wäre so eine Art Superheldin mit der Fähigkeit Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. Ich hätte mich auch nicht gewundert, eines Tages durch meinen unaufgeräumten Kleiderschrank direkt nach Narnia zu stolpern…
Im Teenageralter folgte die Ernüchterung. Mir wurde klar, dass die Dinge, die ich sah, nichts als Einbildungen waren. Mein Gehirn verarschte mich. Es überinterpretierte und überreagierte. Dr. Richard hat es mir erklärt. Überreagieren ist natürlich keine offizielle Diagnose. Dr. Richard ist auch kein Psychologe. Er ist Allgemeinmediziner und fand meinen Fall, meine kindlichen Phantastereien, so unbedeutend, dass er es nicht für nötig befand, mich an einen Profi zu überweisen. Seine Theorie klang für mich plausibel. Mindfuck. Es war einfach nur Mindfuck. Sein Rat war es gewesen, mir nicht so viel Stress zu machen – und das hatte ich getan. Ich sah im Teenageralter manchmal immer noch diese Dinge und ich nannte es immer noch den besonderen Blick, aber es war auf einmal keine Fähigkeit mehr, sondern eine Schwäche.
Damit ihr versteht, welche Art von Dingen ich durch meinen besonderen Blick sehen konnte, schildere ich euch ein konkretes Beispiel:
Ich bin 15. Mittagspause auf dem Schulhof. Danny Holler ist ziemlich gereizt. Ich sehe es ihm an. Wie ein gefangener Tiger tigert er hin und her. Auf einmal zieht er fluchend und wild entschlossen eine Pistole aus der Hosentasche. Ich schreie wie am Spieß. Die Szene friert um mich herum ein. Alle starren mich an. Mich, nicht Danny. Auch Danny starrt mich an. Die Pistole immer noch erhoben. Er stiert mich einfach an. Dann wirft er kurz einen Blick auf die Pistole. Ich bin starr vor Angst. Endlich lässt er die Waffe langsam sinken – und auf einmal ist sie nur noch ein Handy. Ja, ein Handy. Danny hat nämlich niemals eine Pistole in der Hand gehabt. Das habe ich mir nur eingebildet.
Das Besondere dabei ist, dass ich die Pistole ganz klar gesehen habe, während der ganzen schrägen Szene. Es war nicht nur eine optische Täuschung in einem Sekundenbruchteil. Die ganze Sache dauerte sicher eine halbe Minute, in der ich die Waffe genauso deutlich gesah, wie alles andere um mich herum.
So etwas passierte mir immer wieder und führte manchmal zu seltsamen Situationen wie dieser. Ich hatte ja aber beschlossen, keine große Sache draus zu machen und mich nicht zu stressen. So wie Dr. Richard es empfohlen hatte.
Tatsächlich hat das wohl geholfen. Denn irgendwann verschwand er, der besondere Blick. Ich wurde erwachsen und sah nur noch die Dinge, die andere auch sahen.
Bis zu diesem Moment jedenfalls. Denn ich war wie gesagt sicher, dass die runden Knopfaugen, die mich anstarrten, nicht real sein konnten. Ich rieb meine eigenen Augen. Dann bemerkte ich den Geruch. Ein Geruch, der zu echt für eine Einbildung war. Ich schreckte zurück und griff nach meiner Brille. Dann sah ich das ganze Gesicht, in dem die runden Knopfaugen saßen. Es war ein felliges Gesicht. Aus dem offenen Maul drang der Geruch von Verwesung und im nächsten Moment tropfte Hundesabber auf meine Hand. Ich krabbelte noch weiter zurück. Nicht sicher, ob das Biest, das die Vorderpfoten auf der Bettkante aufgestellt hatte, gekommen war, um mich zu verschlingen. Wir hatten keinen Hund. Nie gehabt. Ich hatte immer darum gebettelt, aber mein Flehen war unerhört geblieben.
Ich hörte jemand auf dem Gang.
»Hey! Hey Leute, da ist ein Tier! Es ist aufdringlich und stinkt!«, rief ich. Meine Mutter tauchte im Türrahmen auf.
»Nanu, kannst du etwa Türen aufmachen?«
»Kann ich schon, hab ich aber nicht getan.«
»Ich rede mit Chucky«, erklärte meine Mutter. Das Fellgesicht wandte sich ihr zu. Die riesige Töle wackelte stolz mit dem Staubwedel von Schwanz.
»Chucky, wie Chucky die Mörderpuppe?«, hakte ich nach.
»Keine Sorge, Sonnenblume, er ist ganz lieb«, erklärte meine Mutter. »Wir haben uns im Tierheim mit ihm angefreundet. Jetzt durften wir ihn endlich abholen.«
»Und ihr wolltet mich nicht vorwarnen?« Meine Hand tastete ganz vorsichtig nach dem braunen Kopf. Das Fell war viel weicher, als ich angenommen hatte.
»Du wolltest doch immer einen Hund, Sonnenblume. Außerdem wusste ich ja nicht, dass er Türen öffnen kann und sich gleich selbst vorstellt.«
»Warum jetzt auf einmal ein Hund?«
»Na ja, ich habe ja jetzt mit meinem Halbtagsjob viel mehr Zeit. Außerdem sind wir ja nun drei Erwachsene. Wir können uns die Verantwortung teilen.«
»Aber Mama, du kannst nicht dauerhaft mit mir planen.« Ich konnte meine Hand nicht aus dem weichen Fell nehmen. »Soll das mein Therapiehund sein oder so?«
»Er ist einfach nur unser Hund. Ein neues Familienmitglied.«
»Also euer Therapiehund.«
»Du solltest jetzt aufstehen. Du hast schon wieder 15 Stunden geschlafen.«
Nachdem meine Mutter verschwunden war, wollte ich mich umziehen. Ich griff nach den auf dem Boden verstreuten Klamotten. Runde Knopfaugen starrten mich an.
»Kannst du mir vielleicht mal etwas Privatsphäre geben?« Der Hund wollte nicht von meiner Seite weichen. Ich roch an meinem Shirt.
»Wow….« Ich starrte den Hund an. Er wedelte. »Wir riechen gar nicht so verschieden.«
Wie viele Tage hatte ich das Shirt bereits in Folge getragen? Wann hatte ich zuletzt geduscht? Wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann, ist es zu lange her. Meinen Eltern und Dr. Brick hatten meinen Körpergeruch bestimmt bemerkt, aber sie hatten geschwiegen. Das war dann wohl ihr Problem. Ben konnte ich so allerdings nicht unter die Augen treten. Er war einer der wenigen Menschen, bei denen es mich interessierte, was sie über mich denken.
Also trottete ich unter die Dusche. Es kostete Mühe, den Hund aus dem Badezimmer auszusperren. Er hatte scheinbar beschlossen, wie eine Klette an mir zu kleben. Auch mein frisch geduschter Geruch änderte daran nichts.
Wir gingen gemeinsam zum Mittagessen und wir gingen gemeinsam zur Tür, als es klingelte. Auf der Schwelle stand ein Typ: Kinnlanges lockiges Haar, gestreifte Hippstermütze, Ring in der Nase, Polohemd mit Krokodil und Rolex am Handgelenk. Das war Ben. Der Rebell mit dem Spießerherz. Er arbeitet bei einer Bank, aber in irgendeiner Funktion, bei der man keinen Kundenkontakt hat. Ich habe nie wirklich kapiert, was er genau macht.
»Hey Schlampe!«
»Hey Arschgesicht!«
»Bitch!«
»Das ist doch dasselbe wie Schlampe.«
»Klugscheißerin!«
»Wichser!«
»Hey El! Total beschissen, dich zu sehen!«
»Gleichfalls!« Wir fielen uns um den Hals und grinsten. Es war unsere Standardbegrüßung. Zu Schulzeiten hatten wir uns die wüstesten Beschimpfungen über die Straße zugebrüllt. Wir fanden es lustig.
»Wenn du eines Tages umgebracht wirst und die Polizei fragt, ob du Feinde hattest, werden alle Nachbarn sagen: Na klar, diese Ellen. Sie sollten hören, wie die beiden sich gegenseitig nennen«, hatte ich mal zu Ben gesagt.
»Warum sollte ich umgebracht werden? Du wirst umgebracht und alle werden sagen, ich war's«, hatte er zurückgegeben.
In Wirklichkeit wollte keiner von uns den anderen umbringen. Wir waren beste Freunde. Ben war sogar mein erster fester Freund gewesen. Damals, als ich noch nicht gewusst hatte, dass die Art von Liebe, die ich für ihn empfand, nicht die war – und niemals sein konnte – die man in einer Beziehung empfinden sollte. Wir waren damals 12 und ein einsekündiger Kuss war das Höchste der Gefühle gewesen – ohne Zunge.
Kurze Zeit später brach Ben mir das Herz, indem er Cynthia Walter ebenfalls küsste. Mit Zunge. Ich fühlte mich hintergangen und wünschte ihm womöglich tatsächlich kurzzeitig den Tod. Jedenfalls gingen wir uns für ein paar Wochen aus dem Weg. Aber nur bis das Schicksal ihn zu meinem Nachbarn machte. Seine Eltern ließen sich nämlich scheiden und er zog mit seiner Mutter von der anderen Seite des Ortes in das Haus schräg gegenüber. Sein Vater behielt den luxuriösen Kasten, den sie zuvor gemeinsam bewohnt hatten. Es war eine schwere Zeit für Ben. Aber ich war für ihn da. Cynthia Walter war längst vergessen und Ben und ich waren zu dem geworden, was gut für uns war: beste Freunde. Ohne Küsse und ohne Streitigkeiten. In den letzten Jahren waren wir unserer Wege gegangen und in verschiedene große Städte gezogen, doch sobald wir wieder voreinander standen, war es wie nach Hause kommen. Denn darum geht es dabei: Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringt. Nicht um das Nest, in dem man aufgewachsen ist.
»Wer ist das?«, fragte Ben mit einem Fingerzeig auf den Hund.
»Ach, das ist nur Chucky, der Mörderhund.«
»Ist der gefährlich?«
»Nur für Arschlöcher.« Wir verließen das Haus und Chucky folgte uns.
»Darf der das?«, wollte Ben wissen.
»Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das so genau mit Hunden funktioniert. Meine Eltern wollten ja nie einen. Bis auf jetzt ganz plötzlich.« Ich ahnte, dass ich eigentlich keine Erlaubnis hatte, den Hund mitzunehmen, aber irgendwie gefiel mir die Vorstellung, einen persönlichen Bodyguard mitzuschleifen, der mich vergötterte.
»Aufs Dach?«, fragte ich. Ben nickte. Es war unser Stammplatz. Schon als Teenager waren wir immer von Bens Zimmerfenster im ersten Stock auf das benachbarte Garagendach gesprungen. Der perfekte Platz zum Abhängen, mit den Ästen der großen Eiche über uns.
Im Vorgarten trafen wir auf seine Mutter, Gabriella, die gerade dabei war, das Haus in pinken Sportklamotten zu verlassen. Bereit für ihre Joggingrunde.
»Hey El«, rief sie mir zu, während sie sich auf der Stelle warmlief.
»Wow, Gabriella… Deine Haare… Krasse blonde Mähne und krasse pinke Klamotten.«
»War das ein Kompliment oder Kritik, El?« Sie sah mich schief an. Gabriella hält mich für ziemlich seltsam. Ich kann es ihr nicht verübeln. Ich weiß nicht, warum, aber ich neige dazu, mich ihr gegenüber besonders komisch zu verhalten.
»Na ja, also ich muss mich wohl dran gewöhnen. Du bist irgendwie ein ganz anderer Mensch.« Meine Stimme klang höher als sonst. Ich wusste nicht, warum.
»Freut mich, dass ich dir beweisen konnte, dass auch Menschen über 40 wandlungsfähig sind«, sagte Gabriella kopfschüttelnd.
Bens Eltern waren immer die jüngsten auf dem Elternabend gewesen. Alle hatten ihn beneidet, weil die beiden so gut aussahen und so cool waren. Gabriella war früh Mutter geworden. Sie hatte nicht nur eine heiße Figur, sondern arbeitete auch noch in einem Fitnessstudio.
Chucky stieß auf einmal ein tiefes Bellen aus. Ich erschrak so sehr, dass ich einen Satz machte. Bisher hatte ich nicht einmal gewusst, dass er bellen konnte. Er schaute Gabriella auf eine merkwürdige Art an. Misstrauisch.
»Ist der gefährlich?«, fragte sie skeptisch.
»Meine Eltern sagen nein.« Gabriella runzelte die Stirn, warf Ben eine Kusshand zu und joggte los. Chucky schickte ihr noch ein Bellen hinterher. Ich sah den Hund unschlüssig an und fragte mich, ob er wirklich harmlos war. War das ein aggressives Bellen gewesen? Oder vielleicht doch nur eine Aufforderung zum Spielen? Ich hatte keine Ahnung. Schließlich wusste ich nichts über Hunde.
»Schräg«, sagte Ben.
»Was?«
»Du und der Hund.«
»Was genau?«
»Weiß nicht… Aber irgendwie schräg.«
»Halt die Klappe, du herzloser Kapitalist.« Ich boxte ihm in den Oberarm. Etwas stärker als beabsichtigt. Er verzog das Gesicht. Ich zog ihn oft damit auf, dass er Banker geworden war, obwohl er seit der Mittelstufe davon gesprochen hatte, als Softwareentwickler durchzustarten.
Wir ließen den Hund vor dem Haus zurück.
»Du kannst nicht mit aufs Dach. Du bist ein Hund und keine Katze, aber wir sehen uns gleich wieder. Versprochen«, sagte ich zu ihm.
Als wir durch Bens Zimmerfenster im ersten Stock auf das Garagendach stiegen, stand er vor deren Tor und starrte wedelnd zu uns hinauf. Er fiepte ein paar Mal und lief dabei aufgeregt hin und her. Dann drehte er sich im Kreis und ließ sich einfach unterhalb von uns auf den warmen Asphalt fallen. Scheinbar gab er sich damit zufrieden, in Sichtweite zu bleiben. Er ist echt okay als Bodyguard, befand ich.
3: KREA- TIEF
Wir saßen an der Dachkante, ließen die Beine baumeln, gekühlte Limo in der Hand. So schwiegen wir für eine ganze Weile und die Welt war echt okay. Trinkbarer Zucker mit Orangengeschmack, mildes Sommerwetter, ein Freund neben mir, ein felliger Bodyguard unter mir. Irgendwann fragte Ben:
»Und? Was machst du zur Zeit so?«
»Oh, ich… Also ich bin richtig derb süchtig nach dem Beulenpest-Simulator.«
»Uff, wir sind doch irgendwie alle süchtig nach dem BP-Sim.« Ben kratzte sich unter seiner Mütze. »Ich wünschte, ich hätte das Teil entwickelt.« Ich verkniff mir, erneut auf seiner Berufswahl herumzureiten. Er hat sich damals von seiner Familie reinreden lassen. Von Gabriella und ihren Eltern, die seit der Scheidung an allen Ecken und Enden finanziell aushalfen. Er hatte kleinbeigegeben und darum nie die Chance bekommen, etwas wie den Beulenpestsimulator zu entwickeln. Aber er wirkte eigentlich ganz glücklich mit seinem Job und seinen Krokodil-Polos. Ich ging davon aus, dass er – im Gegensatz zu mir – erwachsen geworden war.
»Klar stehen alle irgendwie ein bisschen auf den BP-Sim. Aber ich bin richtig derb süchtig«, erklärte ich. »Ich meine: Echtes Leben, so was gibt's? Ich verbringe meine Zeit lieber im dunklen Mittelalter mit dem Schwarzen Tod.«
»Dann sag mal an: Was war dein Rekord bisher?«
»Den schlägst du nie!«
»Unterschätz mich nicht. Ich hab schon mal ganze sieben Tage überlebt!«
»Sieben Tage? Ein Witz für mich.« Ich winkte ab. »Mein bester Run ging 12 Tage, Alter!«
»Nicht wahr. Wie geht das denn bitte?«
»Das kann ich dir sagen: Ich habe einen immunen Mönch erwischt.«
»Du warst ein immuner Mönch? Nicht wahr! Wer hat schon so ein Glück?«
»Na ja, das hat weniger mit Glück zu tun, als mit der Zeit, die ich da reinstecke. Zu 90 Prozent war ich auch nur gewöhnlicher Bürger und bin nach einem halben Tag abgekratzt.«
»Woran bist du als immuner Mönch gestorben?«
»Plünderung des Klosters. Die haben es angezündet und ich bin verbrannt. Was für eine Scheiße, Mann.«
Ben nickte verständnisvoll:
»Scheiße, Mann.«
»Also…« Er kratzte sich wieder unter der Mütze. »Du bist irgendwie… Also ich dachte, du wärst richtig beschissen drauf.« Ich zuckte die Schultern.
»Dafür sehe ich richtig beschissen aus.«
»Da ist was dran.« Ich boxte ihn in die Seite.
»Nein, mal im Ernst. Du siehst aus, als hättest du nicht viel geschlafen.«
»Nicht viel geschlafen?« Ich lachte laut. »Ich habe die letzten Tage je 10 bis 15 Stunden gepennt.«
»Wow.«
»Na ja, ich brauche das gerade. Weißt du, ich bin in so einer Orientierungsphase. Es ist nicht so, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Tut mir leid, wenn meine Mutter die Pferde scheu gemacht hat und du extra hergekommen bist.«
»Alles gut. Ich muss die vielen Überstunden sowieso abbauen. Und ich freue mich, dich zu sehen. Außerdem gibt es ja noch die Flurrenovierung… und… eine Frau.«
»Eine Frau…«
»Also ich meine jetzt nicht dich, denn du bist meine beste Kumpelfrau. Es gibt da aber noch eine andere Art von Frau… Große Gefühle, du weißt schon…«
»Wow… Toll«, log ich.
Irgendwie gefiel mir der Gedanke nicht. Gestern hatte ich mich noch beschwert, dass meine Mutter Ben genötigt hatte, wegen mir herzukommen. Aber jetzt da ich mit ihm zusammen war, fühlte es sich verdammt gut an, einfach mit ihm auf diesem Dach zu sitzen. Er kümmerte sich nicht, erwartete nichts von mir, sondern war einfach ein Freund. Es war schön, dass er da war – und dass er wegen mir da war. Nur wusste ich jetzt, dass er gar nicht nur wegen mir da war. Dass da noch Gabriella, seine Mutter, war, das war okay. Aber dass da auch noch eine andere war, ein Love Interest – Das war nicht okay. Denn diese Frau würde sicher viel von seiner Aufmerksamkeit fordern. Ich fühlte mich in den Hintergrund gedrängt und dachte, dass es ja nur wieder so lief wie immer.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe in einer Netflix-Serie. Ich sage bewusst nicht: Mein Leben fühlt sich an wie eine Netflix-Serie, denn ich bin in dieser Serie nicht die Protagonistin. Ich bin nur eine Randfigur, die ab und an auftaucht, einzig und allein zu dem Zweck, alles durcheinanderzubringen und Verwirrung zu schaffen.
»Was ist mit dir?«, wollte Ben wissen.
»Ähm, nichts…«
»Ich meinte: Was hast du vor, in nächster Zeit? Hast du dir eine Weile freigenommen? Funktioniert das überhaupt so in deinem Job?«, wollte Ben wissen.
»Na ja, nein. Also ja – Ich könnte mir wohl schon freinehmen. Kann mir ja niemand verbieten«, murmelte ich. »Aber ich hab ganz aufgehört. Ich mach das nicht mehr. Also ich werd mir irgendwann was Neues suchen. Aber erst mal eine kreative Pause.«
»Wow. Also du machst das nicht mehr mit diesem YouTube-Kanal und den Lost Places und diesem nervigen Typen… Wie heißt er noch? Lenny?«, schlussfolgerte Ben.
»So ähnlich.« Ich weigerte mich, Linus' Namen auszusprechen. »Aber ich meine, ich mache das gar nicht mehr. Das mit dem Filmen war ja sowieso nur so eine Nebensache. Aber das mit dem Fotografieren ist auch vorbei.«
»Nein, oder? Das ist doch nur so eine Phase. Ein kreatives Tief. Ein Krea-Tief.« Ich musste lachen, auch wenn mir nicht danach war. Dann sagte ich:
»Es ist ein gewaltiges Krea-Tief und ich fürchte, es ist so tief, dass ich da nicht mehr rauskomme. Ich bin auf dem Grund gefangen und muss mir da unten eine neue Existenz aufbauen. Arbeit am Fließband oder so.«
»El…«
»Du weißt doch, dass ich nie was durchziehe, Ben. Du kennst mich. Ich bin einfach nicht für Jobs gemacht. Mir fällt es schwer, was dauerhaft zu machen. Du weißt ja noch, die Schule.«
»Du warst eigentlich nie da.«
»Ich war eigentlich nie da.« Ich nickte.
»Aber ich dachte, gerade deshalb machst du das mit der Fotografie und jetzt das mit den Videos: Weil der Job abwechslungsreich ist und du nicht jeden Tag zur gleichen Zeit im gleichen Büro aufkreuzen musst. Und ich dachte, du kommst sogar mit diesem unsäglichen Lenny-Typen bei deiner Film-Nebensache einigermaßen klar. Ich meine, seine Videos sind bescheuert. Aber nur, weil er im Bild ist. Dein Part ist toll, und deine Fotos sind auch toll.«
»Hast du schon mal Fotos von richtig guten Urbex-Fotografen gesehen? Außerdem ist Lenny ein Arsch.« Mir gefiel es, dass Ben ihm einen neuen Namen verpasst hatte. Ich übernahm ihn einfach. Fick dich… Lenny!
»Hat er… na ja, irgendwas Beschissenes gebracht? Soll ich ihn verprügeln?«, wollte Ben wissen. Ich schüttelte den Kopf. Schnell und heftig.
»Nein. Es ist nichts passiert. Du hast doch selbst gesagt, dass er ein Arsch ist.«
»Unsäglich und nervig waren glaube ich die Worte, die ich benutzt habe.«
»Siehst du… Ich glaube, ich muss jetzt mal wieder. Der Hund ist schon ganz nervös. Vielleicht muss er mal.« Ben warf einen Blick auf den Hund, der eingekringelt und reglos vor dem Garagentor lag.
»Bist du sicher? Ich würde nicht mal beschwören, dass der noch am Leben ist.«
»Ich als seine Besitzerin spüre so was.«
»Okay… Aber warte mal noch eine Sekunde.«
Ich war bereits aufgestanden, aber Ben griff nach meiner Hand und hielt mich zurück.
»Vielleicht brauchst du ja ein bisschen kreativen Anstoß, um aus deinem Krea-Tief zu entkommen?«
»Gras?«
»Na ja… Vielleicht würde das auch helfen, aber ich hatte etwas anderes im Sinn.« Bens große Augen funkelten schelmisch
»Muss ich jetzt fragen, was du im Sinn hattest?«
»Musst du. Ein kreatives Projekt, das dich auf ganz andere Gedanken bringen könnte… Erinnerst du dich noch an die Zwillinge? Amal und Amila. Sie stellen gerade ein Laienmusical auf die Beine.«
»Musical? Ben! Singen, albern auf der Bühne rumhampeln und dämliche Dialoge auswendig lernen, ist wirklich nicht mein Ding!«
»Aber du könntest bei den coolen Leuten mitmachen. Amal sucht noch jemanden an der Gitarre für die Band. Du kannst doch Gitarre spielen.«
»Ben, ich habe mal Unterricht genommen. Mit 16. Du weißt doch…«
»Ja, ja. Schon klar. Du ziehst nichts durch. Aber dein Lehrer hat gesagt, du hast Talent.«
»Eigentlich hat er gesagt, ich verschwende mein Talent, weil ich nie übe, und dann hat meine Mutter den Unterricht gekündigt.«
»Aber der Satz beinhaltet auch, dass du Talent hast.«
»Was für ein Musical ist es denn überhaupt?«
»Weiß nicht. Ich schreibe Amal eine Nachricht.«
»Bist du auch dabei?«, wollte ich wissen.
»Nur als Statist. Ich kann ja nicht ständig zum Proben kommen. Ich bin dann erst irgendwann später eingeteilt.« Ben zog sein Handy heraus.
»Warte. Schreib ihm erst mal noch nicht, dass ich dabei bin!«, protestierte ich.
»Nur, dass du Interesse hast.«
»Hab ich das?«
»Jetzt schon. Schau, es steht hier. Schwarz auf weiß!« Er hielt mir sein Telefon unter die Nase.
Donnerstag
Ich hatte ziemlich schlecht geträumt – und ich hätte natürlich so tun können, als wäre dieser Traum die Realität. Ich hätte diesen Absatz kommentarlos mit den Erlebnissen aus meinem Traum beginnen können, nur um euch zu verwirren, aber das ist nicht mein Ding. Es gibt schon genug Verwirrung in meiner Welt. Da werde ich mir den Schriftstellerinnen-Scheiß sparen und klar und deutlich sagen, was Traum und was Wirklichkeit ist.
In Wirklichkeit bin ich nur im Bett gelegen. Im Traum ist mir etwas begegnet. Jemand. Die Traumwelt war hell, überbelichtet. Aber der, der mir entgegentrat, war aus einer farblosen Finsternis.
Ich stand auf einer weiten verwilderten Grünfläche und würde rückblickend sagen, dass ich den Ort kenne, auch wenn es mir in dem Traum nicht so erschienen ist. Es handelt sich um einen der verlassenen Orte, die ich mit Linus besucht habe. Genauer gesagt, um den Garten eines alten Kinderheims. Hohe Grashalme, die Samen trugen, verwachsene Apfelbäume, Wildrosen, die ein altes Schaukelgerüst umschlungen hielten – alles beleuchtet von grellweißen Sonnenstrahlen.
Und dann war da dieser Mann, der so wirkte, als würde ihn das Licht nicht berühren. Er wirkte so, als wäre er dauerhaft von Schatten umgeben. Nur dass dieser Schatten völlig absolut war. Es war Finsternis. Von seinem Körper konnte ich nur eine Silhouette erkennen und die war merkwürdig: Seine Schultern waren seltsam eckig und sein Kopf viel zu groß für den Rest des Körpers. Zudem war er kreisrund. Aber das Schlimmste an diesem Kopf war, was sich da befand, wo das Gesicht hätte sein sollen. In der Mitte des runden Gebildes war eine stinkende Kuhle. Das Gesamtkonstrukt erinnerte mich an ein Nest. Es bestand aus verschlungenen Einzelteilen, die verwittert, verfault, vermodert waren. Außen nicht so stark wie in der Mitte, in der Vertiefung. All das konnte ich weniger sehen als spüren.
Er kam näher, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. Er wuchs mit jedem Schritt in die Höhe, bis er die Apfelbäume überragte. Dabei wurde der Gestank immer stärker. Aus der Kuhle in der Mitte seines Kopfes drang ein fast schon betäubender Fäulnis-Geruch. Ich weiß nicht, ob ich je schon mal etwas in einem Traum gerochen habe, aber in diesem war es so. Ich konnte mich sogar beim Aufwachen noch genau daran erinnern. Eine Mischung aus Verwesung und etwas Stechendem, das einem die Sinne vernebelt. Als mir dieser Gestank entgegenschlug, atmete ich ihn ein. Er füllte meinen ganzen Körper und machte mich schwach. Der Gestank tauchte ab in meinen Bauch und ließ meine Muskeln erschlaffen. Ich krümmte mich. Alles verschwamm und ich dachte, dass es vielleicht doch nicht nur eine Kuhle war, in der Mitte dieses Kopfes, sondern vielleicht eher ein schwarzes Loch. Es würde mich einsaugen und verdauen, bis von mir auch nur noch ein übler Geruch übrig war. Ich fiel auf den Boden und dachte nur noch: Das ist der Fäulnis-Mann.
Dann wachte ich auf. Der Nachmittag war bereits angebrochen. Mir wurde klar, dass ich das Wort, den Namen für diese Schreckgestalt, im Traum erfunden hatte. Ich hatte noch nie zuvor etwas von einem Fäulnis-Mann gehört. Ob das wohl etwas zu bedeuten hatte? Ich wollte es gar nicht wissen.
Drei Stunden später stand Ben vor unserer Haustür, um mich mit zu Amal und Amila zu schleppen. Oder besser gesagt, um uns mitzuschleppen. Chucky war mir seither nicht mehr von der Seite gewichen. Er hatte sogar in meinem Bett geschlafen. Na ja, eigentlich hatte es sich eher angefühlt, als hätte er mich gnädigerweise in seinem Bett schlafen lassen. Ihr müsst nämlich wissen: Neben einem zu groß geratenen Setter-Mischling bleibt auf einer 90 cm-Matratze nicht viel Platz. Es wird zumindest angenommen, dass in Chucky ein Setter steckt. So richtig sicher weiß keiner, was er ist, wie alt er ist oder wo er sich in seinem bisherigen Leben so rumgetrieben hat. Er stand eines schönen Tages einfach vor den Pforten des Tierheims und wedelte mit dem Schwanz, als man ihn hineinließ. Niemand kannte ihn, niemand vermisste ihn, und so war er 18 Monate später an meine Eltern vermittelt worden.
Er folgte Ben und mir konsequenterweise zu Amal und Amila. Sie wohnten ein paar Straßenblöcke weiter, ein paar Pissecken weiter, wie es der Hund wahrscheinlich formuliert hätte.
Die haben es bisher nicht aus ihrem Elternhaus raus geschafft, dachte ich. Zu ihrer Verteidigung muss ich allerdings sagen, dass sie erst 21 Jahre waren, ein eigenes Stockwerk im Souterrain bewohnten und ihr eigenes Geld verdienten. Drei Dinge, die ich zu diesem Zeitpunkt nicht von mir behaupten konnte.
Ich folgte Ben die Gartentreppe hinab, wo er einfach die Türe öffnete, ohne zu klopfen oder auch nur zu zögern. Mir fiel wieder ein, dass er und Amila für kurze Zeit ein Paar gewesen waren. Musste etwa ein Jahr her sein. Hatte aber nicht lang gehalten.
Die Tür führte direkt in das Wohnzimmer, wo Amal an einem PC saß und uns seinen lockigen Haarschopf zuwandte.
»Hello, hello«, rief er über die Schulter, ohne sich umzudrehen. Er erwartete uns offenbar schon. Wir traten hinter ihn. Ben, Chucky und ich. Chucky trat noch einen Schritt vor. Neben Amal. Der drehte sich mit gerümpfter Nase um und sagte:
»Ben, du solltest häufiger dusch… Großer Gott!« Er hatte den Hund entdeckt. »Hoffentlich haben meine Eltern den nicht gesehen.« Er saß vor einem Programm, das unheimlich kompliziert aussah und war gerade dabei, etwas auszudrucken.
»Hey El, lange nicht gesehen. Du hast also Interesse an der Gitarrenstimme?«, fuhr Amal fort, während er aufstand, um zum Drucker hinüberzugehen.
»Na ja…«, stammelte ich, die Hände in den Hosentaschen. »Was für ein Musical ist es denn? Cats? Tanz der Vampire?«
»Aber nein!« Amal winkte ab. »Hast du eine Ahnung, was die Lizenzgebühren für die bekannten Stücke kosten? Wenn man die Lizenz überhaupt bekommt, was für kleine Gruppen echt schwierig ist. Unser Stück heißt Highway Stars, und ist selbst geschrieben.«
»Abgefahren! Du kannst selbst Stücke schreiben?«, fragte ich und folgte Bens Vorbild, als dieser sich ganz selbstverständlich aus einem Glas mit süßem Gummizeugs bediente.
»Nein. Also ich meine: Ich könnte. Aber die Stücke sind bekannte Rocksongs. Wegen dem Wiedererkennungswert«, gab Amal zurück und zog einige Seiten Papier aus dem Ausgabefach des Druckers.
»Was ist dann daran selbst geschrieben?«, wollte ich wissen. Chucky drehte sich im Kreis und kratzte an dem dicken Perserteppich auf dem Boden.
»Könnte er das bitte lassen?«, rief Amal und wedelte mit dem Papier.
»Weiß nicht. Kannst du Chucky?« Er sah mich fragend an und ließ sich dann seufzend fallen.
»Amila hat die Geschichte selbst geschrieben«, erläuterte Amal. »Und ich habe die Stücke für unser Orchester arrangiert.« Er reckte das Kinn.
»Also hast du Noten aus dem Internet ausgedruckt?!«, mutmaßte ich.
»Natürlich nicht. Zwei Drittel der Noten aus dem Internet sind grob falsch, weil sie von unfähigen Idioten aufgeschrieben werden – und außerdem gibt es keine passenden Partituren für unsere ganz spezielle Besetzung.« Er wuchs zu seinen vollen 1,90 m vor mir auf und stemmte die Hände in seine breiten Hüften. Dann reichte er mir den Papierstapel, den er soeben ausgedruckt hatte.
Ich warf einen Blick darauf. Die Blätter waren mit Gitarre 1 betitelt. Darunter ein Haufen… Ja, ein Haufen…
»Äh, was ist das?« Ich blickte verwirrt zwischen Amal und Ben hin und her.
»Na, was steht denn drüber? Das ist die Gitarrenstimme«, sagte Amal spöttisch.
»Das sehe ich. Aber was soll das hier alles?«, wollte ich wissen.
»Das – du Supergitarristin – sind deine Noten. Schon mal was davon gehört?«, versetzte Amal.
»Ja, aber was soll ich denn mit Noten – auf einer verdammten Gitarre, Mann? Woher soll ich denn wissen, welche Saiten und welche Bünde ich spielen muss?« Jetzt stemmte ich die Hände in die Seiten.
»Ja, Amal, ich glaube, sie hatte bisher immer diese Dinger mit den Zahlen«, kam Ben mir zur Hilfe und schob einen Lakritze-Drop in seinen Mund.
»Tabulatur.« Das Wort klang geradezu unanständig aus Amals Mund. »Fähige Gitarristen können normalerweise auch Noten lesen.« Ich warf Ben einen Blick zu. Hochgezogene Augenbrauen.
»Amal, kannst du da nicht was machen?«, fragte er.
»Schön«, sagte Amal und riss mir die Blätter aus der Hand. »Ich glaube, mein Programm kann auch Tabulatur generieren.«
»Ach, du lässt ein Programm die ganze Arbeit machen?«, stellte ich fest.
Amal warf Ben einen Blick zu:
»Bilde ich mir das nur ein oder versucht deine Freundin die ganze Zeit, meine Leistung als Arrangeur zu schmälern?«
Ben zuckte hilflos mit den Schultern.
In diesem Moment trat Amila in das Wohnzimmer und stolperte fast über den Hund. Sie schreckte zurück und riss die Augen auf.
»Großer Gott!« Ihre langen Locken flogen federleicht durch die Luft. Dann schenkte sie Ben dieses Millionen-Dollar-Lächeln. Sie war ein geborenes Model, arbeitete aber im örtlichen Supermarkt. Ben erwiderte das Lächeln. Ich konnte die Schwingungen in der Luft förmlich sehen. Wie in Zeitlupe bewegten sie sich aufeinander zu und fielen sich in die Arme. Küsschen links, Küsschen rechts. Ich verstand etwas. Die Frau. Amila war die Frau. Sie war wieder die Frau