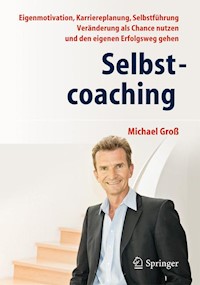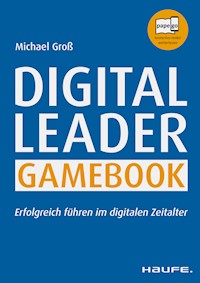24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Erlebnis Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Hofnarr« der Chemie Ausgeforscht - so heißt eine Rubrik in den »Nachrichten aus der Chemie«, in der der Chemiker und Wissenschaftsjournalist Michael Groß alle zwei Monate einen seiner »unsachlichen« Beiträge veröffentlicht - als »Hofnarr«, wie er selbst sagt. Groß schafft in seinen ironischheiteren Kommentaren die seltene Kombination aus guter, unterhaltsamer Schreibe und der Vermittlung von Fachwissen. Gerne sucht er sich abseitige Themen, scheinbar jedenfalls. Aber was ist schon abseitig für Forscher, die aus verwesenden Fischen die Biolumineszenz herauskitzeln oder mit Rattenschwänzen experimentieren?
100 »unsachliche« Beiträge »9 Millionen Fahrräder am Rande des Universums« ist eine Sammlung seiner Glossen und Kommentare der letzten 10 Jahre. In 100 »unsachlichen « Beiträgen kommentiert Dr. Groß respektlos und für alle verständlich Forschung und Forscher und entdeckt die Komik im Normalen. Hier finden Sie Antwort auf die Frage, warum trotz guter Luft im Großraumbüro schlechtes Klima herrschen kann und es Einzelnen gehörig stinkt. Oder Sie erfahren, was es mit dem aufregenden Liebesleben der Glühwürmchen, die biologisch korrekt Leuchtkäfer heißen, auf sich hat.
Sprachpirouetten statt Fachchinesisch Launig dreht Michael Groß seine sprachlichen Pirouetten, erklärt fast spielerisch wissenschaftliche Sachverhalte, stellt - für jeden leicht nachvollziehbar - neue Forschungsergebnisse vor, spießt aber genauso leidenschaftlich Themen aus der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen auf; wie die Fehlkonstruktion der Londoner Millenniums-Fußgängerbrücke über die Themse, die im Jahr 2000 eröffnet wurde. Leider hatten die Ingenieure nicht daran gedacht, dass durchaus auch mal Fußgänger über eine Fußgängerbrücke laufen bzw. an die Schwingungen, die diese verursachen. Was aus der Riesenschaukel wurde? Lesen Sie selbst!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1 Fortschritt und Rückschläge der Technik
Wem gehört die Polymerase-Kettenreaktion?
Wie klein darf’s denn sein?
Von Nullen und Basen
Rotations- und Schwingungsspektroskopie von Brücken
Big Brother mit 1,3 Millionen Teilnehmern
Neue Abenteuer eines Kohlenstoffatoms
Antinobelpreis fürs Uran-Recycling
Mit der Maul- und Klauenseuche zurück ins Mittelalter
Klonen für alle (oder nur für Spinner)?
Macht es wie die Glühwürmchen
Kein k. o.-Sieg für knockout-Ferkel
Obskure Objekte der Wissbegierde
Vom Zauber der Technik
Künstliche Intelligenz im e-Commerce ?
Ende gut, alles Öl
Warum es sich nicht mehr lohnt, Ordnung zu halten
Chemie-Olympiade
Gute Luft, schlechte Lüftchen
Was ist die nutzloseste Erfindung?
Therapeutisches Klonen: Die falsche Vision?
Beruf: Prophet
Nachwuchs im Periodensystem
DNA für Heimwerker
Globale Abkühlung
Chemie des Jungbrunnens
Chemie? Nie gehört!
Das ultimative Statussymbol?
Werden wir bald entbehrlich?
Das erste Mammut
Alter Räuber gesucht
Astrobiologie entdeckt neuen Optimismus
Traumreisen zu fernen Welten
Chemisch aktiviertes Superhirn
Auf die Finger geschaut
Quizfragen für Computer
2 Menschliches, Allzumenschliches, Zwischenmenschliches
Stoppt Alzheimer – spielt Schach!
Ins Hirn geschaut
Aus dem Leben der Terien
Die Globalisierung der Steinzeit
Quantentelepathie
Sternenkinder
Mein autistischer Alltag
Zwei Hirne im Dreivierteltakt
Kinder, Kinder
Ins Hirn gefunkt
Das A und O des Schreibens
Immer der Nase nach
Hilfe, mein Chef lernt von einem Affen!
Auf den Kopf kommt es an – oder nicht?
Aufs Maul geschaut
Schimpansen wie wir
Denglisch für Fortgeschrittene
Die Simpsons, als chemisches Experiment betrachtet
Ertrinken wir in der Zahlenflut?
Auf der Suche nach den verlorenen Illusionen
Liebe ist … wenn die Chemie stimmt?
Abenteuer im Welt-Raum
Rennfahrer, Rockstar, Bankdirektor – Wissenschaftler
Konservativ oder konserviert?
Die magische Chemie der Zahl Sieben
Tycho Brahes Elemente
3 Forschung in guter und schlechter Gesellschaft
Rutschbahn für Genies
Sternmärchen als Studienfach?
Andere Zeiten, andere Namen
Brauchen wir eine »Royal Society«?
Dichtung und Wahrheit
De profundis ad Fundis
Neulich bei der S/M-Party …
Gentests aus der Drogerie
Woher kamen die Milzbrandbriefe?
Umweltschutz à la Homer S.
Dr. Hinz und Prof. Kunz
Lasst das Essen aus der Chemie!
Das Klonbaby der Raelianer: Weihnachtsente oder Zukunftsbote?
Irrungen, Zitierungen
Unis ausgerankt
Deutschland sucht die Superuni
Versuch und Irrtum
Masselos am schnellsten
Lob des Feierabendforschers
Die Materie im Blick
Chemiker: Unbekannte Größen
Anleitung zum Mogeln
Neun Millionen Fahrräder am Rande des Universums
Ångström bis Zytotoxin
Ein Molekül in meiner Hand
Leben auf großem Fuß
Thermodynamik des großen Fressens
Kreativität und Selbsterneuerung
Wo man singt …
Am Fuß der Ranking-Leiter
Wie soll das Kind denn heißen?
Moleküle, Menschen, Marketing
Andere Zeiten, andere Wissenschaftskommunikation
Pisa, Bologna, Florenz?
Drogenkrieg im Königreich
Schöne neue Welt
Adoptieren Sie einen Chemiker
Ein Molekül namens Dornröschen
Red-Queen-Paradox im Bildungswesen
Stichwortregister
Weitere Titel aus der Erlebnis Wissenschaft Reihe…
Schwedt, G.
Lava, Magma, Sternenstaub
Chemie im Inneren von Erde, Mond
und Sonne
2011
ISBN: 978-3-527-32853-6
Will, Heike
»Sei naiv und mach’ ein Experiment«
Feodor Lynen
Biographie des Münchner Biochemikers
und Nobelpreisträgers
2011
ISBN: 978-3-527-32893-2
Schatz, G.
Feuersucher
Die Jagd nach den Rätseln der Zellatmung
2011
ISBN: 978-3-527-33084-3
Hüfner, J., Löhken, R.
Physik ohne Ende
Eine geführte Tour von Kopernikus
bis Hawking
2010
ISBN: 978-3-527-40890-0
Roloff, E.
Göttliche Geistesblitze
Pfarrer und Priester als Erfinder
und Entdecker
2010
ISBN: 978-3-527-32578-8
Zankl, H.
Kampfhähne der Wissenschaft
Kontroversen und Feindschaften
2010
ISBN: 978-3-527-32579-5
Ganteför, G.
Klima – Der Weltuntergang findet
nicht statt
2010
ISBN: 978-3-527-32671-6
Autor
Dr. Michael Groß
School of Crystallography
Birkbeck College
Malet Street
London WC 1 E 7HX
Großbritannien
www.michaelgross.co.uk
Illustrationen von
Roland Wengenmayr, Frankfurt
www.roland-wengenmayr.de
1. Auflage 2011
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2011 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Satz Mitterweger & Partner, Plankstadt
Druck und Bindung Ebner&Spiegel GmbH, Ulm
Umschlaggestaltung Bluesea Design, Vancouver Island BC
ISBN: 978-3-527-32917-5
Vorwort
Ich notiere also: Probe leuchtet grandios, auf Geschmackstest besser verzichten!
Vor zehn Jahren begann ich, auf Anregung von Gerhard Karger, meine Laufbahn als Hofnarr der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Mit schöner Regelmäßigkeit darf ich seitdem alle zwei Monate unter der Titel »Ausgeforscht« (passend zu meinem gleichzeitig erfolgten Ausstieg aus der Forscherlaufbahn) alles, was sich irgendwie mit Wissenschaft (oder bevorzugt: mit Chemie) in Verbindung bringen lässt, auf einer Druckseite in den Nachrichten aus der Chemie durch den Kakao ziehen.
Wenig später begann ich auch, allerdings etwas weniger regelmäßig, Glossen und Kommentare in Spektrum der Wissenschaft und in dem Spektrum-Ableger Gehirn und Geist zu veröffentlichen. In den letzten Jahren haben sich die Randbemerkungen im Hause Spektrum teilweise in die Blog-Plattform »Wissenslogs« verlagert.
In diesem Band sind nun 100 meiner »unsachlichen« Beiträge, überwiegend heitere, aber manchmal auch durchaus ernst gemeinte Kommentare, zusammengestellt. Es liegt in der querdenkerischen Natur der Texte, dass sie sich partout nicht in eine logische Ordnung fügen wollen. Deshalb erscheinen sie hier als Triptychon zu den – sehr weit gefassten – Themen »Fortschritt«, »Mensch«, und »Forschung und Gesellschaft«. Innerhalb der drei Teile sind die Beiträge grob chronologisch geordnet. Wo die angesprochenen Ereignisse inzwischen von der Zeit überrollt worden sind und mir eine Erklärung oder Aktualisierung nötig erschien, habe ich bisweilen ein Postskriptum angehängt.
Unter jedem Beitrag findet sich außerdem ein Hinweis auf Ort und Zeit der Erstveröffentlichung. Ich rechne nicht damit, dass irgendjemand die (weitgehend textgleichen) Originalversionen wirklich nachschlagen will, aber im Falle des Falles findet sich das vollständige Literaturzitat in meiner chronologisch geordneten Publikationsliste unter http://michaelgross.info/journal.html.
Natürlich sollen diese heiteren bis respektlosen Äußerungen keinesfalls bedeuten, dass ich den Ernst und die Wichtigkeit der erwähnten Forschung nicht zu würdigen wüsste. In demselben Zeitraum wie die 100 Glossen und Kommentare erschienen immerhin mehr als siebenmal so viele rein sachlich gehaltene populärwissenschaftliche Beiträge von mir (eine Auswahl von diesen finden Sie in »Der Kuss des Schnabeltiers«, Wiley-VCH 2009). Manchmal habe ich sogar ein und dasselbe Thema einmal von der ernsten und einmal von der heiteren Seite ausgeleuchtet.
Aber auch ernste und wichtige Unternehmungen muss man mal satirisch analysieren oder kritisch kommentieren, das hilft letztendlich nicht nur dem Spaßpegel, sondern mag auch dem tieferen Verständnis dienen. Und oft ist es gerade die wissenschaftlich geprägte Analyse von Alltäglichem und scheinbar Selbstverständlichem, die uns hilft, absurde Widersprüche aufzudecken und das Komische im Normalen zu entdecken.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Oxford, Dezember 2010
Michael Groß
1
Fortschritt und Rückschläge der Technik
Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, so ist der Lauf der Welt – das wusste schon der alte Lenin. Deshalb ist, wo immer ein großer Fortschritt mit viel Trara verkündet wird, der nächste Rückschlag erfahrungsgemäß nicht fern. In meiner Rolle als Wissenschaftsreporter helfe ich natürlich oft mit, den Fortschritt bekanntzumachen, und hoffe insgeheim, dass der Rückschlag nicht allzu katastrophal ausfällt. In meiner zweiten Rolle als Hofnarr kann ich hingegen die Schönheit des Apfels als bloßen Hintergrund benutzen und mich ganz auf den Wurm konzentrieren, der unweigerlich in der Sache steckt, und diesen genüsslich sezieren.
Im ersten Teil des Buches geht es um technischen Fortschritt, und naturgemäß sind Gebiete, die besonders rasant fortschreiten, hier (wie auch in meiner ernsten Wissenschaftsberichterstattung) öfter vertreten, etwa die Informationstechnologie und die Genomforschung.
Wem gehört die Polymerase-Kettenreaktion?
Ein exzentrischer Erfinder, eine geniale Idee, eine Revolution in der Molekularbiologie, Jurassic Park … was sich so alles mit der kurzen Geschichte der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) assoziieren lässt, ist alles andere als langweilig. Neuerdings ist dieser Aufzählung noch ein hochdramatischer Rechtsstreit um milliardenschwere Patentrechte hinzuzufügen, den Goliath in erster Instanz gegen David verloren hat. Das US-Patent, das Hoffmann-La Roche über das aus Thermus aquaticus gewonnene Schlüsselenzym Taq-Polymerase hielt, so befand ein Richter, sei auf betrügerische Weise erhalten worden und somit »nicht durchsetzbar«.
Wessen geistiges Eigentum dieses Patent eigentlich schützen sollte, war eingeweihten Wissenschaftlern sowieso von jeher ein Rätsel – bestimmt nicht das des Erfinders der PCR. Kary B. Mullis, den der nobelpreisgekrönte Geistesblitz nach eigenen Angaben im Frühjahr 1984 bei einer nächtlichen Autofahrt überraschte, stand seinerzeit in Diensten der kleinen, inzwischen aufgelösten Biotech-Firma Cetus. Er hätte dort kündigen und seine Idee in einer eigenen Firma zur Marktreife entwickeln können; dann wäre er heute steinreich, obwohl die Anwälte von Cetus ihm vermutlich Unannehmlichkeiten bereitet hätten. Da er diesen Schritt jedoch nicht tat, fielen die Patentrechte seinem Arbeitgeber Cetus zu. Dass die Methode an sich – eine der brillantesten Ideen in der Geschichte der Molekularbiologie – patentwürdig war, steht außer Frage.
Wie sieht es aber mit dem verwendeten Enzym aus? In dem jetzt für »betrügerisch« erklärten Patentantrag, aufgrund dessen 1989 das US-Patent erteilt wurde, hatten Wissenschaftler der Firma Cetus behauptet, die von ihnen aus Thermus aquaticus isolierte DNA-Polymerase sei neuartig und verschieden von anderen in der Literatur bereits beschriebenen Präparationen eines solchen Enzyms. Dummerweise ließ sich aber anhand der Cetus-Labortagebücher nachweisen, dass die Forscher sich dieses vermeintlichen, hauptsächlich mit abweichenden Molekulargewichtsschätzungen begründeten Unterschieds keineswegs so sicher waren, wie sie vorgaben. Vielleicht, so stellt sich jetzt heraus, war ihre Taq-Polymerase ja doch identisch mit dem Enzym, das Forscher aus Cincinnati bereits 1976 beschrieben hatten.
Nun fragt man sich, warum muss es eigentlich Thermus aquaticus sein? Es gibt dort draußen in den heißen Quellen und Solfatarenfeldern unseres Planeten Hunderte von thermophilen und hyperthermophilen Bakterien und Archaebakterien. Sie alle haben DNA und vermehren sich, folglich hat jedes von ihnen eine hitzestabile DNAPolymerase. Falls die Taq-Polymerase trotz des Richterspruchs nicht in den Besitz der Allgemeinheit zurückgelangt, täte nur ein kleines bisschen Forschung not, um die von Roche geforderten Gebühren zu umgehen: Schafft Hunderte von PCR-Patenten!
(Nachrichten aus der Chemie April 2000)
Wie klein darf’s denn sein?
Wissenschaftliche Debatten können schon recht kindisch sein, insbesondere wenn es um Lorbeeren für eine Entdeckung oder um Rekorde für’s Guinness-Buch geht: »Mein Supraleiter ist zwei Grad wärmer als deiner … mein Laserpuls ist drei Femtosekunden kürzer … meine Totalsynthese hat einen Schritt mehr … und überhaupt: Ich habe das zuerst entdeckt.« Sie kennen das ja sicher.
Ein Mikrobiologe ist, entgegen anderslautenden Gerüchten, nicht etwa ein Millionstel Biologe, sondern jemand, der sehr kleine Lebewesen erforscht. Auch in diesem Bereich gibt es immer wieder mal Rekorde zu vermelden. Während die jeweils hitzefestesten (Pyrolobus fumarii, 1997) oder größten (Thiomargarita namibiensis, 1999) Mikroben nur jeweils fünf Minuten Ruhm genossen, sind die kleinsten der Kleinen nun seit Jahren in öffentlichkeitswirksame Diskussionen verstrickt. Die in Anlehnung an Mikroben als Nanoben, auch als Nano- oder Nannobakterien bezeichneten Lebewesen sollen zwischen 50 und 500 Nanometer messen. Bereits eine Boten-RNA mit Ribosomen, zugehörigen Faktoren und einer umhüllenden Membran würde den 50 Nanometern nahe kommen. Wie ein solches Wesen mit dem Innenvolumen eines Tausendstel Bakteriums mehr als ein Gen ablesen soll, wissen nicht einmal die beredtesten Anhänger der Nanoben.
Dass sie dennoch zumindest als interessantes Phänomen eine gewisse Glaubwürdigkeit unter Wissenschaftlern gefunden haben, verdanken die Nanoben – ausgerechnet – der NASA. Als diese im August 1996 auf dem in Wissenschaftskreisen eher unüblichen Publikationsweg über Präsident Clinton bekanntgab, der Marsmeteorit 84001 enthalte Versteinerungen ungewöhnlich kleiner Mikroorganismen, war die Medienkarriere der Nanobakterien gesichert.
Wo genau die Nanoben auf dem Mars ansässig waren, bevor sie mit ALH 84001 auf Weltraumreise gingen, wissen wir nicht. Auf unserem Planeten scheinen sie an diametral gegenüberliegenden Orten aufzutreten, nämlich in Finnland und in Australien. In Finnland vertritt Olavi Kajander die Ansicht, dass Nanobakterien für die Bildung von Nierensteinen mitverantwortlich sind. Finnische Kollegen haben inzwischen gegen ihn ein Untersuchungsverfahren wegen Betrugsverdachts angeleiert. In Australien hingegen konnte Philippa Uwins die Strukturen, die sie für Lebewesen hält, aus Sandsteinproben gewinnen, die drei bis fünf Kilometer unter dem Meeresboden erbohrt wurden.
Die australischen Sandstein-Nanoben sind Fasern von nur 20 bis 150 Nanometern Länge. Sie sollen DNA und andere organische Materialien enthalten. Zwei neue Publikationen über diese merkwürdigen (Lebe-?)Wesen sind auf dem Weg, und mittlerweile gibt der bekannte australische Wissenschaftsautor Paul Davies schon mal Schützenhilfe. Philippa Uwins sollte bei der Wahl ihrer Unterstützer allerdings ein bisschen aufpassen. Der Mikrobiologe John Baross, der sich in Zeitungsinterviews mit großer Begeisterung über Nanoben äußerte, ist der Fachwelt vor allem als Co-Autor einer spektakulären Falschmeldung in Erinnerung: der »Entdeckung«, dass Bakterien an heißen Quellen in 250°C heißem Wasser leben können.
(Nachrichten aus der Chemie Juni 2000)
Von Nullen und Basen
Zahlen mit drei oder mehr Nullen haben diesen merkwürdigen Effekt, für den es bisher keine wissenschaftliche Erklärung gibt. Vermutlich handelt es sich um eine neuronale Kurzschlussreaktion mit einhergehender Hirnerweichung, die rationales Denken für einen gewissen Zeitraum unmöglich macht. Millenniumswahn, Lottofieber, Mega-Mergers … an Beispielen war ja gerade in jüngster Zeit kein Mangel.
Am 23. November vergangenen Jahres erreichte der Null-Effekt die Gensequenzierer: Die einmilliardste Base des menschlichen Genoms sei sequenziert worden, und es habe sich um ein G gehandelt, verkündete Nature zwei Tage darauf bierernst. Wie die Identität der Neun-Nullen-Base ermittelt wurde, wo doch Hunderte von Sequenzierautomaten gleichzeitig an der Genomsequenz arbeiten, wurde nicht mitgeteilt. Wahrscheinlich meinte man sowieso die milliardste Base, die in die zentrale Datenbank aufgenommen wurde. Und dass diese ein G (G wie Genom?) sein würde, hätte ich mit 25-prozentiger Sicherheit vorhersagen können. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt uns auch, dass dieses G vermutlich keinem Gen angehört, sondern dem womöglich bedeutungslosen Evolutionsschrott, den wir zwischen unseren Genen noch mit uns herumtragen.
Angesichts dieser Vorgeschichte ist noch Schlimmeres zu befürchten, wenn dieser Tage dann drei Milliarden Basen, und irgendwann dann auch (fast) alle Basen unseres Genoms zu Buche stehen. Was machen wir nur mit all den Gs, As, Cs und Ts? Patentieren? Tausende von Gen-Patenten sind beim US-Patentamt beantragt. Bewilligt wurden bisher nur 700. Zum Glück braucht man eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wozu das Genprodukt gebraucht wird, bevor man ein Gen patentieren lassen kann. Und irgendwo im Mittleren Westen der USA sind vermutlich schon die christlichen Fundis damit beschäftigt, ein Gerichtsverfahren zum Schutz der Patentrechte des Allmächtigen vorzubereiten. Veröffentlichen? Um Himmels willen – drei Milliarden Basen, die man mutieren kann! Nach dem Motto »one mutant – one paper« ergibt das mindestens neun Milliarden Publikationen, die in kürzester Zeit auf uns zukommen.
Es stellt sich tatsächlich die Frage: Wem gehört das Genom? Craig Venter, Bill Clinton oder dem lieben Gott? Oder jedem das Seine? (»Mein Genom gehört mir!« macht sich doch gut auf T-Shirts!) Und: Haben wir überhaupt die sittliche Reife, mit dieser Information umzugehen? Wir, die wir mit unseren Steinzeithirnen eigentlich schon von den sozialen Implikationen von Atombomben, Fernsehern und Handys völlig überfordert sind?
Ich will mich da lieber gar nicht so genau festlegen – man weiß ja, wohin so etwas führen kann, spätestens seit der für die Börsenkurse so fatalen Erklärung von Clinton und Blair, die alle beide vom Genom auch nicht mehr verstehen als unsereiner. Natürlich muss die Aussicht, die Baupläne für alle menschlichen Proteine in den Händen zu halten (kann mal bitte jemand schnell das Faltungsproblem lösen?!) alle interessieren, die sich auch nur entfernt für das Funktionieren des menschlichen oder irgendeines anderen Organismus interessieren. Und in einem optimistischen Szenario wäre der Gewinn für Biologie und Medizin in der Tat unschätzbar.
Doch um dieses Potenzial zu verwirklichen, müssen wir unsere Steinzeithirne noch ein wenig in Schwung bringen. Wir bräuchten hierzu Wissenschaftstreibende, welche die psychologischen und ethischen Verwicklungen ihrer Arbeit erkennen und ernst nehmen, politisch Verantwortliche, die zumindest die essenziellen Grundlagen der Wissenschaft begreifen können, Pharmafirmen, die auch in ein Medikament investieren, das keine Milliardengewinne verspricht, und eine breite Öffentlichkeit, die sich nicht von ein paar Nullen völlig verrückt machen lässt. Kurz, eine andere Welt.
(Nachrichten aus der Chemie Juli/August 2000)
Rotations- und Schwingungsspektroskopie von Brücken
Im Jahre 1837 baute Isambard Kingdom Brunel (1806–1859) bei Maidenhead eine Eisenbahnbrücke über die Themse, die alle Welt in Aufregung versetzte. Zwei Bögen mit jeweils mehr als 40 Metern Spannweite bei nur acht Metern Hebung: Ein solches Bauwerk musste einfach einstürzen. Brunel soll die Ängste geschürt haben, indem er zum Scherz kleine Steine so platzierte, dass sie bei der Eröffnung ins Wasser plumpsten. Die Brücke steht heute noch und hält tagaus, tagein der Belastung durch Züge stand, die zehnmal so schwer sind wie zu Brunels Zeit (wenn auch nicht wesentlich schneller oder pünktlicher).
Im Juni diesen Jahres wurde in London eine ebenfalls ungewöhnlich flache Fußgängerbrücke über die Themse eröffnet – und kaum, dass die ersten Fußgänger hinübergegangen waren, wieder geschlossen. Was war geschehen? Die hypermoderne »Lichtklinge« war unter dem Ansturm derer, die bei der Erstüberquerung dabeisein wollten, bedrohlich ins Schwingen geraten. Selbst als dummer Chemiker lernt man in der Physikvorlesung im Grundstudium, dass etwa marschierende Soldaten eine Brücke zum Einsturz bringen können, wenn ihre Trittfrequenz (ca. 2 Hz, vertikal) mit dem Bauwerk in Resonanz tritt. Doch wir wollen nicht zu früh spotten: Diese Vertikalschwingung hatten die Architekten durchaus wirkungsvoll unterdrückt, und zudem waren zur fraglichen Zeit gar keine Soldaten auf der Brücke.
Als Chemiker wissen wir auch, dass Dinge, die aus mehr als zwei Atomen bestehen, auf mehr als eine Art schwingen können. So hat denn auch eine Brücke mehrere Schwingungsfreiheitsgrade, und einer von diesen liegt in der Horizontalen. Was die Planer nicht berücksichtigt hatten war, dass die Fußgänger außer der vertikalen Stampfbewegung auch einen leichten seitlichen Schub auf den Untergrund ausüben. Da linker Fuß und rechter Fuß in diesem Fall in entgegengesetzte Richtungen schieben, beträgt die Eigenfrequenz etwa 1 Hz. Soweit ist das nicht besonders schlimm. Doch dann kam der tückische Wind (vermutlich derselbe, der im Herbst immer die »falsche Art von Blättern« auf die privatisierten Eisenbahnschienen wirft) und bewegte die Brücke unmerklich in Horizontalrichtung. Videoaufnahmen belegen, dass die Fußgänger auf die Windbewegung mit unwillkürlich synchronisierten Gegenbewegungen reagierten. Im Effekt marschierten sie im Gleichschritt über die Brücke und verstärkten damit die Ein-Hertz-Horizontalschwingung in einem Ausmaß, dass sie deutlich spürbar wurde und die Brücke geschlossen werden musste.
Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Einfache Gemüter mögen die vorschnelle Schlussfolgerung ziehen, der britische Brückenbau sei in den letzten eineinhalb Jahrhunderten gründlich auf den Hund gekommen. Der Millennium-Bug bietet sich auch als Sündenbock an, schließlich ist in allen Londoner Größenwahn-Projekten, die mit dem M-Wort zu tun hatten, irgendwie der Wurm drin. Vielleicht am frappierendsten ist jedoch das akute Versagen unserer Informationsgesellschaft. Ähnliche Probleme waren bei weniger prominenten Brücken durchaus schon aufgetreten, hatten sich aber nicht bis nach London herumgesprochen. Ein Kommunikationsausfall im Zeitalter der globalen Vollvernetzung.
Und wie soll es weitergehen? Die Brückenbauer wollen mit Stoßdämpfern nachbessern (vielleicht können sie auch bei DaimlerChrysler ein praxiserprobtes Computersystem zur Behebung peinlicher Fehler erstehen?). Viel interessanter wäre es jedoch, die Brücke in der jetzigen Form für Schulklassen zu öffnen (»Das schwingende Klassenzimmer «). Die Fortsetzung des Kurses könnte dann auf dem Kensal Green Cemetary stattfinden: Rotations- und Schwingungsmessungen am Familiengrab der Brunels.
(Nachrichten aus der Chemie Oktober 2000)
Big Brother mit 1,3 Millionen Teilnehmern
In Estland, so habe ich gerade gelernt, leben 1,445 Millionen Menschen, davon 65% »echte« Esten, deren Vorfahren bereits seit über 5000 Jahren an der östlichen Ostsee ansässig sind. Familienstammbäume können bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung hat einen Hochschulabschluss. Die Lebenserwartung beträgt 69,9 Jahre.
Wen interessiert das alles? Nun, vermutlich jeden Investor, der die Möglichkeit ins Auge fasst, für ein paar Milliarden Dollar den Genpool einer ganzen Nation zu kaufen. Das schlagkräftigste Verkaufsargument, das »Eesti Geenikeskus«, das estnische Genomprojekt, neben den obengenannten Daten ins Feld führt, ist die Akzeptanz der Bevölkerung. Mehr als 90% sollen bereit sein, jeweils 50 Milliliter Blut und ihre Krankengeschichte abzuliefern.
Estnische Politiker hoffen, dass die junge Baltenrepublik durch dieses Projekt eine weltweit einzigartige Stellung einnehmen könnte: Das einzig vergleichbare Projekt in Island greift lediglich auf 200000 Einwohner zurück, die zudem aufgrund ihrer Abstammung von wenigen Siedlern und der jahrhundertelangen Isolation genetisch eher eine Kuriosität als den Normalfall darstellen. Die Aussicht, in einem zukunftsträchtigen Bereich zur globalen Avantgarde vorstoßen zu können, scheint allerdings einigen der hochgebildeten Esten den Verstand geraubt zu haben.
Natürlich könnte man durch dieses Projekt einzigartige Informationen über die menschliche Genetik gewinnen. Man kann sich viele Experimente ausmalen, durch die man biologisches Wissen über Menschen gewinnen kann. Doch der Haken ist halt der, dass verantwortungsbewusste Wissenschaftler sich auf solche Experimente beschränken müssen, die den Untersuchungsobjekten, welche in diesem Falle Artgenossen und somit auch Subjekte sind, keinen Schaden oder Schmerzen zufügen.
Dass dieses allgemeine ethische Prinzip auch dem Sammeln von Information Grenzen setzt, scheint manchen Leuten noch gar nicht aufgefallen zu sein. Unter »Risiken« findet man auf der Website des Genomprojekts neun verschiedene Aspekte, die den Erfolg des Projekts schmälern könnten. Dass das Leben der Versuchspersonen dadurch beeinträchtigt werden könnte, dass ihr Genotyp und Phänotyp (also ihre genetischen Abweichungen vom »Standardgenom« und deren körperliche Ausprägung) in die falschen Hände fällt, oder gar dadurch, dass die Daten in die vom Projekt vorgesehenen »richtigen « Hände gelangen, wird erst gar nicht erwähnt.
Stichproben in Großbritannien haben beispielsweise ergeben, dass mancherorts bis zu 10% der untersuchten Personen nicht von dem Mann abstammen, den sie für ihren Vater halten. Selbst wenn es die estnischen Frauen weniger wild treiben als die britischen (dies ist so ziemlich die einzige Information über die estnische Bevölkerung, die uns die Website vorenthält), werden sich Zigtausende solcher Fälle aus der Datenbank ablesen lassen, wenn die genealogische Information mit der genetischen verglichen wird. Aber das ist natürlich völlig ausgeschlossen, weil die genetischen Daten nur durch Codes gekennzeichnet sind.
Und was, wenn das Projekt Erfolg hat und man demzufolge wirklich demnächst anhand von Genmarkern vorhersagen kann, welche Krankheit wann ausbrechen wird? Wird das wirklich zu einer besseren medizinischen Versorgung führen, oder lediglich dazu, dass diejenigen mit den schlechteren Genen höhere Krankenkassenbeiträge zahlen müssen? Wie sensitiv genetische Information gegenüber den Interessen von Arbeitgebern und Versicherungsgesellschaften sein kann, ist im Westen schon bis zum Überdruss diskutiert worden, scheint in Estland aber kein Problem zu sein. Missbrauch der Gendaten wird einfach verboten.
Und wenn wir die Kristallkugel hervorkramen und das Ganze ein bisschen weiterspinnen? Eines der neun auf der Website genannten »Risiken« ist, dass die Beschreibung des Phänotyps unzuverlässig oder gar falsch sein könnte. Na klar doch: Wenn alle falschen Blondinen ihre künstliche statt der natürlichen Haarfarbe angeben, kann das das schönste Genomprojekt aus der Bahn werfen. Und wer sagt schon die Wahrheit über seinen Schokoladen- und Kokainkonsum? Genau genommen müsste ja nicht nur das äußere Erscheinungsbild und die Krankengeschichte der Versuchspersonen erfasst werden, sondern ihr gesamtes Verhalten. Sprich, alle Probanden müssen mit Webcams ausgestattet werden, die ihr Benehmen im Privat- und Berufsleben über Jahre hinweg aufzeichnen und direkt auf die Server des Genomprojekts senden. Dann wäre Estland nicht nur im Genom-, sondern auch im Internetbereich führend.
Ein weiterer Risikofaktor, den die Esten scharfsinnig erkannt haben: Konkurrenten in anderen Ländern könnten ein ähnliches »Produkt« auf den Markt bringen. Es gibt ja durchaus auch andere Gebiete auf dem Globus, wo ethnisch wohldefinierte, regierungstreue und optimistische Staatsbürger nur darauf warten, ihre DNA abliefern zu dürfen. Bin mir fast sicher, dass die bayerische Staatskanzlei schon ihr eigenes Projekt in der Schublade hat.
Aber letzten Endes wird es dann eh darauf hinauslaufen, dass jedes Land eine Genomdatenbank hat, sei es nur, weil die anderen eine haben. Angesichts der parallelen Entwicklung des Reality-TV und der Omnipräsenz von Überwachungskameras lässt sich ein globales »Big Brother«-Spiel vorhersagen, an dem alle teilnehmen. Einmal in der Woche werden die Teilnehmer mit den unpopulärsten Genen herausgewählt und … aber nein, lassen wir das lieber. Es besteht ja noch Hoffnung, dass Estland doch nicht die Welt ist.
(Nachrichten aus der Chemie Dezember 2000)
Neue Abenteuer eines Kohlenstoffatoms
Aus der Hinterlassenschaft meiner Großeltern besitze ich ein Exemplar des ersten Kosmos-Bändchens, das nach dem zweiten Weltkrieg publiziert wurde: »Lebensgeschichte eines Kohlenstoff-Atoms« von Dr. Helmut Schmid, erschienen im Sommer 1946. Das fragliche Atom erzählt den Mitgliedern der »Gesellschaft der Naturfreunde« im Schnelldurchlauf (sechs Milliarden Jahre auf 90 Seiten!) die Geschichte des Universums von seiner eigenen Geburt, an die es sich dummerweise nicht erinnern kann, bis zur Gegenwart des Jahres 1946, in der es durch glückliche Zufälle in der Druckerschwärze des Kosmos-Buches gelandet ist.
Gemessen an diesem langen und ereignisreichen Leben sind die seither vergangenen 55 Jahre natürlich nur ein Augenblick, und da ich das Buch weder verbrannt noch kompostiert, sondern gut aufbewahrt habe, hat das Atom von dieser Zeit nicht allzuviel mitbekommen. Doch was für Abenteuer seine Brüder und Schwestern in freier Wildbahn in jüngster Zeit erleben konnten!
Das Leben eines Kohlenstoffatoms ist natürlich noch mehr als das unsere ein Glücksspiel. Man bedenke nur, was für ein grausames Schicksal es sein muss, für Jahrmillionen in einem Diamantgitter gefangen zu sein. Doch mit etwas mehr Glück konnten Kohlenstoffatome in jüngster Zeit an den aufregendsten Entwicklungen der modernen Welt mitwirken. Selbst ein Großteil derjenigen, die Jahrmillionen im Tiefschlaf als Erdöl oder Erdgas tief unter der Erde verbracht haben, können sich jetzt wieder als CO2 frei umherbewegen in dem erhebenden Gefühl, einen positiven Beitrag zur Erwärmung der Erdatmosphäre geleistet zu haben. Geraten sie versehentlich mal in den Stoffwechsel einer Pflanze, können sie fast sicher sein, dass diese innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren das Zeitliche segnet und ihren Kohlenstoff dem globalen Treibhaus zurückgibt. Andere haben vielleicht sogar das Glück, sich in Fullerenen, Graphit-Nanoröhren oder Methaneis-Lagerstätten wiederzufinden. Deren Lebensgeschichten tauchen dann sogar auf den Seiten von Nature und Science auf.
Na und die ganz großen Trendsetter, die steigen dann ins Carbon- Trading ein. Sie erkaufen sich die Freiheit, sich als CO2 in die Lüfte zu schwingen, mit der Zusicherung, dass sich ein entfernter Vetter auf der anderen Seite des Globus als Baum sesshaft macht. Ein bis drei US-Dollar pro Tonne Kohlendioxid soll so ein Deal derzeit wert sein. Sagen wir also: Zwei Dollar pro 22,727 mol, das macht 0,0088 Cent pro Mol oder 1,46 · 10–26 Cent pro Kohlenstoffatom. Soviel sollte einem die große Freiheit wert sein, denke ich. Und wenn dieser neue Zweig der Weltwirtschaft erst mal richtig in Schwung gekommen ist, können die Preise durchaus noch kräftig anziehen. Auf die Gigatonne gerechnet werden da schon stattliche Beträge zusammenkommen. Vielleicht lassen sich ja selbst die international agierenden Großkriminellen überreden, ihren Anteil am Kohlenstoffkreislauf nicht in Form von Schmuggeldiamanten und Kokain, sondern zukunftsweisend als virtuelles Kohlendioxid zu verschieben.
Zum Abschluss der »Lebensgeschichte« wagt Schmids Kohlenstoffatom auch einen Blick in die Zukunft. In einigen Jahrtausenden, so lesen wir, werde das »einst so geschäftige Menschengeschlecht müde geworden« sein und sich langsam zur Ruhe begeben, sprich: aussterben. Welch ein gesunder Optimismus. Neuere Entwicklungen bis hin zum Klimagipfel in Den Haag legen nahe, dass sich dieses Ende vielleicht doch etwas schneller und ganz und gar nicht ruhig abspielen wird. Es wird vielmehr von einer Kakophonie widersprüchlicher Analysen und politischer Absichtserklärungen begleitet werden. Vielleicht ist unser Kohlenstoffatom doch ganz froh, dass es im Bücherregal von alledem nicht viel mitbekommt.
(Nachrichten aus der Chemie Februar 2001)
Antinobelpreis fürs Uran-Recycling
Mit dem IgNobelpreis werden alljährlich wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet, die nicht reproduziert werden können oder sollten. Zumeist sind diese harmlos und exzentrisch. Die Physik des Keksstippens bringt zwar keinen offensichtlichen Nutzen, aber auch keinen nennenswerten Schaden. Was bisher noch fehlt, ist eine Auszeichnung für jene vordergründig guten Ideen, die sich über kurz oder lang (immer öfter über kurz) als außerordentlich schlecht entpuppen, da ihre Umsetzung mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen behaftet ist und der Menschheit mehr schadet als nützt. Für solche Geistesleistungen sollte es einen Antinobelpreis geben, der mit einer Geldbuße verbunden ist, ähnlich wie Alfred Nobel mit seiner Preisstiftung für die Verbreitung des nicht immer zum Wohle der Menschheit eingesetzten Dynamits Buße leistete.
Die Geschichte lehrt uns, dass gute, schlechte und harmlos verrückte Ideen durchaus aus ein und demselben Kopf kommen können. Nobelpreisträger Fritz Haber wäre zum Beispiel für seine Bemühungen um die Extraktion von Gold aus Meerwasser ein aussichtsreicher IgNobel-Kandidat gewesen (hätte es den Preis zu seinen Lebzeiten schon gegeben), während seine Beiträge zum Einsatz von Giftgas im ersten Weltkrieg ein klassisches Beispiel für eine Antinobel-verdächtige Leistung wären.
Im aktuellen Geschehen fällt die Auswahl schwer, so viele schlechte Ideen sind derzeit im Umlauf und und richten konkreten Schaden an. Wer auch immer das marktbeherrschende Betriebssystem für PCs so gestaltet hat, dass jeder Idiot einen Computervirus in Umlauf bringen kann, wäre ein guter Kandidat. Oder jenes Genie, das die Verfütterung toter Rinder an ihre lebenden Artgenossen einführte (darauf muss man erst mal kommen, ich hätte geschworen, die Rindviecher sind von Haus aus Vegetarier). Mein Favorit für den diesjährigen Antinobel ist jedoch der bisher im Verborgenen gebliebene Geistesheld, der auf die Idee kam, Atommüll als Munition wiederzuverwerten, die sich beim Auftreffen in radioaktiven Staub verwandelt und gleichermaßen Freund und Feind verseucht.
Man kann sich geradezu vorstellen, wie es in jenem Kopf geraucht haben muss, bis diese geniale Idee geboren wurde. Um Panzer kaputtzuschießen, brauchen wir ein Material, das wesentlich dichter ist als Stahl, muss er sich gedacht haben (in diesem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich um ein männliches Wesen handelte). Zwanzig Gramm pro Kubikzentimeter wären schon ganz gut, aber Gold können wir uns nicht leisten, und wir wollen unsere Kriegsgegner ja nicht beschenken. Und dann, nach einem langen Arbeitstag, den unser Held damit verbracht haben mag, auf sein Periodensystem zu starren und Nachschlagwerke der Materialwissenschaften zu wälzen, schläft er abends vor dem Kamin ein. Im Traum erscheint ihm ein grünlich glimmende Form, ein Ring? Nein, halt – das ist doch ein U!
Vor Schreck wacht er auf und fällt fast von seinem Sofa, greift sich das erstbeste Anorganik-Lehrbuch aus dem Regal und schlägt nach. Uran-238 – das ist doch das Zeug, das übrigbleibt, wenn die Kernkraftfritzen ihren Stoff aus der Pechblende herausgeholt haben. Halbwertszeit: 4,5 Milliarden Jahre. Na prima, bis das zerfällt, sind wir eh alle tot. Dichte: 19 Gramm pro Kubikzentimeter, na bitte! Genau was wir brauchen. Und die Kernkraftwerker sind sicher froh, wenn wir ihnen das abnehmen, dann haben sie keine Endlagerprobleme.
Vermutlich hat der geniale Erfinder dann in seiner Begeisterung das Buch sofort zugeschlagen und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um seine Idee rechtzeitig bis zum nächsten Krieg umsetzen zu können. Hätte er weitergelesen, dann wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass Uran bereits bei 700 Grad verbrennt, toxisch ist und noch eine ganze Reihe weiterer unangenehmer Eigenschaften hat. Ganz zu schweigen von den möglichen Verunreinigungen mit Spurenelementen wie Plutonium. Doch solche Kleinigkeiten stören natürlich keinen großen Geist.
Ähnlich wie beim richtigen Nobelpreis dürfte der Trend zur Teamarbeit bei der Ermittlung der Antinobelpreisträger Probleme schaffen. Im Falle der Uranwaffen müssen außer dem ursprünglichen Erfinder dieser Idee noch etliche weitere Personen zu ihrer Umsetzung in die tödliche Praxis und zur wirkungsvollen Abschirmung gegenüber möglichen Kritikern beigetragen haben. Hier hat sich offenbar die nur bis zur Mündung ihres Geschützlaufs reichende Weitsicht von Militärs mit dem Positivdenken von Politikern verbündet, die sich ganz auf positive Szenarien und das berühmte Blatt Papier verließen, mit dem man Alphastrahlung abschirmen kann (wenn man den Strahler nicht dummerweise eingeatmet hat). Die Ermittlung, wessen Dummheit hier den durchschlagenden Beitrag zum »Erfolg« gebracht hat, wird eine Herausforderung für die Preisverleiher sein.
Doch der Aufwand wird sich lohnen, schließlich lernt man am meisten aus Fehlern. Vielleicht sollte man in der Schule nicht so viel über Pasteur und Einstein lehren – denen werden es die Eleven doch nicht nachtun können. Wenn man sie hingegen in der Geistesgeschichte der schlechten Ideen unterrichtete … das könnte vielleicht gar am Ende etwas nützen.
(Nachrichten aus der Chemie April 2001)
Mit der Maul- und Klauenseuche zurück ins Mittelalter
Im Seminarraum, zwei Stockwerke unter meinem Büro, hängt er als Trophäe an der Wand, der Erreger der Maul und Klauenseuche, kurz MKS-Virus. Im Februar 1989 berichtete die Arbeitsgruppe von David Stuart, hier am 1988 gegründeten Oxford Centre for Molecular Sciences, die hochaufgelöste Struktur des Virus und errang damit die höchste Auszeichnung für Wissenschaftler – eine Abbildung des Virus auf dem Titelblatt von Nature. Wie Stuart in Nature schrieb, »sollte das Wissen um die Struktur des Virus bei der Entwicklung verbesserter und neuartiger Impfstoffe behilflich sein und könnte zu antiviralen Medikamenten führen.«
Fast auf den Tag genau zwölf Jahre später sucht ebendieses Virus Viehbestände in Großbritannien heim. Zwölf Jahre, sollte man meinen, müssten hinreichend sein, um einen Impfstoff, ein Medikament und/oder eine wirkungsvolle Diagnostik zu entwickeln? Man könnte also, im Lande des Ur-Impfers Edward Jenner und am Beginn des 21. Jahrhunderts, einem solchen wohlerforschten molekularbiologischen Problem mit wohldurchdachten wissenschaftlich fundierten Lösungen begegnen?
Falsch gedacht. Was wirklich geschah, war, dass das Landwirtschaftsministerium auf einen Katastrophenplan von 1929 zurückgriff, der hinwiederum sich von seinen Vorgängern im Mittelalter nur dadurch unterscheidet, dass es damals noch keinen Dieselkraftstoff und keine Traktoren gab. Kurz gesagt, erkrankte Tiere und die gesunden Tiere in einem gewissen Umkreis wurden geschlachtet, zu riesigen Kadaverbergen aufgehäuft, mit Diesel übergossen und open air verbrannt.
Dass dabei die Hälfte des Dieselkraftstoffs in den Boden sickert und das Grundwasser verseucht, wen kümmert’s? Dass bei den schlechten und unvollständigen Verbrennungsbedingungen infektiöse Viruspartikel in die Luft geschleudert und mit dem Wind zu anderen Bauernhöfen getragen werden, ist auch nur wenigen aufgefallen. Dass Füchse, Ratten und andere räuberische Gesellen sich an den Kadaverbergen gütlich tun und dann in Missachtung des Bewegungsverbots für Tiere die Seuche weitertragen – auch eine bedauerliche Panne.
Und warum das alles? Ließe man der Seuche ihren Lauf, so würden daran vielleicht 5% der Tiere sterben. Eine Extrapolation der gegenwärtigen Strategie könnte hingegen bedeuten, dass die Hälfte des Viehbestands ins Gras beißt. Ließe man die gefährdeten Tiere impfen, so würde sich – bei allen Zweifeln an der vollständigen Wirksamkeit der existierenden Impfstoffe – ein sehr viel unblutigeres Ende abzeichnen. Aber dann, und das ist der Haken, könnte Großbritannien über Jahre hinweg kein Vieh mehr exportieren (weil man nämlich trotz Strukturanalyse keine Methode hat, ein infiziertes von einem geimpften Tier zu unterscheiden!).
Und das ist der Punkt, wo mein Hirn nicht mehr mitmacht. Um ein Exportgeschäft zu schützen, das nach Ansicht vieler Leute ebenso sinnlos wie grausam ist und lediglich 50 Millionen Pfund im Jahr an Gewinn erwirtschaftet, werden Milliarden verheizt und neuerdings auch verbuddelt. Zusätzlich gehen Milliarden im Tourismus verloren, der bisher das einträglichste Geschäft der britischen Bauern war. Bei den Strategiebesprechungen ist offenbar nicht nur die Molekularbiologie, sondern auch die Arithmetik draußen vor der Tür geblieben.
Doch die erschreckendste Frage ist: Was, wenn ein ebenso infektiöses, aber für Menschen lebensgefährliches Virus eine neue Epidemie auslöst – werden wir dann ebenfalls auf die Rezepte des Mittelalters zurückgreifen, auf Pestmasken und Weihwasser?
(Spektrum der Wissenschaft Mai 2001)
Klonen für alle (oder nur für Spinner)?
Am 13. Dezember 1973 ereilte den französischen Motorsportjournalisten Claude Vorilhon die Erleuchtung. Statt zur Arbeit nach Clermont-Ferrand fuhr er ohne ersichtlichen Grund zum Krater des Puyde-Lassolas in der Auvergne, wo er ein UFO vorfand und den Elohim begegnete. Die Elohim sind die uns technisch überlegenen Außerirdischen, die bereits in der Bibel vorkommen sollten. Nur durch ein dummes Missverständnis verwandelte sich das Wort »Die, die vom Himmel kamen« in »Gott«. Vorilhon seinerseits verwandelte sich durch diese Begegnung in den neuen Messias, Rael, und er begründete die Sekte der Raelianer, welche die biblische Geschichte akzeptiert, aber etwas anders interpretiert, als wir es in der Schule gelernt haben. Ein Kernpunkt ihrer Weltsicht ist, dass die Auferstehung Christi in Wirklichkeit eine Wiedererschaffung durch Klonierung war.
Angesichts dieses Hintergrunds ist es nicht verwunderlich, dass die Raelianer seit der Nachricht von Dolly dem Klonschaf darauf hinarbeiten, es den Elohim nachzutun und einen Menschen zu klonen. Sie gründeten bereits 1997 auf den Bahamas die Firma Clonaid, die genau dieses Ziel verfolgt und, wenn es dann soweit ist, den Klonservice für ca. 200000 Dollar anbieten will. Wer auch immer diesen Preis zahlen kann – also auch Alleinstehende und homosexuelle Paare – wird bei Clonaid bedient werden. (Als wissenschaftliche Randbemerkung sei hier klargestellt, dass der resultierende Mensch dem Zellkernspender weniger ähnlich sein wird als ein eineiiger Zwilling dem anderen, da er während der Embryonalentwicklung einen anderen Mutterleib bewohnt und anderen hormonellen Einflüssen ausgesetzt ist. Hunderte von identischen Menschen wird man erst erzeugen können, wenn man die ganze Entwicklung in vitro abwickeln kann. Einen auf natürlichem Wege entstandenen Menschen exakt zu replizieren wird meines Erachtens niemals möglich sein.)