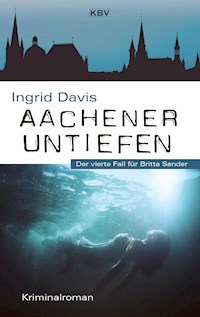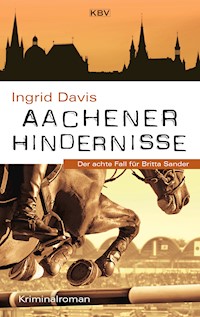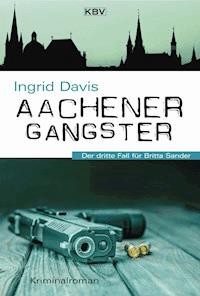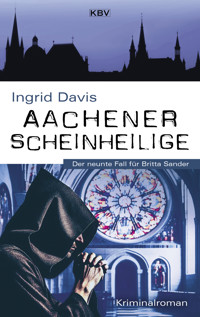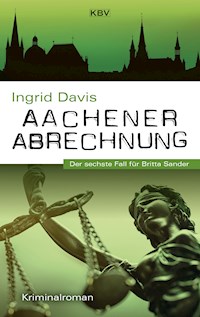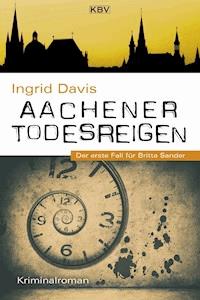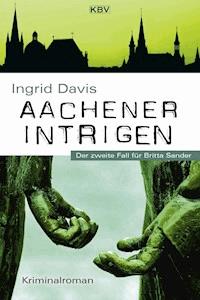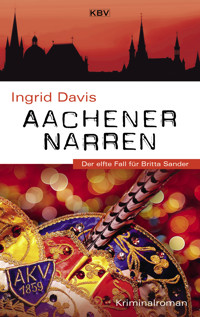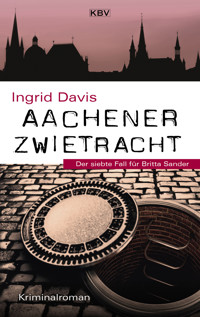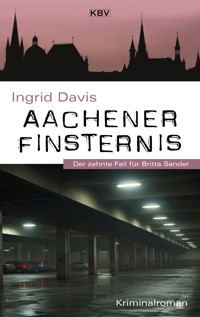
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Britta Sander
- Sprache: Deutsch
Die Kaiserstadt in Angst … Der zehnte Fall für Britta Sander Ganz Aachen ist in Aufruhr. Zwei aus der JVA entflohene Gewaltverbrecher halten die ganze Stadt in Atem. Da wird mitten in einem belebten Aachener Parkhaus die Unternehmerin Susanne Jaschke hinterrücks ermordet – ein Fall für die Detektivin Britta Sander und Kriminalkommissar Körber. Hinter der Fassade einer vermeintlich glücklichen Familie entdecken sie schon bald mehr als nur ein Motiv für diesen Mord, und ein Geheimnis tritt zutage, das den Ermittlungen eine unerwartete Wendung gibt. Als Britta nur knapp einem Anschlag entgeht, wird die Suche nach dem Täter zu einem sehr persönlichen Kräftemessen zwischen ihr und einer Verschwörung, die sich tief ins Herz der Kaiserstadt gefressen hat. Hand in Hand mit dem Ex-Gangsterboss Tom Hartwig muss Britta sich ihrem bisher finstersten Fall stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ingrid Davis
Aachener Finsternis
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Aachener Todesreigen
Aachener Intrigen
Aachener Gangster
Aachener Untiefen
Aachener Abgründe
Aachener Abrechnung
Aachener Zwietracht
Aachener Hindernisse
Aachener Scheinheilige
Ingrid Davis (Jahrgang 1969) ist gebürtige Aachenerin und begann bereits im Alter von zehn Jahren mit dem Schreiben von Kurzgeschichten, Novellen und Gedichten. Ihr Weg führte sie nach dem Studium (Englische Literatur und Geschichte) jedoch zunächst nicht in die Schriftstellerei, sondern ins Marketing und Projektmanagement. Hauptberuflich ist sie auch heute noch als Marketingmanagerin tätig und lebt bei Aachen. Neben dem Krimischreiben verbringt sie ihre Freizeit gerne mit Reisen, Kino, Literatur und Strategiespielen.
Aachener Finsternis ist der zehnte Band der Reihe um die schlagfertige Privat-Ermittlerin Britta Sander, die ein verhängnisvolles Talent besitzt, in gefährliche Situationen zu geraten.
Ingrid Davis
AACHENER FINSTERNIS
Britta Sanders zehnter Fall
Originalausgabe
© 2025 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH
Am Markt 7 · DE-54576 Hillesheim · Tel. +49 65 93 - 998 96-0
[email protected] · www.kbv-verlag.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unsere Herstellung:
[email protected] · Tel. 0 65 93 / 998 960
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von
© Markus - Fotolia.de und © serg3d - stock.adobe.com
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
ISBN 978-3-95441-720-9 (Taschenbuch)
ISBN 978-3-95441-727-8 (eBook)
Inhalt
PROLOG FREITAG, 10. JANUAR
SAMSTAG, 11. JANUAR
SONNTAG, 12. JANUAR
MONTAG, 13. JANUAR
DIENSTAG, 14. JANUAR
MITTWOCH, 15. JANUAR
SAMSTAG, 18. JANUAR
EPILOG SAMSTAG, 18. JANUAR
DANKE
Für Jürgen und Waltraud Scholl.
Wenn aus Recherche Freundschaft wird.
REGISTER
DER HAUPTFIGUREN
Britta Sander
Privatdetektivin in der Detektei Schniedewitz & Schniedewitz
Anne-Roos de Vries, Eric Lautenschläger, Silke Juratha, Marc Achten
Brittas Kolleginnen und Kollegen
Kriminalhauptkommissar (KHK) Matthias Körber
Brittas Partner
Sammy
Brittas kleine, schwarze und immer hungrige Promenadenmischung
Tom Hartwig
Ex-Gangsterboss und enger Freund Brittas
Tahar Karim
französischer IT-Sicherheitsexperte und Brittas bester Freund
Jyoti Chandra
Brittas älteste Freundin
Petra Hoffmann, geb. Sander
Brittas Schwester
Gregor Hoffmann
Brittas Schwager
Felix, Finn, Pip und Ronja Hoffmann
Brittas Neffen und Nichte
Elise Dion alias »Die blaue Elise«
Geschäftsführerin bei Schniedewitz & Schniedewitz
Martin Sander
Brittas zweitältester Bruder und Inhaber von Schniedewitz & Schniedewitz
Holger Sander alias »Chefarzt Dr. Holger«
Brittas ältester Bruder
Jürgen Sander
Brittas drittältester Bruder
Polizeikommissar (PK) Lukas Körber
Körbers jüngster Bruder
Oberst a. D. Krause
Brittas Nachbar
Harry Schlüper
geläuterter Ex-Knacki und Privatdetektiv
PROLOG FREITAG, 10. JANUAR
18:37 Uhr
Gedankenverloren setzte Susanne Jaschke den Blinker, reduzierte das Tempo und bog von der Lagerhausstraße nach rechts in die Zollamtstraße ein. Sie folgte der Straße zwischen den hohen Betonstelzen hindurch, die das hässliche, immer schmuddelig wirkende Verwaltungsgebäude der Stadt Aachen trugen. Kurz darauf drosselte sie erneut das Tempo und lenkte ihren Wagen in die Einfahrt des Parkhauses am Hauptbahnhof.
Während sie langsam auf die Einfahrtschranke zurollte, öffnete sie die Mittelkonsole und griff, ohne hinsehen zu müssen, nach der blauen Parkkarte, die sie so häufig nutzte. Sie ließ das Fenster des großen Kombis lautlos nach unten gleiten und hielt die Karte so, dass das Erfassungsgerät sie erkannte. Nachdem die grau-blau gestreifte Schranke sich gehoben hatte, rollte Susanne an, während sich das Fenster wieder schloss.
Wie immer nahm sie die Kurven auf dem Weg nach unten zu den Parkebenen ruhig und gelassen. Was geschah, wenn man zu eilig unterwegs war, konnte man an den zahlreichen Schrammen sehen, die die weißen Wände zierten.
Sie warf einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett. Genug Zeit, um den Zug nach Köln zu erreichen, aber trödeln sollte sie auch nicht. Mit etwas mehr Schwung als sonst nahm sie die nächsten Kurven und rollte schließlich die letzte Rampe hinunter zum untersten Parkdeck.
Zielstrebig fuhr sie auf den Platz zu, auf dem sie am liebsten parkte, und stellte erfreut fest, dass er frei war. Es gab keinen Grund, warum sie ausgerechnet diesen bevorzugte, trotzdem war es schon lange »ihr« Parkplatz.
In einer gekonnten Bewegung schwang sie ihren großen Wagen in die eher eng bemessene Parktasche, stellte den Motor ab und griff nach ihrer Handtasche, die wie immer auf dem Beifahrersitz stand. Da der Platz neben ihrem frei war, brauchte sie diesmal nicht darauf zu achten, wie weit die Fahrertür aufschwang. Als sie ausstieg, spürte sie plötzlich an ihrer rechten Hand einen unerwarteten Ruck, und ehe sie sich versah, hatte sich der Inhalt ihrer Handtasche über den Fahrersitz und den Fußraum davor ergossen.
»So ein verdammter Mist«, fluchte sie, denn es war nicht das erste Mal, dass die ledernen Schnüre außen an ihrer Tasche beim Aussteigen an der Gangschaltung hängen blieben. In letzter Zeit hatte sie meistens daran gedacht, den Reißverschluss zuzuziehen, damit sie nicht durch den ganzen Wagen krabbeln musste, um ihre Habseligkeiten wiederaufzulesen. Heute war sie jedoch so in Gedanken gewesen, dass sie nicht daran gedacht hatte.
Ärgerlich ruckte sie die Tasche frei und beugte sich in den Wagen, um alles so schnell wie möglich wieder zurückzuschaufeln. Die Sachen in der Tasche wieder an ihren jeweiligen Platz kramen konnte sie auch auf der Zugfahrt.
Als sie alles wiederaufgeklaubt hatte, kontrollierte sie zur Sicherheit noch das kleine Seitenfach im Inneren der Tasche. Dessen Reißverschluss war Gott sei Dank verschlossen gewesen, und ein kurzer Griff zeigte ihr, dass der USB-Stick noch drin war. Nicht auszudenken, wenn der in die falschen Hände geriete. Erleichtert atmete sie aus und richtete sich auf. Jetzt würde sie sich wirklich beeilen müssen, um den Zug noch zu erwischen.
Sie wollte gerade einen Schritt zurücktreten, um die Autotür zu schließen, als jemand von hinten eine Drahtschlinge um ihren Hals legte und mit aller Kraft zuzog. Sieben Sekunden später verlor Susanne Jaschke das Bewusstsein. Als ihr Herz nach vier qualvoll langen Minuten aufhörte zu schlagen, setzte sich der RE 1 in Richtung Köln gerade ohne sie in Bewegung.
SAMSTAG, 11. JANUAR
17:25 Uhr
»Das ist nicht dein Ernst!«, entfuhr es meiner Schwester Petra, die das Salatbesteck in ihrer Hand kurzfristig vergessen zu haben schien.
»Nicht so laut, Pe!«, gab ich hastig zurück. »Die Zwerge …«
»… sind alle oben und spielen mit Gregor Verstecken«, winkte sie meinen Einwand ungeduldig weg. Trotzdem senkte sie ihre Stimme, als sie weitersprach. »Du willst mir also allen Ernstes erzählen, dass zwei Schwerverbrecher aus der JVA ausgebrochen sind und die Polizei einen Tag später noch immer keine Ahnung hat, wo die hin sind?«
»Ich fürchte, so sieht’s aus«, erwiderte ich und versuchte, die Käsewürfel vor mir wenigstens einigermaßen adrett auf Pes schicker Käseplatte zu drapieren. »Die Nerven im Präsidium liegen blank.«
»Das kann ich mir vorstellen«, schnaubte Pe. »Wer hat denn bei der Suche eigentlich den Hut auf?«
»Bei so was die Polizei Köln.« Ich legte den Kopf schief, um mein Käsewürfeltürmchen zu begutachten.
»Das heißt, die haben beschlossen, die Öffentlichkeit nicht zu informieren?« Man hörte Pes Stimme an, was sie von dieser Entscheidung hielt.
»Mh-hm. Aber laut Körber herrscht darüber alles andere als Einigkeit.« Mein Partner Matthias Körber verdiente im Kriminalkommissariat 11 – Todesermittlungen – seine Brötchen und saß natürlich direkt an der Informationsquelle. »Einerseits könnte eine Öffentlichkeitsfahndung wichtige Hinweise liefern, wo die zwei abgeblieben sind. Andererseits will man auch keine Panik auslösen. Das sind schwere Jungs – Raub mit Todesfolge, schwere Körperverletzung, bei Heppner auch Vergewaltigung, und das ist noch lange nicht alles.«
»Super Idee, die Bevölkerung nicht zu warnen, wenn solche Typen plötzlich frei herumlaufen. Wie viele Geiseln hatten Heckhoff und Michalski 2009 noch mal genommen, als sie ausgebrochen sind?«
»Fünf, glaube ich, aber sie haben alle unverletzt wieder freigelassen.« Ich griff nach den gewaschenen Weintrauben und machte mich daran, die Käseplatte damit halbwegs ansehnlich zu dekorieren. Sammy, meine kleine schwarze Promenadenmischung, ließ mich – oder besser gesagt das Essen – keine Sekunde aus den Augen.
»Das wird sicher ein großer Trost sein, wenn die aktuellen Ausbrecher sich auch ein paar Leute schnappen«, antwortete Pe.
»Ich glaube nicht, dass man das noch lange unter der Decke halten kann. Dass gestern Nachmittag plötzlich Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht in Richtung JVA gerauscht sind, wird nicht unbemerkt geblieben sein – genauso wie das erhöhte Hubschrauberaufkommen über der ganzen Städteregion. Würde mich wundern, wenn ein paar Bluthunde von der Presse nicht schon Witterung aufgenommen hätten.«
»Wenn das über die Presse rauskommt, können sich die Verantwortlichen schon mal warm anziehen.« Pe nahm zwei rote Paprikas und warf sie mir nacheinander quer durch die Küche zu.
»Laut Körber genau die Worte von Polizeipräsidentin Schaller«, nickte ich, stellte die Käseplatte zur Seite und begann, die Paprikas zu schneiden.
Als Sammy plötzlich aufsprang und in Richtung Haustür flitzte, wussten wir, dass es Sekunden später klingeln würde. Ich sah auf meine Smartwatch und trocknete mir die Hände ab. »Das ist bestimmt Körber. Ich mach auf.«
Als ich die Haustür öffnete, drückte Körber gerade eine Kippe in seinem kleinen Taschenaschenbecher aus. Sorgfältig putzte er sich die Schuhe an der Fußmatte ab, küsste mich zur Begrüßung und folgte mir dann in die Küche, wo Pe gerade letzte Hand an ihren berühmten Nudelsalat legte.
Körber warf einen Blick auf mein Schneidebrett und die halb zerstückelte Paprika. »Du lässt Frau Sander in der Küche arbeiten?«, brummte er, während er seine Jacke auszog. »Wenn ich gewusst hätte, dass du so verzweifelt Hilfe brauchst, wär ich was früher gekommen.«
»Alles halb so wild, Körber, beim Schnippeln kann ihr ja nichts anbrennen«, grinste Pe und begrüßte ihn mit einer herzlichen Umarmung.
»Waffeln brennen mir nie an«, protestierte ich.
»Das ist aber auch das Einzige«, gab Körber zurück und verschwand kurz im Flur, um seine Jacke aufzuhängen.
»Und?«, fragten Pe und ich im Chor, als er zurückkam.
»Die Katze ist aus dem Sack«, knurrte er.
»Hatten sie doch endlich ein Einsehen?« Ich drückte Körber ein Küchenmesser in die Hand, damit er sich nützlich machen konnte.
»Nicht ganz. Irgend so einem Jüngling von einem privaten Radiosender kamen die ganzen Hubschrauberüberflüge seit gestern Nachmittag komisch vor. Dann hat er was herumgeschnüffelt, vom JVA-Einsatz gestern Wind bekommen und eins und eins zusammengezählt. Die haben den Beitrag gesendet, der ging auf Social Media viral, und dann hat eine große Presseagentur das Thema aufgegriffen. Eine Stunde später stand eine ganze Pressemeute vor dem Präsidium und wollte wissen, ob wirklich gestern jemand aus der JVA ausgebrochen ist.«
»Auweia!«, sagte ich inbrünstig.
»Allerdings«, brummte Körber und schnitt die Fleischwurst, die Pe ihm hingelegt hatte, in kleine Würfelchen. »Viel Gefeixe im Präsidium – die Herrschaften aus Köln wollten ja nicht auf uns hören, da hat man sie den Öffentlichkeits-GAU auch selbst ausbaden lassen.«
»Recht so. Und von Heino und Hannelore weiterhin keine Spur?«, fragte ich.
»Von wem?« Pe sah uns entgeistert an.
»Na ja, eigentlich heißen sie Heiner Heppner und Winfried Gruber«, grinste ich, »aber im Knast kennt man sie wohl nur als Heino und Hannelore.«
»Wieso das denn?«, staunte Pe.
»Heppner wurde schon als Kind Heino gerufen, weil er weißblonde Haare hat«, erklärte Körber. »Und seit ein paar Jahren läuft er draußen nur noch mit einer schwarzen Sonnenbrille herum. Er und Gruber sind seit Jahren dicke Freunde, und da Gruber fast die gleiche Frisur hat wie die Frau vom echten Heino …« Er zuckte mit den Schultern und steckte sich ein Stück Fleischwurst in den Mund.
»Wer hat die gleiche Frisur wie die Frau von Heino?«, fragte mein Schwager Gregor, der völlig zerzaust in der Küchentür aufgetaucht war.
»Ich dachte, ihr wolltet Verstecken spielen«, schmunzelte Pe. »Du siehst eher aus, als hätte dich jemand rückwärts durch eine Hecke gezogen.«
»Eine Hecke war Gott sei Dank nicht in der Nähe«, ächzte Gregor und versuchte vergeblich, seine Haare wieder zu glätten. »Klein-Ronja fand Versteckenspielen langweilig, sie hatte da eine viel bessere Idee – und wie immer waren Felix, Finn und Pip sofort Feuer und Flamme.«
»Ich seh’s«, lachte Pe.
»Wer hätte gedacht, dass die Kleinste ein schlimmerer Rabauke wird als ihre drei Brüder zusammen«, grinste Gregor, als er Körber zur Begrüßung die Hand schüttelte und sich ebenfalls ein Stück Fleischwurst mopste.
»Was hast du denn gedacht, bei der Patentante?«, brummte Körber.
»Unverschämtheit«, protestierte ich grinsend.
Körber schielte zu Pe, ob er es riskieren konnte, noch mehr Wurst vom Nudelsalat abzuzweigen.
»Untersteh dich!«, sagte sie. »Du auch, Gregor!«
»’nen Versuch war’s wert.« Gregor zuckte bedauernd mit den Achseln. »Also, wer hat denn jetzt die gleiche Frisur wie Heinos Hannelore?«
* * *
19:35 Uhr
»Echt jetzt?«, brummelte ich, als mein Handy zwei Stunden später plötzlich klingelte und das muntere Stimmengewirr von zehn gut gelaunten Personen verstummte. »Wer soll das denn sein?« Auf dem Display leuchtete eine mir unbekannte Handynummer auf. Mit einem ratlosen Blick und einem Schulterzucken nahm ich das Gespräch an. »Hallo?«
»Spreche ich mit Britta Sander?«, sagte eine mir ebenfalls unbekannte Männerstimme.
»Ja, höchstselbst«, gab ich zurück.
»Ich bin von der Gilde der Unsichtbaren«, sagte er, und ich hatte den Eindruck, dass seine Stimme etwas zitterte. »Wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Die Präfektin ist spurlos verschwunden.«
Die Gilde der Unsichtbaren hatte gut zweieinhalb Jahre zuvor das erste Mal Kontakt mit mir aufgenommen und mir und meinen Kollegen damals zunächst nichts als Rätsel aufgegeben. Immer wieder hatten Umschläge mit seltsamen Gegenständen auf der Fußmatte meiner Wohnung gelegen, ohne dass wir uns hätten erklären können, was der ganze Spuk sollte. Die Boten, die die Umschläge überbrachten, hatten wir nie zu sehen bekommen.
Hatten wir zu Anfang noch gedacht, dass wir es vielleicht mit einer Horde Spinner zu tun hatten, führten die Hinweise der Gilde uns kurze Zeit später auf die Spur des brutalsten Serienmörders in der Geschichte Aachens. Nachdem ich das Ergreifen dieses Wolfs im Schafspelz beinahe mit dem Leben bezahlt hätte, hatte ich die letzte Probe offenbar bestanden.
Das Aachener Kapitel der Gilde trug mir die Rolle der Gilde-Ermittlerin an. Erst durch diese Einladung hatte ich erfahren, dass es sich bei der Gilde um einen Geheimbund handelte. Dort hatten sich Menschen zusammengeschlossen, die in unserer Gesellschaft oft nicht wahrgenommen oder gar bewusst übersehen wurden. Ob nun die Reinigungskraft, der Chauffeur oder die Toilettenfrau, die Kellnerin oder der Mann an der Garderobe – sie alle hatten eins gemeinsam: Andere Menschen achteten nicht darauf, was sie in deren Beisein sagten oder was für Spuren sie hinterließen.
Über Unwichtiges hörten die Mitglieder der Gilde hinweg; Privates behielten sie für sich. Kamen ihnen jedoch Dinge zu Ohren, die auf ein Verbrechen hindeuteten oder auf einen massiven Verstoß gegen die ethischen Regeln des Zusammenlebens einer Gesellschaft, so informierten sie die sogenannten Buchwächter. Diese notierten die Hinweise von Tausenden von Mitgliedern und werteten sie aus. Gab es aus ihrer Sicht Handlungsbedarf, informierte das jeweilige Gilde-Kapitel die Ermittlerin oder den Ermittler, mit denen es zusammenarbeitete. Gab es diese Möglichkeit nicht, bekamen die Ermittlungsbehörden einen Hinweis.
Ich räusperte mich. »Können Sie das vielleicht noch einmal wiederholen?«
Die Stimme des Mannes überschlug sich fast. »Die Präfektin ist seit gestern Abend verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist!« Da war jemand entweder in echter Panik oder ein begnadeter Schauspieler, der herausbekommen wollte, ob es die Gilde wirklich gab.
Ich stand auf, ging in die Küche und machte die Tür hinter mir zu. »Mit wem spreche ich denn?«
»Mit einem Mitglied der Gilde, das eng mit der Präfektin zusammenarbeitet.«
Ich wartete. Wenn er jetzt nicht noch etwas nachschob, durfte ich mir nicht anmerken lassen, dass ich von der Existenz der Gilde wusste. Das hatte die Präfektin mir für genau diesen Fall eingeschärft – dass mich jemand auf die Gilde ansprach, ohne dass ich sicher sein konnte, dass er dazugehörte.
»Sie sagen ja gar nichts.«
»Stimmt.«
»Sie müssen uns helfen! Sie sind doch die Gilde-Ermittlerin!«
Ich fand es ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand über Gilde-Ermittler Bescheid wusste, ohne zur Gilde zu gehören – trotzdem hielt ich mich streng ans Protokoll. Ich wollte wirklich nicht diejenige sein, die die Gilde nach über vierzig Jahren im Verborgenen auffliegen ließ.
Als ich immer noch nichts sagte, rief er verzweifelt: »Worauf warten Sie denn noch?«
Ich seufzte. »Ja, was glauben Sie denn, worauf ich warte?«
»Oh Gott, ich Idiot! Natürlich, das Kennwort! DOPPELTER KOLBENFRESSER!«, schrie er so laut, dass ich das Handy kurz vom Ohr nehmen musste.
»Na, geht doch«, sagte ich freundlich. Wenn die Präfektin wirklich verschwunden war, hätte ich ungern aufgelegt, nur weil der Mann sich nicht an das Kennwort erinnern konnte. »Und mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Corsten, Viktor Corsten ist mein Name.«
»Und jetzt erzählen Sie mal der Reihe nach.«
In diesem Moment flog die Küchentür auf, und Körber kam hereingestürmt, sein eigenes Handy noch in der Hand. »Britta, wir müssen los.«
Hastig stellte ich mein Gilde-Gespräch auf stumm. »Wieso? Ist was passiert?«
»Man hat im Parkhaus am Hauptbahnhof eine Leiche gefunden, Gewaltverbrechen.«
»Verflixte Hasenkacke!« Ich überlegte blitzschnell und aktivierte das Mikrofon meines Handys wieder. »Hören Sie? Seit wann ist denn die Präfektin verschwunden?«
»Soweit wir wissen, seit gestern Abend.«
Also gerade einmal vierundzwanzig Stunden. »Haben Sie schon mit der Familie gesprochen?«
»Nein, wir …«
»Britta«, wiederholte Körber drängend. Ich hielt einen Finger hoch, dass er mir eine Minute geben sollte.
»Dann machen Sie das. Haben Sie schon alle Freunde und Verwandten abtelefoniert? Haben Sie in den Krankenhäusern angerufen?«
»N-nein, ich …«
»Okay, dann machen Sie das auch noch und rufen mich wieder an, sobald Sie damit durch sind, ja? Ich muss dringend etwas erledigen, aber ich melde mich so bald wie möglich bei Ihnen zurück. Ihre Nummer habe ich ja.«
»Britta!«, wiederholte Körber.
»Ja doch«, zischte ich. In den Hörer sagte ich möglichst beruhigend: »Vor allem nicht in Panik geraten, okay?«
»Ist gut. Ich versuch’s«, sagte das Gilde-Mitglied am anderen Ende der Leitung um Tapferkeit bemüht und legte auf. Dann machten Körber und ich uns auf in Richtung Tatort.
* * *
19:55 Uhr
Die Zusammenarbeit unserer Detektei, Schniedewitz & Schniedewitz, mit der Aachener Polizei hatte einige Jahre zuvor fast durch Zufall begonnen und sich im Laufe der Zeit immer weiter vertieft.
Die Aachener Kripo kämpfte wie so viele andere Behörden mit Personalmangel, und im Bereich Todesermittlungen konnte man nicht mal eben neue Leute einstellen. Zwar gingen die Bewerberzahlen für die Polizeiausbildung stetig nach oben, aber bis jemand bei der Kripo mitarbeiten konnte, vergingen Jahre. Nachdem der Innenminister des Landes NRW unsere anfängliche Kooperation als Leuchtturmprojekt bezeichnet hatte, war man schließlich seitens der Polizei auf die Detektei zugegangen, um die gemeinsame Arbeit auch formal auf solide Füße zu stellen.
Das, was das Land an Honorar anbieten konnte, entsprach natürlich nicht im Geringsten den überzogenen Vorstellungen unserer raffgierigen Chefetage. Trotzdem war man sich nach einigem Hin und Her schließlich handelseinig geworden, und seitdem gab es einen Rahmenvertrag, der unsere Mitarbeit an Polizeiermittlungen abdeckte und die Vergütung für die geleisteten Stunden regelte.
Von Pes und Gregors Haus in der Hein-Görgen-Straße waren es vielleicht zwei Kilometer bis zum Hauptbahnhof, sodass wir nur zehn Minuten brauchten, bis wir am Parkhaus waren und unseren Weg zum Leichenfundort auf dem untersten Parkdeck gesucht hatten.
»Ah, da seid ihr ja«, sagte Körbers Chef, Kriminalhauptkommissar Eduard »Ede« Bienwald, erfreut. »Und die Rechtsmedizin habt ihr auch gleich dabei. Ja, is’ denn heut scho Weihnachten?«, zitierte er zwinkernd Franz Beckenbauer und schüttelte meiner Freundin Jyoti die Hand. »Ich freue mich ja immer, Sie zu sehen, Frau Chandra, aber ich muss zugeben, heute ganz besonders.«
»Klarer Fall von Vorspiegelung falscher Tatsachen«, schmunzelte Jyoti, die zwar in Köln arbeitete, aber in Aachen lebte. »Eigentlich hieß es, wir feiern bei Brittas Schwester den erfolgreichen Abschluss des Mordfalls im Kloster letzte Woche. Stattdessen wird man zum Nachtisch gleich zum nächsten Tatort geschleppt.«
»Wenigstens waren wir mit dem Essen fertig«, brummte Körber, dessen Aufmerksamkeit schon dem grauen Mazda-6-Kombi älteren Baujahrs galt, der mit geöffneter Heckklappe in einer der Parkbuchten stand. Auf den Fahrzeugtüren prangte groß Werbung für eine Autowerkstatt aus der Region. Die Kofferraumabdeckung, die bisher vermutlich den Blick auf die Tote verborgen hatte, war zurückgeschoben.
Ede Bienwald hob galant das Absperrband an, um uns durchzulassen. Im gleichen Moment kam der weiße Transporter des Erkennungsdienstes die nächstgelegene Rampe heruntergefahren.
»Wie hat man die Tote denn entdeckt?«, fragte Jyoti. »Der Kofferraum war ja vermutlich geschlossen?«
»Der junge Mann dort drüben«, antwortete Ede und zeigte auf einen schlanken Mann Mitte dreißig, der mit angezogenen Knien auf dem feuchten Betonboden saß, den Rücken an einen der Betonpfeiler gelehnt. Körbers jüngerer Bruder Lukas, der in Uniform seinen Dienst versah, hockte neben ihm und schien beruhigend auf ihn einzureden.
»Er kam mit seinem Jack-Russell-Terrier von einer Reise zurück«, fuhr Ede fort, »und wollte schon in sein Auto steigen.« Er zeigte auf einen blauen Opel Corsa, der nicht weit vom Leichenfundort entfernt stand. »Aber der Hund war sehr unruhig und zog die ganze Zeit zu dem Mazda hin. Als der Mann dann nachgab, hat der Hund wohl verrücktgespielt. Der hat die Leiche natürlich gerochen.«
»Und wo ist der Hund jetzt?«, fragte ich.
»Den haben wir erst mal in den Corsa gesetzt. Der war kaum noch zu bändigen, als die Kofferraumklappe einmal auf war.«
»Der Typ hat aber den Mazda nicht eigenmächtig aufgemacht, oder?«, fragte ich.
»Nein, nein«, erwiderte Ede. »Er hat das Parkhauspersonal informiert, und die haben sofort die Leitstelle angerufen. Für einen Menschen war zwar noch nichts zu riechen, aber das Verhalten des Hundes war Grund genug, um den Wagen aufzubrechen.«
Inzwischen waren wir bei dem großen Kombi angekommen, und Ede knipste die starke Taschenlampe an, die er in der Hand hielt.
Die Tote lag in einer sehr merkwürdigen Körperhaltung, irgendwie verdreht, nicht ganz auf der Seite, aber auch nicht ganz auf dem Bauch, das Gesicht von uns abgewendet. Die Knie waren angewinkelt, der obere Arm ausgestreckt, der Arm unter dem Körper so seltsam verrenkt, dass man bei einer lebendigen Person ganz schöne Schmerzen hätte befürchten müssen.
»Gar nicht so einfach, siebzig bis achtzig Kilo totes Gewicht in ein Auto zu bugsieren«, sagte Jyoti trocken. Die Tote war schlank, aber selbst in liegender Position konnte man sehen, dass sie ungefähr einen Meter achtzig groß war.
»Meinst du, dass sie deshalb so komisch daliegt?«, fragte ich.
»Gut möglich. Oder man war sehr in Eile. Hier kann ja jeden Moment jemand reinkommen oder vorbeifahren.«
»Sieht fast so aus, als wäre sie vor oder nach einer Kurzreise hier gewesen.« Ede zeigte auf die kleine Übernachtungstasche, die neben Warndreieck und Erste-Hilfe-Kasten das Einzige war, was außer der Toten noch in dem geräumigen Kofferraum lag.
»Guten Abend, die Herrschaften«, erklang hinter uns die Stimme von Ritchie Nowarra, dem Leiter des Erkennungsdienstes bei der Aachener Kripo. »Ihr hattet ja sicher nicht vor, ohne Schutzkleidung näher heranzugehen, hm?«
»Das würden wir doch nie wagen«, grinste ich. »Wir sind ja nicht lebensmüde.«
»Ich zieh mich schnell um«, sagte Jyoti, bevor sie eilig in Richtung des ED-Transporters verschwand.
»Wie wär’s schon mal mit ein paar Fotos von der Vorderseite?«, bot Ritchie an und hob die Hand mit der digitalen Spiegelreflexkamera, ohne die er an keinem Tatort auftauchte.
»Schon wieder beim Mitdenken erwischt worden, der Herr Nowarra«, brummte Körber.
»So kennt ihr mich, so liebt ihr mich. Das haben wir gleich.« Ritchie, der bereits das volle Ganzkörperkondom angelegt hatte, zog sich noch die Schutzmaske vors Gesicht und öffnete die linke hintere Fahrzeugtür. Zunächst machte er Bilder von der Rückbank, um deren Originalzustand zu dokumentieren, falls sie später umgeklappt werden musste. Dann kniete er sich auf den Sitz und schoss eine schnelle Fotoserie der Toten von vorne. »Hier unten gibt es keinen Empfang«, sagte er nach einem kurzen Blick auf die Anzeige der Kamera. »Ihr müsstet also erst mal mit dem Kamerabildschirm vorliebnehmen. Schicken kann ich sie euch, sobald wir hier raus sind.«
»Frau Chandra«, sagte Ede zu Jyoti, die gerade im Schutzanzug zurückkam, »Sie am besten zuerst.«
Jyoti nahm die Kamera in Empfang, warf einen kurzen Blick auf den kleinen Bildschirm und gab Ritchie den Fotoapparat zurück. »Das hat keinen Sinn. Viel zu klein. Das muss ich mir direkt angucken.« Sie fasste ihre langen, tiefschwarzen Haare hinter dem Kopf zusammen, rollte sie in einen straffen Knoten und zog die Kapuze des Schutzanzugs drüber. Dann zog sie Einmalhandschuhe und eine Gesichtsmaske an.
Nachdem Ritchie aus mehreren Perspektiven weitere Bilder gemacht hatte, klappten er und Jyoti gemeinsam beide Teile der breiten Rückbank nach vorne um. Dann kniete Jyoti sich vorsichtig darauf und begutachtete Gesicht und Oberkörper der Toten. Ritchie wachte von der anderen Seite mit Argusaugen darüber, dass jedes noch so kleine Detail fotografiert wurde, bevor man es veränderte. Ede leuchtete von der Seite mit der Taschenlampe durchs Fenster, damit Jyoti so viel Licht hatte wie möglich.
»Das Gesicht hat eine rötlich violette Farbe«, berichtete Jyoti. »Punktförmige Einblutungen mindestens in der Gesichtshaut und in den Augenlidern. Ich vermute, auch in der Mundschleimhaut, aber das kann ich nicht gut genug sehen. Blutaustritt aus beiden Nasenlöchern und mindestens einem Gehörgang«, ergänzte sie, nachdem sie die Haare über dem nach oben liegenden Ohr kurz angehoben hatte. »Tiefe Einschnürungen in der Haut des vorderen und seitlichen Halsbereichs mit schmalen Schürfungen.« Sie nickte Ritchie zu. »Ich denke, ich habe für den Moment erst mal genug gesehen.« Sie betastete noch kurz den Arm der Toten und legte eine Hand auf die frei liegende Haut des Handgelenks. Dann robbte sie vorsichtig zurück und rutschte ins Freie. Als sie bei Körber und mir ankam, zog sie sich die Maske vom Gesicht und die Kapuze vom Kopf. Hinter uns wartete schon das restliche ED-Team mit Scheinwerfern und Ausrüstung.
»Ich schätze die Frau auf Mitte bis Ende vierzig. Sehr gepflegtes Äußeres, kein Make-up. Ohne Obduktion, ihr wisst schon, keine Gewissheit. Aber ich bin sicher, dass sie erdrosselt wurde, und zwar von hinten. Das Drosselwerkzeug hat der Täter vermutlich mitgenommen – jedenfalls habe ich nichts gesehen, was infrage käme. Alles andere als Draht würde mich überraschen.«
»Was für ein Draht?«, fragte ich, ohne wirklich mit einer Antwort zu rechnen.
»Klaviersaitendraht«, sagte Jyoti wie aus der Pistole geschossen.
»Klavierdraht?«, staunte ich, vor allem, weil Rechtsmediziner sich vor der Leichenöffnung sonst immer möglichst bedeckt hielten.
Jyoti zuckte mit den Schultern. »Das würde ich verwenden, wenn ich jemanden erdrosseln wollte, ohne dass mir der Draht mittendrin reißt.«
»Manchmal machst du mir Angst, Jyoti«, brummte Körber amüsiert.
»Am besten warnen wir Eric, dass er das Weite suchen soll, sobald Jyoti sich ein Klavier zulegt«, grinste ich. Jyoti war seit einiger Zeit mit meinem Kollegen Eric Lautenschläger liiert.
»Ein ganz schön wagemutiger Täter«, schaltete Ede sich ein, der wieder zu uns getreten war.
»Wie meinst du das?«, fragte ich.
»Korrigieren Sie mich, Frau Chandra, wenn ich etwas Falsches sage, aber soweit ich weiß, dauert es bei dieser Art von Tötung drei bis fünf Minuten, bevor der Tod eintritt. Und in dieser ganzen Zeit darf man den Draht auch nicht lockern.«
»Absolut richtig«, bestätigte Jyoti. »Der Täter hatte also bis zu fünf Minuten lang das Risiko, dass jemand vorbeikommt und ihn bei der Tat entdeckt.«
»Es sei denn, er hatte jemanden, der Schmiere stand«, knurrte Körber, und ich sah, dass er einen besorgten Blick mit Ede wechselte.
»Es muss jemand gewesen sein, der über die nötige Körperkraft verfügt«, sagte Jyoti. »Das Schwere ist nicht das initiale Anziehen des Drahtes um den Hals, sondern die Tatsache, dass dieser Zug über mehrere Minuten konsequent gehalten werden muss.«
»Und das wiederum setzt auch eine hohe psychische Stabilität in Stresssituationen voraus«, ergänzte Ede. »Um jemanden zu erdrosseln, muss man sehr nah an sein Opfer heran und erlebt den Todeskampf hautnah mit.«
»Was hoffentlich bedeutet, dass wir Abwehrverletzungen und DNA-Spuren am Täter nachweisen können?«, fragte ich.
»DNA-Spuren ja«, sagte Jyoti. »Aber DNA-Spuren alleine belegen ja nur einen Kontakt, und nicht, wie genau der Kontakt ausgesehen und in welchem Zusammenhang er stattgefunden hat. Und was die Abwehrverletzungen angeht, würde ich mir nicht allzu viele Hoffnungen machen.«
»Nicht?«, fragten Körber und ich im Chor.
»So wie die Einschnürung aussieht, hat der Täter sie von hinten überwältigt und erdrosselt. Die Frau hatte maximal zehn Sekunden Zeit, bevor sie das Bewusstsein verloren hat, wahrscheinlich weniger. Die typischen Griffe in einer solchen Situation wären nach den Händen des Täters und an den Draht, um sich diesen buchstäblich vom Hals zu schaffen. Vielleicht – und das ist ein ganz großes Vielleicht – hat sie es geschafft, ihn an den Handrücken zu kratzen. Das hängt aber davon ab, wie weit die Hände von ihrem Hals entfernt waren, sprich, wie lang der Draht war und wie gelenkig und entschlossen das Opfer. Aber ganz ehrlich – wenn ich wetten sollte, ob sie ihn verletzt haben kann, läge mein Einsatz bei null.«
»Wenn der Draht so tief in den Hals des Opfers einschneidet, dass die gesamte Blutzufuhr zum Kopf abgedrückt wird, müsste dann der Draht nicht auch in die Hände des Täters einschneiden?«
»Genau, dazu wollte ich gerade kommen. Wenn er – und ich behaupte jetzt einfach mal, das war höchstwahrscheinlich ein Mann – seine Hände nicht geschützt oder abgepolstert hat, hat der Draht auf jeden Fall in seine Hände eingeschnitten. Wenn er ihn sich womöglich sogar um die Hände gewickelt hat, damit er ihm nicht durch die eventuell schweißnassen Finger rutscht, wären die Einschnitte natürlich auch auf dem Handrücken zu sehen. Aber wenn er nicht am Anfang mit einem tierischen Ruck zugezogen hat, ist die Haut nicht gerissen, es wird also keine blutige Verletzung sein. Und deshalb auch nicht sehr lange sichtbar.«
»Na, Mahlzeit«, seufzte ich.
»Bisher keine Handtasche, Schlüssel, Portemonnaie oder Handy im Auto oder an der Person zu finden«, rief Ritchie, der mithilfe seiner Kollegin Jessica in der Zwischenzeit eine schnelle Suche nach irgendetwas durchgeführt hatte, mit dem wir die Tote hätten identifizieren können.
»Was wetten wir, dass der Täter die Wertsachen mitgenommen hat?«, spekulierte ich. »Du fährst ja vielleicht noch ohne Geld oder Handtasche ins Parkhaus – aber ohne Autoschlüssel? Selbst für die Schlüssellosen brauchst du doch einen Sender.«
Edes Miene war in den letzten Minuten immer besorgter geworden. Schließlich sagte er: »Nicht, dass ich gründlichen Ermittlungen vorgreifen möchte, aber meines Erachtens haben wir hier eine beunruhigende Konstellation an Faktoren.« Er zählte an den Fingern seiner rechten Hand ab: »Eins – hohe Risikobereitschaft des Täters und/oder ein Komplize; zwei – ausreichende Körperkraft, um eine solche Tat durchzuziehen; drei – genug Skrupellosigkeit und psychische Belastbarkeit für diese Art von Tat; vier – in unmittelbarer Nähe eines Bahnhofs; fünf – vermutlich ist eine Handtasche oder wenigstens ein Geldbeutel verschwunden.«
»Du meinst Heppner und Gruber«, fasste Körber zusammen. »Die beiden, die gestern Nachmittag aus der JVA entkommen sind.«
»Wie lange liegt sie denn schon hier? Wissen wir das?«, fragte ich.
»Das kann ich ohne Obduktion unmöglich sagen«, sagte Jyoti. »Aber die Totenstarre ist vollständig ausgeprägt, so viel ist sicher. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie sich schon löst. Ohne Thermometer kann ich die Körpertemperatur nicht zuverlässig bestimmen, aber subjektiv und durch den Handschuh gefühlt ist der Körper kalt, keinerlei Restwärme. Bei den niedrigen Außentemperaturen schreitet das Abkühlen aber natürlich schneller voran als bei Zimmertemperatur. Ich denke, sie ist zwischen zehn und vierzig Stunden tot. Wenn ich wetten müsste, setzte ich mein Geld auf zwölf bis sechsunddreißig Stunden. Nicht sehr hilfreich«, entschuldigte sie sich.
»Aber sehr viel mehr als gar nichts«, sagte Ede dankbar.
»Wann der Wagen ins Parkhaus gefahren ist, wird uns das Personal ja sagen können«, brummelte Körber.
»Und anhand der Videos kann man sicher auch feststellen, wer am Steuer gesessen hat«, nickte Ede.
»Du meinst, dass sie schon tot hierhergebracht wurde?«
»Kann doch sein? Sie brauchten ein Auto, haben die Frau umgebracht und das Auto mit ihrer Leiche hier abgestellt. Dann sind sie mit dem Zug weitergereist.«
»Wäre es nicht viel einfacher für sie gewesen, wenn sie einfach mit dem Auto da hingefahren wären, wo sie hinwollen, statt erst umständlich den Wagen samt Leiche hier abzustellen und mit der unpünktlichen Bahn zu fahren?«, fragte ich skeptisch.
»Das stimmt allerdings auch wieder«, räumte Ede ein. »Es war auch nur eine Idee. Wir dürfen sowieso nicht den Fehler machen, uns sofort auf eine These einzuschießen. Aber ich werde nicht der Einzige sein, der auf diese Erklärungsmöglichkeit kommt.«
»Allen voran die Presse«, sagte Körber düster, »die sowieso schon schlecht auf uns zu sprechen ist.«
* * *
21:45 Uhr
Trotz der fehlenden Papiere war es unerwartet einfach, die Tote zu identifizieren. Die große Werbung auf den Türen des Mazda führte uns auf die Webseite der Autowerkstätten Jaschke GmbH. Und dort stellte man freundlicherweise die Teams der einzelnen Werkstätten mit Namen und Foto vor – ebenso wie die Inhaberin und Geschäftsführerin: Susanne Jaschke, siebenundvierzig Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern.
Während Ede sich aufmachte, um mit dem Sicherheitspersonal des Parkhauses zu sprechen, entschied Jyoti kurzerhand, gleich beim Bestatter mitzufahren, der die sterblichen Überreste der Ermordeten nach Köln in die Rechtsmedizin brachte. Körber und ich hatten das kurze Streichholz gezogen: Wir mussten der Familie der Toten schonend beibringen, dass Susanne Jaschke nie wieder nach Hause kommen würde.
Schweigend stiegen wir in den schwarzen BMW aus dem Polizeifuhrpark, und noch bevor wir auf die Lagerhausstraße abbogen, hatte Körber das Fenster heruntergelassen und sich eine Kippe angezündet. Es gab niemanden, der Todesnachrichten gerne überbrachte. Für Körber war es jedoch besonders schwer, weil jedes Mal eine ähnliche Szene aus seiner Kindheit wieder hochkam. Sein Vater, Schutzmann mit Leib und Seele, war bei dem Versuch, einen Streit zu schlichten, ins Kreuzfeuer geraten und hatte die Schussverletzungen nicht überlebt. Körber war damals elf Jahre alt gewesen.
Schweigend bogen wir an der Normaluhr nach links ab und rollten die Wilhelmstraße hinunter, über den Kaiserplatz und den sanften Anstieg der Heinrichsallee hoch. Am Hansemannplatz mussten wir an einer roten Ampel warten, bevor wir auf der Monheimsallee am Spielcasino und dem Quellenhof vorbeifahren konnten.
Am Ponttor bogen wir nach rechts in die Roermonder Straße ein, schlugen vor Beginn der Schnellstraße den Weg rechts über die Brücke ein und schlängelten uns anschließend durch Laurensberg.
»Ach, hier geht’s doch zum Rugby-Club«, sagte ich, als wir nach links abbogen und die Rathausstraße hochfuhren. »Wir haben länger kein Spiel geguckt.«
»Wen wundert’s, bei dem Wetter«, erwiderte Körber mürrisch, während er das Fenster wieder schloss, weil es hereinregnete. »Ah, das ist die richtige Straße.« Er blinkte und bog nach links in die Brunnenstraße ab, kurz darauf ging es rechts und dann erneut rechts in eine kleine Stichstraße.
Körber fuhr zügig bis zum Ende der Sackgasse, an dem sich zwei eingezäunte große Grundstücke quasi gegenüberstanden. Die Häuser waren – soweit man das bei Dunkelheit und miesem Wetter beurteilen konnte – beinahe identisch. »Das hier muss es sein.« Ich zeigte auf das rechte der beiden Anwesen.
Körber parkte kurzerhand vor der Einfahrt und schlug beim Aussteigen den Kragen seiner Jacke hoch. Ich war froh um meine Kapuze und darüber, dass ich vor der Abfahrt zu Pe und Gregor noch ordentliche Klamotten angezogen hatte. Nicht, dass es etwas änderte, aber man wollte eine Todesnachricht auch nicht in löchrigen Jeans mit Pfotenabdrücken überbringen.
Auf unser Klingeln meldete sich eine höchst besorgte Männerstimme: »Susanne?«
»Nein, leider nicht«, sagte Körber im freundlichsten Tonfall, den er zu bieten hatte. »Körber, Kriminalpolizei. Dürfen wir kurz reinkommen?«
Statt einer Antwort summte der Türöffner, und als wir das schmiedeeiserne Gittertor wieder hinter uns schlossen, sahen wir schon, dass sich die Haustür am oberen Ende einer kurzen Treppe geöffnet hatte.
Ich drückte kurz Körbers Hand, bevor wir hintereinander die Treppe hochgingen. An der Haustür erwartete uns ein etwa fünfzigjähriger Mann, der sichtlich mit den Tränen kämpfte.
»Wolfgang Jaschke?«, fragte Körber.
»Ja«, sagte der heiser und räusperte sich energisch, sicher, um die aufsteigenden Tränen in Schach zu halten. Wenn die Kripo abends um zehn vor der Tür stand, waren die Nachrichten selten gut.
Körber holte seinen Dienstausweis aus der Tasche und hielt ihn Wolfgang Jaschke hin. »Mein Name ist Matthias Körber, das hier ist Frau Sander. Wir …«
»Es ist etwas mit Susanne, nicht wahr? Hatte sie einen Unfall?«
»Wenn es geht, würden wir gerne drinnen mit Ihnen sprechen«, erwiderte Körber sanft.
»Oh Gott, sie ist tot, nicht? Ich … Die Kinder …«
Wolfgang Jaschke war leichenblass geworden und sah so aus, als würde er jede Sekunde umkippen. Körber trat über die Türschwelle und nahm Jaschke stützend am Arm. »Wir können sicher irgendwo in Ruhe sprechen?«
»Ja, natürlich«, brachte Jaschke gerade noch heraus, bevor er in lautes Schluchzen ausbrach.
Körber, der noch nie gut mit anderer Leute Gefühlsausbrüchen hatte umgehen können, warf mir einen Hilfe suchenden Blick zu, und ich machte eine Kopfbewegung in Richtung einer offen stehenden Tür gerade vor uns. Nach dem zu urteilen, was wir sehen konnten, befand sich dort die Küche.
»Kommen Sie«, sagte Körber ungewohnt sanft und schob den weinenden Jaschke vorsichtig, aber bestimmt durch den Flur. Ich schloss die Haustür und folgte den beiden.
Der Eingangsbereich des Hauses war hell und einladend gestaltet, viel Holz, viel Weiß, klassischer Landhausstil. Man sah sofort, dass hier eine Familie wohnte. Die Garderobe quoll über vor Jacken, Mützen und Schals. Auf einem offenen Schuhregal tummelten sich wild durcheinander Schuhe, Sneakers und Stiefel unterschiedlicher Größen. An den weiß gestrichenen Wänden hingen auf der einen Seite gerahmte Schnappschüsse der Jaschkes und – wie ich annahm – ihrer beiden Kinder. Auf manchen der Fotos waren auch zwei Katzen mit von der Partie.
In der geräumigen und sehr gemütlichen Küche schob Körber Wolfgang Jaschke sanft auf einen der Küchenstühle.
»Möchten Sie etwas trinken, ein Glas Wasser vielleicht?«, fragte ich.
»Ich möchte wissen, was mit meiner Frau ist«, gab Jaschke schluchzend zurück.
»Die Kinder?«, fragte ich.
»Sind noch nicht zurück. Judowettkampf, Vollsperrung der Autobahn auf dem Rückweg«, fügte er hinzu und schnäuzte sich. »Normalerweise wäre ich dabei gewesen, aber man hat vergangene Woche mehrere kleine Löcher in meiner Netzhaut entdeckt, die mehrfach nachgelasert werden mussten. Mein Arzt hat mir empfohlen, erst mal vorsichtig zu sein, keine hektischen Bewegungen, schweres Heben et cetera. Mein Sohn kümmert sich heute mit um meine Gruppe.« Sein Wortschwall brach plötzlich ab.
Von der Küchentür her erklang ein energisches »Miau«. Eine kräftige schwarze Katze mit weißer Brust und drei weißen Pfötchen kam hereinstolziert und sprang mühelos auf den Schoß von Wolfgang Jaschke, um uns von dort misstrauisch zu beäugen.
»Ach Mieke …« Jaschke streichelte der Katze liebevoll über den Kopf, was die mit einem sanften Schnurren quittierte. »Du willst auch wissen, was mit der Mama ist, nicht?«
Körber räusperte sich. »Herr Jaschke, es tut uns wirklich sehr leid, aber wir müssen Ihnen mitteilen, dass Ihre Frau, Susanne Jaschke, heute Abend tot aufgefunden wurde.«
Jaschke sank richtiggehend in sich zusammen, bis seine Stirn auf dem Köpfchen der Katze zu ruhen schien. Die schnurrte etwas lauter und begann, Jaschke fürsorglich über die Haare zu lecken.
Schließlich hob Jaschke den Kopf wieder, und unter Tränen fragte er: »Wo haben Sie sie denn gefunden, und wie ist sie überhaupt ums Leben gekommen? Sie war doch kerngesund. War es ein Unfall? Ich habe ihr immer gesagt, sie soll nicht so schnell fahren. Oder ist sie plötzlich zusammengebrochen? Herzversagen? So was liest man ja immer wieder. Ich …«
Hilflos brach er ab.
Körber atmete tief durch, bevor er sagte: »Es gibt leider keinen schönen Weg, es zu sagen, Herr Jaschke. Ihre Frau ist nach allem, was wir bisher wissen, Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie wurde heute Abend gegen Viertel nach sieben im Parkhaus am Hauptbahnhof gefunden.« Trotz unseres ehrlichen Mitgefühls für diesen Mann beobachteten wir beide wie Luchse seine Reaktionen. Rein statistisch gesehen war der Täter einfach zu oft der Partner oder der Ex-Partner.
Jaschke wirkte zunächst wie betäubt. Dann fragte er: »Ist sie überfallen worden? Ausgeraubt? Wie oft hab ich ihr gesagt, sie soll nicht in dem dusteren Ding parken, wenn sie nach Köln fährt. Sie hätte sich doch ein Taxi zum Bahnhof nehmen können, es ist ja nicht so, als hätte sie sich das nicht leisten können.«
»Wir wissen noch nicht im Detail, was passiert ist«, sagte Körber. »Ihre Frau wurde im Kofferraum ihres Wagens gefunden. Dort fand sich eine Übernachtungstasche, jedoch keine Handtasche – auch kein Portemonnaie, Handy oder Schlüssel.«
»Also doch ein Raubüberfall«, schluchzte Jaschke. »Warum tun Menschen so etwas? Für ein paar Kröten einen anderen Menschen töten.« Er drückte die Katze so fest an sich, dass die hastig begann, sich aus der Umklammerung zu winden. Sie landete elegant auf dem Boden und suchte schleunigst das Weite.
»Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen«, entgegnete Körber. »Habe ich Sie richtig verstanden, dass Ihre Frau nach Köln fahren wollte?«
»Ja, ganz recht«, nickte Jaschke. »Das hat sie einmal im Monat gemacht, immer am zweiten Freitag des Monats.«
»Ist sie immer mit dem Zug gefahren?«
»Mh-hm. Mit dem Regionalexpress gegen zehn vor sieben.«
»Und sie hat immer im Parkhaus am Hauptbahnhof geparkt?«
»Ja, genau. Soweit ich weiß, immer auf der gleichen Ebene und, wenn möglich, auch auf dem gleichen Platz. Sie hat oft gescherzt, dass man sie so gut finden kann, wenn jemand sie sucht.« Als ihm bewusst wurde, was er da gerade gesagt hatte, brach er erneut in Tränen aus.
Wenn der Mörder sie kannte, musste er nur im Parkhaus auf sie warten.
Körber entschuldigte sich und verließ kurz den Raum. Ich wäre jede Wette eingegangen, dass er Ede die Abfahrtzeit des Zuges durchgab, den Susanne Jaschke normalerweise nahm. Ich sah mich unterdessen unauffällig um, bis ich hinter der Glastür eines Hängeschranks eine Flasche Sherry entdeckte. Kurz entschlossen stand ich auf, holte die Flasche und ein Glas und schenkte Jaschke großzügig ein. Er leerte das Glas auf einen Zug und schüttete sich sofort nach.
Körber kam zurück, setzte sich wieder und fragte: »Welche Ebene und welchen Platz hat sie denn bevorzugt?«
»Das weiß ich nicht.«
Das würde ich an deiner Stelle auch sagen.
»Der Tasche im Auto nach zu urteilen wollte sie auch über Nacht bleiben?«, fragte ich.
»Richtig. Sie war samstags meist gegen Mittag zurück, spätestens am Nachmittag. Die Kinder haben ja am Wochenende oft Wettkämpfe oder Training, da wollte sie …« Er winkte ab und leerte das zweite Glas Sherry.
»Und was war das, wo sie in Köln hingefahren ist?«, fragte ich, während Jaschke sich erneut einschenkte.
»Sie hatte da so eine Arbeitsgruppe, wie hat sie das doch gleich genannt? … Richtig, ›Kompetenzzirkel‹.« Er malte Anführungsstriche in die Luft. »Sie hat sich da mit anderen Unternehmern aus der Autobranche getroffen, da ist ja viel im Umbruch momentan.«
»Ihrer Frau gehörten mehrere Autowerkstätten, nicht?«
»Ja, genau. Sie hat von ihrem Vater zwei Werkstätten übernommen und mit den Jahren immer weiter expandiert. Inzwischen sind es sieben in der ganzen Städteregion.«
»Und Autowerkstätten reden in der Automobilbranche mit?«, fragte ich erstaunt.
»Nicht wirklich – und genau das ist nach Susannes Auffassung das Problem. ›Wir müssen den Mist, den die bauen, immer ausbaden‹, hat sie mal gesagt. Sie wollte wenigstens versuchen, das zu ändern.«
Für mich hörte sich das ein bisschen konstruiert an, und ich fragte mich, ob Susanne Jaschke nicht vielleicht einen ganz anderen Grund gehabt hatte, jeden Monat nach Köln zu fahren. Und warum übernachten, wenn bis spät in der Nacht noch Züge fuhren?
»Arbeiten Sie auch im Familienunternehmen?«, fragte Körber, dem mit Sicherheit ähnliche Gedanken durch den Kopf gingen.
»Nein, ich bin bei einem Gebäudereinigungsunternehmen beschäftigt. Mädchen für alles in der Verwaltung – Einsatzplanung, Ansprechpartner für die Kunden, Rechnungen schreiben und so was. Halbtags.«
»Ach so?«, sagte Körber möglichst neutral.
»Einer muss sich ja um die Kinder kümmern; also was heißt müssen – einer darf sich um die Kinder kümmern. Und das bin in unserem Fall ich.« Diesmal nippte er nur am Sherry. »Meine Frau ist … war eine bessere Unternehmensleitung, als ich es je hätte sein können.«
»Sie hatten also beruflich keine Berührungspunkte?«, vergewisserte Körber sich.
»Außer dass das Unternehmen, für das ich arbeite, in den Werkstätten meiner Frau die Unterhaltsreinigung macht, nicht, nein.«
Das heißt, sie konnte dir bezüglich ihrer Ausflüge nach Köln erzählen, was sie wollte.
Jaschke sah auf die Uhr.
»Haben Sie noch etwas vor?«, fragte Körber freundlich.
»Nein, nein, ich frage mich nur, wo die Kinder bleiben. Das muss ja ein Riesenunfall gewesen sein, wenn die Autobahn so lange gesperrt bleibt. Langsam wird es doch sehr spät. Leonie ist erst elf.«
»Ich muss da doch noch mal ganz blöd nachfragen«, stellte ich mich dumm. »Ist das nicht eine ungewöhnliche Konstellation? Ihre Frau betreibt ein offensichtlich florierendes Unternehmen, und Sie arbeiten in einer anderen Firma? Verwaltungsarbeit gibt es doch bei sieben Autowerkstätten auch sicher reichlich?«
Wolfgang Jaschke seufzte, so als hätte er diese Frage bereits tausendmal beantwortet. »Meine Frau ist … war so erfolgreich, dass ich eigentlich gar nicht arbeiten müsste. Aber davon einmal ganz abgesehen – ich denke, es tut keinem Familienleben gut, wenn die Eltern die Arbeit zu Hause nahtlos weiter diskutieren, oder einem Unternehmen, wenn womöglich private Krisen mit zur Arbeit geschleppt werden.«
»Gab es denn Krisen?«, hakte Körber blitzschnell ein.
»Was? Nein. Also, doch, natürlich gab es auch mal Streit. Ich meinte das eher allgemein. Außerdem …«
»Außerdem?«, stupste ich ihn an, als er zunächst nicht weitersprach.
»Ich wollte finanziell auch nicht völlig abhängig von meiner Frau sein. Man weiß ja nie.«
»Man weiß ja nie was?«, fragte ich freundlich.
»Was weiß ich – man zerstreitet sich, dem Partner passiert etwas …«
Statt erneut in Tränen auszubrechen, leerte er kurzerhand wieder das Sherryglas und stellte mit offensichtlichem Bedauern fest, dass die Flasche leer war.
Ist auch besser, sonst bist du gleich voll wie eine Haubitze.
»Hatten Sie denn Grund zu der Annahme, Ihrer Frau könnte etwas passieren?«, fragte Körber.
»Nein, nein, ich sagte doch, das war nur allgemein.«
»Wurde Ihre Frau bedroht?«
»Nicht, dass ich wüsste. Das hätte sie mir bestimmt erzählt.«
»Sie hatten also ein gutes Verhältnis?«
»Ja, ausgezeichnet sogar. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander.«
Wenn du wüsstest, wie oft wir das schon gehört haben.
»Über ihre berufliche Tätigkeit waren Sie also auch voll im Bilde?«
»Na ja, voll im Bilde würde ich nicht sagen. Sie hat schon ab und an mal was erzählt, aber eigentlich haben wir versucht, berufliche Angelegenheiten aus unserem Zuhause herauszuhalten. Man hat als Familie schon wenig genug Zeit füreinander.«
»Wissen Sie denn, ob es in letzter Zeit im beruflichen Bereich Probleme gab? Auseinandersetzungen irgendwelcher Art?«
Jaschke schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht. Allerdings …« Er stockte.
»Allerdings?«
»Susanne hat in den letzten Monaten noch mehr gearbeitet als sonst. Viel mehr. Vor acht Uhr abends war sie eigentlich nie zu Hause, aber seit letztem Sommer wurde es immer später. Zuletzt war es unter der Woche oft elf oder halb zwölf, wenn sie nach Hause kam. Früher war samstags immer mittags Schluss und der Sonntag tabu. Aber zuletzt wurde auch das immer mehr.«
Soso, ich muss heute länger arbeiten, Schatz …
»Also doch kein florierendes Unternehmen?« Körbers Gedanken gingen anscheinend in eine andere Richtung als meine.
»Nein, nein, das Gesamtunternehmen steht sehr gut da. Auch jede einzelne der Werkstätten wirft einen Gewinn ab«, wandte Jaschke ein.
»Also hatte es einen anderen Grund, dass Ihre Frau in letzter Zeit so viel gearbeitet hat«, stellte Körber fest.
»Ich nehme es an.«
»Sie haben nicht gefragt?« Körber klang ehrlich verblüfft.
»Na ja, doch, nach einer Weile schon. Aber sie hat nur gesagt, die Personalsituation sei so angespannt, weil man so schwer Leute bekommt, und dass sie letzten Sommer die Fuhrparks von zwei großen Firmen in Aachen an Land gezogen hat – also, die Reparaturen natürlich.«
»Und da musste sie mit anpacken?«
»Gekonnt hätte sie das schon«, sagte Jaschke stolz. »Susanne hat ihren Kfz-Meister ja nicht nur an der Wand hängen gehabt. Die fand sich auch noch in jedem Motorraum zurecht. Dafür hat sie viel zu gerne selbst an Autos herumgeschraubt.« Jetzt klang er wehmütig. »Den jungen Hüpfern hat sie locker noch was vorgemacht. Aber das war zu ihrem Bedauern eher die Ausnahme. Zu viel Arbeit als Chefin.«
So richtig zufriedenstellend waren die Antworten nicht, aber entweder wusste Jaschke nicht mehr oder er wollte nicht mehr sagen.
Mein Handy vibrierte in meiner Hosentasche, aber ich ignorierte es, denn ich ahnte, welche Frage Körber gleich stellen würde. Mir war nämlich das Gleiche aufgefallen.
»Wo waren Sie denn eigentlich zwischen gestern Abend achtzehn Uhr und heute Mittag?«, fragte Körber so beiläufig, dass Jaschke ein paar Sekunden brauchte, um zu begreifen, was Körber gerade auf den Tisch gelegt hatte.
Empört sprang Jaschke auf. »Sie wollen mir den Mord an meiner Frau in die Schuhe schieben?«
»Sie haben bisher noch nicht gefragt, wie Ihre Frau ermordet wurde«, antwortete Körber seelenruhig. »Vielleicht wissen Sie es ja schon.«
»Nein, weiß ich nicht!«, rief Jaschke hitzig. In diesem Moment drehte sich ein Schlüssel im Schloss, und die Haustür ging auf.
»Papa, Papa!«, rief eine aufgeregte Mädchenstimme.
»Hier in der Küche, Leonie!«
»Ich hab gewonnen, Papa«, rief das hübsche elfjährige Mädchen mit den langen dunkelblonden Haaren, das wie angewurzelt stehen blieb, als es uns entdeckte. Es war seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. »Wer sind denn die Leute?«
Wir hörten, wie die Haustür zuschlug, Taschen auf den Boden geworfen wurden und lange Schritte sich näherten. Dann tauchte der Junge von den Fotos hinter seiner Schwester auf und legte ihr beschützend die Hände auf die Schultern. Auch der groß gewachsene Teenager konnte seinen Vater beim besten Willen nicht verleugnen.
»Setzt euch her, Kinder«, umschiffte Jaschke die Frage noch kurzzeitig und klopfte auf den Stuhl neben sich. Während Leonie uns mit unverhohlener Neugier betrachtete, hatte sich auf der Stirn des gut aussehenden Jungen eine steile Sorgenfalte gebildet. »Wo ist denn Mama?«, fragte er.
»Ist sie etwa schon ins Bett gegangen? Wollte sie nicht hören, wie es heute war?« Die Enttäuschung war Leonie deutlich anzuhören. »Ich hab doch Lisa Müller besiegt!«
»Da würde sie sich sicher riesig freuen, wenn sie das wüsste, mein Schätzchen«, sagte Jaschke erstickt und legte ihr den Arm um die schmalen Schultern.
»Würde?«, fragte der Teenager. »Wüsste?« Er klang in höchstem Maße besorgt.
Jaschke zog seine Tochter auf seinen Schoß. »Setz dich bitte zu mir, Julius. Ich muss euch etwas sagen.«
»Was denn sagen?« Plötzlich klang Julius sehr viel jünger, als er war.
»Eure Mutter«, setzte Jaschke an. »Die Mama …« Wieder brach er ab.
Körber räusperte sich und sah die Kinder nacheinander an. »Leonie, Julius, mein Name ist Matthias Körber, ich bin von der Kriminalpolizei. Wir haben leider sehr traurige Nachrichten für euch. Vielleicht setzt du dich wirklich besser hin, Junge.«
Wie ein Zombie schlurfte der athletisch wirkende Teenie zum Tisch und ließ sich kraftlos auf den Stuhl neben seinem Vater fallen.
Ich merkte, wie Körber stockte. Einem erwachsenen Mann eine solche Botschaft zu überbringen, war das eine. Aber einer Elfjährigen, die nichts dringender wollte, als ihrer Mutter von ihrem Judoerfolg zu erzählen, war ein ganz anderes Kaliber. »Es tut mir unendlich leid, aber eure Mama ist verstorben.«
Zwei ungläubige Augenpaare starrten uns an. Schließlich platzte Julius heraus: »Wie? Verstorben? War sie krank? Papa, sie hatte doch nichts?« Die Stimme, mit der er seinen Vater ansprach, stand kurz davor, ins Hysterische zu kippen.
Mit einem beschwörenden Unterton und einem bedeutungsvollen Seitenblick auf Leonie sagte Körber: »Die Umstände ihres Todes sind noch nicht ganz geklärt …«
»Was reden Sie denn da?«, schrie Julius. »Was denn für Umstände?«
»Julius«, versuchte Wolfgang Jaschke seinen Sohn zu beschwichtigen. »Das besprechen wir vielleicht besser später, wenn …«
»Leonie und ich haben ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist!«
Ich legte Körber die Hand auf den Arm. »Natürlich habt ihr das.« Ich sah beide Kinder abwechselnd an. »Aber die Umstände ihres Todes sind nicht schön, und …«
In dem Moment klingelte es an der Tür.
»Erwarten Sie noch jemanden?«, fragte ich. Jaschke schüttelte den Kopf und wollte aufstehen. Ich winkte ihm, sitzen zu bleiben, und ging zur Haustür.
Hoffentlich sind das noch keine sensationsgierigen Presseleute.
Als ich die Tür vorsichtig einen Spalt öffnete und meine Nase durchsteckte, strahlte mich eine eher kleine Frau in Susanne Jaschkes Alter an. »Hallo, Britta.«
»Äh.« Frollein, isch kenn Sie, aber isch komm nisch auf Sie.
»Notfallseelsorge. Dorothee Kuhn.« Sie streckte mir ihre kleine Hand hin, und als ich sie schüttelte, musste ich mich wirklich zusammenreißen, um nicht laut zu quieken. Dorothee hatte einen Händedruck wie ein Schraubstock.
»Natürlich. Dorothee, sorry, ich hatte gerade einen auf der Leitung stehen«, sagte ich entschuldigend. »Dich schickt der Himmel.«
»Nicht ganz«, schmunzelte sie. »Eher das Präsidium.«
»Auch gut, Hauptsache, du bist hier«, lächelte ich zurück und winkte sie herein. Dann schloss ich die Tür hinter ihr und wisperte: »Bist du informiert? Weißt du, was passiert ist?«
»Ja, ich weiß Bescheid«, nickte sie und flüsterte: »Seid ihr mit der Befragung des Ehemanns fertig?«
Ich schüttelte den Kopf. »Die Kinder sind gerade von einer Sportveranstaltung zurückgekommen und haben erst vor einer Minute erfahren, was passiert ist.«
»In Ordnung, dann nehme ich mich der Kinder an, bis ihr mit dem Ehemann gesprochen habt. Gibt es irgendeinen Bereich des Hauses, wo wir nicht hindürfen, oder etwas, das nicht berührt werden darf?«
Das war definitiv nicht das erste Gewaltverbrechen, mit dem sie zu tun hatte.
»Wir gehen momentan davon aus, dass die Tat auch im Parkhaus begangen wurde, insofern gibt es wahrscheinlich erst einmal keine offensichtlich kritischen Orte im Haus. Wenn wir mit dem Vater gesprochen haben, wissen wir vielleicht mehr.«
»Ist gut.« Sie atmete durch, so als ob sie Raum schaffen müsste für das, was jetzt auf sie zukam. Mir schoss durch den Kopf, dass sie vielleicht bis eben noch bei dem Unfall gewesen war, dessen Aufräumarbeiten die Autobahn so lange blockiert hatten. Ich hatte die größte Hochachtung vor Menschen wie Dorothee Kuhn, die andere stützten, denen schreckliches Leid widerfahren war. Und ich fragte mich immer wieder, wie man diese Arbeit Tag für Tag tun und dabei so fröhlich bleiben konnte wie Dorothee. Ich nahm mir vor, sie bei unserer nächsten Begegnung einfach mal zu fragen. Jetzt jedoch hatten erst einmal Leonie und Julius Jaschke Vorrang.
Wieder vibrierte mein Handy. Wahrscheinlich würde es noch ein paar Minuten dauern, bis wir wieder unter sechs Augen mit Wolfgang Jaschke sprechen konnten, also zog ich das Smartphone aus der Hosentasche und sah auf den Bildschirm. Eine Nachricht von Ede: Susanne Jaschke ist um 18:38 Uhr ins Parkhaus gefahren. Sie saß selbst am Steuer.
Ich wollte gerade antworten, als das Handy wieder vibrierte, diesmal wegen eines Anrufs des Gilde-Mitglieds Viktor Corsten.
Ich schlüpfte durch die Haustür, schob die Fußmatte zwischen Tür und Rahmen und ging die paar Stufen hinunter in den Vorgarten. »Sander«, meldete ich mich leise. Im Handumdrehen fing ich an zu frieren. Es war wirklich verdammt kalt, und meine Jacke hing in der Küche über der Stuhllehne.
»Gott sei Dank«, rief Corsten statt einer Begrüßung. »Ich dachte schon, Sie gehen nicht mehr dran.«
»Haben Sie die Präfektin gefunden?«
»Nein. Aber wenn ich recht informiert bin, die Polizei«, antwortete er traurig.
»Wie bitte?«
Noch bevor Corsten antworten konnte, fiel bei mir scheppernd der Groschen. Langsam drehte ich mich um und starrte entgeistert auf das große Haus, aus dessen Fenstern so heimelig das Licht nach draußen fiel. »Wie heißt denn die Präfektin im wirklichen Leben?«
»Jaschke«, antwortete Corsten. »Susanne Jaschke.«
* * *
Als ich wieder ins Haus kam, fand ich Körber und Wolfgang Jaschke in der Essecke, die durch einen offenen Durchgang direkt mit dem geräumigen Wohnzimmer verbunden war. Eine Hängelampe spendete helles, aber freundliches Licht. Auf dem Tisch standen drei dampfende Gläser mit Tee, die wir vermutlich Dorothee Kuhn zu verdanken hatten. Aus der Küche hörte ich leise Stimmen. Also war Dorothee schon mit den Kindern ins Gespräch gekommen.
Als ich mich setzte, drückte ich Körber unauffällig einen zerknitterten Kassenbon in die Hand, auf dessen Rückseite ich eine Kurzform der Information gekritzelt hatte, die Viktor Corsten mir in unserem Gespräch gegeben hatte. Die Info über die Uhrzeit, wann Frau Jaschke ins Parkhaus gefahren war, hatte Ede ihm sicherlich auch direkt geschickt.
Körber nickte fast unmerklich und steckte den Zettel in seine Jackentasche. Die spannende Frage war natürlich, ob Wolfgang Jaschke wusste, was seine Frau neben ihren Autowerkstätten noch geleitet hatte.
Ich war der Präfektin zu Lebzeiten nur einmal persönlich begegnet, und bei dieser Begegnung hatte sie ihre goldene Maske nicht abgelegt. Aber ich erinnerte mich noch gut an ihre wachen grünen Augen, die durch die Sehschlitze sichtbar gewesen waren, und an ihre warme, sympathische Stimme, die ich ansonsten nur vom Telefon her kannte.
Der Fall, der gerade mal ein paar Stunden alt war, hatte von einer Minute auf die andere eine ganz andere Dimension bekommen, unter anderem weil die Präfektin mich innerhalb der letzten sechs Monate zweimal angerufen und davon gesprochen hatte, dass sie etwas Größerem auf der Spur gewesen sei. Vielleicht war ihr genau das zum Verhängnis geworden? Ich setzte mich neben Körber und faltete dankbar meine kalten Finger um mein Teeglas. Hoffentlich wusste Viktor Corsten, worum es bei den Ermittlungen der Präfektin gegangen war. Dazu hatte er sich nämlich bisher nicht geäußert.
Körber räusperte sich und signalisierte damit, dass ich die nächsten Fragen stellen sollte. Nachdem Jaschke gerade so empört auf Körbers Frage nach einem Alibi reagiert hatte, hatte ich vermutlich erst einmal bessere Karten.
»Wann haben Sie Ihre Frau denn das letzte Mal gesehen, Herr Jaschke?«
»Gestern Morgen«, sagte er. »Sie ist wie immer kurz vor halb acht aus dem Haus gegangen. Ihre Sachen für die Übernachtung hat sie mitgenommen. Sie wollte direkt von der Firma aus zum Bahnhof fahren, wie immer, wenn sie nach Köln zum Kompetenzzirkel gefahren ist.« Seine Stimme wackelte etwas, aber im Moment schlug er sich ganz wacker.
»Und haben Sie gestern im Laufe des Tages noch mal mit ihr gesprochen?«
»Nein. Sie hat mir nur eine Nachricht geschickt, als sie sich auf den Weg zum Bahnhof gemacht hat.« Er zog ein Smartphone aus der Tasche seiner Strickjacke, entsperrte es und schob es zu uns herüber.
Bin jetzt weg. Ich seh euch morgen!, hatte sie geschrieben und einen lächelnden Smiley ergänzt.
»Wissen Sie, wer außer Ihrer Frau noch an diesem Kompetenzzirkel in Köln teilgenommen hat?«
»Ich habe keine Ahnung. Susanne hatte so viele Kontakte, war mit so vielen Menschen verbunden – ich bin ganz schlecht mit Namen und werfe diese ganzen Leute immer durcheinander. Ich habe es irgendwann aufgegeben zu fragen. Sie wurde auch immer ein bisschen ungeduldig mit mir, wenn ich wieder nicht wusste, wer wer war.« Er zuckte etwas verlegen mit den Schultern.
Entweder log er oder er wusste wirklich nichts von der Gilde und der Rolle seiner Frau. Viktor Corsten hatte mir nämlich gesagt, dass der monatliche »Kompetenzzirkel« regionaler Automobilindustrievertreter tatsächlich ein regelmäßiges Treffen des langjährigen Führungskreises der Gilde war. Und dass Susanne Jaschke zum diesmaligen Treffen nicht erschienen war.
Rein theoretisch war es vielleicht möglich, dass Jaschke doch von der Gilde wusste, aber ich hielt es für sehr unwahrscheinlich. Wäre er Mitglied der Gilde gewesen, hätte er gewusst, dass ich die Ermittlerin für die Region Aachen war und dass inzwischen auch ausgewählte Beamte der Polizei, wie etwa Körber, von dem Geheimbund wussten. Jetzt, wo außer uns dreien niemand in Hörweite war, gab es keinen Grund mehr, sich bezüglich der Gilde bedeckt zu halten.
»Wer wusste denn außer Ihnen, dass sie regelmäßig am zweiten Freitag jeden Monats ins Parkhaus fuhr und vorzugsweise immer den gleichen Parkplatz nahm?«
»Das weiß ich nicht. Ich denke, dass eine ganze Reihe von Leuten wusste, dass sie regelmäßig nach Köln fuhr. Sie ist ja an diesen Freitagen immer deutlich früher aus dem Büro aufgebrochen als an anderen Freitagen – und an den betreffenden Samstagen war sie dann natürlich auch nicht in der Firma. Und sie hatte keinen Grund, ein Geheimnis aus diesen Treffen zu machen.«
Das denkst du.
»Dass sie mit dem Auto zum Bahnhof fuhr, wird unter den engeren Mitarbeitern auch kein Geheimnis gewesen sein«, sprach Jaschke weiter. »Aber ob jemand wusste, wo genau sie das Auto abstellte?« Er schüttelte den Kopf. »Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen.«
»Wo hatte Ihre Frau denn eigentlich ihr Büro?«
»Immer noch im Stammsitz in der Süsterfeldstraße. Dort sitzt auch die zentrale Verwaltung, also alles, was nicht in den einzelnen Werkstätten angesiedelt sein muss.«
»Hätte sie da nicht auch ab Aachen-West den Zug nehmen können?«
»Wahrscheinlich. Aber sie hat immer den Hauptbahnhof bevorzugt. Warum, weiß ich nicht. Ich fahre eigentlich nie mit dem Zug.«
Nach Jyotis Pendlergeschichten zu urteilen, fällt das inzwischen auch eher in die Kategorie Abenteuerurlaub.
»Ist das Firmengebäude ein eingezäuntes Gelände?«
»Ja. Aber zu den Geschäftszeiten ist das Tor natürlich immer offen. Da ist ja viel Publikumsverkehr.«
»Hat Ihre Frau einen eigenen Parkplatz, der irgendwie gekennzeichnet ist?«
»Ja, auf der Rückseite.«
»Und ist der vom Firmengebäude aus gut einsehbar?« Vielleicht hatte sie den Mörder ja schon im Auto, als sie zum Bahnhof aufbrach.
Wolfgang Jaschke überlegte. »Von den unteren Etagen eigentlich nicht. Das ist die Rückseite der Werkstatt, auf der Seite sind keine Fenster. Aber wenn Sie von den oberen Etagen aus dem Fenster gucken, sehen Sie ihn schon.«
»Und ist freitags nach sechzehn Uhr auf dem Firmengelände noch viel los?«
»Bis siebzehn Uhr oder siebzehn dreißig können die Autos aus der Werkstatt noch abgeholt werden, aber das spielt sich alles auf der Vorderseite des Gebäudes ab«, sagte Jaschke nachdenklich. »Aber in der zentralen Verwaltung oben ist da, glaube ich, nicht mehr viel los. Meinen Sie, da hat ihr schon jemand aufgelauert?«