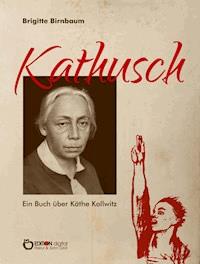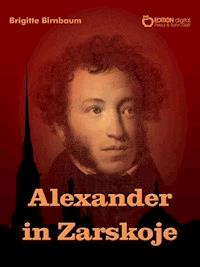6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der Lithograf Heinrich Zille ist entlassen worden - nach 30 Jahren zuverlässiger und mühevoller Arbeit ist er ,,zu alt für die Firma“! Was soll nun werden? Erschrocken steht Zille auf der Straße. Miete muss bezahlt werden, und Brot gibt kein Bäcker umsonst. Hansens Schulgeld ist fällig, die Winterkohlen sind zu kaufen, und dem Zeitungsjungen Emil wollte er endlich richtige Schuhe schenken. Ratlos geht er durch die Straßen. Auch wenn es so aussieht - Heinrich Zille ist noch nicht am Ende. Mit seinen Zeichnungen findet er einen neuen Anfang, und für die Berliner Hinterhauskinder Emil und Paule, Fritz und Otto, für alle, die er malt, wird Zille später „der Pinselheinrich“ sein. Aber bis dahin ist es noch ein weiter und mühevoller Weg. Das mit Zillezeichnungen illustrierte Buch für Kinder ab 10 Jahre erschien erstmals 1977 in Der Kinderbuchverlag Berlin, 1986 unter dem Titel „Der Pinselheinrich“ im Elefanten Press Verlag, Berlin (West). LESEPROBE: „Und unter jede noch einen kleinen Witz, so’n paar lustige Worte. ’n echter Berliner lässt sich nicht unterkriegen, behält stets den Humor.‘‘ Zuerst hat ihn diese Forderung von Fräulein Mehlitz gekränkt. Will man sich auf Kosten seiner armen Leute amüsieren? Das duldet der Pinselheinrich nicht. Auf keinen Fall. Aber soll’n sie ihre Witze haben. Seine Straßenkinder sind schlagfertige Gören, und es gibt kein schärferes Schwert als eine spitze Zunge. Mit diesem Schwert wird er kämpfen für die, die sich selbst nicht wehren können. Wird denen Mut machen, die manchmal schon ohne jede Hoffnung sind. Auf dem vor ihm liegenden Blatt hat er eine Mansarde gezeichnet. Eine lausig kalte Bude ohne Ofen. Am Bett klettern drei Kinder herum. Ein viertes hockt vor der Kommode, die es zu öffnen versucht. Vorn im Bild steht ein Arzt. Tadellos gekleidet. Ihn hat man geholt, damit er für Hans einen Totenschein ausfüllt. Der kleine Hans war nur ein paar Wochen alt geworden. Zu wenig Milch und zu viel Wasser im Fläschchen. Das vertrug er nicht. „Darüber reißt man keine Witze“, sagt Zille so heftig, dass Hanseken erschrocken „diü!“ schreit. Er nimmt den Federhalter, taucht ihn ins Tintenfass, stockt, taucht nochmals tief in die dunkle Flüssigkeit und schreibt unter das Blatt: Arzt: „Kinder, wo ist denn euer heute morgen verstorbenes Brüderchen?“ Kinder: „Ach, Herr Doktor. Mutter ist weggegangen und hat den Hans in die Kommode geschlossen, wir soll’n nicht mit ihm spiel’n.“ Was werden das Fräulein Mehlitz und der Verlagschef dazu sagen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Brigitte Birnbaum
Ab morgen werd ich Künstler
Eine Erzählung aus dem Leben Heinrich Zilles
ISBN 978-3-86394-433-9 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1977 bei Der Kinderbuchverlag, Berlin und 1986 unter dem Titel „Der Pinselheinrich“ bei Elefantenpress in Berlin (West).
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Das größte Unglück ereilt den Menschen immer dann, wenn er es am wenigsten erwartet. Zille erwartet überhaupt kein Unglück, auch kein kleines. Zeitig wie jeden Morgen ist er auf den Beinen. Und wie jeden Morgen begrüßt ihn sein Dompfaff mit einem sanften „Diü“.
Vater Zille zieht die Weste über, rückt die runden, in Nickeldraht gefassten Brillengläser zurecht und öffnet das Fenster. Die Kühle des frühen Oktobertages strömt herein. Ein Windhauch spielt träge mit der Gardine. Auch der Wind ist noch müde, hat noch nicht ausgeschlafen.
Nebenan in der Küche pfeift der Teekessel. Doch nur kurz. Sofort nimmt ihn Frau Hulda vom Gas und brüht Kaffee für ihren Mann. Malzkaffee, den teuren echten können sie sich höchstens an Feiertagen leisten, und heute ist ein gewöhnlicher Dienstag. Sie dreht die Flamme kleiner und macht die von gestern übrig gebliebenen Schrippen frisch. Nun kann Heinrich Zille frühstücken. Er tut’s mit Appetit und ohne Hast. Eben fuhr der Sechsuhrzug im nahen Bahnhof Westend ein. Das bedeutet, der Mann braucht sich nicht mit dem Essen zu beeilen. Er zerbröckelt eine Schrippenhälfte und trägt die Krümel seinen Freunden, den Spatzen, hinaus auf den Balkon. Er füttert den Dompfaff, der munter im Käfig umherhüpft. Alles wie an jedem anderen Morgen. Zille reißt das Blatt vom Vortag aus dem Kalender, und weil auf der Rückseite kein Sprüchlein prangt, steckt er das Zettelchen in die Westentasche, um es zum Zeichnen zu benutzen. Er weiß auch schon, was er darauf skizzieren wird, und darum hat er’s plötzlich eilig.
Nur mit halbem Ohr hört er, dass ihn seine Frau freundlich erinnert: „Bitte, vergiss nicht zu besorgen, was du Grete versprochen hast, und ... Heinrich“, sie hilft ihm ins Jackett, „das Schulgeld für Hans ist wohl wieder fällig.“
„Wird alles erledigt“, murmelt er und greift nach seinem alten, vom ständigen Tragen grau schimmernden Hut.
Auf der Treppe bemerkt Heinrich Zille, dass Emil schon da war. Die Zeitungen stecken in den Briefkästen. Emil trägt, bevor er zur Schule geht, in der Sophie-Charlotten-Straße die BERLINER MORGENPOST aus. Und wenn er bereits im Eingang Nummer 88 war, trabt er in Richtung Kaiserdamm. Also wird Zille den Jungen heute nicht mehr sehen und ihn nicht zeichnen.
Um aus der Haustür treten zu können, muss Zille über einen schlafenden Mann hinwegsteigen, der quer auf der obersten Steinstufe hockt, die angezogenen Beine gegen die Wand gestemmt. Einer, der über seinen Durst getrunken hat? Oder einer der vielen Obdachlosen, die keine Bleibe haben? Nein, einer, der nachts zu Fuß von weit herkam, um früh auf dem Bahnhof vielleicht Arbeit zu finden. Zille begegnet ihm nicht zum ersten Mal, und wie neulich schließt er die Tür hinter sich mit einem lauten Knall,damit der Schläfer aufwacht und seine Chance nicht verpasst.
Das Kopfsteinpflaster der Straße ist feucht. Vergilbte Lindenblätter kleben im Rinnstein, durch den mit nackten Füßen ein Junge patscht.
„Halt dir feste, sonst kommen wir zu spät!“, warnt er das Schwesterchen, das er huckepack schleppt. Die Kleine juchzt vor Vergnügen und hält sich mit den Händen am Hals des Bruders.
Zille bleibt stehen und blickt ihnen nach. Emil rennt auch noch immer barfuß, denkt er, während er das Kalenderzettelchen und einen Bleistiftstummel hervorsucht. Er tritt einen Schritt beiseite, als wolle er sich ausruhend an einen der Straßenbäume lehnen, und skizziert den mit seiner quietschenden Last davongaloppierenden Jungen.
Vor der Arbeit muss Zille ein Bildchen für sich gezeichnet haben, eines, das ihm Spaß macht. Auch das wiederholte sich heute wie an jedem anderen Morgen. Und wie immer um diese Stunde grüßen den Meister Zille die Droschkenkutscher, die vor dem Bahnhof Westend auf Kundschaft warten.
„Na, ist deine Liese wieder auf den Beinen?“, erkundigt er sich im Vorbeigehen bei einem von ihnen.
„Seit sie den Rossschlächter gesehen hat, immer!“, ruft der zurück. Die Umstehenden lachen, und Zille eilt schmunzelnd weiter, kürzt den Weg ab, denn der Sechsuhrfünfundvierzigzug dröhnt heran. Seine gebremsten Räder kreischen.
Heinrich Zille biegt in die Ahornallee ein und kommt wie stets fast zehn Minuten vor der Zeit in die fotografische Gesellschaft.
Diese Gesellschaft ist in Berlin ein bekannter und angesehener Betrieb, in dem Kunstwerke reproduziert werden. Jedes Bild wird so oft vervielfältigt, wie es die Händler glauben verkaufen zu können. Pro Stück eine Mark. Fürsten, auf Schimmeln reitende Heerführer und betende Madonnen werden am meisten gebraucht. Aber auch Modezeitungen lassen hier ihre Seiten anfertigen.
Heinrich Zille zieht sein Jackett aus, knöpft, um ihn zu schonen, den Kragen vom Oberhemd, krempelt die Ärmel hoch und will sich an seinen Arbeitsplatz setzen, da spricht ihn der Werkmeister an.
„Herr Zille?“, fragt er mit einer unangenehmen Freundlichkeit in der Stimme. Seine kurzen Finger deuten auf einen Kasten, in dem ein Bild eingespannt ist. Zille will gerade Kolophoniumstaub in den Kasten blasen, damit sich die Schatten und Linien deutlich zeigen. „Herr Zille, wie lange werden Sie noch daran zu tun haben?“
Über die Ränder seiner Brille hinweg sieht Zille den Frager an. Sehr erstaunt. So erstaunt, dass er nicht sofort antwortet. Seit Wochen haben sie kein Wort miteinander gewechselt. Und heute dieser eigenartig liebenswürdige Ton? Sollte etwa ...? Wegen Zilles Kollegen Otto waren die beiden heftig aneinandergeraten. Regelmäßig mussten alle Angestellten der Firma mit dem Werkmeister abends Kegel schieben und anschließend Skat spielen. Eine langweilige Sache, weil der Werkmeister immer gewinnen musste. Manchmal drückte sich Zille, schob seine Zuckerkrankheit vor. Und eines Abends packte den sonst so bedächtigen Otto die Wut. Er spielte, bis der Werkmeister verlor und zahlen musste. Von Stund an taugte Ottos Arbeit nichts mehr. Der Werkmeister nörgelte ständig herum, und ein paar Wochen danach wurde Otto entlassen.
Zille beschwerte sich. Es gab Krach. Doch Otto zu helfen vermochte er nicht.
„Bis neun müssen Sie‘s geschafft haben“, ordnet der Werkmeister an. Sein Blick sucht den Fußboden, denn Zilles wache Auge mustern ihn voller Misstrauen.
Was will dieser Schleicher von mir? denkt er. Weshalb bis neun? Der weiß doch genau, wie viel Zeit solche mühsame Arbeit kostet.
Um neun Uhr, die Sonne scheint warm in die Werkstatt, wird Heinrich Zille ins Büro der Firma gebeten. Ein seltenes Ereignis!
„Was will denn der Chef von dir, Heinrich?“, fragt ihn ein Kollege neugierig.
„Das wird er mir gleich sagen.“
„Vielleicht 'n besonderer Auftrag“, wirft ein anderer ein.
Und ein dritter orakelt: „Vielleicht wegen Otton. Dass sie sich's doch noch mal überlegt haben.“
Nur Vogler, der wie Zille schon dreißig Jahre hier sein Brot verdient und sich besser in allen Gewohnheiten des Hauses auskennt als die jüngeren, wird plötzlich unruhig.
Nicht der Chef erwartet Zille im Büro, sondern der Prokurist. Das mildert Zilles aufsteigendes Unbehagen nicht, denn dieser Mensch ist nicht gerade sein Freund. Der Prokurist findet, dass sich Zille ein bisschen viel mit den Schicksalen armer Leute beschäftigt. In den elendsten Ecken schnüffelt Zille herum, nicht nur in der Firma. Und was er für Jammergestalten aufs Papier kritzelt! Lauter zerlumpte Hungerleider! Von den rotznäsigen Gören ganz zu schweigen. Diese Stricheleien veröffentlicht er auch noch in Witzblättern. Und in einer richtigen Kunstausstellung, wo bekannte Maler ihre Werke zeigten, haben vor fünf Jahren bereits Zilles Arbeiten gehangen. Gesehen hat sie der Prokurist natürlich nicht, nur davon gehört. Doch sie haben gehangen. Und auch das nimmt ihm der Prokurist übel: Es ärgert ihn, dass der vor ihm Stehende etwas zu leisten vermag, was ihm selbst nie gelingen wird.
Trotzdem überlegt er, ob er ihm nicht jetzt, in diesem Augenblick, doch einen Stuhl anbieten müsste. Zilles Gesundheit soll ja nicht die beste sein. „Bringen Sie’ s ihm schonend bei“, hatte der Chef vorhin gewünscht, obwohl ihm Zilles Verhalten noch viel weniger gefallen hatte als seinem Prokuristen. Aber einem geschickten und klugen Arbeiter sah man eben einiges nach.
„Lieber Zille ...“ Der Prokurist schwingt sich auf seinem Drehschemel hin und her. „Sie haben ja gewiss schon bemerkt, denn Ihnen entgeht doch nichts ...“ Er versucht zu lächeln. „Aber bitte, setzen Sie sich!“
„Sitz ja den ganzen Tag.“ Heinrich Zille nimmt die Hände über der Weste zusammen und bleibt stehen.
Dieses Selbstbewusstsein! grollt der Prokurist und spricht weiter: „Die fotografische Gesellschaft ist gezwungen, sich umzustellen. Wenn unsere Firma leistungsfähig bleiben will, wenn sie weiterhin ihre Angestellten ernähren will ...“
Was quasselt der? überlegt Zille. Wir haben doch die Firma ernährt und nicht die Firma uns! Feine Häuser haben sich die Chefs bauen lassen! Reicht ihnen das denn nicht? Wollen sie etwa noch mehr?
„... müssen wir neue Methoden einführen. Früher war es leichter. Heute hält sich nur über Wasser, wer etwas leistet. Jüngere Kräfte sind nachgewachsen, drängen nach vorn. Ihnen muss man eine Chance bieten.“
Aus ihnen könnt ihr noch mehr herausholen, denkt Zille.
„Darum müssen wir uns von den ältesten Mitgliedern der Firma trennen, auch von Ihnen, Zille.“ Der Mann sagt diese Worte ohne das leiseste Bedauern.
Zille starrt ihn an. Hat er sich verhört?
„Sie sind heute dreißig Jahre bei uns. Da wird’s doch Zeit, dass Sie sich endlich mal ausruhen, lieber Zille.“
Heinrich Zille ist fassungslos. „Und wovon soll ich leben?“, würgt er hervor. „Meine Familie ... Ich hab drei Kinder ...“
„Na, na, Zille. Sie werden doch wohl was zurückgelegt haben in den dreißig Jahren. Ein Mann wie Sie! Fleißig und ordentlich, der spart doch.“
„Sparen?“, schreit Zille. „Von den paar Mark, die ihr uns gezahlt habt, auch noch sparen? Ich hab ja kein Prokuristengehalt eingesteckt! Ich bin man bloß Lithograf. Sie ...“ Zilles Gesicht ist gerötet. Er spürt, wie sein Herz tobt.
„Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich“, beschwört ihn der Prokurist, mit den Armen abwehrend durch die Luft wedelnd. „Das ist doch nicht meine Schuld. Auch nicht die vom Chef. Er würde Sie gern behalten ...“
„Wer zwingt ihn denn, mich rauszuschmeißen? Wer?“
„Die Zeiten, die augenblicklich schwierige Situation, in der sich unser Vaterland befindet.“
„Quatsch!“ Barsch schneidet Zille dem Schwätzer das Wort ab. „Noch mehr verdienen will er! Und Sie unterstützen ihn dabei.‘‘
„Seien Sie doch vernünftig, Mann. Ihnen geschieht doch kein Unrecht. Dreißig Jahre ... mal muss eben Schluss sein.“ Er reicht ihm das Kündigungsschreiben. „Und nun geben Sie mir die Hand, lieber Zille.“
„Nee, Sie sind dreckig!“
Ehe der Prokurist begreift, hat Heinrich Zille den Raum verlassen.
Als nächster wird Vogler ins Büro gerufen.
„Arbeitslos ...“, flüstert Zille, „arbeitslos.“ Er steht auf der Straße und fasst dieses furchtbare Wort nicht. Die Sonne blendet ihn. Er spürt die Wärme nicht. Ihn friert.
Er darf sich nicht aufregen, hat Dr. Heilborn, sein Arzt, verordnet. Aufregung sei Gift für seine Zuckerkrankheit. Dr. Heilborn hat klug reden. Erst neunundvierzig Jahre alt und arbeitslos. Ungläubig schüttelt Zille den Kopf. Sinnlos, woanders nachzufragen. Niemand wird ihn einstellen. Jüngeren braucht man noch weniger Lohn zu zahlen. Also bevorzugt man sie.
Aber was soll werden? Wie weiterleben? Dieser Gedanke flößt ihm Angst ein. Miete muss bezahlt werden, und Brot gibt kein Bäcker umsonst. Hansens Schulgeld ist fällig. Tochter Grete hat in drei Tagen Geburtstag. Die Winterkohlen sind noch zu kaufen. Und Emil, dem Zeitungsjungen, wollte er ein Paar Schuhe schenken. Zille läuft durch die Allee, blickt nicht nach rechts und links. Sieht nicht die herbstlichen Farben der Bäume, die ihn sonst erfreuen. Hört nicht die mit Eisen beschlagenen Wagenräder über das Pflaster rasseln. Er ist nicht einmal imstande, sich eine von seinen billigen Zigarren anzuzünden. So sehr zittern seine Hände. Er geht durch die Straßen, und jeder seiner schnellen Schritte entfernt ihn weiter von der fotografischen und der Gegend, in der er wohnt.
Nach einer guten Stunde Fußmarsch erreicht er die Gassen, die ihm von seiner Kindheit an vertraut sind. Schmalbrüstige Häuser bilden lichtlose Höfe. Dunkle Winkel zwischen baufälligen Mauern. Doch selbst der nasseste Keller ist hier bewohnt, das kleinste fensterlose Loch vermietet. Auch das ist Deutschlands Hauptstadt. Und Kneipen an jeder Ecke.
Wieder befällt ihn ein leichtes Frösteln. Einen Bissen essen müsste er, einen Schluck trinken. Zille taucht ins Halbdunkel eines Eingangs, tastet ein paar morsche Stufen hinab und betritt eine der Kneipen. Das trübe Licht vermischt sich mit dem Tabaksqualm selbst gedrehter Zigaretten und lässt die Gesichter der Gäste wie graue Flecke erscheinen. Statt an Tischen wird auf Tonnen und an Tonnen gesessen. Zille setzt sich etwas abseits, wie immer, wenn er hier mal einkehrt. Der Wirt beantwortet seinen Gruß mit einem Kopfnicken, verwundert über diesen Gast zu dieser Stunde. Da stimmt doch was nicht!
Zille sieht sich um. Fuhrleute spielen Karten. Zwei Hausdiener kiebitzen. Matrosenkarl streitet mit der schieläugigen Elsa um Geld. Wird seine Stimme zu laut, knurrt der neben der Theke zusammengerollte Hund drohend. Eine ganze Familie, Vater, Mutter und drei Kinder, setzen ihre erbettelten Groschen in Buletten um. Ein völlig zerlumpter Alter schläft inmitten des Lärms seelenruhig, den Kopf auf den Armen. Ihn hätte Zille sonst gewiss auf einer Skizze verewigt. Aber heute stockt sein Bleistift. Heute bringt er keinen Strich aufs Papier.
Unaufgefordert serviert ihm der Wirt eine Weiße mit Schuss. „Spül man den Kummer runter, Heinrich“, rät er, ohne zu ahnen, was seinen Gast so schwer bedrückt.
Sein Kummer lässt sich nicht runterspülen, wächst eher mit jedem Tropfen des schäumenden Biers an. Zille dreht das große Glas mit dem abgesplitterten Rand langsam zwischen den Fingern. Ist dies sein letztes Bier? Als Arbeitsloser wird er sich keins mehr leisten können.
Zille beißt in seine Frühstücksschnitte und trinkt. Das Bier stillt heute nur den Durst, zaubert ihm keine bessere Stimmung.
Einer der halb betrunkenen Kartenspieler versucht, Zille ins Gespräch zu ziehen. Da winkt er den Wirt herbei, bezahlt seine Zeche und geht, streift weiter durch die Straßen, seinen quälenden Gedanken nachhängend.
Mit der Gabel probiert Hulda Zille, ob die Kartoffeln gar sind. Jeden Augenblick müsste ihr Mann aus der fotografischen heimkommen. So denkt sie, während sie den Topf vom Feuer hebt. Es ist Feierabendzeit. Walter, ihr Jüngster, poltert bereits die Treppen herauf. Obwohl ihm schon tausendmal gesagt wurde, er solle leise und langsam gehen. Aber ein Sechzehnjähriger kann nicht langsam gehen. Bald nach ihm erscheint sein Vater.
Der Dompfaff ruft Zille „diü!“ entgegen. Zille nickte ihm wortlos zu, und Frau Hulda bemerkt sofort, ihr Mann hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Zu Späßen ist er heute nicht aufgelegt. Stumm lächelt sie ihn an, lässt ihn schweigen, fragt nichts. Diese verständnisvolle Rücksicht verdoppelt seinen Gram.
Die Familie isst zu Abend. Walter freut sich, dass sein Vater keinen großen Appetit hat. Um so mehr kann sich der Junge auf seinen Teller häufen. Walter schmeckt’s immer. Er kaut hastig, denn er hat’s eilig. Walter will Zeichner werden, aber noch ist er Lehrling und muss abends die Gewerbeschule besuchen. Darum seine Eile. Er möchte zum Unterricht nicht zu spät kommen.
Seine Schwester Grete summt ein Lied, während sie der Mutter beim Geschirrspülen hilft. Die beiden ahnen nicht, was über sie hereingebrochen ist. Vater Zille lässt kein Wort davon verlauten, und sein Verhalten bietet keinen Anlass zum Argwohn. Zigarre rauchend sitzt er beim Schein der leicht blakenden Petroleumlampe mit dem grünen Glasschirm. Zurückgezogen in seine Arbeitsecke im Wohnzimmer, sortiert er Stapel von Skizzen, Notizen, die er sich vor Jahren machte; von seinen Kindern, als sie noch klein waren, von Grete, dem stupsnäsigen Lockenköpfchen; von Straßenszenen. Gesammelte Eindrücke. Heiteres und Ernstes. Warum er sie gerade heute Abend vorgesucht hat, weiß er selbst nicht. Er schiebt seine Brille auf die Stirn und streicht die Dochtkohle ab. Nun brennt die Lampe ruhiger. Er hört die Tochter in der Küche singen. Wie soll er ihr sagen: Ab heute musst du unsere Familie ernähren. Dein Vater ist dazu unfähig. Rausgeschmissen hat man ihn. Bitter lacht er vor sich hin. Nein, er kann nicht sprechen. Er schämt sich.
Der Dompfaff versucht, den Schweigenden zum Reden zu bewegen. Er ist gewohnt, dass sein Gezwitscher beantwortet wird. Doch Zille steht auf und deckt ein Tuch über das Vogelbauer. Sofort schweigt der kleine Kerl gekränkt.
Zille setzt sich wieder. An Hans, seinen Zweitältesten, denkt er. Der Junge muss vom Lehrerseminar zurückgeholt werden. Wer soll seine Ausbildung weiterbezahlen? Sein Kostgeld? Seinen Anzug? Seine Bücher? Gretes Gehalt, das sie als Buchhalterin verdient, ist niedrig, und so ein junges Mädchen muss sich gut kleiden, damit der Chef es behält. Und wenn Hans hier ist, was wird dann aus ihm? Er ist neunzehn. Und Walter? Walter wird seine Lehre abbrechen müssen und sich als Straßenfeger verdingen oder wie jener heute früh vor der Haustür auf eine Gelegenheitsarbeit warten. Hulda, denkt Zille, Hulda, dass ich dir das nicht ersparen kann! Aber heute Nacht sollst du noch ruhig schlafen. Er zündet seine Zigarre neu an, beugt sich tiefer über seine Zeichnungen und entdeckt auf einer, flüchtig notiert, einen Vers:
„Gibt dir det Leben een Puff, dann weine keene Träne! Lach dir’n Ast und setz dir druff Und baumle mit die Beene !‘‘
2. Kapitel
Emil hat sich daran gewöhnt, ihm allmorgendlich zu begegnen. Im Sommer früher als im Winter. Nun vermisst er ihn schon den dritten Tag. Was ist passiert? Irgendetwas muss passiert sein mit Pinselheinrich. (Diesen Namen schnappte Emil bei den Droschkenkutschern auf.) Sonst kam Zille immer gleich nach den Arbeitern von der Spandauer Bergbrauerei. Meist war er eilig an Emil vorbeigelaufen. Und einige Male hatte der Junge ihn überrascht, als er zeichnete, und konnte ihm einen Moment über die Schulter schauen.
Emil bewundert den Pinselheinrich, weil er alles zeichnen kann, was um ihn herum passiert. Genauso. Gedanken und Wünsche fremder Menschen gelingt es ihm auszudrücken. Er hingegen quält sich schon, soll er in der Zeichenstunde ein Lindenblatt abmalen.
Bevor Emil mit seinen Zeitungen im nächsten Hauseingang verschwindet, blickt er noch einmal die Straße hinab. Er reibt einen nackten Fuß am anderen, um ihn zu wärmen. Dann spuckt er aufs Pflaster. Zille ist nicht zu sehen.
Der Erwartete liegt auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer und grübelt über die Ungerechtigkeit der Welt nach. Er hat sich keinen Ast lachen, sich draufsetzen und mit den Beinen baumeln können. An die Stubendecke starrt er, als erhoffe er sich von da oben Hilfe. Er wagt es nicht, seiner Frau ins Gesicht zu sehen, die ihn tröstet: „Vielleicht noch ein, zwei Tage, Heinrich, und du fühlst dich besser und kannst wieder in die fotografische gehen.“ Er hat ihr die Wahrheit noch nicht gesagt, findet keine Worte. Seine Frau tut ihm leid.