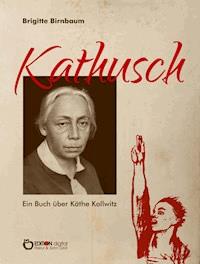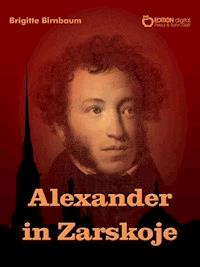7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Endlich ist es Hans und Lea gelungen: Für wenig Geld können sie ein Atelier beziehen, zwei lichte Räume in einem Mietshaus an der Ostbahnstraße, vier Treppen hoch. Der Blick geht über das Bahnhofsdach, Lärm dringt herauf, und der Qualm der Loks weht gegen das schlecht verkittete Fenster. — Eine schmutzige, verrußte Gegend, doch das stört die beiden nicht. Endlich werden sie ungehindert arbeiten können, malen und zeichnen, und sie werden leben in eigenen vier Wänden. Es ist das Jahr 1930 und eine schwere Zeit für die angehenden Künstler. Noch sind Hans und Lea Grundig unbekannt, wer Geld hat, kauft ihre Bilder nicht, und die Grundigs wissen, warum das so ist. Fürs erste hilft ein Kunstpreis weiter, ein paar hundert Mark, doch bald schon sind die Kassen wieder leer, und das wird nicht die einzige Sorge für Hans und Lea sein ... Sachkundig im Detail, lebendig und engagiert in der Schilderung von Leben und Werk, erzählt Brigitte Birnbaum von einem Künstlerehepaar, das den Schwierigkeiten des Alltags nicht nachgibt und mit seinen Bildern etwas bewirken will in dem alles beherrschenden Konflikt der Zeit: Es naht das „Tausendjährige Reich“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Brigitte Birnbaum
Die Maler aus der Ostbahnstraße
Aus dem Leben von Hans und Lea Grundig
ISBN 978-3-86394-435-3 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1990 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Dort drüben muss das Haus gestanden haben, die Nummer 4, mit der Vorderfront zur Bahnhofsrückseite. Grau wird es gewesen sein. Häuser hinter Bahnhöfen sind immer angerußt. Vier Stockwerke hatte es. Das weiß ich genau und auch, dass die Ateliers unterm Dach lagen. Ich schaue hinauf, wo sich jetzt der Himmel dehnt, trete einen Schritt zurück und versuche, mir das Haus zu denken:
Ein junges Paar verließ das Haus. Er öffnete ihr die in den Angeln durchhängende Tür, blieb auf dem Gehsteig stehen und schlug ihr den Mantelkragen hoch. Es war kalt an jenem frühen Februarnachmittag. Sie lachte. Hinter einem Fenster bewegte sich die Gardine. Auch der Mann, der die Ostbahnstraße vom oberen Ende her ansteuerte, blickte den beiden nach. Ihm schien, er kannte den in Kniehosen und Joppe, der die Frau unterhakte. Er konnte sich aber auch geirrt haben. Mit federnden Schritten betrat er das Haus und klingelte bei Hilscher. Der aufriegelnden Frau, einer dicklichen Person, stellte er sich vor: „Krüpel. Willi Krüpel, Kunstmaler.“
Sie bat ihn nicht herein, sondern sagte kurz angebunden: „Die Ateliers sind vermietet.“
„Beide?“ Er schob seinen rechten Fuß in den Türspalt. „Ich zahle ein paar Mark drauf.“
Sie antwortete nicht sofort. Sie überlegte. Schon drei Mark zusätzlich wären viel Geld. Ob der andere jeden Monat das Fällige aufbringen wird?
„Gnädige Frau, wir einigen uns ...“ Er zeigte ihr lächelnd seine Zähne. Kräftige, ein wenig schief gewachsene Zähne. „Auf dem Schild in Ihrem Fenster verlangen Sie ...“
„Das Schild gilt nicht mehr.“
„Unerhört! Stellen ein Schild ins Fenster und haben längst vermietet.“
„Vor einer Minute.“ Plötzlich war sie froh, dass der andere vor diesem nachfragte. Der hatte freundliche Augen und benahm sich fürsorglich zu seiner Frau. „Sie müssten ihm begegnet sein.“
Krüpel hatte sich auf der Straße also nicht geirrt. Seine Miene veränderte sich. „Sie haben doch nicht etwa an Grundig vermietet?“
„Mei Gutester, ich vermiete, an wen es mir passt.“
„Ich passe Ihnen wohl nicht?“ Drohend reckte er sich. „Auf uns nationalsozialistischen Künstlern glaubt jeder herumtrampeln zu dürfen. Warten Sie nur ...“
„Sie betrampeln meine Schwelle“, unterbrach ihn Frau Hilscher, und als er widerstrebend den Fuß zurückzog, schloss sie energisch die Tür.
Wütend stieg Willi Krüpel im Halbdunkel die fünf schmuddeligen Stufen abwärts. Hampelte derart mit den Armen, dass er sich die Knöchel an der Wand stieß. Schon an der Hochschule hatte ihn Grundig ausgestochen. In seiner bescheidenen, stillen Art war er bei den Professoren und unter den älteren Studenten beliebt. Fand sogar Anerkennung. Krüpel nicht. Und nun schnappte ihm Grundig das Atelier weg, wo Ateliers in Dresden rar sind, nahm ihm den Arbeitsplatz. Das würde Krüpel niemals ungesühnt lassen.
„Was der sich einbildet“, murmelte Frau Hilscher, sich den schmalen Korridor entlangarbeitend. Dann entfernte sie das Schild aus ihrem Stubenfenster. Dass einer wie Krüpel kein Freund von Grundig war, machte ihr diesen und seine kleine, dunkelhaarige Frau nur sympathischer. Sie vermietete seit Jahren und besaß schließlich Erfahrung.
Allerdings, ganz so bescheiden hatte Frau Hilscher sich das Mobiliar der neuen Mieter nicht vorgestellt. Sie fuhren am nächsten Vormittag ihre Wohnungseinrichtung auf einem Handkarren an, auf dem sonst ein Stubenmaler seine Leitern und Farben zu transportieren pflegte. Ohne fremde Hilfe schleppten die beiden ihre Habseligkeiten hinauf, und Frau Hilscher hörte, dass die junge Frau ihn „Witschel“ rief und er sie „mein Schwarzes“ nannte. Darüber schüttelte sie den Kopf, nicht über die drei Töpfe, das wacklige Bettgestell und den bunt bemalten Schrank. Noch heftiger hätte sie den Kopf geschüttelt, hätte sie gesehen, dass der Mann den Kanonenofen im großen Atelier anheizte und Wasser aufsetzte, um die Fußböden zu scheuern. Das war doch wohl Aufgabe der Frau. Sein Schwarzes aber, das Lea hieß, schaute, alles um sich her vergessend, aus dem Fenster auf die blanken Schienenstränge. Lea spürte weder die Kälte in dem hohen, bis unter die Decke verglasten Raum noch wie empfindlich der Wind durch jede Ritze blies. Von unten drangen Bahnhofsgeräusche herauf, und der Qualm der Loks wehte gegen die schlecht verkitteten Scheiben.
„Ach, Witsch!“, sagte sie begeistert, sich zu ihrem Mann umdrehend, „für jeden ein Arbeitszimmer! Du hier. Ich nebenan.“ Nach dem Mansardenstübchen in der Melanchthonstraße muteten sie diese paradiesisch an. Die Nase rümpfend fügte sie hinzu: „Nur dass es so stinkt.“
„Dos wermer glei hamm“, meinte er, zwischen Staffelei und bemalten Leinwänden nach Schrubber und Wischtuch stöbernd. „Gleich wird es nicht mehr nach Katzen riechen. Wahrscheinlich hielten unsere Vorgänger eine.“
Gründlich sauber machen hatte Hans schon als Junge in der väterlichen Malerwerkstatt gelernt. In Leas Elternhaus in der Frauenstraße hielt man dazu ein Dienstmädchen. Bevor Hans mit dem Schrubber und Imi-Wasser überschwängliche Muster und von Lea ein Porträt aufs Parkett malte, zündete er sich eine Zigarette an, eine von der billigsten Sorte, und rauchte genussvoll.
Lea machte sich ans Sortieren und Einräumen. Die wenigen Stücke fanden schnell ihre Plätze. Die fünf gesprenkelten Tassen samt Kanne und die drei Becher stellte sie sich griffbereit, denn sie rechnete morgen mit Besuch. Die Ecke neben dem eisernen Ausguss musste ihnen als Küche dienen. Küche und Zimmer am Korridorende gehörten zwar zu den beiden Ateliers, wurden aber, wie sie am Klingelschild festgestellt hatten, von einer Frau Ahnert bewohnt und wären zusätzlich für die Grundigs unerschwinglich gewesen.
Allmählich wich der Katzengestank dem Geruch von feuchtem Holz. Lea sang, während sie stolz nach und nach ihr Zeichengerät, ihre Pappen und Papiere in den kleineren Raum trug. Hans blickte hinter ihr her und freute sich, dass sie mit ihrem Lied das Kindergeplärr aus der Wohnung unter ihnen übertönte. Vor den Teilen ihres Bettes, eines weißen Metallbettes, verstummte sie. „Witschel“, sagte sie kläglich, „mein Bett bleibt neben deinem. Allein fürcht ich mich nachts.“ Das hatten sie gestern bei der Aufteilung ihres neuen Reiches nicht bedacht.
„Und tags?“ Übermütig foppte er sie. „Mein Schwarzes wollte doch unbedingt ein eigenes Atelier.“ Er warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu und spielte den Schadenfrohen.
„Tags wird gearbeitet. Aber nachts ...“ Sie streckte den Arm nach ihm aus. „Überhaupt ist bei dir fast doppelt so viel Platz.“
„Den brauch ich auch, bei meinem Format.“ Energisch strich er sich die blonde Haarsträhne aus der Stirn, die ihm bei jedem Bücken bis auf die Nase fiel, und bürstete mit der Hand Staub von der Hose.
„Außerdem, wo sollen morgen alle sitzen?“ Sie ließ nicht locker, wohl wissend, dass er es nicht anders wünschte. „Allein deshalb brauchen wir beide Betten hier.“ Ihre Augen maßen die Wand neben der Tür ab. Unten verstärkte sich das Geplärr zu einem wütenden Geschrei.
„Wen hat denn mein Schwarzes eingeladen?“
„Eingeladen?“
„Hier oben findet uns so leicht keiner.“
Gegen die Matratze gelehnt, lachte Lea seine Bedenken aus. Auch sie ordnete ihre Frisur, und das Gedonner vorbeifahrender Züge übertönte jede weitere Antwort.
Lea behielt recht. Kaum war Hans vom Fürsorgeamt zurück, wo er wie immer sechs Mark Unterstützung für die halbe Woche empfing, kaum dass Lea vom einzigen Tisch ihr Zeichenzeug geräumt, ihn vor die Betten gerückt und in einen Esstisch verwandelt hatte, als es klingelte. Zum ersten Mal bei ihnen. Zwei Zirptöne. Einmal Zirpen war für Frau Ahnert.
In der Tür rang Mutter Grundig nach Atem. Die vier Treppen hatten ihr die Luft genommen. Sie musste erst ein bisschen verpusten, ehe sie ihren Ältesten ans Herz drücken und ihm zum neunundzwanzigsten Geburtstag gratulieren konnte. Nach herzlicher Umarmung half ihr Lea aus dem Mantel, und Hans führte die kleine, grauhaarige Frau zum besten Platz, dem einzigen gepolsterten Stuhl.
„Kinder! Ist bei euch der Wohlstand ausgebrochen?“ Martha Grundig staunte und betupfte sich mit einem Taschentuch die Stirn. öffnf
„Ach, Mutter. Du weißt doch. Der Preis.“
Hans Grundig war ein Kunstpreis verliehen worden. Gestiftet hatte diesen Preis der Millionär Hermann Ilgen, ein Dresdner Häusermakler und Industrieller der Chemie, der in seiner Fabrik Rattengift herstellte. Eintausend Mark erhielt Hans. Eine märchenhafte Summe. Sie ermöglichte, die Mietschulden in der Melanchthonstraße zu tilgen, Kohlen zu kaufen und für Lea warme Schuhe, für Hans einen Pullover; vor allem aber Arbeitsmaterial: Farben, Leinwände, Papier, Ölkreiden, Stifte, Keilrahmen unterschiedlicher Größe, eine gebrauchte Staffelei, ein zweites Reißbrett. Und endlich für jeden ein Atelier, wenn auch in der düsteren Gegend hinterm Dresdner Hauptbahnhof.
„Jetzt sind wir blank. Es reichte gerade noch zu Zigaretten.“ Lea sagte die Wahrheit. „Allein die Miete, die Frau Hilscher für ein Vierteljahr im Voraus verlangte, verschlang zweihundert Mark! Ohne Gas und Wasser!“
Martha Grundig seufzte. Sie konnte den beiden nicht aushelfen. Seit dem Tod des Mannes war sie selbst auf die Unterstützung durch die Tochter und die drei Söhne angewiesen, von denen der Herbert noch bei ihr lebte.
„Lass nur, Mutter!“ Hans streichelte ihre Schulter. „Mein Schwarzes und ich, wir schaffen es schon. Und ...“ Er zwinkerte pfiffig. „Auf der Ausstellung in Magdeburg werde ich verkaufen. Es gibt Interessenten für meine Bilder.“
Lea nickte bestätigend, mit schrägem Kopf auf das nächste Klingeln lauschend, während sie Wasser in den Teekessel füllte. Es ließ auch nicht lange auf sich warten. Hans wollte sich gerade über die von der Mutter für ihn gestrickten Socken freuen, als die nächsten Gratulanten erschienen: der lange Eugen Hoffmann und seine Frau Rose. Und ihr Begrüßungshallo vergrößerten die drei Frölichs, Kurt und Else samt der kleinen Sonja. Lea aber wartete auf zwei andere Gäste und versuchte sich damit zu trösten, dass es noch zu früh für sie sei. Noch hatten die Geschäfte geöffnet. Noch war eine Stunde bis Ladenschluss, und sie zögerte das Kaffeeaufbrühen hinaus. Die Nachzügler sollten auch einen Schluck „Heeßen“ abbekommen. Für mehr als eine Kanne reichten die Bohnen nicht. Das hatte Else geahnt. Sie steckte Lea ein Tütchen zu. Else konnte es sich leisten. Sie hatte Arbeit, und auch Kurt war bei der Zeitung fest angestellt. Anders sah es allerdings bei den Hoffmanns aus. Beide Künstler, und wer kaufte in diesen Zeiten einem Bildhauer eine Plastik ab.
Die vier Treppen n bisschen verpu- d ihm zum neun. Nach herzlicher Hans führte die n einzigen gepol-
Umständlich stopfte Eugen seine Pfeife, zündete sie an und begutachtete fachkundig mit Hans die neue Unterkunft. Sonja hängte sich still an Grundig. Der nahm die Vierjährige auf den Arm, zeigte ihr die Funken sprühenden Dampfrösser in der Tiefe und die grün und rot aufleuchtenden Signale, die Halt oder Einfahrt geboten. Die Lichter fesselten sie so, dass sie sogar das kleine Holzpferdchen mit dem Wagen auf Leas Bücherbrett vergaß, mit dem sie sonst immer spielte.
Kurt setzte sich nicht neben seine Frau aufs Bett, sondern quetschte sich auf das andere, das ebenfalls als Sofa diente, neben Rose. Von dort konnte er besser die echten Grundigs betrachten: die Jungenkammer, in der Hansens Schwester das Bett machte; den Gänseblümchentopf; den Brienzer See bei Mondschein; die Arbeitslose Zigarettenarbeiterin; das Mädchen mit Katze; vor allem aber das Bildnis von Lea in der kahlen Mansarde auf dem Stuhl, auf dem jetzt Mutter Grundig saß. Hans schaffte es gestern nicht, die Trennwand zu Leas Atelier frisch zu weißen, und behängte sie mit seinen Bildern.
„Lange kann ich nicht bleiben“, erklärte Kurt, „ich hab Nachtdienst.“
Hans antwortete ihm nicht. Er bastelte der Kleinen aus ihrem Taschentuch ein Mäuschen. Lea tuschelte mit Else, und Mutter Grundig erkundigte sich bei Rose nach deren Töchterchen. Kurt hörte zu und dachte nach.
Unter den Geruch von Ölfarbe, Terpentin und irgendetwas Widerlichem mischte sich endlich der Duft von Kaffee. Da klingelte es erneut. Dieses Mal ging Hans selbst öffnen.
„Hierher habt ihr Bande euch verkrochen!“ An der Stimme hörte Lea, dass es Johnny Friedlaender war. Zu früh hatte ihr Herz freudig gehopst. Wieder nicht die von ihr Erwarteten. Nervös vertropfte sie Kaffee beim Eingießen. Schwiegermutter Martha, die den wahren Grund ihrer Erregung nicht kannte, nahm ihr die Kanne nicht aus den Händen. Sollte sich die junge Frau an ihre Pflichten gewöhnen. Die Wirtschaftlichste schien sie ihr sowieso nicht. Sich rasch fangend, zwitscherte Lea: „Mein Schreck! Witschel, unsere Tassen reichen nicht.“
„Hauptsache, es ist genug zu trinken da“, meinte Eugen, dem Kurt seinen Platz neben Rose abtrat und der sich mühte, seine langen Beine unterzubringen. Kurt hockte sich etwas unbequem auf den Rand einer Holzkiste.
Der siebente Gast, ein schmalschultriger Jüngling, um den Hals einen Seidenschal, nickte allen grüßend zu, verharrte neben dem Öfchen und hielt seine knochigen, blau gefrorenen Hände über die glühende Platte. Er verkehrte erst seit Kurzem bei den Grundigs, war aus Breslau kommend zu ihnen gestoßen.
„Habt ihr euch wieder gestritten?“, fragte ihn Hans besorgt.
Nun drehte Else ihm ihr strenges Gesicht mit den kurzgeschnittenen, glatt aus der Stirn gekämmten Haaren zu und versuchte, ihm in die Augen zu sehen.
„Friedel hat Vorstellung. Sie will nachkommen“, sagte Johnny, genussvoll die Finger reibend. Im Flur hatte er dem Geburtstagskind eine Flasche überreicht. Für dieses Geschenk handelte er sich von Lea einen bösen Blick ein, tat aber, als bemerke er ihn nicht.
„Bringt Friedel die Dore mit?“ Else kannte Friedels Freundin noch nicht und war neugierig auf die Tänzerin.
Johnny wusste nicht, ob Friedel die Dore mitbrachte. Zwinkernd verständigten sich Lea und Else. Also doch verzankt. Lea drängte Kurts Frau die Kaffeekanne auf. Else sollte weiter einschenken. Derweil huschte Lea hinaus. Mächtig blass kehrte sie nach ein paar Minuten mit vier Tassen zurück. Angeekelt quälte sie sich ein Lächeln ab. „Frau Ahnert hält nebenan in ihrem Zimmer mindestens zwanzig Katzen.“
„Man riecht’s auf der Treppe.“ Eugen gehörte nicht zu den Leuten, die so etwas tragisch nehmen.
„Sie ist ein hilfsbereiter Mensch.“ Lea wies die Tassen vor, die sie ausgeliehen hatte. „Aber die Katzen ...“, stöhnte sie und presste die Linke an den Mund, als müsse sie Übelkeit unterdrücken. Hans miaute vergnügt.
Sofort verlangte Sonja, die Miezen zu streicheln. Da aber spielte Onkel Hans doch nicht mit. „Die fressen sonst unser Mäuschen.“
„Is ja nur ’n Taschentuch.“ Enttäuscht verzog die Kleine das Gesichtchen, bereit, loszuheulen, wurde rasch von Johnny abgelenkt, der seine Jacke aufknöpfte und durch die Räume stapfte, kräftig auftretend, als prüfe er, ob ihn die Dielen trugen. Nach einem flüchtigen Blick auf die Bilderwand begann er, die schlechte Qualität der Farben zu kritisieren, der Farben im Allgemeinen und der Ölfarben im Besonderen.
Kurt betrachtete ihn von der Seite und schwieg. Für Kurt Frölich existierten wichtigere Probleme. Er dachte an Meldungen, die er gestern Nacht in der Druckerei für die heutige Ausgabe der Zeitung gesetzt hatte. Nur Rose pflichtete Johnny bei. Die anderen tranken ihren Kaffee und stießen mit Hans auf seine Gesundheit und ein langes Leben an und auf den Verkauf der Bilder in Magdeburg.
„Prost!“, krähte Sonja begeistert und amüsierte sich über das ulkige Wort, das sich die Erwachsenen wie einen Zauberspruch zuriefen.
Im munteren Durcheinander sprang Lea plötzlich auf. Zirpte es nicht eben? Zweimal?
„Nee. Noch schafft sich Friedel auf der Bühne.“ Unbekümmert winkte Johnny ab.
Von seinem Geschwätz gereizt, ermahnte ihn Lea mit einer Handbewegung zur Ruhe und lauschte in die entstandene Stille. Draußen regte sich nichts. Lea setzte sich wieder. Der Hocker knarrte störrisch. Erst in diesem Moment begriff Hans, auf wen sie so sehnsüchtig wartete. Hatte sie es denn noch nicht aufgegeben? Ihr Kummer tat ihm weh. Zorn stieg in Hans hoch. Er griff nach der Flasche. Am Nachschenken hinderte ihn Kurt, der aufbrach.
„In den nächsten Tagen muss ich unbedingt mit dir sprechen“, sagte Kurt und streckte ihm die Rechte hin.
Fragend hob Hans seine buschigen Brauen.
,Je eher, desto besser“, sagte Kurt geheimnisvoll.
„Dann komm bald vorbei“, schlug Lea vor, die Kurt bis zur Treppe begleitete und ihm fürsorglich das Licht anknipste.
„Danke!“ Er flüsterte beinah, obwohl sie beide allein waren. „Mädchen, du musst dich damit abfinden, dass euch dein Vater nie besuchen wird. Du weißt doch am besten, er verzeiht dir den Hans nicht, den Goi und armen Künstler.“ Fester als sonst drückte Frölich ihre Hand.
Verwirrt blieb Lea stehen, bis unten die Haustür klappte und das Licht erlosch. Dem Kurt entgeht nichts, dachte sie. Was aber mochte er von Witschel wollen?
Die Fensterscheiben klirrten leise, doch laut genug, dass sie Lea weckten. Verdrossen blinzelte sie unter ihrer Zudecke hervor. Das musste der Prager D-Zug gewesen sein. Jeden Morgen gegen acht Uhr dreißig ließ er die Scheiben erzittern. Also war sie wieder eingeschlafen. Sie drehte sich von der Seite auf den Bauch. Dass Hans noch nicht vom Brötchenholen zurück war, wunderte sie. Denn wäre er zurück, hätte er ihr das Deckbett weggezogen. Gnadenlos. Fröstelnd stand sie auf, legte zwei Kohlen ins fast ausgebrannte Öfchen und setzte Kaffeewasser auf. Obwohl sie in dieser Wochenhälfte gar nicht mit der Hauswirtschaft dran war, sondern Hans. Sogar den Frühstückstisch begann sie zu richten. Ihr knurrte der Magen. Und Witschel bummelt, grollte sie, während sie sich, vor Kälte bibbernd, wusch. Außerdem muss er nachher aufs Arbeitsamt. Jeden dritten Tag musste er dort seine Stempelkarte vorlegen. Persönlich. Lea erhielt keine Arbeitslosenunterstützung. Als Ehefrau oblag ihr die Haushaltsführung, und Haushaltsführung galt als Berufsarbeit.
Rasch zog sich Lea an und horchte auf den Gesang im Treppenflur. „Wie kommt der Herr Meier auf den Himalaja ...“ Das interessierte sie im Augenblick am allerwenigsten. Wo blieb nur Hans? Schon begann das Wasser auf dem Öfchen zu summen. Hatte Hans unterwegs jemanden getroffen? Kurt? Um diese Stunde? Sie erinnerte sich, dass Kurt mit Hans etwas besprechen wollte. Mit Kurt wäre er heraufgekommen, obwohl sie damit rechnen mussten, Lea noch im Bett zu finden. Wenn schon. Sie kannten einander lange und gut genug. Unruhe beschlich sie.
Hätte Lea das Fenster geöffnet, den Kopf in den Wind gesteckt und ein bisschen nach rechts geschaut, hätte sie ihren Hans inmitten der Leute stehen sehen, mit dem Netz am Arm, darin die vier Brötchen, für zehn Pfennig Milch, ein Achtelchen vom billigen Kaffee, ein Achtelchen Butter, den kleinen Limburger Käse und die zehn Zigaretten. Hans Grundig war mit seinem Einkauf schon auf dem Heimweg gewesen, da geschah vor seinen Augen das Grässliche.
Voller Vorfreude, wie er sein Schwarzes wecken würde, schlenkerte er mit dem Netz, als irgendwo über ihm Kinder in höchster Angst losschrien. Noch ehe er den Kopf heben konnte, senkte sich ein Schatten und schlug ein paar Meter vor ihm auf den Bürgersteig. Eine Frau, mit dem Gesicht nach unten, lag auf den Steinen, die Arme wie eine Gekreuzigte von sich gestreckt.
Menschen liefen zusammen. Hans wurde vorangestoßen. Ein Mann mit einer hässlichen Narbe auf der Stirn rief nach einem Arzt, ein anderer nach einem Polizisten. Der war auch als erster zur Stelle.
„Weitergehen! Gehen Sie weiter.“ Mit seiner Trillerpfeife pfiff er sich Verstärkung herbei. Trotzdem ging niemand weiter. Im Gegenteil. Der Zuschauerkreis um die Tote wuchs. An Hansens Ohr drangen Gesprächsfetzen:
„Das ist nun schon die zweite.“
„Was blieb ihr denn übrig?“
„Morgen wollte der Hauswirt sie raussetzen lassen. Mit der Miete war sie drei Monate im Rückstand.“
„Der Mann starb letzten Herbst an der Schwindsucht.“
„Arbeit fand sie keine.“
Aus dem Fenster springen ist doch kein Ausweg, dachte Hans erregt.
„Sollte sie denn zusehen, wie ihr ein Kind nach dem anderen verhungert?“
„Und nu?“, fragte der Mann mit der Narbe.
„Im Waisenhaus kriegen sie wenigstens einmal am Tag ’ne Suppe.“
„Mein Gott, deckt sie doch wenigstens zu ...! Deckt sie doch zu!“
Ein Rollwagenkutscher vom Bahnhof erbarmte sich und warf eine Pferdedecke über die Tote.
„Wer ist sie?“, fragte der Polizist barsch die Umstehenden und zückte sein Notizbuch.
„Mutter...“, jammerte ein Stimmchen. Fünf heulende, abgemagerte Kinder mit vor Entsetzen geweiteten Augen schmiegten sich aneinander und wagten nicht, sich zu rühren. Das ganze Elend der Welt blickte Hans aus diesen Kinderaugen entgegen. Die Wirtschaftskrise. So sah sie aus. Eingebrockt von den Reichen, um noch reicher zu werden. Aber die Herren sollten sich verrechnet haben, schwor sich Hans erschüttert und empört. Wir sind auch noch da!
Eine verhärmte Alte, die zu dem Narbigen zu gehören schien, nahm sich der zitternden Geschwister an, führte sie weg von der toten Mutter und verschwand im nächsten Torweg mit ihnen. Zu spät begriff Hans, warum ihn das Kleinste, das sich kaum auf seinen Beinchen halten konnte, so unverwandt angesehen hatte. Die Brötchen in seinem Netz! Er war wütend auf sich, soweit er in seiner Bestürzung wütend sein konnte. Lea hätte mit ihm aufs Frühstück verzichtet. Wäre ja nicht zum ersten Mal, dass sie fasteten. Gewöhnlich konnten sie sich nur eine Mahlzeit leisten, morgens oder mittags. Und da die Nacht lang war, entschieden sie sich meistens für das Frühstück. Hans wollte den Kindern hinterher, wurde aber abgedrängt. Der Kriminalkommissar fuhr vor.
Hans wirkte derart verstört, dass Lea, die ihn schmollend empfangen wollte, nur besorgt fragte: „Was ist passiert?“
Wortlos reichte er ihr das Netz, zog seine Joppe aus und ließ sich auf seinen Stuhl fallen.
„Witschel! Was ist denn bloß passiert?“
Bisher hatte er zwar in der Arbeiterstimme täglich davon gelesen. In keinem Land Europas nähmen sich augenblicklich so viele Frauen das Leben wie in Deutschland. Nun hatte er es erlebt. Mit eigenen Augen angesehen. Er erzählte.
„Die armen Kinder ...“ Ein kalter Schauer überrieselte Lea. Sie dachte an den Tag, an dem sie ihre Mutter, die schwer krank gewesen war, verloren hatte, und sie stöhnte: „Gott, der Gerechte!“
„Er ist eben nicht gerecht!“, sagte Hans aufgebracht.
„Nein.“ Schon lange hielt Lea nichts mehr von ihrem Gott. „Er ist ungerecht. Warum lässt er solch Elend zu?“
„Weil sie es zulassen, die Arbeiter. Weil sie zulassen, dass sich das Kapital auf ihre Kosten gesund frisst!“
Bevor Lea den Hans kennenlernte, hatte sie nichts von solcher Not geahnt. Im Hause ihres Vaters, des Textil- und Möbelkaufmanns Moritz Langer, herrschte kein Mangel.
Lea legte Hans ein halbes Butterbrötchen auf den Teller, damit er das Essen nicht vergaß. Hans übersah es. Er spürte keinen Hunger. Mit der einen Hand massierte er seine Stirn, mit der anderen fingerte er eine Zigarette aus der Schachtel. Erst jetzt bemerkte er, dass Lea bereits die Betten gemacht und die morgendliche Unordnung beseitigt hatte, was hieß, sie wollte sich sofort nach dem Frühstück an ihre Zeichnungen setzen.
„Selbstmord ist doch kein Ausweg“, wiederholte er sich.
„Witschel ...“ Sie dachte an die gelbgesichtige Frau mit dem Säugling auf dem Arm, die ihr gestern im Treppenhaus begegnete. Würde die sich wehren? Sich auflehnen? Für sich und ihr Kind um irgendein Recht kämpfen? Fehlte ihr nicht sogar die Kraft, neidisch zu sein auf das Leben der Herrschaften, denen sie den Dreck aus der Wäsche schrubbte und die sie ohne Gewissensbisse um ihren Lohn betrogen? Ewig niedergehalten, fand sie sich mit allem ab. „Witschel, sie wissen es nicht besser.“
Überrascht sah er sein Schwarzes an. „Man muss es ihnen sagen. Wir müssen es ihnen sagen. Wir!“
Lea nickte. Auch sie fühlte sich nicht berufen, Elfen zu malen, die auf der Nasenspitze eines Bären tanzen. Längst hatte sie sich anders entschieden. „Ja, wir sollten ihnen sagen, dass es einen Ausweg gibt.“
„Aber wie? Wie es sagen?“ Er pustete den Rauch aus den Mundwinkeln, dass er Lea nicht belästigte, und kniff das linke Auge leicht zu. Er fragte nach den künstlerischen Mitteln, Lea nach dem Ziel. „Zum Nachdenken müssen wir anregen. Ausbeuter sind nämlich nicht nur begüterte Leute, sondern auch wissende, gebildete. Sie verstanden, sich Vorteile zu schaffen, sie zu nutzen, und sie denken nach, wie sie diese behalten können.“ Lea sprach aus Erfahrung.
„Freilich, zum Nachdenken war die zu abgerackert.“ Hans kam von der Selbstmörderin nicht los. Überdeutlich erwachten Einzelheiten. Verdichteten sich bildhaft. Quälten ihn. Das Geflatter des Rockes im Herabstürzen. Die Hände, die lebendig wirkten. Der fünffache Kinderschrei klang in ihm nach. Hans verbrannte sich fast die Lippen am Zigarettenstummel. „Sie sind schwächer als wir. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen“, sagte er, vor sich hin brütend. Dann schwieg er minutenlang. In seinen Augen las sie die Frage: Wie?
Mit der Zungenspitze fuhr Lea über den Rand ihrer Tasse. Erleichtert atmete sie auf, als Hans sich regte und doch vom Brötchen abbiss, wenn auch nur ein, zwei Happen. „Vielleicht fällt dir in der Schlange vor dem Arbeitsamt etwas ein.“ Sie stellte ihre leere Tasse auf die Tischplatte zurück.
Unten wurden Güterwagen rangiert. Puffer knallten aneinander. Hans verzog sein Gesicht. Ihn ärgerte, dass er vorm Arbeitsamt seine Zeit vertrödeln musste. Lieber hätte er sich vor die Staffelei gestellt. Aber sie brauchten die sechs Mark. Sonst gab’s morgen und übermorgen kein Frühstück. Aufs Mittagessen musste sowieso verzichtet werden. Er wurde wieder lebhaft, stemmte sich mit beiden Händen vom Tisch ab und stand auf „Wenn es heute nicht zu lange dauert, geh ich beim Frölich-Kurt vorbei.“
„Frag, wann es Else passt. Ich brauch sie mit Sonni als Modell“, bat ihn Lea und aß den Rest seines Brötchens.
Hans versprach, es nicht zu vergessen, meinte aber, sie fände doch hier im Hause genügend Modelle. Eins um das andere wie für sie geschaffen.
„Ach!“ Auch sie erhob sich. „Hier kenne ich noch niemand. Die Frau Ahnert kommt erst spät heim. Außerdem muss ich die Zeichnungen für die Gardine fertigmachen.“ Konnte Lea mit ihrer Arbeit schon nichts verdienen, weil ihr niemand ein Blatt abkaufte, wollte sie doch etwas Nützliches tun. Sie unterstützte die Betriebszeitung der Gardinenweberei in Dobritz. So blieb sie in Übung und hatte ein Ziel.
Lea hatte sich derart in ihre Arbeit verbissen, dass sie Zeit und Stunde vergaß. Aber sie konnte es sich leisten. Sie brauchte also nicht zu erschrecken, als Hans gegen ein Uhr wieder im Zimmer stand.
„Schon?“, fragte sie.
„Wo steckt der Schurke!“, herrschte er sie von der Tür her an.
„Du störst mich.“ Ein wenig unwillig tauchte sie die Zeichenfeder in die schwarze Tusche.
„Wo der Schurke steckt, will ich wissen!“ Hans sprang aus der Jacke.
Lea lachte. Sie durchschaute sein Spiel. „Wer?“
„Wo hält er sich verborgen?“ In vorgetäuschtem Zorn guckte Hans unters Bett und hinter die Bilder an der Wand. „Else sagte, Kurt sei hier.“
„Verrückter Kerl!“ Lea presste den Rücken gegen die Stuhllehne und hob die Schultern. Das tat gut. „Bei mir war Kurt nicht. Und du solltest dich lieber an den Herd scheren. Ein paar Nudeln sind noch im Schrank.“
„Die bleiben fürs Abendbrot.“ Hans wollte sehen, was sie gezeichnet hatte. Er trat hinter sie, neigte sich zu ihr hinab und umarmte die Sitzende. Kopf an Kopf begutachteten sie gemeinsam die Entwürfe. „Mein liebes Leamädchen! Mancher unserer Kollegen könnte von dir lernen. Wie bin ich stolz auf dich.“
„Unrasiert bist du wieder mal.“ Trotzdem schmiegte sie ihre Wange an seine.
Es klingelte.
„Das wird Kurt sein.“ Lea entzog sich Hansens Armen.
Es war Kurt.
„Nun, schon ein bisschen eingelebt?“ Seine derben Schuhe gründlich auf der Fußmatte reinigend, blickte er von Hans zu Lea und wieder zu Hans. Zu dritt ließen sie sich in dessen Atelier nieder, Kurt so, dass er die Bilder vor sich hatte. Er stellte fest, dass die Wände inzwischen in einem fast weißen Grau gestrichen waren und dass die Grundigs geheizt hatten. „Wieder einen Kaufmann gefunden, der anschreibt?“
Ja, den hätten sie gefunden. Aber augenblicklich brauchten sie für Brot und Milch nicht anschreiben zu lassen, nur für größere Dinge, für Fleisch etwa, und darauf verzichteten sie.
„Fünf Fasten sind uns wöchentlich beschert, und unsre Zähne sind so lang wie Rechen. Und keine Kuchen, nein, zu trocknem Brot kann ich, soviel ich Lust hab, Wasser zechen ...“, zitierte Hans seinen Lieblingsdichter, den Franzosen Villon.
Kurt schaute Hans freundlich in die Augen, saß ein paar Minuten schweigend da, als lausche er nur dem Bahnhofslärm, bis er fragte: „Welches willst du auf der Sommerausstellung zeigen?“ Er nickte zu den Bildern hinüber.
Hans, der die Tür zu Leas Atelier schloss, um die Wärme nicht sinnlos nach nebenan verströmen zu lassen, runzelte die Stirn. Darüber hatte er sich bisher keine Gedanken gemacht, und Lea feixte über das dumme Gesicht ihres Mannes. Noch war’s nicht einmal richtig Frühling. Aber ein Kurt Frölich fragte nicht grundlos. Sie musterte ihn gespannt-neugierig.
Ohne hinzusehen, nahm Hans eine Farbtube und drehte sie spielerisch in den Händen. „Ich will noch bessere Bilder malen.“
„Gut und schön ..., doch zu wem sprechen sie, deine Bilder? Wen erreichen sie? Wer schaut sie sich an?“ Und auf Leas erstaunte Miene fügte Kurt hinzu: „Sind eure Figuren mit den Leuten bekannt, die sie begaffen?“
„Müssen sie das?“ Hans warf die Tube zurück in den Kasten, in dem er seine Vorräte aufbewahrte.
Kurt Frölich antwortete nicht, schwieg, als wollte er den beiden Zeit zum Nachdenken gönnen. „Selbst wenn mehr von uns Arbeitern in die Galerie gingen, verstehen sie denn die Bilder von Otto Dix?“ Wieder verstummte er. Sein Blick blieb an der Lea auf der Leinwand hängen. „Kann deine Zigarettenarbeiterin oder die Gerda Laube etwas mit den Arbeiten von Kokoschka oder Klee anfangen?“
Hans überlegte kurz und schüttelte den Kopf. Er hatte Dix früher sehr geschätzt. Aber jetzt, so fand er, hatte das Bürgerleben Dix kaputtgemacht, und er stellte nur noch die kleinen persönlichen Erlebnisse einer absterbenden Klasse dar.
„Dich würden sie verstehen. Bei dir fänden sie sich, wenn sie gingen. Wenn!“
Der mit der Narbe oder die Alte, die sich heute Morgen der Waisen annahm, dachte Hans, die gehen bestimmt nicht, weder in den Zwinger noch in die Sommerausstellung auf der Brühlschen Terrasse. Obwohl sie vor Langeweile nicht wissen, wohin. Und die, welche noch Arbeit haben und das Eintrittsgeld, interessiert nach der Schinderei nur der Topf Suppe und das Bett. Lange genug hatte Hans als Stubenmaler gerackert, um das beurteilen zu können.
„Sie trauen sich nicht“, sagte Lea ärgerlich. „Sie glauben, Kunst ist nur für Gebildete.“
Im Raum wurde es dunkler. Ein Regenschauer jagte über die Stadt, warf sich nass auf die Dächer.
„Sie trauen sich nichts zu, springen lieber aus dem Fenster ...“ Hans wanderte zwischen Ofen und Staffelei. Unter seinen Füßen knackte das Parkett.
Kurt folgte ihm mit Blicken.
„Also ... müsst ihr nach anderen Wegen suchen. Entgegengehen müsst ihr ihnen. Sie brauchen euch. Wer sonst sollte ihnen die Welt erklären? Die Nazis?“
Hans umrundete seine leere Staffelei. Lea wickelte eine Locke über ihren rechten Zeigefinger. Hans beobachtete sie, und einen Augenblick lang wünschte er, mit ihr allein zu sein, sie in die Arme zu schließen, ihr Haar zu streicheln, sie zu küssen. Doch schon hörte er wieder auf Kurt. „Marx allein schafft es nicht. Außerdem erreichen wir in unseren Versammlungen nur diejenigen, die längst bereit sind, das elende Leben zu verändern. Ihr kennt ja das Problem.“
Sie kannten es. Schließlich waren Hans und Lea seit vier Jahren Genossen von Kurt und Else. Keinem Befehl waren sie gefolgt, sondern ihrem eigenen Willen und dem Gefühl der Verantwortung füreinander. Um die Kraft ihrer Gemeinsamkeit zu nutzen, um sich gegenseitig zu unterstützen, war Kurt Frölich gekommen. Die beiden Künstler brauchten Aufträge, und die Partei suchte nach Möglichkeiten, ihre Ziele zu erläutern, Augen zu öffnen und neue Mitglieder zu gewinnen. Kurt bat die Grundigs, dabei zu helfen. Er versprach sich eine große Wirkung von der künstlerischen Darstellung wichtiger politischer Situationen. Als kleinformatige Grafiken vielleicht, die man pro Stück für zwanzig oder dreißig Pfennig unter den Arbeitern verkaufen konnte. Zehn Pfennig sollten an Hans fließen und zehn in die Parteikasse.
„Drucken könntet ihr nachts bei uns in der Arbeiterstimme, auf der Handpresse“, bot Kurt an. Er stellte sich Holzschnitte vor. Holzschnitte, wie sie in vergangenen Jahrhunderten benutzt wurden, um auf Jahrmärkten und Messen die Parolen der Zeit unter den einfachen Leuten zu verbreiten.