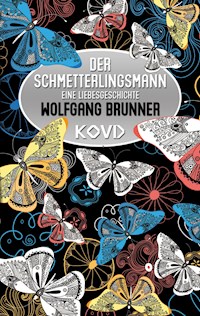4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Oftmals nimmt das Abartige im Leben der Menschen einen deutlich größeren Raum ein, als man auf den ersten Blick meint.
Verschleiert hinter ihren Masken tragen sie vielerlei Dinge in sich, die wir nicht für möglich halten. Einige dieser Dinge halten sie selbst nicht für möglich. Es bedarf äußerster Vorsicht, hinter diese Masken zu sehen, damit die Menschen keinen Schaden nehmen.
Markus Lawo hat eine Reihe namhafter und noch nicht namhafter Autor*innen gefunden, um diese Abgründe zu ergründen.
Wolfgang Brunner
DAS EWIGE LEBEN DES JOHN SMITH
Emely Meiou
VERMISST
Jutta Wölk
TODSÜNDEN
Ralf Kor
221 A
Marvin Buchecker
SHERLOCK HOLMES
UND DER VERRÜCKTE ARABER
Moe Teratos
DAS RESTAURANT AN DER BAKER STREET
Markus Kastenholz
DARHAM: BLACK
Jean Rises
DRAGFOOT
Doris E. M. Bulenda
EIN DETEKTIV TUT ...
COLJA NOWAK
Sascha Dinse
POST MORTEM
Thomas Tippner
NUR NICHT SHERLOCK HOLMES
Raven Roxx
BLOOD-RIPPER
Jacqueline Pawlowski
DIE LAST
Nici Hope
EBENE NULL
Timo Koch
IM BANN DER GRÜNEN FEE
Nicole Renner
JASON, JACKS ERBE
Markus Lawo
I HOLD YOUR HAND IN MINE
Elli Wintersun
ZWISCHENWELT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Abartige Geschichten - Baker Street
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenIntro / Vorwort
ABARTIGE GESCHICHTEN
Baker Street
Herausgegeben von
Markus Lawo
Vollständige Buchausgabe 2020
Copyright © Hammer Boox, Bad Krozingen
Lektorat & Korrektorat:
Hammer Boox, Bad Krozingen
Doris E. M. Bulenda
(Fehler sind völlig beabsichtigt und dürfen ohne Aufpreis
behalten werden)
Titelbild: Markus Lawo
Satz und Layout: Hammer Boox
Copyright © der einzelnen Beiträge bei den Autoren
2 / 20 - 15
EINE BITTE:
Wie ihr vielleicht wisst, ist HAMMER BOOKS noch ein sehr junger Verlag.
Nicht nur deshalb freuen wir uns alle, wenn ihr uns wissen lasst, was ihr von diesem Roman haltet.
Schreibt eine Rezension, redet darüber, fragt uns, wenn ihr etwas wissen wollt...
Sir Arthur Conan Doyle entlieh sich bekanntermaßen den Namen dieser Londoner Straße und verschaffte ihr mit seiner Romanschöpfung Sherlock Holmes, die er dort mit ihrem treuen Begleiter Dr. John Watson wohnhaft werden ließ, einen legendären Ruf, der bis in die heutigen Tage anhält.
Dass der grandiose Ermittler - der Mr. Holmes literarisch unzweifelhaft war - seine Fälle auf zumeist leise Weise und dennoch nicht unspektakulär löste, war nur ein Bruchstück zum Erfolg dieser Erzählungen. Dass diese allesamt seltsam bis skurril waren, stellt ein weiteres Puzzleteil dar. Wenn wir nun noch als letzte Zutaten Kannibalen, schreckliche Gesichter am Fenster und unmögliche Selbstmorde geben, nähern wir uns dem, was die geneigte Leserschaft in dieser Anthologie finden wird.
Geschichten, die mal bizarr, auch brutal, bisweilen gar brachial, aber immerfort bitterböse daherkommen und ihre Wirkung bei denen nicht verfehlen werden, die genau auf diese Art und Weise angesprochen werden wollen.
Darauf, dass sich der werte Markus Kastenholz als Verleger, sowie der gute Markus Lawo als Herausgeber dessen durchaus bewusst waren, als sie diesen Titel erwählten, würde ich höchstpersönlich meinen Kopf wetten …
Ergebenst
Ihr Bernar LeSton
Beschreibung
Oftmals nimmt das Abartige im Leben der Menschen einen deutlich größeren Raum ein, als man auf dem ersten Blick meint.
Verschleiert hinter ihren Masken tragen sie vielerlei Dinge in sich, die wir nicht für möglich halten. Einige dieser Dinge halten sie selbst nicht für möglich. Es bedarf äußerster Vorsicht, hinter diese Masken zu sehen, damit die Menschen keinen Schaden nehmen.
Markus Lawo hat eine Reihe namhafter und noch nicht namhafter Autor*innen gefunden, um diese Abgründe zu ergründen.
Inhaltsverzeichnis
INHALT:
Wolfgang Brunner
DAS EWIGE LEBEN DES JOHN SMITH
Emely Meiou
VERMISST
Jutta Wölk
TODSÜNDEN
Ralf Kor
221 A
Marvin Buchecker
SHERLOCK HOLMES
UND DER VERRÜCKTE ARABER
Moe Teratos
DAS RESTAURANT AN DER BAKER STREET
Markus Kastenholz
DARHAM: BLACK
Jean Rises
DRAGFOOT
Doris E. M. Bulenda
EIN DETEKTIV TUT ...
COLJA NOWAK
Sascha Dinse
POST MORTEM
Thomas Tippner
NUR NICHT SHERLOCK HOLMES
Raven Roxx
BLOOD-RIPPER
Jacqueline Pawlowski
DIE LAST
Nici Hope
EBENE NULL
Timo Koch
IM BANN DER GRÜNEN FEE
Nicole Renner
JASON, JACKS ERBE
Markus Lawo
I HOLD YOUR HAND IN MINE
Elli Wintersun
ZWISCHENWELT
Wolfgang Brunner - Das ewige Leben des John Smith
Ich lege den Griffel zur Seite und lausche.
Ich bin nicht sicher, ob die Auseinandersetzung in der Wohnung links oder rechts neben der meinen stattfindet. Entweder es handelt sich um John Smith, diesen Kunstliebhaber, der Miss Oliver immer beim Malen zusehen will, oder diesen Sherlock Holmes, bei dem ich noch nicht genau weiß, was er eigentlich im Schilde führt.
Sie müssen wissen, ich habe die kleine Wohnung in der Baker Street 221b noch nicht lange bezogen und kenne die Mieter noch nicht detailliert genug, um etwas Genaueres über sie sagen zu können. Aber das wird sich noch ändern, wie ich mich einschätze.
Smith scheint ein netter Kerl zu sein, wenn man von seinem allabendlichen Gejammer absieht, das er aller Wahrscheinlichkeit nach der Gicht wegen von sich gibt, die bei ihm von seinem Arzt vor kurzem diagnostiziert wurde. Woher ich das weiß?
Ich bin Schriftsteller. Oder, besser gesagt, ich möchte einer werden. Und daher habe ich es mir angeeignet, meine Umgebung und Mitmenschen aufs Genaueste zu beobachten. Ich würde fast sagen, sie bis ins letzte Detail zu analysieren, um möglichst viel für meine Arbeit herauszufiltern.
Mein Name ist Arthur Ignatius Conan Doyle und ich bin vor wenigen Tagen 23 Jahre alt geworden. Seit letztem Jahr führe ich eine mehr oder weniger gut gehende Arztpraxis in der Nähe von Portsmouth. Ich verdiene gerade genug, um einigermaßen zu überleben, wollte es mir aber dennoch nicht nehmen lassen, diese kleine Stube in der Baker Street anzumieten, in der ich an den Wochenenden versuche, zu schreiben.
Aber lassen Sie mich auf das Streitgespräch zurückzukommen, das sich gerade in der Wohnung neben der meinen abspielt. Es sind zwei Stimmen, die ich heraushöre, also nehme ich an, dass es sich auch nur um zwei Personen handelt, die sich in einer Sache uneinig sind. Beides sind Männerstimmen. Dominant und kräftig.
»Ich bin ein Andersdenkender, na und?«, vernehme ich den ersten der Streithähne, den ich aufgrund seiner tiefen Stimme eindeutig als John Smith identifiziere.
»Das heißt aber noch lange nicht, dass deine Gedanken richtig sind«, entgegnet der zweite. Ich vermute, dass es sich um Sherlock Holmes handelt, jenen jungen Mann, der mir seit meinem Einzug in der Baker Street niemals unangenehm aufgefallen ist. Im Gegenteil: Er ist immer äußerst aufmerksam und hilfsbereit, wenn ich ihm im Treppenhaus begegne.
»Mich beschäftigen so viele Dinge, die anscheinend keinen in gleichem Maße interessieren«, ereifert sich Smith. »Meine Krankheit, die Evolution, die Stellung der Menschheit darin … all die Trauer und die Schmerzen, von denen die Menschen heimgesucht werden. Ich meine, was bedeutet denn eigentlich der Tod? Sind wir dann tatsächlich für alle Zeiten verloren, wenn er uns ereilt? Und was halten Sie vom Schicksal der Frauen? Was ist mit der Ehe, Holmes?«
Nun ist eindeutig klar, dass es sich bei den Männern nebenan um John Smith und Sherlock Holmes handelt. Ich greife nach dem Griffel und notiere die beiden Namen auf das leere Blatt Papier, das vor mir auf dem Schreibtisch liegt:
John Smith
Sherlock Holmes
Beide Namen haben einen angenehmen Klang und eignen sich hervorragend zur Benennung eines meiner Protagonisten. Ich lächle und unterstreiche Sherlock Holmes. Als ich kurz darauf Smiths nächste Worte vernehme, ändere ich meine Meinung, streiche Holmes Namen durch und mache einen Kreis um den von Smith. Der Satz, der mich umstimmt, lautet folgendermaßen:
»Würde jemand meine Lebensgeschichte literarisch festhalten – all meine trüben Aussichten, herzergreifenden Hoffnungen, traurigen Gedanken und vergeudeten Lebensstunden – so wäre dies wohl eine der traurigsten Aufzeichnungen, die je verfasst wurden. Jeder Tag meines Lebens ist wie ein eigenes Kapitel, in dem ich mich einmal mehr mit den Tragödien dieses unsäglichen Lebens auseinandersetze. Ha …!«, er lacht laut auf, »… was sage ich: Auseinandersetzen muss. Denn was bleibt mir anderes übrig, als mich mit diesen lebensnotwendigen Dingen zu befassen?« Er macht eine Pause, in der auch Holmes kein Wort von sich gibt. »Robert Louis Stevenson zum Beispiel … Er wäre durchaus geeignet, meinen Lebensbericht schriftlich festzuhalten.«
Jetzt werde ich hellhörig und umkreise John Smiths Namen ein weiteres Mal. Smith hat soeben von einem zeitgenössischen Schriftsteller gesprochen, der mich erst vor kurzem mit seinen Geschichten im Cornhill Magazine überzeugt hat. Vor allem seine Erzählung Der Pavillion auf den Dünen, in der ein Vagabund die Liebe seines Lebens findet, hat es mir angetan. Ich habe den Artikel, der vor drei Jahren in besagtem Magazin erschien, ausgeschnitten und über die Zeit hinweg mehrmals gelesen. Eine bedeutende Geschichte, wenn nicht die größte der Weltliteratur.
Und nun meint mein Nachbar, dass ebenjener Robert Louis Stevenson geeignet wäre, seine Memoiren zu verfassen … Das ist eine Herausforderung ganz nach meinem Geschmack, und ich beschließe spontan, mich fortan dem Leben meines Nachbarn in sämtlichen Details anzunehmen.
Schon überlege ich, wie es anstellen könnte, um so schnell wie möglich Kontakt mit ihm aufzunehmen.
Warum eigentlich nicht sofort? So könnte ich Mr. Holmes ebenfalls gleich kennenlernen, würde beides auf einmal erreichen. Denn bei einem bin ich mir schon jetzt sicher: Sherlock Holmes wird eines Tages ebenfalls in einem meiner Romane, die ich hoffentlich in den nächsten Jahren noch schreiben werde, erscheinen. Charakterstudien sind außerordentlich wertvoll, wenn man Schriftsteller werden will.
Also entschließe ich mich, die Nachbarswohnung auf der Stelle aufzusuchen.
***
Die Stimmen verstummen schlagartig, nachdem ich den Türklopfer betätigt habe. Verhaltenes Murmeln, gefolgt von schnellen Schritten, die sich der Wohnungstür nähern.
Als sich die Tür einen Spalt öffnet, blickt mir ein etwa fünfzigjähriger Mann mit wildem Schnauzbart entgegen. »Sie wünschen?« Er wirkt angespannt und ich vermeine in seinen Augen eine widersprüchliche Mischung aus Schmerz und Hoffnung zu erkennen.
»Ich … ähm, mein Name ist Arthur Conan …«
»Doyle«, beendet er mein Stammeln. »Ich weiß, wer Sie sind, mein Herr. Sie sind in die Wohnung neben mir eingezogen.«
»Vollkommen richtig«, erwidere ich, nunmehr gefasst, und reiche ihm meine Hand. »Doyle ist mein Name. Ich wollte Sie fragen, ob Sie einen Moment Zeit für mich haben.«
Smith zögert, sieht über die Schulter zurück in seine Wohnung und wendet sich dann wieder in meine Richtung. »Wobei kann ich Ihnen behilflich sein?« Er will mich wohl nicht hereinbitten.
»Wenn ich ehrlich bin, verehrter Herr, so muss ich gestehen, dass ich soeben einen Teil des Gesprächs zwischen Ihnen und Mr. Holmes unabsichtlich aufgeschnappt habe. Und ich hätte da einen Vorschlag, der von eventuellem Interesse für Sie sein könnte. Ich …«
»Sie haben uns belauscht?« Er klingt nicht entrüstet, sondern eher erstaunt.
»Nicht direkt belauscht«, entgegne ich beschämt. »Es war vielmehr so, dass Ihre Stimmen laut genug waren, um durch die nicht allzu dicken Wände an meine Ohren dringen zu können.«
Smith öffnet ohne ein weiteres Wort die Tür und bittet mich, einzutreten.
»Ich hatte gehofft, Sie würden es hören«, murmelt er, als ich mich an ihm vorbei ins Innere der Wohnung zwänge.
Ich stutze, weil ich denke, dass ich seine Worte nicht richtig verstanden habe. Aber schon innerhalb der nächsten Minuten wird mir klar, dass ich meinen Nachbarn richtig verstanden hatte.
Das Zimmer, in das mich John Smith führt, wirkt wie der Salon eines vornehmen Herrenhauses. Seine Dimensionen wirken auf mich im ersten Moment wie die eines Tanzsaales. Große, mehrflügelige Fenster geben den Blick auf die unserem Haus gegenüberliegende Gebäudefront frei.
Ein zierlich anmutender Schreibtisch steht vor einem der Fenster. Daneben eine Frisierkommode, in deren dreiteiliger Spiegelanordnung ich vor meinem geistigen Auge die von Smith hoch verehrte Miss Oliver sehe, wie sie sich das Haar frisiert. Auch das übrige Mobiliar scheint aus einer Zeit zu stammen, in der man Herrenhäuser derart mondän einrichten ließ. Ein monumentales Ölgemälde, das eine beeindruckende Berglandschaft darstellt, hängt über einer schulterhohen Kommode aus dunkler Eiche. Daneben befindet sich eine massive Chaiselongue im viktorianischen Stil aus wunderschönem Mahagoni. Die unterschiedlichen Farben der beiden nebeneinanderstehenden Möbelstücke stellen in meinen Augen zwar einen enormen Stilbruch dar, wirken aber auf widersprüchliche Weise dennoch äußerst reizvoll auf mich. Pfauen in zartblauer Tönung, verziert mit Pflanzenmotiven, bedecken die viktorianische Tapete an den Wänden und ein flauschiger Ohrensessel steht neben einem offenen Kamin. Ich frage mich, wie meine Unterkunft derart schäbig ausfallen kann, während neben mir ein wahrer Palast zum Vorschein kommt. Verschnörkelte Kopfenden schmücken ein Bettgestell, das sich im Nebenzimmer befindet, in das ich durch eine offenstehende Tür sehen kann. Flankiert wird das prunkvolle Bett auf der einen Seite von einem antiken Waschtisch und auf der anderen Seite von einem wuchtigen Kleiderschrank mit ovalen Spiegeln auf den Türen. Ein zerwühltes Laken liegt darauf, unter dem sich die Umrisse eines Menschen – oder zumindest eines menschenähnlichen Wesens – abzeichnen.
Holmes steht, mit einem Glas Whisky in der Hand, neben dem Kamin und sieht mich erwartungsvoll, aber keineswegs überrascht an.
»Mr. Doyle …« Er nickt mir zu und hebt zum Gruß das Glas.
»Darf ich Ihnen etwas anbieten?«, wendet sich Smith an mich und lächelt freundlich. »Whisky? Ein Bowmore? Oder ein Talisker? Er kommt direkt von der Insel Skye in Schottland. Äußerst edel, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.«
Ich entscheide mich für letzteren, weil ich schon davon gehört habe und neugierig bin.
»Nun denn, Mr. Doyle. Wir haben Sie also erwartet«, beginnt Smith das Gespräch.
»Ehrlich gesagt haben wir darauf vertraut, dass Sie unserem kleinen, nebenbei bemerkt, arrangierten, Disput folgen«, fügt Holmes hinzu und wartet geduldig, bis Smith meinen Whisky eingeschenkt hat.
»Es war Ihre Absicht, dass ich das alles höre?«, erkundige ich mich überflüssigerweise, weil ich mir auf gewisse Weise wie in einem Traum vorkomme.
»Korrekt«, äußert Smith knapp und reicht mir das halbvolle Glas. Er greift nach seinem eigenen, das auf der Kommode neben dem Kamin steht, und wendet sich zuerst in meine und dann in Holmes’ Richtung. »Womit beginnen wir?«
Holmes zuckt mit den Schultern und deutet dann auf das Zimmer, in dem ich das prachtvolle Bett gesehen habe. »Vielleicht mit der Lösung deines Problems?«
Smith sieht mich mit ernstem Blick an und nickt dann. »Du hast recht, Sherlock. Miss Oliver wird meine Rettung sein.«
»Rettung?«, wiederhole ich verwundert. »Rettung wovon?«
Smith deutet auf das elegante Sofa neben der Kommode. »Nehmen Sie doch Platz, werter Herr Doyle. Es wird eine längere Geschichte, die ich Ihnen gleich mit Hilfe meines Freundes erzähle.«
Seine Augen wirken jetzt freundlich und bei weitem nicht mehr so ernst und bedrückt wie noch vor wenigen Momenten. Es scheint, als löse die Aussicht auf eine Erklärung jener Situation diesen Stimmungswechsel aus. Ich nehme Platz, nippe noch einmal aus Verlegenheit an meinem Whisky und richte dann meine volle Aufmerksamkeit auf John Smith.
»Also gut, ich fange am besten mit meiner Krankheit an«, eröffnet er das Gespräch.
Ich werde den Eindruck nicht los, dass es sich um eine Art Beichte handeln könnte, denn mein Gegenüber knetet nervös seine Hände, während er beginnt:
»Rheumatische Gicht«, flüstert er und senkt seinen Blick zu Boden, als schäme er sich ob dieses Leidens. »Es begann eindeutig mit dieser vermaledeiten Gicht, die in meinen Gelenken steckt. Doktor Turner hat mir vor einigen Wochen Arthritis urica diagnostiziert. Seit diesem Zeitpunkt stehen meine Gedanken nicht mehr still, und ich sinniere Tag und Nacht über alle möglichen Dinge nach. Nicht nur über mein eigenes Schicksal, das mir schubweise unerträgliche Schmerzen bereitet, sondern auch über weltliche Probleme wie Politik, Kriege und zentrale Fragen der menschlichen Rasse.«
»John beschäftigt sich seitdem zum Beispiel mit der für ihn ausnehmend wichtigen Frage, warum Menschen eigentlich erkranken«, wirft Holmes ein und lächelt mich freundlich an. »Wie sieht das ideale Leben eines Menschen aus? Wo liegt die Grenze zwischen Gut und Böse? Wieso werden die Geschöpfe unserer Welt von Trauer und Tod geplagt? Ist es möglich, Unsterblichkeit zu erlangen? Ich könnte noch viele weitere Dinge aufführen, die John beschäftigen, aber diese Beispiele sollten genügen, um die nachfolgenden Worte zu erklären.«
»Danke, Sherlock. Ich bin wirklich dankbar, dass Sie mir zur Seite stehen und mich in meinem Bestreben unterstützen.«
Ich schaue die beiden Männer eine Weile an und trinke aus Verlegenheit einen weiteren Schluck Whisky.
»Nun denn, begeben wir uns ins Nebenzimmer«, schlägt Smith vor und betritt als erster den Schlafraum. Seine Miene ist wieder ernst. »Treten Sie näher, mein Herr. Sie sollen dies alles schriftlich festhalten, wenn Sie mögen. Deshalb sprachen wir vorhin laut genug, damit wir Ihre Neugier weckten.« Er dreht sich in meine Richtung und lächelt verschmitzt. »Das ist uns gelungen, nicht wahr? Schließlich sind Sie hier. Ich deute es als ersten Erfolg.«
Ich nicke, weiß aber nicht, was ich antworten soll und bleibe daher schweigsam.
Der Raum riecht nach Frühling. In diese Frische mischt sich allerdings auch ein unterschwelliger Geruch nach Verwesung, sodass ich mich unbeabsichtigt schüttle.
»Entschuldigen Sie bitte den Gestank. Es lässt sich leider nicht ganz vermeiden, dass …«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, John«, unterbricht Holmes und winkt mich zu sich. »Kommen Sie doch zu mir, Doyle.«
Ich folge seiner Bitte und stelle mich neben ihn auf die linke Seite des Bettes, während Smith sich auf der rechten Seite im oberen Drittel positioniert.
»Was geschieht hier?«, murmle ich.
»John wird es Ihnen gleich erklären«, vertröstet mich Holmes.
»Unsterblichkeit«, sagt Smith. »Das ist es, was mich bewegt und beschäftigt. Das Leben ist zu kurz … eindeutig.«
Ich halte die Luft an und überlege, ob ich hinüber in meine Wohnung gehen und tun soll, als wäre dies alles nicht geschehen.
»Und was habe ich damit zu tun? Ich meine, mit Ihrem Wunsch nach Unsterblichkeit?«
»Wie ich schon sagte: Sie sollen meine Geschichte für die Nachwelt festhalten. Sie könnte von großem Interesse sein. Sie werden in wenigen Augenblicken verstehen, was ich damit meine.«
Er lächelt erneut und beugt sich über das Bett. Zärtlich fährt er mit seiner Hand die Konturen der Gestalt nach, die unter dem Laken liegt und schlägt es dann etwa einen halben Meter zurück.
Das wächserne Gesicht einer Frau ist zu sehen, und ich brauche eine Weile, bis ich erkenne, dass es sich um die ehrenwerte Miss Oliver handelt.
»Was …? Wieso …?« Ich kann keine meiner beiden Fragen aussprechen, weil mir der Anblick die Sprache verschlägt. Miss Oliver sieht aus, als schliefe sie. Oder als wäre sie tot …
»Keine Sorge, sie ist nicht tot«, wendet sich Sherlock Holmes an mich und legt beruhigend eine Hand auf meine Schulter. »Auch wenn es so aussieht. Aber der Dame geht es gut …«
»Noch …«, murmelt Smith und streichelt ihr sanft über die Wangen. »Noch geht es ihr gut, lieber Holmes. Aber in wenigen Minuten werde ich sie ihrer Seele berauben.«
»Ihrer Seele?« Ich stütze mich an dem massigen Kleiderschrank ab, der direkt hinter mir an der Wand steht. »Aber wie soll das vonstattengehen? Woher wissen Sie, dass der Mensch eine Seele besitzt?«
Smith lächelt erneut. »Weil ich sie gesehen habe.«
Er deutet auf Miss Olivers Körper und schiebt jetzt das Bettlaken bis zu ihren Hüften hinab. Das erste, was mir auffällt, sind die wunderschön geformten Brüste der Frau, die nackt vor uns liegt. Ich kann meinen Blick für mehrere Sekunden nicht davon losreißen und wende meine Aufmerksamkeit erst später der offenen Wunde neben ihrer linken Brust zu. Ich spüre leichte Übelkeit in mir aufsteigen und halte vorsichtshalber meine rechte Hand vor den Mund.
Eine Stelle über ihrer Scham ist blutverschmiert, ansonsten sieht der Körper, bis auf die aufgeklappte Brustpartie, unversehrt aus.
»Ist sie tot?«, erkundige ich mich, obwohl mir vor wenigen Augenblicken noch bestätigt wurde, dass es ihr gutgehe.
»Sie ist narkotisiert«, bestätigt Smith. »Wir sind allerdings nicht sicher, wie lange sie diesen Eingriff ohne medizinische Hilfe überlebt.«
»Wir haben ihren Körper erst vor etwa einer halben Stunde aufgeschnitten«, erklärt Holmes, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. »Sie wird ohnehin sterben. Ein Mensch ohne Seele kann nicht existieren.«
»Aber …« Ich trete einen Schritt näher an das Bett und betrachte das Gesicht des Opfers. Die Augen sind geschlossen, der Brustkorb hebt und senkt sich gleichmäßig wie bei einer Schlafenden. »Sie muss ins Krankenhaus.«
»Sie muss mir ihre Seele geben«, berichtigt Smith und sieht mich an wie ein unschuldiges Kind. »Dies allein ist der Zweck dieser Maßnahme.«
Er beugt sich noch weiter über den Körper und deutet auf die Wunde. Ich vermeine, das Pulsieren ihres Herzens inmitten des Fleisches zu erkennen.
»Hier drin verbirgt sich das Geheimnis des ewigen Lebens«, flüstert er ehrfurchtsvoll.
»Im aufgeschnittenen Körper eines Menschen vermuten Sie einen Jungbrunnen?«, frage ich verblüfft. Der Mann erscheint mir vollkommen verrückt. Ich wende mich an Holmes, der regungslos neben mir steht und seinen Freund beobachtet.
»Herzschlag bedeutet Leben«, sagt er nach einer Weile, als wäre auch er von dieser Idee überzeugt.
»Aber nicht nur hier«, redet Smith weiter. »Auch im Gehirn verbirgt sich der Schlüssel.«
»Was haben Sie vor?« Ich spüre, wie ich zu zittern beginne. Das ganze Szenario um mich herum macht mir Angst.
»Ich werde unsterblich«, flüstert John Smith verzückt und haucht Miss Oliver einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Ich verspeise ihr Herz und anschließend das Gehirn.«
»Das ist … widerlich«, presse ich hervor und wende mich von dem furchterregenden Anblick ab, um Sekunden später der morbiden Faszination zu erliegen und doch wieder hinzusehen. »Dadurch können Sie niemals ewiges Leben erlangen. Sie sind ein Mörder … das ist alles.«
»Überlassen Sie es doch einfach mir, wie ich diese Sache angehe«, entgegnet Smith. »Ich bin krank und habe Schmerzen. Ihr Herz wird mir neue Kraft verleihen. Und ihr Gehirn wird mich verjüngen, sodass mir mehr Zeit auf dieser Welt bleibt. Miss Oliver ist bedeutend jünger als ich. Ich werde also ihre Jugend in mir aufnehmen …«
»Sie sind verrückt«, unterbreche ich den Redeschwall des Mannes. »Sie haben vollkommen den Verstand verloren.«
Weder Smith noch Holmes reagieren auf meine Worte.
Ersterer dehnt die Wunde in der Nähe des Herzens mit einem schmatzenden Geräusch und rüttelt mit Auf- und Abwärtsbewegungen im Inneren des Körpers. Ich unterdrücke ein Würgen, als Smith mit einem einzigen Ruck einen blutigen Klumpen herauszieht.
Miss Oliver atmet zwischenzeitlich nicht mehr. Sie ist tot.
Ich frage mich, welche Droge sie ihr verabreicht haben, weil sie sich kein einziges Mal bewegt geschweige denn aufgebäumt hat.
Smith hält kurz inne und betrachtet das Organ in seiner rechten Hand, während er die linke an seinem Hosenbein abwischt.
Ich komme mir vor wie in einem unwirklichen Traum und wende erneut das Gesicht vom Geschehen ab, sodass ich nur anhand des unappetitlichen Geräuschs mitbekomme, wie Smith den Herzmuskel tatsächlich verspeist.
Wie kommt er nur auf die Idee, dass er durch das Verzehren eines Herzens unsterblich wird?, durchzuckt es mich. Ich höre, wie sich Holmes neben mir bewegt und wende mich ihm zu:
»Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Teile von ihr isst.« Meine Gedanken überschlagen sich, und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Soll ich John Smith angreifen und daran hindern, seine grauenvolle Tat weiterhin auszuführen? Oder soll ich aus der Wohnung flüchten und die Polizei benachrichtigen?
»Ich habe schon mehrmals versucht, ihn umzustimmen«, gibt mir Sherlock Holmes zur Antwort. »Aber er wollte nichts davon hören.«
»Aber Sie machen sich doch mitschuldig an diesem Mord«, presse ich zwischen den Zähnen hervor. Ich werfe einen kurzen Blick auf Miss Oliver und beobachte, wie sich Smith mit einem Skalpell über sie beugt und, mit fachmännischem Ausdruck im Gesicht die Haut an ihrer Stirn anritzt. »Er begeht gerade eine Straftat. Das muss doch verhindert werden!«
Holmes legt mir erneut eine Hand auf die Schulter und zieht mich sanft in seine Richtung. »Wir tun einfach so, als hätten wir nichts gesehen«, flüstert er.
»Wie können Sie nur …?«
Mein Ekel hält sich momentan zwar in Grenzen, aber ich bin weiterhin zutiefst schockiert von der Kaltblütigkeit meines Wohnungsnachbarn.
Mit einem in die Länge gezogenen, unter die Haut gehenden Schmatzen löst sich die Kopfhaut und gibt einen albtraumhaften Blick auf Fleischgewebe frei, unter dem der Schädelknochen hervorschimmert.
»Ja, bald ist es soweit«, seufzt Smith und zieht den Hautlappen zurück, wobei er einen dicken Schleimfaden mitzieht. Im selben Augenblick, in dem ich mich frage, wie ein Mensch ein solches Gemetzel ertragen kann, beginnt Smith mehrmals zu würgen. Knatschend löst sich die Haut vom Schädel. Smith rülpst laut und wirft den Skalp achtlos zur Seite. Seine Augen glühen, als stünde er unter Drogen.
Eine gelbliche Flüssigkeit sprudelt aus dem Schädelknochen hervor, den Smith Sekunden vorher mit einem kleinen Hammer aufgeschlagen hat.
Ich bekomme Gänsehaut und halte mich an Holmes fest, der mich bereitwillig stützt. Ohne seine Hilfe wäre ich mit Sicherheit gestürzt. Meine Beine fühlen sich an wie Pudding, und ich setze mich mit einem leisen Stöhnen an den Rand des Bettes. Den Gedanken, dass ich neben einer Leiche sitze, ignoriere ich geflissentlich.
Smith hat es in der Zwischenzeit geschafft, den Schädel zu spalten und das darunter liegende Gehirn annähernd freizulegen. Ich starre wie paralysiert auf den Kleiderschrank und versuche, die Geschehnisse um mich herum zu ignorieren. Zum wiederholten Mal frage ich mich, warum ich nicht einfach die Flucht ergreife und diese Hölle verlasse.
Ich vernehme ein abscheuliches Schlürfen und Schmatzen und weigere mich, mir entsprechende Bilder, die in meinem Kopf versuchen, Gestalt anzunehmen, mit meinem geistigen Auge anzusehen.
Holmes setzt sich neben mich, hält sich mit beiden Händen die Stirn und seufzt leise, als könne auch er plötzlich nicht mehr länger diese Grauen erregende Tat ertragen.
»Die Ära der Zivilisation ist nur eine schmale Grenze zur dichten Schwärze der menschlichen Frühgeschichte«, murmelt Smith wie von Sinnen. Als ich ihn ansehe, erkenne ich den Mann nicht wieder. Seine Gesichtszüge sind nicht nur blutverschmiert, sondern auch verzerrt wie die eines Monstrums, das dem Gehirn eines Schriftstellers entsprungen ist. Smiths Augen sind blutunterlaufen und ich erkenne, dass mehrere Adern darin geplatzt sind. Das verleiht dem Mann zu seinen Taten noch zusätzlich das Aussehen eines irren Mörders, vor dem man sich in Acht nehmen muss.
»Ich habe den Tod besiegt … und das Leben«, zischelt er. »Religionen sind nichtig, denn ich, der Mensch, und nicht Gott, habe das Geheimnis des ewigen Lebens entdeckt. Ja, ich werde niemals sterben. Ich. Bin. GOTT!« Das letzte Wort schreit er heraus, als hätte man ihm einen Speer durch die Brust gestoßen. Er stützt sich am Bettrand ab, starrt mich mit seinen unnatürlich geweiteten Augen an und grinst wie von Dämonen besessen. »Ja, ich bin der Herrscher über Leben und Tod.«
Smith stürzt und wälzt sich sekundenlang im Raum zwischen Bett und Waschtisch. Letzterer kippt um und verstreut mit lautem Scheppern diverse Utensilien wie Bürsten, Kämme, Scheren und einen Rasierpinsel. »Nun hat Miss Oliver ihr Schicksal erfüllt. Die Bestimmung aller Frauen, die nur zu dem einen Zweck auf dieser Erde weilen: Dem Manne zu dienen, in sexueller wie in ehelicher Verpflichtung.«
Trotz aller Grausamkeiten, deren Zeuge ich soeben geworden bin, verschlägt mir sein Chauvinismus die Sprache. Ich bin erschüttert über die Ignoranz und Dummheit, mit der er das weibliche Geschlecht auf derartige Rollen reduziert und spüre eine unbändige Wut in mir hochsteigen. Ich schaue kurz zu Holmes, der noch immer sein Gesicht in den Händen vergräbt und nicht mehr beachtet, was um ihn herum geschieht.
»Es reicht«, flüstere ich und erhebe mich wie in Zeitlupe. Mein Blick fällt auf das Skalpell, das neben Miss Olivers Leiche auf dem Kopfkissen liegt. Während Smith sich unter dem umgestürzten Waschtisch aufrappelt, greife ich wie in Trance nach dem chirurgischen Instrument. Meine Sinne sind betäubt von dem unbeherrschten Hass, der mich von einer Sekunde auf die andere ergreift. Ich habe nur noch einen Gedanken: Ich muss diese Bestie umbringen, bevor sie noch einen weiteren Mord an Sherlock Holmes oder mir begeht!
Mit einer Kraft, die mir bis zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht bewusst war, drehe ich mich um meine eigene Achse und stoße ohne Vorwarnung Smith das Messer in die Kehle. Dann reiße ich es wieder heraus.
Der röchelt und schaut mich verblüfft an, als er hintenüber kippt und auf den Waschtisch fällt. Ein Gurgeln dringt aus der Kehle meines Wohnungsnachbarn, und ein Schwall aus Gallenflüssigkeit und unverdautem Herz und Gehirn ergießt sich über meine Beine und den unteren Teil des Betts. Ich springe über den am Boden liegenden Smith und packe Holmes am Kragen, der noch immer bewegungslos dasitzt und keinerlei Reaktion zeigt.
Nachdem ich ihn aber berührt habe, springt er auf und schlägt Smith übers Bett hinweg mitten ins Gesicht, sodass dieser erneut stürzt.
Ich schiebe Holmes aus dem Zimmer und wende mich noch einmal Smith zu, der mittlerweile auf den Beinen ist und in meine Richtung torkelt. Ohne zu zögern ramme ich ihm das Skalpell zwischen die Augen und reiße den Griff nach links und rechts. Dann stoße ich den Mann zurück in Richtung Bett und renne ins Nebenzimmer, wo Holmes mich verwirrt erwartet.
»Was ist geschehen?«, stammelt er, als hätte er diesen grauenhaften Mord vergessen. Ich bin sicher, dass er unter Schock steht und im Moment nicht weiß, was um ihn herum vorgeht. Ich schlage die Tür zum Schlafraum zu und ziehe Holmes mit mir durch den Wohnraum. John Smith wird meine Attacken nicht überleben, davon bin ich überzeugt.
Ich nehme den innen steckenden Schlüssel an mich und werfe noch einmal einen letzten Blick zurück. Dann verlassen wir, die wütenden und qualvollen Schreie Smiths ignorierend, die Wohnung, und ich lasse es mir nicht nehmen, sie hinter uns abzuschließen.
Ich lasse Holmes den Vortritt in meine Unterkunft und schließe auch hier die Tür ab, hier allerdings von innen. Wir lassen uns auf meine schäbige Couch fallen und holen tief Luft. Wir schließen beide die Augen und versuchen, an etwas anderes als das soeben Geschehene zu denken. Der Albtraum ist vorüber. Ich komme zur Ruhe und gewinne meine alte Selbstsicherheit zurück. Nicht ich bin der Schuldige, sondern John Smith.
»Seine Idee klang von Anfang an unlogisch«, äußert Holmes nach einer Weile.
»Aber warum haben Sie ihn unterstützt? Wieso haben Sie nicht die Polizei gerufen?«
Sherlock Holmes sieht mich eine Weile an und richtet dann seinen Blick auf den Boden. »Er hat mich bedroht. Sagte, er würde mich umbringen, wenn ich bei seinem Vorhaben nicht mitmache. Außerdem hatte er mich in der Hand, weil er von Dr. Watson weiß.«
»Watson?«
»Mein Begleiter … Freund … äh …«
Ich entschließe mich, die für Holmes unangenehme Situation zu ignorieren und wechsle das Thema. Mir ist klar, dass Holmes dem Anschein nach besondere Gefühle für diesen Watson hegt, aber nicht näher darauf eingehen will.
»John Smith wollte, dass ich über sein Leben schreibe«, lenke ich in eine andere Richtung. »Er wusste also, dass ich Schriftsteller bin?«
Holmes nickt. »Wir vermuteten es vielmehr. Bei Ihrem Einzug erzählten Sie Miss Oliver davon, dass Sie hier etwas zu Papier bringen wollten und deswegen …« Er spricht den Satz nicht zu Ende und schaut verlegen auf seine Hände.
»Schon gut«, beschwichtige ich. »Sie hatten recht. Ich habe tatsächlich vor, in der literarischen Welt Fuß zu fassen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich habe nicht vor, mein Leben lang Arzt zu bleiben. Und wissen Sie was?« Ich hole tief Luft und verdränge die Erinnerungen an die Geschehnisse in der Nebenwohnung aus meinen Gedanken. »Ich werde einen Roman über Sie schreiben, Mr. Holmes. Und, wenn Sie möchten, auch über diesen Dr. Watson.« Ich mache eine Pause und deutete in Richtung von Smiths Wohnung. »Aber vorher werde ich John Smith tatsächlich unsterblich machen.«
Verdutzt blickt Holmes auf. »Wie meinen Sie das?«
»Nun ja, ich werde einen Roman über ihn schreiben. Welche Ängste und Hoffnungen er hatte. Und Sie werden mir dabei helfen, einverstanden? Sie kennen doch ein paar Begebenheiten aus seinem Leben, oder? Und danach kommen Sie und Watson dran.« Ich betrachte seine scharlachrote Krawatte. »Ich könnte die Geschichte Eine Studie in Scharlachrot nennen.«
»Sehr aufmerksam, aber was machen wir mit Miss Olivers und Smiths Leichen?«
»Über dieses Problem können wir später noch nachdenken. Wir lassen sie verschwinden. Als wäre nichts geschehen«, schlage ich vor. »Wie oft werden Leichen oder Leichenteile in der Themse gefunden?«
Ich erhebe mich, gehe zu meinem Schreibtisch und greife nach dem Griffel.
»Das ewige Leben des John Smith. Was halten Sie von diesem Titel?« Ich will ihn gerade auf das leere Blatt Papier schreiben, als ich innehalte. »Nein, das hat er eigentlich nicht verdient, oder? Ich bevorzuge einen etwas bescheideneren Buchtitel, wie etwa Die Erzählung von John Smith. Ja, das klingt sehr gut. Ich beginne mit der Gicht. Die hat ihm anscheinend die meisten Probleme in seinem Leben bereitet. Habe ich recht, Mr. Holmes?«
Sherlock Holmes nickt.
»Also gut. Los geht’s …«
Und ich beginne:
»Gicht oder Rheuma, Doktor?«, fragte ich.
»Ein bisschen von beidem, Mr. Smith«, sagte er.
Emely Meiou - Vermisst
Die Hände auf die Hüften stemmend, stand ich vor meinem Mann. Wie immer hatte Jonathan ein Glas mit billigem Scotch in der Hand. Und wie üblich lehnte er sich, wenn er trank, und das tat er oft und gern, dabei tief in seinen Sessel.
Ich unterdrückte den Drang, ihm schon wieder zu sagen, dass er sich, anstatt sich zu betrinken, lieber einen Job suchen sollte. Einen, bei dem er länger als ein paar Wochen durchhielt.
Scheinbar war er meinen missbilligenden Blick leid. Er erhob sich, wobei er mich abfällig ansah.
»Ich gehe ins Jacks.«
Ich verdrehte die Augen. »Es ist doch noch früh am Tag«, versuchte ich ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. Doch meine Worte schienen ihm durch das eine Ohr rein und das andere wieder rauszugehen. Ich hielt ihn am Arm fest, wohl wissend, dass mir dieser Versuch ein blaues Auge einbringen konnte. Die Scham vor weiterem Getuschel unserer Nachbarn und den anderen Leuten aus der Baker Street war größer als meine Furcht vor einer Tracht Prügel.
»Verdammt, Weib, lass meinen Arm los«, brüllte er und holte zum Schlag aus.
Das Bimmeln der Türglocke bewahrte mich vor Schlimmerem.
Jonathan prustete laut und ging genervt zur Haustür. Mit einem Ruck öffnete er sie, und ich konnte die alte Mrs. Rosenberg erkennen.
Verdammt! Nicht jetzt!
Schnell setzte ich ein künstliches Lächeln auf. »Ah, Mrs. Rosenberg.« Ich trat an meinem Mann vorbei und begrüßte sie. »Haben Sie einen neuen Hut? Der steht Ihnen ausgezeichnet.«
»Vielen Dank, mein Kind«, lächelte sie mich an, doch nur einen Moment darauf erstarb ihr Lächeln und ich erkannte, woran es lag.
»Darf ich mal vorbei?«, herrschte Jonathan mich an. Ohne unsere Nachbarin eines Blickes zu würdigen, verschwand er mit seiner Jacke unter dem Arm von der Bildfläche.
Ich seufzte unwillkürlich.
»Machen Sie sich nichts daraus, Liebes. Männer sind … Ach ja … Männer eben.«
Von Dutzenden ihrer Erzählungen über ihren zweiten Ehemann wusste ich ganz genau, was sie mit ihrer Aussage meinte.
Auch sie hatte einen Trinker zum Gatten gehabt, doch das Glück war ihr hold gewesen, denn eines Nachts, nachdem er wieder einmal über den Durst getrunken hatte, verlor er das Gleichgewicht und fiel in die Themse, wo er ertrank.
»Ich wollte eigentlich nur kurz zum Markt gehen und wollte wissen, ob Sie etwas benötigen?«, fragte sie mich.
»Wie lieb von Ihnen, aber nein, vielen Dank.«
»Gut, gut, dann will ich Sie nicht von Ihren Aufgaben abhalten.« Sie tätschelte mir den Arm und machte auf dem Absatz kehrt. Ich wollte gerade die Tür schließen, als sie noch einmal in meine Richtung sah.
»Sagen Sie, Kind, haben Sie auch Besuch von diesem Privatdetektiv bekommen?«, fragte sie mich mit Neugier in der Stimme. »Ein sonderlicher Mensch«, fügte sie hinzu und rümpfte die Nase. »Hat mir auf penetrante Art und Weise Fragen gestellt. Skurrile Fragen.«
Ich spürte, wie sich meine Brauen zusammenzogen. »Nein. Was für ein Privatdetektiv denn?«
»Nun ja …« Sie kam wieder auf mich zu und hielt die Hand an ihren Mundwinkel, so als wollte sie nicht, dass jemand anderes unser Gespräch mitbekam.
»Es geht um die Familie Beckinsale. Sie wissen schon … Tragisch, wirklich tragisch. Ich bete seither jeden Tag und jede Nacht zum Herrn, dass er die Kleine zu ihrer Familie zurückbringen möge.«
»Aber ich dachte, die Polizei würde sich um den Fall kümmern?«, fragte ich verdutzt.
»Die Polizei? Pah! Kindchen, Sie müssen es doch besser wissen. Diese ungehobelten Kerle sind doch allesamt Nichtsnutze. Ja, sich wichtig tun, das können sie, aber ihrer Arbeit gewissenhaft nachgehen?« Sie zog eine ihrer grauweißen Brauen hoch. »Nein, nein, die Familie tat recht daran, einen Privatdetektiv anzuheuern, auch wenn sie sich meiner Meinung nach lieber einen anderen hätten nehmen sollen.«
Zustimmend nickte ich ihr zu. »Ich hoffe nur, dass Matilda schnell und unversehrt zu ihrer Familie zurückkommt.«
Ich musste wohl traurig geschaut haben, denn sofort zogen ihre Mundwinkel nach unten und sie streichelte mir über den Arm. »Ich weiß ja, wie gern Sie sie mochten und dass Sie oft mit ihr gespielt haben.«
Mochten? Es missfiel mir, dass sie die Vergangenheitsform gebrauchte, so als sei Matilda schon tot.
Da ich nichts erwiderte, schien sie das als Aufforderung zum Beenden unserer Unterhaltung aufzufassen. Sie drehte sich um und warf mir, während sie zum Treppenhaus ging, über die Schulter einen Blick zu. »Und Sie brauchen wirklich nichts?«
Ich schenkte ihr ein aufgesetztes Lächeln. »Nein, vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Tag, Mrs. Rosenberg.«
Ich lehnte mich gegen meine geschlossene Haustür und seufzte. Dieses Theaterspiel raubte einem nicht nur Zeit, sondern kostete auch einiges an Kraft. Ich konnte diese aufdringliche alte Kuh nicht ausstehen. Ihre täglichen Besuche, die neugierigen Fragen um mein Wohlbefinden und die hochnäsigen Blicke, die sie meinem Mann nachwarf. Was erlaubte sie sich? Nur mir als Ehefrau standen diese Blicke zu!
Meine Gedanken kreisten um ihre Worte. Privatdetektiv. Ein sonderlicher Mensch. Ob er auch mich aufsuchen würde? Ich hatte weiß Gott genug um die Ohren, als mich auch noch mit einem Schnüffler auseinandersetzen zu müssen.
Nachdem ich bis zum frühen Nachmittag meine Haushaltsarbeiten erledigt hatte, ging ich unruhig durch meine kleine und spärlich eingerichtete Wohnung – und sah dabei immer wieder aus dem Fenster. Worüber machte ich mir eigentlich Sorgen? Wusste ich doch, dass er vor Anbruch des Abends und bis ihm das letzte bisschen Geld ausgegangen war, ohnehin nicht nach Hause kommen würde. Mrs. Rosenbergs geringschätziger Gesichtsausdruck sowie die mitleidvollen Blicke der anderen Bewohner des Hauses schwirrten mir durch den Kopf.
Bitte, Jonathan, komm nicht angetrunken und schon gar nicht um die Zeit, in der die Nachbarn dir über den Weg laufen könnten, nach Hause. Bitte, Gott, bewahre mich vor weiterer Schmach!
Ein lautes Poltern schreckte mich auf. Ich erhob mich von der Fensterbank und ging in den Flur. Da war es wieder. Doch diesmal drangen auch unverständliche Worte an mein Gehör. Kurz bevor ich die Haustür erreichte, wurden die Stimmen erheblich lauter.
Gott, nein! Ich befürchtete das Schlimmste.
Ruckartig öffnete ich die Tür und sah in die Gesichter meiner Nachbarn Luisa und Kenneth. Luisa hielt ihren Gatten am Arm fest. Kenneths Gesichtsausdruck jagte mir einen kurzen Schauer über den Rücken. Nie zuvor hatte ich ihn so aggressiv gesehen. Beide sahen in Richtung Treppenhaus.
Mich hatten sie scheinbar nicht bemerkt. Ich trat aus der Tür und hielt den Atem an.
Jonathan.
Ich presste die Zähne zusammen. »Luisa. Kenneth.« Ich nickte den beiden freundlich zu. »Jonathan, Liebling, geh schon mal rein.« Ich umfasste seinen Arm und zog ihn mit mir. Mein ganzer Körper brannte insgeheim vor Scham.
»Lass mich!«, keifte er und entzog mir seinen Arm. »Ich habe den beiden doch nur gesagt, dass sie auf ihre Tochter besser hätten aufpassen müssen«, lallte er eher, als dass er die Worte aussprach.
Ich wollte im Boden versinken. Auf der Stelle, hier und jetzt.
»Du verdammter …«
»Nein!«, schrie Luisa und versperrte ihrem wutentbrannten Mann den Weg, indem sie sich vor ihn stellte.
Wie angewurzelt stand ich da und sah abwechselnd zu Kenneth und zu dem Mann, dessen Geburt ich fast täglich verfluchte.
»I-ich … Ich bitte euch vielmals um Entschuldigung.« Beschämt sah ich die beiden kurz an und ging dann zu Jonathan. »Bitte, Jonathan …« Ich wollte ihn gerade erneut am Arm fassen, als er von sich aus in Richtung Haustür ging. Mein Herz machte einen Freudensprung.
»Wer weiß das schon?«, stammelte er und blieb plötzlich stehen.
Geh weiter, verdammt!, schoss es mir durch den Kopf.
»Ja, vielleicht sind sie es«, sagte er, und es schien, als würde er Selbstgespräche führen.
Ich stupste ihn sanft in den Rücken, damit er weiterging.
»Wie war das?«, presste Kenneth zwischen den Zähnen hervor.
Jonathan blickte mich mit einem merkwürdigen Ausdruck an. »Du hast doch gesagt, dass die beiden überfordert sind. Immer musstest du auf das Gör aufpassen. Deine Worte«, grunzte er grinsend. »Vielleicht haben sie«, er deutete mit dem Finger zu unseren Nachbarn, »sie umgebracht und ihre Lei…«
Noch ehe er aussprechen konnte, versetzte Kenneth ihm einen kräftigen Faustschlag mitten ins Gesicht.
Jonathan taumelte unter dem Geschrei Luisas nach hinten und fiel zu Boden, was Kenneth nicht davon abhielt, brutal auf ihn einzutreten.
Eine Stimme in mir jubelte beim Zusehen.
Luisa war es, die ihren Mann daran hinderte, weiterzumachen.
Jonathan lag bewegungslos und schwer zugerichtet da. Blutstropfen klebten nahe meiner Füße ringsum auf dem Steinboden. Sein Gesicht war fast unkenntlich geworden durch all das Blut und die Schwellungen, doch mein Mitgefühl blieb aus.
Ich hörte Kenneth neben mir schwer atmen und seine Frau wimmern. Sie kauerte sich, am ganzen Körper zitternd, gegen das Geländer. Aus den Augenwinkeln bekam ich mit, wie er sich neben seine Frau stellte und versuchte, sie zu beruhigen.
Am liebsten hätte ich den Tunichtgut von Gatten im Treppenhaus liegen lassen, doch ich musste den Schein einer liebevollen Ehefrau den Nachbarn gegenüber wahren.
Ich ging auf ihn zu und hockte mich hin. Zögernd rüttelte ich an seiner Schulter. »Jonathan! Jonathan, hörst du mich?«
Unwillkürlich sah ich zu den beiden hinüber. Luisa wandte ihr Gesicht beschämt ab. Ich wunderte mich über ihr Verhalten. Hätte jemand so über mich gesprochen, ich hätte nicht schuldbewusst weggesehen.
Kenneth sah indes hasserfüllt zu meinem Mann, noch immer mit geballter Faust.
Unter meiner Hand bewegte sich etwas. Jonathan stöhnte und hustete gleich darauf.
»Komm, ich helfe dir.« Ich nahm seinen Arm, um ihn über meine Schulter zu legen und ihn zu stützen.
Mit der freien Hand fasste er sich an den Kopf und fing laut zu lachen an.
»Nicht, Ken«, hörte ich Luisa rufen. Sie hielt ihn davon ab, sich erneut auf meinen Mann zu stürzen.
»Gar nicht mal übel«, faselte Jonathan neben mir. »Hätte ich dir gar nicht zugetraut.«
Er stieß mich unsanft von seiner Seite und stützte sich am Türrahmen ab, immer noch grinsend.
»Darf ein Mann heutzutage nicht das aussprechen, was er denkt?« Er hustete stark. »Ich wollte doch damit nur zu verstehen geben, dass jeder von uns das kleine Gö… das Mädchen in seine Fänge hätte bringen können.« Schwankend und schelmisch grinsend sah er dabei über seine Schulter zu dem Paar hinüber. »Du, du, du.« Er deutete mit dem Zeigefinger auf die beiden und auch auf mich. »Oder auch ich selbst. Ja, sogar die alte Mrs. Rosenberg könnte Matilda geschnappt haben«, fügte er hinzu und schob sich an mir vorbei in die Wohnung.
Mit großen Augen sah mich das Paar an. Mir fiel nichts ein, was ich ihnen hätte sagen können in dieser beschämenden Situation, weswegen ich auf dem Absatz kehrtmachte und hineinging.
Jon hatte es nicht einmal bis ins Schlafzimmer, geschweige denn in die Stube geschafft. Bewusstlos lag er zwischen Flur und Wohnzimmer. Ich schüttelte mit verächtlichem Ausdruck den Kopf und trat über ihn hinweg. Der Entschluss, der mich seit Monaten beschäftigte, war gefallen. Ich würde ihn verlassen. Doch nicht jetzt. Heute benötigte ich nur noch Schlaf und vorher ein Glas Whiskey.
***
Lautes Donnern ließ mich im Bett aufschrecken. Ich sah vom Schlafzimmer in Richtung Stube und entdeckte meinen noch immer in Schlaf versunkenen Mann, der nach wie vor auf demselben Platz lag.
Erleichtert seufzte ich, dass der Krach nicht von ihm verursacht worden war.
Wieder drangen Geräusche an mein Ohr, nur dieses Mal konnte ich sie identifizieren. Es klopfte an der Haustür. Mrs. Rosenbergs Bildnis erschien vor meinem geistigen Auge.
Trotz der Erkenntnis, dass ich heute nicht zur Arbeit musste, entschied ich mich, nicht an die Tür zu gehen. Sollte sie doch von mir denken, was sie wollte. Mir war es gleich. Ich würde ohnehin nicht mehr lange unter diesem Dach leben.
Ich erhob mich vom Bett und sah auf die Uhr, woraufhin ich erschrak.
Um Himmels Willen, so spät? Ich muss heute hin. Gestern war ich schon nicht bei ihr.
Nachdem ich mich hergerichtet und ein paar Brote mit selbstgemachter Marmelade beschmiert hatte, legte ich sie zusammen mit einer Flasche Milch in meinen Einkaufsbeutel und ging zur Tür.
Kaum hatte ich sie geöffnet, blickte ich in das Gesicht eines fremden Mannes. Allem Anschein nach wollte er gerade bei mir klopfen. Er war zwei Köpfe größer als ich, trug eine runde, karierte Mütze und ein langes Jackett. Was neben den starren graublauen Augen am meisten hervorstach, war seine spitze, lange Nase. Dennoch strahlte seine Aura eine gewisse Sicherheit aus.
»Guten Tag.« Er verbeugte sich knapp vor mir. »Sind Sie Mrs. Anna Cleaver?«
Ich zog die Brauen zusammen. »Ja, die bin ich. Und wer sind Sie?«
»Mein Name ist Holmes, Sherlock Holmes. Privatdetektiv.«
Verdammt, nicht jetzt!
»Richtig, ich habe bereits von einer Nachbarin gehört, dass die Familie Beckinsale einen Privatdetektiv zu den Ermittlungen hinzugezogen hat«, äußerte ich mich.
»Ah ja, das ist gut, dann kann ich mir ja die Mühe sparen, Ihnen zu erklären, was ich von Ihnen will, Madame.«
»Von mir?«, fragte ich verdutzt.
Er räusperte sich. »Ja, von Ihnen. Es handelt sich lediglich um ein paar Fragen, die ich Ihnen und auch Ihrem Mann stellen möchte«, erklärte er. »Ist er denn ebenfalls zugegen?«
Ich sah kurz über meine Schulter. »Ähm, nein, also, ich meine, er ist momentan unpässlich. Genauso wie auch ich, Mr. Holmes. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit.«
»Zur Arbeit?« Er holte aus seinem Jackett einen kleinen Zettel hervor, den er mit grüblerischer Miene betrachtete. »Ah ja, wie ich es mir gedacht habe.«
»Wie meinen?«, fragte ich stutzig und gab Mrs. Rosenberg recht, dass es sich bei dem Schnüffler um eine skurrile Person handelte.
»Sie müssten meines Wissens nach heute nicht zu Mrs. Lewis in die Schneiderei.« Er steckte den Zettel wieder in die Tasche.