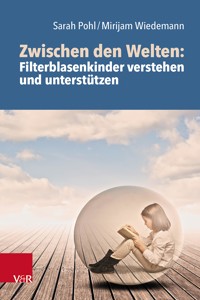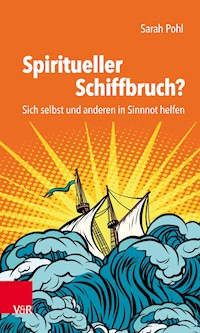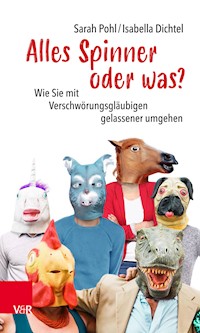Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Edition Leidfaden – Begleiten bei Krisen, Leid, Trauer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Viele Menschen berichten von außersinnlichen Erlebnissen wie Begegnungen mit Verstorbenen, mit Geistern oder anderen Spukphänomenen, die sie nach oder vor dem Tod eines nahestehenden Menschen gemacht haben. Handelt es sich dabei um abergläubische Vorstellungen oder um Erfahrungen, die eine Ressource im Abschiedsprozess sein können? In diesem Buch geht es um eine inhaltliche Einordnung solcher Erlebnisse. Anhand der Praxisbeispiele wird die Bandbreite außergewöhnlicher Erlebnisse rund um das Sterben deutlich. Anregungen zum beraterischen und therapeutischen Umgang mit solchen Erlebnissen ermuntern Trauerbegleiter*innen, wertschätzend, offen und ressourcenorientiert mit Berichten über außergewöhnliche Erfahrungen umzugehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EDITION Leidfaden
Hrsg. von Monika Müller, Petra Rechenberg-Winter, Katharina Kautzsch, Michael Clausing
Die Buchreihe Edition Leidfaden ist Teil des Programmschwerpunkts »Trauerbegleitung« bei Vandenhoeck & Ruprecht, in dessen Zentrum seit 2012 die Zeitschrift »Leidfaden – Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer« steht. Die Edition bietet Grundlagen zu wichtigen Einzelthemen und Fragestellungen im (semi-)professionellen Umgang mit Trauernden.
Sarah Pohl / Yvonne Künstle / Reiner Sörries
Aberglaube, Magie und Zuflucht im Übernatürlichen
Der Umgang mit außersinnlichen Erfahrungen in der Trauerbegleitung
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Horoskopautomat in einem Seebad an der Ostsee. Foto: Reiner Sörries
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2198-2856
ISBN 978-3-647-99474-1
Inhalt
Vorwort
Erster Teil
Aberglaube – Versuch einer inhaltlichen Klärung
Zufall und Empirie
Schutz und Schirm, Glück und Heil
Marginaler Aberglaube
Dinge zwischen Himmel und Erde
Begegnung mit oder Suche nach außergewöhnlichen Erfahrungen
Alltägliche Wunder: Erfahrungen mit dem Übersinnlichen
Zweiter Teil
Außergewöhnliche Phänomene und Erlebnisse rund um das Sterben – Beispiele aus der Praxis
Ich hab’s geahnt … Beispiele zu Präkognition
Weitere »paranormale« Phänomene rund um das Thema Tod
Klassifizierung der Fallbeispiele
Welche Ressource bieten außergewöhnliche Erfahrungen im Kontext Tod?
Belastende außersinnliche Erfahrungen im Zusammenhang mit Tod
Das Medium als Trauerbegleiter – Kontaktaufnahme mit dem Jenseits und Verstorbenen
Aber… Glaube? Ein Leitfaden für die Praxis
Rituale: Zwischen Aberglauben und Ressource
Rituale am Sterbebett
Rituale nach dem Versterben
Umgang mit Aberglauben in den verschiedenen Trauerphasen
Erste Phase: Nicht-wahrhaben-Wollen
Zweite Phase: Aufbrechende Emotion
Dritte Phase: Suchen und sich trennen
Vierte Phase: Neuer Selbst- und Weltbezug
Auf die Passung kommt es an
Hilfreiche Maßnahmen und Methoden in der Trauerbegleitung
Glas voller Glück
Notfallkoffer für Akutsituationen
Körperarbeit
Starke Reize
Reizreduktion
Gefühlsarbeit
Beziehungen aktivieren
Beziehungsgeschichte explorieren
Fragen nach der Herkunft von Glaubensüberzeugungen
Reframing
Sensibilisierung für Glaubenssätze und gesellschaftliche Normierungen
Kultursensitives Vorgehen
Mitgefühl und Selbstreflexion
Theoretisches Wissen zu Trauerreaktionen und Trauerphasen
Literatur
Vorwort
Statistiken haben so ihre Tücken. Aktuellen repräsentativen Umfragen zufolge bezeichnet sich weniger als ein Drittel der Deutschen als abergläubisch. Zwar kennen etwa 80 Prozent der Bevölkerung die Vorstellung, Freitag der 13. sei ein Unglückstag, doch würden dem die meisten keine Bedeutung beimessen. Weniger als 20 Prozent gaben an, an diesem Tag besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Aufschlussreich ist allerdings, dass die Lufthansa und andere Airlines in Rücksicht auf diese Minderheit auf eine Sitzreihe »13« verzichten. Ebenso wird man im ICE der Deutschen Bahn vergeblich einen Wagen mit der Nummer »13« suchen. Gleiches gilt für viele Hotels, in denen es keine Zimmer mit dieser Nummer und auch kein 13. Stockwerk gibt. Man nimmt offenbar Rücksicht auf ein ungutes Gefühl, das offensichtlich weiter verbreitet ist, als man zunächst annehmen möchte. Wer nun tatsächlich mit der »13« hadert, findet für seine Befürchtung freilich rasch gute Gründe. Es sollte die dritte Mondlandung werden, als am 11. April 1970 um 19:30 Uhr die Saturn-V-Rakete von Florida aus in den Himmel abhob. 56 Stunden später explodierte der Sauerstofftank des Raumschiffs und zwang die nun in Lebensgefahr schwebenden Astronauten zu einer risikoreichen Rückkehr. Es war die »Apollo 13«!
Die Tücke der Statistiken besteht aber auch darin, dass Aberglaube in Umfragen nur an seiner Oberfläche erhoben werden kann, während tiefere Schichten kaum abfragbar sind. Die Interviewer forschen nach der Einstellung zur Unglückszahl »13«, zur schwarzen Katze, die von rechts den Weg quert; dazu, dass man nicht unter einer Leiter stehen und sich nicht über Kreuz die Hände reichen soll. Vielleicht fragen sie noch nach dem Vertrauen in das Horoskop. Hingegen unterbleibt aus guten Gründen die Frage nach der Begegnung mit Verstorbenen, mit Geistern und anderen Spukerlebnissen. Kaum jemand wird sich im Kontext einer statistischen Umfrage auf solche Fragen einlassen. Menschen mit derartigen Erfahrungen öffnen sich allenfalls einem Therapeuten, einer Therapeutin oder einem Seelsorger, einer Seelsorgerin, falls sie ihre Erfahrungen und gegebenenfalls ihre damit verbundenen Sorgen und Ängste nicht gänzlich für sich behalten. Sie würden es zudem vehement ablehnen, ihre Erfahrungen als abergläubisch zu bezeichnen und damit als gleichsam unwahr einzustufen. Denn sie machen diese Erfahrungen ja.
Das, was Aberglaube ist, definieren sowieso immer die anderen von einer Warte aus, von der aus sie behaupten, zwischen richtig und falsch, zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden zu können. Früher waren solche Urteile das Metier der Kirche, heute sind es Vernunft und Wissenschaft, die Wirklichkeit definieren. Wo es sich um Erfahrungen handelt, die sich offenkundig außerhalb allgemein gültiger Gesetzmäßigkeiten bewegen, ist es deshalb eher Konsens, statt von Aberglauben von paranormalen Phänomenen oder außergewöhnlichen Erfahrungen zu sprechen. Auf den Punkt bringt es die Bezeichnung außersinnliche Erfahrungen, denn sie werden nicht mit den klassischen fünf Sinnen gemacht, und man spricht dann vom sechsten Sinn. Forscherinnen und Forscher mit konträren wissenschaftlichen Positionen versuchen, solche Phänomene zu belegen oder rational zu erklären. Häufig ist den Betroffenen mit paranormalen Erfahrungen mit wissenschaftlichen Debatten allerdings nicht gedient, sondern sie suchen therapeutischen oder seelsorgerlichen Rat.
Sind manche Menschen angesichts paranormaler Erfahrungen in Sorge oder ängstigen sich sogar, so ist die Zahl derer nicht gering, die ihr Vertrauen und die Suche nach ihrem Lebensglück gerade auf Phänomene gründen, die außerhalb herkömmlichen Wissens und gültiger Gesetzmäßigkeiten liegen. Manche vertrauen dem uralten Wissen außerhalb der Schulmedizin, manche glauben an übersinnliche Kräfte. Wiederum wird sich kein Mensch, der auf esoterische Praktiken setzt, als abergläubisch stigmatisieren lassen wollen.
Statistische Erhebungen von Aberglauben gehen demnach an der Wirklichkeit vorbei. Und es geht auch um etwas anderes. Es geht um jene Dinge, die sich gemäß dem Volksmund zwischen Himmel und Erde ereignen. Ein Buch zu Erfahrungen im übersinnlichen Bereich sieht sich bei aller aufgeklärten Skepsis vor die Aufgabe gestellt, Erfahrungen von Menschen, die sich außerhalb des eigenen Erfahrungshorizonts bewegen, ernst zu nehmen. Denn Menschen, die davon berichten, lügen in aller Regel nicht. Wir als Autor*innen sind nicht willens, nur die eigenen Maßstäbe an Wirklichkeit anzulegen. Erfahrungen bleiben erst einmal Erfahrungen, so weit sie auch außerhalb des Normalen zu liegen scheinen. So wollen die Autor*innen mit ihren Urteilen über wahr und falsch vorsichtig sein.
Vielmehr kommt im ersten Teil (Reiner Sörries) zur Sprache, was sich zu den Hintergründen und den Ursprüngen von Aberglauben und zu seiner Systematisierung sagen lässt. Und Aberglaube heißt hier in seiner ursprünglichen Bedeutung nur Gegen-Glaube ohne negative Vorbelastung. In einem zweiten Teil (Sarah Pohl und Yvonne Künstle) geht es anhand von Fallbeispielen aus der Praxis um den Umgang mit außergewöhnlichen Erfahrungen. Wie kann negativen Szenarien begegnet werden und welche positiven Kräfte lassen sich freisetzen? Dabei setzen die Autorinnen ihren Schwerpunkt auf außergewöhnliche Erfahrungen im Umfeld von Sterben und Tod und führen zu Ritualen und Praktiken, die dem Volksgauben zuzurechnen sind, aber in der Lage sind, beängstigenden Erfahrungen entgegenzuwirken. Außerdem wird diskutiert, welche Funktion der Besuch eines Mediums im Rahmen der Trauerbearbeitung haben kann und wo hier auf Risiken und Nebenwirkungen zu achten ist. Letztlich geht es darum, Strategien aufzuzeigen, die helfen, angstgesteuerte, einengende und destruktive Glaubensvorstellungen so zu verändern, dass Menschen das ressourcenhafte Potenzial entsprechender Erlebnisse im Trauerverarbeitungsprozess wahrnehmen können.
Sarah Pohl, Yvonne Künstle und Reiner Sörries
Erster Teil
Aberglaube – Versuch einer inhaltlichen Klärung
Aberglaube hat heute einen deutlich negativen Beigeschmack. Bestenfalls schmunzelt man darüber, schlimmstenfalls hält man abergläubische Menschen für dumm oder gar zurückgeblieben. Dabei meint Aberglaube von seiner Wortbedeutung her etwas, was zum normierten Glauben im Gegensatz oder im Widerspruch steht. War es in unserer Kultur zunächst die Kirche, die Glauben normierte und den Aberglauben mit teils drastischen Mitteln verwarf, so sind es heute Vernunft und wissenschaftlich nachweisbare Gesetzmäßigkeiten, die über wirklich und unwirklich urteilen. Was nicht den Naturgesetzen und der beobachtbaren Wirklichkeit folgt, ist Aberglaube, wenngleich er heute nicht mehr immer so genannt wird.
Wie Aberglaube entsteht? Die Welt bestimmt sich nicht allein aus einer Abfolge von logisch aufeinander folgenden Ereignissen. Das fängt beim Wetter an, das so gar nicht immer den Jahreszeiten und dem durchschnittlichen Mittel folgt, und reicht bis zu Naturkatastrophen, die unerwartet hereinbrechen. Für Menschen, die in einer agrarisch strukturierten Gesellschaft und ohne Katastrophenschutz lebten, waren solche Ereignisse noch weit lebens- und existenzbedrohender als für die moderne Menschheit. Ereignen sich Katastrophen zur bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, stellt sich die Frage nach dem Warum. Eine Erklärung ist schlichtweg der Zufall. Andere Erklärungen waren früher, solche Ereignisse als Folge von Fehlverhalten und Schuld zu werten, als Strafe durch göttliche oder dunkle Mächte. Ebenso kannte man natürlich glückliche Zufälle, ausgelöst durch gute Mächte. Beide hat man gern zwischen Himmel und Erde ansiedelt und auch personalisiert als Dämonen oder Engel. Waren gute wie böse Ereignisse einem Gegenüber zuzuschreiben, so lag es nahe, diese Kräfte zu beeinflussen, wozu man magische Praktiken ersann. Ohne religionsgeschichtlich weit ausgreifen zu wollen, sind Dämonen und Engel, böse wie gute Geister in Judentum, Christentum und Islam bekannt. Solche Vorstellungen reichen weit in die Menschheitsgeschichte zurück und blieben vom Animismus bis zur Hochreligion im Denken und Glauben der Menschen präsent. Mindestens Fragmente davon haben sich bis in das postmoderne, digitale Zeitalter erhalten. Dort feiern sie in Gestalt von bisweilen abstrusen Verschwörungstheorien fröhliche Urständ.
Zu Beginn unserer Zeitrechnung hatten die Missionare und Kirchenlehrer nicht nur damit zu tun, den Menschen die frohe Botschaft, das Evangelium, zu verkünden, sondern sie sahen sich mit dem Problem konfrontiert, heidnische Praktiken ausmerzen zu müssen. Es ging darum, den Glauben an einen Gott in seiner dreifaltigen Personalität in und gegen eine Welt mit Göttern, Halbgöttern, Heroen, Fabelwesen und Dämonen durchzusetzen. Man kann schon sagen, dass die antike Welt mit mythischen und magischen Vorstellungen durchsetzt war. Bestenfalls opferte man den Göttern, um für sich Gutes zu erreichen, schlimmstenfalls vertraute man auf Zauberformeln, um dem missliebigen Nächsten zu schaden. Das passte nicht in das christliche Weltbild.
Wohl aber passte es ins christliche Weltbild, auf Gott, den Sohn Jesus Christus und die Gnade des Heiligen Geistes zu vertrauen. Es gehörte bald zur christlichen Praxis, in Nöten und Sorgen die Heiligen und Märtyrer um Beistand anzurufen. Durch die Ableistung von frommen Handlungen, Almosen oder Wallfahrten konnte man sich von Schuld befreien. So kannte auch das christliche Weltbild Möglichkeiten einer Verbindung zwischen irdischer und himmlischer Welt, eben genau jenen Raum zwischen Himmel und Erde, der offen ist für außergewöhnliche Erfahrungen. Es war für die Kirche eine notwendige Aufgabe, falschen und richtigen Glauben zu unterscheiden: Glaube und Aberglaube.
Wenn beides nahe beieinanderliegt und sich vermischt, spricht man vom Volksglauben. Zur liturgischen und seelsorgerlichen Praxis gehört die Spendung von Segen. Und rund um den Dreikönigstag ziehen die Sternsinger durch die Straßen, sammeln Geld für gute Zwecke und schreiben mit Kreide die drei Buchstaben C + M + B sowie die aktuelle Jahreszahl an die Haustür. Im Volksglauben löst man diese drei Buchstaben gern mit den legendären Namen der Heiligen Drei Könige auf: Caspar + Melchior + Balthasar. Ursprünglich bedeuten diese Worte: Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus. Diese Praxis ist kirchlich nicht nur geduldet, sondern modern gesprochen wichtiger Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Solcher Segen ist kirchlich legitimiert. Hatte ein Bauer zum Schutz seines Viehbestandes an die Stalltür ein Pentagramm gezeichnet oder andere magische Zeichen angebracht, so wurde dies als abergläubisch verurteilt. Es war oftmals eine schwierige Gratwanderung, zwischen Glauben und Aberglauben zu unterscheiden.
Heilige dürfen verehrt und um Beistand angerufen werden. Früher brachten vor allem die Klöster und Wallfahrtskirchen Heiligenbilder massenhaft in Umlauf, um die Andacht zu fördern. Man vertraute ihnen jedoch so sehr, dass man kleinformatige Exemplare bei allerlei Krankheit schluckte; die Volkskunde nennt sie Schluckbildchen, die bis ins frühe 20. Jahrhundert als Bestandteil einer geistlichen Hausapotheke in der Volksmedizin verbreitet waren. Bis heute fahren Menschen zum französischen Wallfahrtsort Lourdes, weil sie dort auf eine wunderbare Heilung hoffen. Nicht wenige Gesundungen dort sind von der Kirche offiziell als Wunderheilungen anerkannt. Menschen, die auf die schamanischen Kräfte von Wunder- und Geistheilern vertrauen, werden möglicherweise eher beargwöhnt, weil sie auf solchen Hokuspokus setzen. Längst hat die Kirche ihr Wundermonopol verloren, während nach wie vor Menschen auf Heilung wider alle Prognosen hoffen. Die Not lehrt nicht nur beten, sondern auch den Glauben an das Unerwartbare.
Zufall und Empirie
Aberglaube setzt nicht nur auf Wunder, sondern auch auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Kennt der Volksmund die Redensart Kommt einer, geht einer, so kann man den auf eine Geburt folgenden Sterbefall in der Familie, in der Nachbarschaft oder im Dorf einen Zufall nennen. Der Aberglaube setzt aber darauf, dass es sich um eine Gesetzmäßigkeit handelt, und er wird immer recht behalten. Möglicherweise werden zwischen Geburt und Sterbefall Tage, Wochen oder Monate vergehen, aber der Todesfall wird irgendwann eintreten und bestätigt alle, die von der Wahrhaftigkeit dieser Prognose überzeugt sind. Ist das Unglück nicht an einem Freitag, den 13. geschehen, sondern später, wird man sagen, dass es sich aber an diesem Tag schon angebahnt hat. Oder Apollo »13« liefert dazu die Bestätigung. Aberglaube hat viel mit Empirie zu tun, wie schon beim Bauern zu sehen war, dessen Viehbestand gesund blieb, weil er ein Pentagramm an der Stalltür angebracht hatte. Starben trotzdem ein oder sogar mehrere Tiere, so konnte man sicher sein, dass die entsprechenden Vorkehrungen nicht ordnungsgemäß getroffen worden waren. Vertraut man dem schamanischen Heiler, so wird man die Genesung seinen Kräften zuschreiben, selbst wenn sich die Ärzte gewissenhaft um den Kranken gekümmert haben. Ein erwartetes oder prognostiziertes Ereignis wird oftmals eintreten, selbst wenn man möglicherweise lange darauf warten muss: Ich habe es doch gleich gewusst! – Es ist halt Zufall gewesen, kann man entgegnen. Und darauf setzt der gesunde Menschenverstand, der derartige Folgeereignisse als normalen Gang der Dinge betrachtet. Dann wird man es ebenso als Zufall ansehen, falls doch jemand an einem Freitag, den 13. über eine schwarze Katze stolpert und sich dabei ein Bein bricht.
Freilich will die Wissenschaft weder von Wundern noch von Zufall etwas wissen. Eine überraschende Heilung in Lourdes ohne therapeutische Maßnahme möchte man weder einem Zufall noch einem Wunder zuschreiben, sondern spricht dann lieber in Anerkennung eigener Unkenntnis von Spontanheilung, die man letztlich aber doch mit medizinischen Erklärungen begründet.
Ob man gewisse Ereignisse mit Aberglauben erklärt oder zu paranormalen Phänomenen macht, zurück bleibt der Mensch, der unter Umständen mit außergewöhnlichen Erfahrungen hadert, sich ängstigt oder gar verzweifelt. Wer damit rechnet, dass Dinge geschehen, die von außerhalb unserer Erfahrungswelt gesteuert werden, wird Maßnahmen ergreifen, sich diese Kräfte zunutze zu machen oder sich ihrer zu erwehren.
Schutz und Schirm, Glück und Heil
Was hängt nicht alles am Rückspiegel der ansonsten durchgestylten und digitalisierten Automobile: Babyschuhe, Würfel, Kreuze und andere Dinge baumeln daran im Takt der Bodenwellen. Ihre Besitzer, danach gefragt, werden sie etwas verlegen oder schmunzelnd als Glücksbringer bezeichnen. Vielleicht sollen sie auch vor Gefahren schützen. All das mag man seinerseits wohlwollend zur Kenntnis nehmen, kaum der Rede wert. Was aber passiert, wenn in einer zu schnell gefahrenen Kurve das Kinderschühchen aus der Halterung rutscht und zu Boden fällt? Drohen Ungemach und Unheil? Versichert man sich mit einem raschen Anruf zu Hause, ob mit den Kindern alles in Ordnung ist? Es kommt darauf an, wie sehr man seinem Talisman Gehör, Glauben oder Aberglauben schenkt.
Wo die Welt durchwoben ist von Mächten außerhalb unserer Verfügbarkeit, muss man Mittel und Wege finden, sie doch irgendwie zu steuern. Man schafft sich Talismane als Glücksbringer und Amulette als Abwehrzauber. Beide Varianten magischer Einflussnahme auf die unsichtbare Welt lassen sich weit in der Geschichte zurückverfolgen und finden sich praktisch in allen Kulturen. Judentum und Islam kennen gleichermaßen das blaue Auge, das vor dem gefürchteten bösen Blick schützt. Durch den Blick eines mit magischen Kräften begabten Menschen kann ein anderer Mensch Unheil erleiden, in seinem Besitz geschädigt werden oder gar zu Tode kommen. Vor allem Menschen mit hellblauer Augenfarbe traut man diese Fähigkeiten zu und schützt sich gegen solchen Schadenzauber durch einen entsprechenden Gegenzauber mit einem ebenfalls blauen Auge, das im Orient Nazar genannt wird. Wer ein blaues Auge in dieser Absicht trägt, wird sich nicht des Aberglaubens bezichtigen lassen. Oder er war in der Türkei im Urlaub und hat ein Nazar als Souvenir oder Schmuckstück erworben. Trägt jemand ein Kreuz an der Halskette, mag er oder sie ihm beschützende Funktion zumessen oder trägt es als Andenken an seine Konfirmation oder eben als Schmuckstück. Will sagen, Aberglaube lässt sich nicht auf einen Blick erkennen, und oft wissen die Träger und Trägerinnen solcher Accessoires selbst nicht genau, was sie ihnen wirklich bedeuten.
Wenn Blicke töten könnten, sagt man, wenn man einen besonders dunklen Gesichtsausdruck beschreiben möchte. Dass der böse Blick tatsächlich töten kann, ist eine uralte, weltweit verbreitete Sorge und geht in die Tiefe unseres Bewusstseins bis heute. Verstorbenen die Augen zu schließen, mag man als pietätvolle Geste deuten, dahinter steht aber der Glaube, der Tote könnte sich offenen Auges nach einem Opfer umschauen, um es in sein Grab nachzuziehen. Die außerhalb unserer logischen Erfahrungswelt verorteten Geschehnisse wurden oder werden häufig mit mächtigen Untoten in Verbindung gebracht. Hierin wurzeln Phänomene, die man Geistern und Gespenstern zuschreibt, weil dafür ein anderes Vokabular fehlt. Meist will man solche Begegnungen meiden, bisweilen sucht man aber den Kontakt mit Verstorbenen bewusst, um etwas zu erfahren, sich ihres Wissens zu bemächtigen. Im Okkultismus traut man ihnen zu, Tische zu bewegen, Gläser zu verrücken und darin geheime Botschaften zu verstecken. Vernunftbegabt und aufgeklärt ist man geneigt, solche Praktiken ins Reich des Aberglaubens zu verweisen. Wie aber ist mit Berichten zu verfahren, die solche Begegnungen schildern?
Vermutlich ist man schnell dabei, okkulte Praktiken ins Reich des Aberglaubens zu verbannen. Schließlich hatte der Okkultismus seine Blüte auch schon vor über hundert Jahren, als spiritistische Sitzungen in gehobenen Gesellschaftsschichten durchaus praktiziert wurden, um Nachrichten aus dem Jenseits zu erhalten. Nicht erloschen ist hingegen das Verlangen, Einsichten in das Drüben zu erlangen. Mit großer Aufmerksamkeit hat man die sogenannten Nahtoderfahrungen rezipiert, die von vielen für real gehalten werden. Man kann daraus schließen, dass das Verlangen nach außergewöhnlichen Erfahrungen nicht erloschen ist, sondern seiner Zeit entsprechend lediglich eine andere, zeitgemäßere, glaubwürdigere Gestalt annimmt. Aberglaube ist ein Stigma. Ausgestorben sind die damit verbundenen Gewissheiten, Hoffnungen, Ängste oder Unsicherheiten nicht.
Marginaler Aberglaube