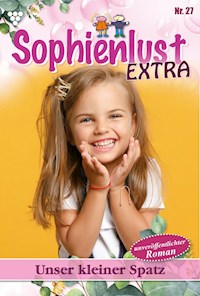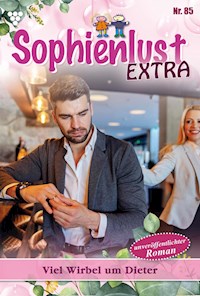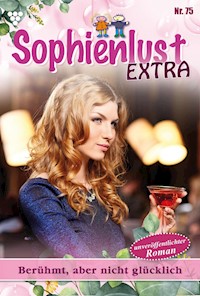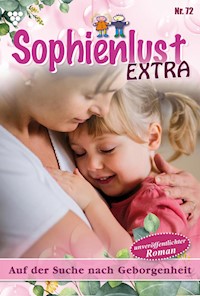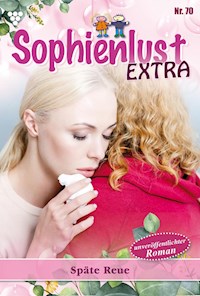Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust Extra
- Sprache: Deutsch
In diesen warmherzigen Romanen der beliebten, erfolgreichen Sophienlust-Serie ist Denise überall im Einsatz. Denise hat inzwischen aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle geformt, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Doch auf Denise ist Verlass. In der Reihe Sophienlust Extra werden die schönsten Romane dieser wundervollen Erfolgsserie veröffentlicht. Warmherzig, zu Tränen rührend erzählt von der großen Schriftstellerin Patricia Vandenberg. Der Abend war ein großartiger Alpinist. Er kletterte, wenn seine Stunde gekommen war, leichtfüßig und mühelos über die höchsten Gipfel, die in ewigem Schnee und Eis erstarrt waren. Im Tal gingen die Lichter an und schimmerten traulich durch die rasch heraufziehende Dämmerung. Wanderer, die noch unterwegs waren, beeilten sich, um nicht von der Dunkelheit überrascht zu werden. Es war ein schöner Herbst, der zum Wandern verlockte, aber der Tag ging bereits früh zur Neige. Auf halber Höhe, am Rande der Arvenwälder, lag ein einsames Chalet. Die Fenster blickten ins Tal hinunter. Nur ein einziges Fenster war den Bergen zugewandt. Dieses Fenster gehörte zu Nathalies Zimmer, das im Obergeschoss des Chalets lag. Manchmal, wenn ein Wanderer von der Dunkelheit überrascht wurde und nicht mehr ins Tal zurückfand, pochte er am Chalet an und wurde stets freundlich aufgenommen. Das kam allerdings nicht oft vor. Im Sommer eigentlich nie, aber im Herbst oder zur Winterszeit konnte es schon geschehen, dass sich überraschend ein fremder Gast im Chalet einfand. Drei Menschen wohnten in dem stillen kleinen Haus am Berghang. Sie führten ein zufriedenes Leben und verkörperten gleichsam drei Generationen. Professor Daniel Paulsen, dem das Chalet gehörte, war zweiundsiebzig Jahre alt. Benedikt Voss, der früher im Orchester von Professor Paulsen die Bratsche gespielt hatte und jetzt das Hauswesen in Ordnung hielt, zählte vierzig Jahre. Und Nathalie war dreizehn. In der Wohnhalle knisterte und flackerte ein Holzfeuer im Kamin. Benedikt brachte eben einen Korb mit dicken Holzscheiten, um das Feuer zu versorgen. »Es ist kalt geworden«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust Extra – 103 –Abschiednehmen tut weh
Unveröffentlichter Roman
Gert Rothberg
Der Abend war ein großartiger Alpinist. Er kletterte, wenn seine Stunde gekommen war, leichtfüßig und mühelos über die höchsten Gipfel, die in ewigem Schnee und Eis erstarrt waren.
Im Tal gingen die Lichter an und schimmerten traulich durch die rasch heraufziehende Dämmerung. Wanderer, die noch unterwegs waren, beeilten sich, um nicht von der Dunkelheit überrascht zu werden. Es war ein schöner Herbst, der zum Wandern verlockte, aber der Tag ging bereits früh zur Neige.
Auf halber Höhe, am Rande der Arvenwälder, lag ein einsames Chalet.
Die Fenster blickten ins Tal hinunter. Nur ein einziges Fenster war den Bergen zugewandt. Dieses Fenster gehörte zu Nathalies Zimmer, das im Obergeschoss des Chalets lag.
Manchmal, wenn ein Wanderer von der Dunkelheit überrascht wurde und nicht mehr ins Tal zurückfand, pochte er am Chalet an und wurde stets freundlich aufgenommen. Das kam allerdings nicht oft vor. Im Sommer eigentlich nie, aber im Herbst oder zur Winterszeit konnte es schon geschehen, dass sich überraschend ein fremder Gast im Chalet einfand.
Drei Menschen wohnten in dem stillen kleinen Haus am Berghang. Sie führten ein zufriedenes Leben und verkörperten gleichsam drei Generationen. Professor Daniel Paulsen, dem das Chalet gehörte, war zweiundsiebzig Jahre alt. Benedikt Voss, der früher im Orchester von Professor Paulsen die Bratsche gespielt hatte und jetzt das Hauswesen in Ordnung hielt, zählte vierzig Jahre. Und Nathalie war dreizehn.
In der Wohnhalle knisterte und flackerte ein Holzfeuer im Kamin. Benedikt brachte eben einen Korb mit dicken Holzscheiten, um das Feuer zu versorgen. »Es ist kalt geworden«, sagte er.
Professor Paulsen saß an seinem Schreibsekretär. Er hatte die Lampe angezündet, die ein mildes Licht verströmte. »Wo ist Nathalie?« fragte er.
»In ihrem Zimmer«, antwortete Benedikt. »Sie liest.« Er legte einige dicke Holzscheite auf das Feuer und stellte den Holzkorb neben das kupferne Kohlebecken.
»Dann ist sie ja beschäftigt und gut aufgehoben«, meinte Professor Paulsen und lächelte flüchtig.
Sein hageres, ausdrucksvolles Gesicht wurde freilich gleich wieder sehr ernst. Er sah auf einen Brief, der vor ihm auf dem Schreibsekretär lag.
Der Professor war ein hochgewachsener schlanker Mann. Er hielt sich sehr aufrecht. Das dichte weiße Haar, das sorgfältig gepflegt fast bis auf seine Schultern herabfiel, verriet den Künstler. In seiner Glanzzeit war Daniel Paulsen ein genialer Dirigent gewesen. Er hatte triumphale Erfolge in allen fünf Kontinenten gefeiert, und die Musikwelt hatte ihm viele Lorbeerkränze zu Füßen gelegt.
Doch diese Zeit war vorbei. Daniel Paulsen war alt geworden. Aber das bedeutete nicht, dass er einen tatenlosen Müßiggang pflegte. Ein Mensch, der die Musik liebt, pflegte er zu sagen, kann gar nicht alt werden, denn Frau Musika hält ihn jung. Professor Paulsen gab noch immer als Gastdirigent berühmter Orchester Konzerte. Er arbeitete auch noch immer unermüdlich an sich selbst, spielte Geige und Klavier. Es waren schöne und erfüllte Stunden, wenn er zusammen mit Benedikt und Nathalie musizierte.
Der Flügel beherrschte die Halle des Chalets. Es war ein wundervolles Instrument, dessen Klang warm und harmonisch war.
»Es sollte mich nicht wundern«, brummte Benedikt, »wenn heute Nacht Schnee fallen sollte. Es ziehen Wolken auf, und der Wind bläst so kalt, als käme er geradewegs aus Sibirien.«
Die Gesten Professor Paulsens waren noch immer impulsiv und von jugendlicher Lebhaftigkeit. Er wandte sich Benedikt zu, der emsig mit dem Feuer beschäftigt war. »Wenn es sich so verhält«, sagte er rasch, »dann musst du noch einmal ins Dorf hinunter.«
»Heute Abend?« Benedikt seufzte. Er liebte eine gewisse Behaglichkeit, und er hatte außerdem noch eine Menge zu tun. Die Zugehfrau aus dem Dorf kam nur jeden dritten Tag ins Chalet. Sie kam nun schon seit Jahren, aber für Professor Paulsen war sie immer noch ein ›fremdes Gesicht‹, wie er das nannte. Und fremde Gesichter ertrug er nicht um sich. Benedikt musste also die meiste Arbeit allein tun. Außerdem war er erst am Nachmittag im Dorf gewesen, um den wöchentlichen Vorrat einzukaufen.
»Ich hoffe, du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich dich nicht grundlos in den kalten Abend hinaushetze?«, fragte Professor Paulsen lächelnd.
»Das ändert nichts daran, dass ich nicht noch einmal anschirren möchte. Schimmi ist es sicher auch nicht recht.« Schimmi war der Apfelschimmel, der den Kutschwagen zog. »Hat es denn nicht Zeit bis morgen?«
Professor Paulsen deutete auf den Brief, der vor ihm auf dem Schreibsekretär lag. »Diese Sache duldet keinen Aufschub. Es tut mir leid, Benedikt, aber wenn heute Nacht tatsächlich Schnee fallen sollte, wird es uns morgen vielleicht nicht möglich sein, ins Dorf hinunterzufahren. Dieser Brief muss aber unverzüglich zur Post.«
»Ist er denn so wichtig?«
Zwischen Benedikt und dem Professor herrschte seit Jahren ein Vertrauensverhältnis. Deshalb konnte sich Benedikt ruhig ein offenes Wort erlauben.
»Noch wichtiger«, antwortete Professor Paulsen sehr nachdenklich. Er hatte keine Geheimnisse vor Benedikt, sodass dieser über alles Bescheid wusste. Benedikt kannte die Familiengeschichte der Paulsens, die reich an Glanz und Triumphen, aber auch an erschütternder Tragik war.
Professor Paulsen stand auf. Er ging zu der rustikalen Vitrine, die neben seinem Schreibsekretär stand, und holte zwei Gläser und eine Flasche Tokajer.
»Ich merke schon, ich komme nicht darum herum, noch einmal ins Dorf zu kutschieren«, brummte Benedikt, der den Professor beobachtete.
Professor Paulsen lachte. Er sah jung aus, wenn er lachte, trotz der Spuren, die zweiundsiebzig Jahre in sein markantes Gesicht gezogen hatten. »Wie gut du mich kennst, Benedikt«, meinte er. »Nun, das war schon früher eine hervorragende Eigenschaft von dir. Wenn das ganze Orchester aus dem Takt kam, du hast immer genau gewusst, was ich wollte. Erinnerst du dich noch, damals, in Prag, als wir Smetana spielten …« Er brach ab. »Nein, jetzt keine Erinnerungen. Wir haben Wichtigeres zu tun.«
Er stellte die Tokajer-Flasche und die Gläser auf den Clubtisch am Kamin.
»Wir haben Smetanas ›Moldau‹ gespielt«, ergänzte Benedikt, der Erinnerungen liebte. »Ich war damals ein blutjunges Bürschlein, und die Schuhe des Bratschisten waren noch ein wenig zu groß für mich. Aber trotzdem habe ich damals als einziger nicht gepatzt. Nun ja«, fügte er hinzu, »außer ein paar Kritikastern hat kein Mensch etwas gemerkt. Das Publikum war jedenfalls begeistert. Das war es eigentlich immer, Herr Professor, wenn wir igendwo spielten, ganz egal, wo es war – ob im Süden oder Norden, im Osten oder Westen. Wir waren überall mit unserer Musik zu Hause.«
»Ja, aber das ist Vergangenheit«, bremste Professor Paulsen vorsichtig Benedikts Erinnerungsfreude. »Gib dir keine Mühe! Du kannst mich nicht davon ablenken, dass du Schimmi noch einmal anspannen musst. Benedikt, ich will dir nichts vormachen. Es geht um Nathalie.«
»Um Nathalie?«, fragte Benedikt erstaunt und etwas erschrocken, da der Tonfall des Professors ihn irritierte. Er kannte jede Nuance in der Stimme des Professors. »Was ist denn mit ihr? Muss sie vielleicht wieder in irgendeine Klinik?«, fügte er bestürzt hinzu. »Also, das können wir dem Kind nicht antun, Herr Professor! Sie hat in dieser Hinsicht wahrscheinlich schon genug mitgemacht, und sie hat es tapfer ertragen. Aber mehr sollten wir ihr nicht zumuten. Sie ist doch jetzt so glücklich.«
»Ja«, stimmte Professor Paulsen ihm ernst zu, »sie ist glücklich. Aber ich werde nicht ewig leben, Benedikt. Das sollten wir nicht vergessen. Der Tag wird kommen, an dem Nathalie mich nicht mehr haben wird. Nein, widersprich mir nicht. Es wäre töricht, den Kopf in den Sand zu stecken. Sicher, ich kann noch lange leben. Aber in meinem Alter muss man einfach daran denken, dass die Zeit, die einem noch zugedacht ist, bemessen ist. Nun mach kein so ängstliches Gesicht, Benedikt. Ich habe keine düsteren Ahnungen! Ich handle nur wie ein verantwortungsbewusster Mensch. Und jetzt trinken wir erst einmal unseren Tokajer. Prost!«
»Prost, Herr Professor«, murmelte Benedikt. Er war im Moment so bedrückt, dass ihm nicht einmal der Tokajer richtig schmeckte. Irgendetwas stimmte nicht. Er spürte es und hoffte nur, dass der Professor mit der Sprache herausrückte. Manchmal konnte er nämlich sehr verschwiegen sein und sich ihm erst dann, wenn alles schon passiert war, anvertrauen.
»Mein Leben war reich«, fuhr Professor Paulsen fort. »Es war reich an Erfolgen, reich an Zärtlichkeit. Aber es war auch reich an Kummer und Schmerz. Geblieben ist mir die Liebe zur Musik und die große, echte Aufgabe, die ich noch zu erfüllen habe, die Erziehung meiner Enkeltochter. Trinken wir auf Nathalies Zukunft, Benedikt.«
Benedikt schätzte den Tokajer sehr. Er trank ihn furchtbar gern, und auf das Wohl der kleinen Nathalie zu trinken, war für ihn eine ganz besondere Ehre, aber diesmal machte es ihm keinen Spaß. Er beobachtete den Professor aufmerksam.
»Ich habe einen Brief geschrieben«, erklärte der Professor, »der Nathalies Zukunft erleichtern wird.«
Benedikt stellte fest, dass sich zwischen die buschigen weißen Brauen des Professors die steile Falte schob, die er von früher her noch gut kannte. Diese Falte war immer dann zum Vorschein gekommen, wenn der Professor über eine Disharmonie seines Orchesters unglücklich und besorgt war.
»Für den Fall der Fälle«, fügte Daniel Paulsen betont leicht hinzu, »soll Nathalie nicht alleinstehen, sondern ein Zuhause haben. Solange ich lebe, ist alles gut. Aber wenn ich einmal nicht mehr bin, ändert sich Nathalies Situation schlagartig. Jetzt wird ihr nicht bewusst, dass sie kein Elternhaus mehr hat … Nein, unterbrich mich nicht, Benedikt«, bat er wieder ungeduldig. »Du kennst diese ganze lange und traurige Geschichte, die Nathalies Eltern entzweit und mir sehr viel Kummer bereitet hat. Wir wollen darüber jetzt nicht diskutieren. Mir geht es einzig und allein darum, dass sich das Kind in eine Umgebung eingewöhnen soll, in der es vielleicht einmal leben muss, wenn ich nicht mehr da bin.«
»Aber das kann doch noch hundert Jahre dauern!«, rief Benedikt etwas unbeherrscht.
»In diesem Falle wäre Methusalem ein Waisenknabe gegen mich«, sagte Professor Paulsen lächelnd. »Nein, Benedikt, wir dürfen die Augen vor der Wirklichkeit nicht verschließen. Das wäre wenig sinnvoll. Ich habe lange gesucht, bis ich ein mir geeignet scheinendes Plätzchen für Nathalie gefunden habe.«
»Was für ein Plätzchen ist das?«, forschte Benedikt misstrauisch.
»Ein Kinderheim«, antwortete Professor Paulsen lebhaft. »Es heißt Sophienlust und liegt in Deutschland. Wir sind Deutsche. Ich habe mich zwar bisher in die Schweizer Berge zurückgezogen, weil ich mich hier besonders wohlfühle, aber deshalb sind wir doch Deutsche geblieben. Jedenfalls ist mir dieses Kinderheim von verschiedenen Seiten wärmstens empfohlen worden. Verlassene oder einsame Kinder finden in Sophienlust eine Heimat. Eine Heimat«, wiederholte er leise. »Das ist es, worauf es mir ankommt. Nathalie soll, wenn ich einmal nicht mehr bei ihr sein kann, eine Heimat haben. Ich bin sicher, dass sie diese Heimat in Sophienlust finden wird. Ich wünsche, dass Nathalie, bevor der Winter einsetzt, einige Wochen in Sophienlust verbringt. Sie soll sich dort eingewöhnen. Dann wird es ihr später leichterfallen, sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden.«
Benedikt war so bestürzt, dass er kein Wort herausbrachte.
»Ich habe mich genauestens informiert«, fuhr Professor Paulsen engagiert fort. »Sophienlust wird von Menschen geführt, denen man vertrauen kann. Ich habe meinen Brief an Frau Denise von Schoenecker gerichtet. Falls ich eine zusagende Antwort von ihr erhalte, werden wir unverzüglich nach Sophienlust reisen, um Nathalie für eine Weile dort unterzubringen.«
Benedikt schüttelte bekümmert den Kopf. »Aber ich fürchte, Herr Professor«, wandte er traurig ein, »Nathalie wird davon nichts wissen wollen.«
»Nathalie ist ein weit über ihre Jahre hinaus vernünftiges Kind«, entgegnete der Professor. »Ich bin sicher, dass sie uns keine Schwierigkeiten machen wird. Natürlich«, schränkte er ein, »müssen wir die Wahrheit ein bisschen verbrämen.« Er zwinkerte Benedikt zu. »Wir werden Nathalie sagen, dass wir beide zusammen wieder ein Gastspiel geben. Irgendwo. Wenn wir ein Konzert geben, dann haben wir ja beide keine Zeit, uns um Nathalie zu kümmern. Das weiß sie und wird auch verstehen, dass wir sie während dieser Zeit nach Sophienlust bringen. Benedikt, nun mach kein so belämmertes Gesicht! Ich habe mir schließlich die größte Mühe gegeben, einen Ausweg zu finden. Trink dein Glas leer und spanne Schimmi an. Fahre zur Poststation, ehe die ersten Schneeflocken fallen.«
»Vielleicht fallen sie gar nicht«, brummte Benedikt. »Außerdem ist die Poststation jetzt geschlossen.«
»Na, na!« Professor Paulsen lachte. »Der Posthalter ist doch dein spezieller Freund! Er wird sich bestimmt nicht weigern, den Brief noch anzunehmen und ihn morgen in aller Frühe per Eilboten weiterzubefördern.«
»So eilig ist das?«, fragte Benedikt ängstlich. »Per Eilboten?«
»Das ist die sicherste Art, einen Brief zu unserem entlegenen Dorf in die Welt hinaus befördert zu bekommen«, erklärte der Professor. »Auf diese Weise gibt es mit Sicherheit keine Verzögerung. Also, wie ist es? Spannst du Schimmi an?«
Benedikt seufzte. Er hatte sich den Verlauf dieses Abends gemütlicher vorgestellt.
»Na schön«, meinte er und ergab sich in sein Schicksal. »Holz habe ich schon gebracht. Aber vergessen Sie bitte nicht, Holz nachzulegen, Herr Professor, sonst geht das Feuer aus, und die Ölheizung haben wir ja noch nicht in Betrieb genommen. Außerdem ist es bald Zeit zum Abendessen. Nathalie wird Hunger bekommen.«
»Nicht, wenn sie liest«, behauptete der Professor. »Du brauchst fünfzehn Minuten zum Dorf hinunter und fünfundzwanzig zurück. Wenn du dich nicht länger als zehn Minuten bei deinem Post-Spezi aufhältst, kannst du in knapp einer Stunde zurück sein. Bis dahin werden Nathalie und ich nicht verhungern.«
Der Professor ging zu seinem Schreibsekretär. Er überlas den Brief, den er geschrieben hatte, noch einmal und steckte ihn dann in das schon vorbereitete Kuvert, das er Benedikt übergab.
»Hüah«, meinte Benedikt. »Dann werde ich also.« Unter der Tür wandte er sich noch einmal um. »Falls Nathalie Durst kriegen sollte, die Limo steht auf dem Küchentisch.«
»Danke, Benedikt«, sagte Professor Paulsen. Er hörte, wie Benedikt in der holzgetäfelten Diele seinen Kapuzenmantel überzog und zur Tür ging. Dann fiel die Tür hinter ihm zu. Seine Schritte knirschten über die Steine vor dem Haus zu Schimmis Stall.
Professor Paulsen schenkte sich noch ein Glas Tokajer ein. Er sah in das Kaminfeuer und war zufrieden. Leicht war es ihm nicht gefallen, diesen Brief zu schreiben. Aber er wusste, dass er richtig gehandelt hatte.
Daniel Paulsen setzte sich in die rustikale Klubecke am Kamin, um die Wärme des Feuers zu genießen. Wenn man in die Jahre kommt, dachte er, braucht man die Wärme. Früher hat mir Kälte nichts ausgemacht.
Er zog den ledernen Tabaksbeutel aus seiner Joppentasche. Umsichtig stopfte er seine Pfeife.
Jetzt hörte er die Stalltür knarren. Benedikt redete mit Schimmi. Das machte Benedikt immer, und er war überzeugt, dass Schimmi ihn genau versteht. Das, was Benedikt sagte, konnte der Professor nicht verstehen, aber er ahnte es: Wir müssen noch einmal ins Geschirr, Schimmi!
Nach einer Weile klapperten Schimmis Hufe im Stakkato über die Steine vor dem Haus, die Räder der Kutsche rumpelten den Bass dazu, und Benedikt rief: »Hüah, Schimmi, hüah!«
Wenn Benedikt in einer Stunde ›Brrr, Schimmi, Brrr!‹ ruft, dachte Professor Paulsen mit feinem Lächeln, dann ist alles getan, und wie es getan ist, so ist es gut. Er lehnte sich entspannt in den gemütlichen Sessel zurück. Es war jetzt sehr still. Auch draußen war die Stille groß wie immer, wenn der Abend kam und das Leben leise wurde.
Auf Zehenspitzen, dachte Professor Paulsen, schleicht der Tag davon. So vergeht ein Tag nach dem andern, und man weiß nie, wann es der letzte Tag eines Menschenlebens sein wird.
Er paffte seine Pfeife und überlegte, ob er noch einmal nach Nathalie sehen sollte. Aber er wollte sie nicht stören. Er wusste schließlich, wie wichtig es für sie war, dass sie lesen konnte. Wenn es ihr zu langweilig wird, dachte er, wird sie schon von sich aus zu mir kommen.
An den Wänden der Halle hingen die vergoldeten Lorbeerkränze, die Professor Paulsen während seiner glanzvollen Laufbahn als Dirigent überall in der Welt überreicht worden waren. In Rom, in Moskau, in Paris, Berlin, London, New York und Madrid. Sie sahen müde aus. Auch Lorbeer welkt, dachte der Professor. Sogar dann, wenn er vergoldet ist.
Zwischen diesen goldenen Lorbeerkränzen, vom Widerschein des Kaminfeuers wie mit lebendiger Wärme angehaucht, hing das Porträt einer jungen Frau. Sie war schön, und ihr blondes Haar leuchtete aus den zarten Pastelltönen des Gemäldes. Sie lächelte, aber ihre Augen waren traurig.
»Cosima«, flüsterte Daniel Paulsen gequält. »Cosima …«
Das Kaminfeuer knisterte traulich. Zu den Fenstern sah die Dunkelheit herein. Es waren keine Sterne am Himmel. Wahrscheinlich würde Benedikt recht behalten. Der erste Schnee würde bald fallen.
Der Professor geriet ins Träumen. Das geschah in letzter Zeit häufig. Aber nicht immer waren die Träume ihm freundlich gesinnt. Manchmal beschworen sie auch Erinnerungen herauf, die ihn bedrängten. Er sah im flackernden Kaminfeuer Bilder, die er lieber nicht sehen wollte. Es waren Gesichter, die ihn ansahen, die zu Menschen gehörten, die in seinen Lebenskreis einbezogen waren.
Er blickte in das markante, von einem dunklen Bart umrahmte Gesicht eines jungen Mannes – sein eigenes Gesicht. Nein! Unwillig schüttelte der Professor den Kopf. Er selbst war das nicht. Er hatte nie so sieghaft und verwegen gelacht, und er hatte das Leben auch nie so leicht genommen wie jener, zu dem dieses Gesicht gehörte.
»Georg«, flüsterte der Professor. »Georg, mein Sohn …«
Ein Geräusch schreckte ihn aus seinen Wachträumen auf.
»Großvater«, rief Nathalies helle Stimme aus dem Obergeschoss. »Es klopft jemand an die Tür. Ist Benedikt nicht da?«
»Nein, ich habe ihn noch einmal ins Dorf hinuntergeschickt«, rief Daniel Paulsen zurück. »Ich mache schon selber auf. Es wird ein verspäteter Wanderer sein!«
Der Professor legte seine Pfeife in den Ascher auf dem Klubtisch und ging in die holzgetäfelte Diele.
In diesem Augenblick hörte er zum ersten Mal den Wind. Er erschrak, weil er das Gefühl hatte, der Wind singe ein unheilvolles Lied. Als er die Tür aufsperrte, drängte der Wind sich mit gewalttätiger Heftigkeit durch den Spalt der offenen Tür ins Chalet.
Das Licht, das in der Diele brannte, fiel in die Dunkelheit hinaus. Vor der Tür des Chalets stand ein großer und hagerer Mann.
Er trug einen pelzgefütterten Mantel und eine Pelzmütze.