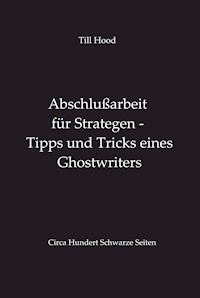
5,99 €
Mehr erfahren.
In diesem Leitfaden beschreibt Till Hood, der jahrelang als Ghostwriter gearbeitet hat, wie strategisch vorgegangen werden kann, um die Abschlußarbeit fast zu einem "Spaziergang" zu machen. Auf unterhaltsame und humorvolle Art führt er in die Arbeitsweise eines Ghostwriters ein und zeigt, wie man mit etwas Planung viel Arbeit, Zeit, Geld und viele Nerven sparen kann. Ein Muß für jeden, der sich nicht länger mit wissenschaftlichen Arbeiten herumquälen möchte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Till Hood
Abschlußarbeit für Strategen – Tipps und Tricks eines Ghostwriters
www.tredition.de
----------------------------------------------------
© 2016 Till Hood
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-7345-5937-2 Hardcover: 978-3-7345-5938-9 e-Book: 978-3-7345-5939-6
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Ausgangssituation und Ziel des Leitfadens
Zielgruppe
Über Leitfäden und diesen Leitfaden
1. Die Vorüberlegungen
1.1 Das Ziel – Abstand von Perfektion und Emotion
1.1.1 Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und die Abschlußarbeit
1.1.2 Verteidigung
1.2 Über das Schreiben in der Wissenschaft und an der Uni
1.3 Die Dozenten – oder: Mein Prof, das unbekannte Wesen
1.3.1 Die Arbeit mit dem Dozenten oder: Wie führe ich einen Prof an der langen Leine
2. Die Arbeit
2.0 Die Emotion
2.1 Die einzelnen Schritte und ihr zeitlicher Ablauf
2.2 Das Thema
2.2.1 Ein empirischer Teil
2.2.2 Die ausgewählte Methode
2.3 Die Lektüreauswahl
2.4 Die Gliederung
2.5 Das Lesen und das Einsortieren der Stichpunkte
2.6 Das Sortieren
2.7 Das Formale
2.8 Das Schreiben
2.8.1 Den Inhalt verdichten
2.8.2 Seiten schinden
2.9 Das Zitieren
2.10 Die Einleitung und die Zusammenfassung
2.11 Endkontrolle und „letzter Schliff“
3. Die Arbeitsschritte in Kurzform
4. Die Lektionen oder: Die 10 Goldenen Regeln
Zusammenfassung
Einleitung
Ausgangssituation und Ziel des Leitfadens
Ihr habt es also bis hierher geschafft. Der Abschluß grüßt bereits von der Zielgeraden. Einzig die Abschlußarbeit fehlt noch zu eurem Glück. Gerade die Abschlußarbeit, dieses Monster von 40, 50 oder noch mehr Seiten, das erlegt werden will. Und irgendwie graut euch davor. Schließlich hat euch die Uni mehr oder weniger allein gelassen mit diesem Monster, hat eher noch gesagt „mach mal“ („und zwar flott“).
Zu eurer Beruhigung sei gesagt, daß alle Unis in Deutschland das sagen. Ihr seid also kein Einzelfall. Die deutschen Unis machen zwei große Fehler: zum einen folgen sie nach wie vor der alten Tradition des Abschlußarbeitschreibens, die in vielen Disziplinen nicht mehr die Berufswirklichkeit repräsentiert. Und zum anderen tun sie kaum etwas dafür, daß das, was sie den Studenten abverlangen, diesen auch beigebracht wird.
Das Ghostwriting würde sich in Luft auflösen, wenn die universitäre Lehre und die Prüfungsverfahren modernisiert, mehr Professoren eingestellt und den Studenten der Fächer, in denen eine Abschlußarbeit Sinn macht, obligatorische Schreibkurse angeboten werden würden. Würde, könnte, hätte, Arschbulette.... ist aber nicht. So müßt also auch ihr euch mit dem Monster herumschlagen.
Damit das Monster aber kleiner wird, so klein, daß es in eure Hosentasche paßt und ihr euch bei Bedarf mit dem wuscheligen Fell eure Nase schnäuzen könnte, habt ihr jetzt diesen Leitfaden. Dieser hilft euch, drei Dinge zu sparen: Geld – Zeit – Nerven. Geld spart ihr, weil ihr keinen Ghostwriter engagieren müßt. Zeit spart ihr, weil weil ihr lernen werdet, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nerven spart ihr, weil ihr erkennt, was zu tun ist, es umsetzen könnt und eure Zweifel im Griff habt.
Das wesentliche Ziel dieses Leitfadens ist es somit, euch die Angst zu nehmen vor dem Monster. Oder drücken wir es aus motivationspsychologischen Gründen positiv aus: das wesentliche Ziel dieses Leitfadens ist es, euch eurem Text gegenüber ein neutrales, objektives Nicht-Gefühl zu verschaffen.
Dieser Leitfaden will euch nicht die Freude an der wissenschaftlichen Forschung und dem Erstellen wissenschaftlicher Texte nehmen, aber er wird die Ausgangsbasis austauschen. Wir gehen nicht davon aus, daß das Erstellen eines wissenschaftlichen Textes von Vornherein mit „Juchu“ und „Yippie“ und „Danke, großer Wissenschaftsgott, daß ich unwürdiger Wurm was schreiben darf“ verbunden ist. Wir gehen davon aus, daß der wissenschaftliche Text folgendes ist:[1]
ein Zeitklauer und Energieverschwender
ein notwendiges Übel
eine zu bewältigende Aufgabe
etwas, was zwischen euch und der Freiheit steht und aus dem Weg geräumt werden muß
ein spaßiges Ding, an dem ihr euer Organisationstalent und eure Kreativität trainieren könnt
Klingt besser, oder?
Dieser Leitfaden soll ein Korsett seyn und einen Rahmen vorgeben, an dem ihr entlanghangeln könnt. Der Leitfaden möchte auch mit bestimmten Irrtümern aufräumen, die mit dem wissenschaftlichen Schreiben verbunden sind, in erster Linie mit dem, daß das Gewicht immer auf das Schreiben gelegt wird. Ihr werdet sehen, daß das Schreiben an sich erst am Ende einer langen Reihe von „Vor“-arbeiten kommt, die, ordentlich ausgeführt, das Schreiben fast zu einem Selbstläufer machen. Aus diesem Grunde möchte ich eher davon sprechen, einen Text zu designen. Hier stütze ich mich auf meine Erfahrung als langjährigen Ghostwriter.
Ghostwriter schreiben keine Texte, sie designen sie. Wissenschaftliche Texte sind nichts anderes als Texte mit einer bestimmten Struktur. Der Inhalt ist nicht unwichtig, aber wenn man einmal verstanden hat wie ein wissenschaftlicher Text „funktioniert“, kann man immer wieder und wieder eine funktionierende Struktur erarbeiten. Wenn dies nicht so wäre, würden Ghostwriter, die das professionell betreiben, verhungern. Das tun sie aber nicht.
Dieser Leitfaden wird euch dabei helfen, euren eigenen Text zu designen, und, im zugegeben besten Falle, sogar eure Freude, dies tun zu können, aktivieren. Erste Lektion also (alle mitsprechen): „Ich designe den Text.“
Zielgruppe
Studenten vielleicht? Genau. Etwas konkreter gesagt, richtet sich dieser Leitfaden an die unter euch, die wenig Zeit haben oder die denken, daß Schreiben etwas für Götter ist. Er richtet sich an die, die einfach nur ihren verfickten Abschluß haben wollen und an die, die sich an der Uni und in der Wissenschaftswelt nicht zuhause fühlen, und die einfach nur, aber nicht ganz ohne Benefiz nach all den Jahren, raus wollen aus dem Unibetrieb, und das dürften einige seyn, denn sind wir mal ehrlich: Wissenschaftler an der Uni sind nicht unbedingt für ihre lebensnahe Art bekannt.
Der Leitfaden richtet sich an die, die mit relativ wenig Aufwand das Minimalziel erreichen wollen, das da heißt: Bestanden! Wenn es mehr wird (und unrealistisch ist das nicht), freut euch ein Loch in den Bauch.
Der Leitfaden ist allerdings nicht für Faule gedacht und geschrieben worden. Das Buch heißt nicht umsonst „für Strategen“. Irgendwas muß man schon tun, wenn man einen Abschluß haben will. Leute, die denken, das alles von alleine passiert, haben sich das falsche Buch gekauft. Denen empfehle ich eher die Lektüre von „Wünsche an das Universum“; und schließlich hat man ja auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.
Also mitmachen und euren Grips anstrengen müßt ihr schon, aber der Leitfaden zeigt euch, wie ihr das in die richtigen Bahnen lenken und auf das nötige Minimum begrenzen könnt, so daß alles Notwendige enthalten ist und eure Betreuer euch mit einiger Wahrscheinlichkeit ein fettes „like„ unter den Text setzen. Daher die zweite Lektion (und alle mitsprechen): „Ich will nur meinen Abschluß gestalten.“
Über Leitfäden und diesen Leitfaden
Es wird Leute geben, die werden sagen, daß hier teilweise unwissenschaftlicher Scheiß drin steht. Diesen Leuten möchte ich entgegnen, daß dieser Leitfaden keine Hommage an die Wissenschaft darstellt, sondern gequälten Studentenseelen den Abschluß erleichtern soll und sofern hier billige Tricks hilfreich sind, ist das von meiner Seite her vollkommen legitim; und: glaubt mir, den fertigen Text, wenn er gut gemacht wurde, sieht man die billigen Tricks nicht an. Auch der wissenschaftliche Text lebt von der Illusion des Lesers.
Ich will zeigen, wie man Gefahren geschickt umschiffen kann und wie man Wissenschaftlichkeit schnell und effizient verschriftlichen kann. Leitwörter sind somit „schnell“, „effizient“ und „effektiv“. McKinsey läßt grüßen.
Ganz klar: ich bin auf der Seite der Studenten. Die Idee, diesen Leitfaden überhaupt zu schreiben, entwickelte sich aus der Erkenntnis, daß fast alle Leitfäden über das wissenschaftliche Schreiben, die von irgendwelchen Wissenschaftsfuzzis geschrieben wurden, gerade an der Realität vorbei gehen. Sie sind entweder zu kompliziert geschrieben, zu lang oder bekräftigen die Angst, die man durch Lesen des Leitfadens eigentlich abbauen möchte. Die anderen Leitfäden gehen in der Regel davon aus, daß es sich bei allen abschlußwilligen Studenten um Adepten handelt, die mit der Abschlußarbeit die Salbung der Wissenschaft erhalten wollen.
Dieser Leitfaden geht vom Gegenteil aus. Aus diesem Grunde besteht die Hauptaufgabe darin – und wenn ich mich in diesem Punkt immer und immer wieder wiederhole, ist das Absicht – das wissenschaftliche Schreiben klein und alltäglich zu machen zu machen und die Bedeutung von Routinen für das wissenschaftliche Schreiben hervorzuheben.
Im Leitfaden wird es daher mit Hilfe von Pragmatismus und Ironie/Humor darum gehen, bei euch das Ausschalten eures Angstgefühls zu erreichen und bei euch die Perspektive zu „implantieren“, den Text als den Text eines Fremden zu betrachten. Und nochmal: die wichtigste Lektion ist es, sich emotional aus der Arbeit heraus zu nehmen. Daher gleich mal alle die Lektion drei nachsprechen: „Meinem Text gegenüber habe ich keine Gefühle.“
Nur wenn man das macht, kann man schnell, effizient und effektiv seyn. Interesse für ein Thema zu haben, ist auch hierfür wichtig, ohne Frage. Ohne Interesse übersteht man keine Arbeit, keinen Job, aber über das Interesse sollte es nicht hinaus gehen. Man sollte immer sagen können: „eigentlich egal, ob ich es so oder so mache, Hauptsache ist, dass es richtig ist und ich schnell fertig werde.“
Daher gleich noch ein Hinweis: Perfektionsdrang abschalten. Eure Arbeit wird die Welt nicht revolutionieren. Denkt dran: zwei, maximal drei Leute werden sie lesen. Und die werden ihr Leben nicht umschmeißen, weil ihnen ein kleines Studentlein versucht hat zu erklären, warum die Welt so und so funktioniert.
Alle, die jetzt merken, daß sie ihr Herzblut für das Thema und ihren Perfektionsdrang nicht im Zaum werden halten können, sollten sich an dieser Stelle verabschieden ...
.... ich warte .....
.... okay, weiter im Text.
Um die Angst auszumerzen, bezieht der Leitfaden auch den universitären Kontext mit ein. Im ersten Teil wird darauf eingegangen, welche Bedeutung das wissenschaftliche Schreiben generell hat und wie mit diesem umgegangen wird. Das dies keine Lobeshymne wird, sollte sich bereits nach den ersten Seiten dieser Einleitung von selbst verstehen. Denn was alles so abgeht in der Wissenschaft mit Texten und welch Schindluder damit getrieben wird, paßt tatsächlich auf keine Kuhhaut.
Ebenfalls einbezogen wird auch die zweite Person, die wichtig ist, für das Textdesign – der Betreuer. Über diese Spezies müssen auch mal ein paar Dinge gesagt werden. In diesem Leitfaden natürlich nur solche, die ebenfalls angstabbauend wirken.
Um es wenigstens einmal zu sagen (und es wird bei diesem einem Mal bleiben; also, Dozenten, lest das und zehrt die restlichen Seiten davon): es gibt natürlich auch gute Wissenschaftler und Dozenten, engagierte, Studenten wohlgesinnte, die den Spagat zwischen Lehre und Forschung gut meistern und das eine dem anderen nicht aufopfern wollen, die Studenten nicht von oben herab betrachten, immer noch wißbegierig sind, Studenten als Bereicherung ihres eigenen Denkens betrachten .... aber diesen „Guten“ wird es in der Universitätslandschaft immer schwerer gemacht.
Das Humboldtsche Ideal des selbständigen Denkens, des ewigen Forschens (was nicht Ziellosigkeit oder Ergebnislosigkeit heißt; das nur für den Fall, falls hier jemand denkt, schlau reinquatschen zu können) stirbt aus, wird aus der neoliberal orientierten Dienstleistungsuniversität entfernt, weil die Wissenschaft zum reudigen Köter der Wirtschaft und der Politik verkommen ist und hechelnd jedem Stöckchen hinterherrennt, der von den geistig armen Popanzen weggeworfen wird. Denk ich an Deutschlands Uni in der Nacht, ...ihr kennt den Rest.
Und da ich gerade mein kleines schwarzes Herz etwas geöffnet habe, gleich noch hinterher: wie unschwer zu erkennen ist, liebe ich nicht die Wissenschaft als Institution mit ihren ganzen aufgeblähten Ritualen, ihrer Wichtigtuerei, ihrem Versuch, Religionsersatz zu seyn. Aber ich liebe das wissenschaftliche Arbeiten, das Fragen, das Nach-Antworten-Suchen, das Nachlesen, das Kennenlernen von Neuem, das Überraschtwerden, das Denken, das Zusammenhänge-Herstellen, das Diskutieren, letztlich also das, was Wissenschaft im Kern ausmacht. Da geht mir wirklich einer ab!
Deshalb habe ich ein Problem damit, wenn Rituale und Konventionen diesen Kern überdecken, und schlimmer noch: wenn Politik, Engstirnigkeit und menschliche Schwächen diesen Kern fast schon abgetötet haben durch Exzellenzinititativen, Drittmitteleinwerbung und pures Konkurrenzdenken, welches dem Kern der Wissenschaft bereits diametral entgegengesetzt ist.
Wissenschaft ist Kooperation, aber das kapieren die ganzen Fuzzis nicht. Dem sokratischen „Erkenne, daß du nichts weißt!“ ist als wissenschaftlichem Credo nichts mehr hinzuzufügen. Und alle bejubeln das in ihren Antrittsreden, Laudatios und so weiter, aber niemand hält sich daran. Aber gut, ich echauffiere mich schon wieder.
Was gibt es noch zu sagen? Ich nehme mir hier mal ganz bewußt die Freiheit, gendermainstreaminggerechte Sprache[2] vollkommen außer Acht zu lassen, so zu schreiben, wie mir der Schnabel gewachsen ist und auf die Grammatik und Rechtschreibung zu koten. Bezogen auf letzteres bin ich Anhänger der sprachlichen Freiheit des 18. Jahrhunderts. Ich mag das „ß“, ich mag „seyn“ mit „y“, ich mag es, Kommas nach dem Satzrhythmus zu setzen und mit Semikolons und Bindestrichen herumzuwerfen. Und da dies hier mein Buch ist und dieses Buch unterhalten und informieren soll, und meine Sprache beidem nicht abträglich, sonder eher das Gegenteil der Fall ist, pfeife ich auf die Korrektheit deutscher Sprachapostel.
Der Leitfaden bietet eines nicht: detailliertes Erklären des Formalen. Das könnt ihr gerne bei den anderen Leitfäden nachlesen, die damit vollgestopft sind, um Seiten zu schinden. Ihr könnt aber auch ganz einfach in wenigen Sekunden die Infos zu „wie zitiere ich eine Internetquelle richtig“ im Internet finden. Hierfür muß an dieser Stelle kein Speicherplatz verschwendet werden.
1. Die Vorüberlegungen
1.1 Das Ziel – Abstand von Perfektion und Emotion
„Vergeuden Sie bitte nicht so viel meiner Lebenszeit.“ Das sagte der Zweitgutachter zu mir, als ich auf Empfehlung meiner Erstgutachterin bei ihm vorsprach, um ihn als Zweitgutachter zu gewinnen.[3] Er gab mir damit zu verstehen, dass es keine Dissertation wäre und ich das Maximum der möglichen Seitenzahl nicht ausschöpfen müsse. Ich mußte ihn leider enttäuschen und schrieb doch die maximal möglichen 120 Seiten.
Warum habe ich das getan? Ich steckte knietief im Material. Das Thema, etwas über Hermann Hesse, hatte mich bereits das ganze Studium über beschäftigt. Ich saß dann fast 12 Monate an dem Ding. Und wofür? Damit zwei Prüfer das Ding lesen und nach einer Stunde wieder vergessen haben. Es existiert ein krasser Widerspruch zwischen dem Aufwand und der Anzahl der Personen, die sich mit diesem Aufwand beschäftigen.
„Aber man schreibt die doch für sich und lernt dabei“, werden einige jetzt sagen.
Richtiiiiich, aber das muss jeder für sich einschätzen. Und es ist die Frage, was man lernen soll. Wer zu einem anderen Zeitpunkt Selbstzweifel und dem jedem innewohnenden Perfektionismus kennenlernen und sich mit diesen auseinandersetzen möchte, sollte meiner Meinung nach, das Recht dazu haben. Und über das Thema lernt man genug, auch wenn man sich nur einen oder zwei Monate damit beschäftigt.
Wenn man glänzen möchte, ist es die Frage, ob man sich dafür die Abschlußarbeit aussuchen sollte. Wenn man schnell seyn will, geht es eher darum, grobe Fehler zu vermeiden und etwas Solides zustandezubringen. Das ist ausreichend, letztlich auch in der Wissenschaft. Denn fragen wir doch mal, wozu so eine Abschlußarbeit nötig ist.
Fangen wir beim Offensichtlichen an, obwohl das für viele nicht so offensichtlich ist: Die, die die Arbeit bewerten, wissen, daß nur ein verschwindend geringer Prozentsatz an der Uni und in der Wissenschaft verbleiben wird. Bei dem Großteil genügt es somit, daß sie zeigen können, daß sie ungefähr wissen, was sie tun. Was heißt das?
Oft genügt es, die formalen Vorgaben zu befolgen, denn auch die Wissenschaft, vor allem Geisteswissenschaften leben vom Formalem, da bei ihnen die Objektivität noch weniger zu erkennen ist als bei den Naturwissenschaften. Man soll zeigen, daß man ein eigenes System aufstellen kann, in dem man eine Frage behandeln kann, d.h. daß man zeigen soll, daß man einen eigenen Ablauf für eine Arbeit entwickeln und diesen auch einhalten kann. Man soll zeigen, daß man gelernt hat zu denken, daß man bestimmte Schlüsse ziehen, und daß man bestimmte Dinge ausschließen und jedes Argument schön absichern kann durch eine zweite Meinung. Ich denke, daß die soeben genannten Erfordernisse von jedem erbracht werden können.
In einer Abschlußarbeit kann es primär nicht um etwas Neues gehen. Nur die wenigsten schaffen mit ihrer Abschlußarbeit einen Neuerwerb für die Wissenschaft. Der Großteil zeigt nur, daß man über vielen Seiten einen roten Faden halten kann, an dessen Ende sogar ein Pullover hängt, den man benutzen kann. Nur das dieser Pullover schon von anderen vorher gehäkelt worden ist, worum es aber nicht geht. Zum Thema Goethe, zur Stadtsoziologie, zum Autismus ….. ist bereits viel gedacht worden, Quantensprünge sind hier äußerst selten und in der Regel werden diese dann von den etablierten Wissenschaftlern vorgenommen, die sich 2,3,4 Jahrzehnte mit einem Thema beschäftigt haben (die Armen!). Des weiteren scheint es Themenballungen zu geben. Sieht man sich mal entsprechende Internetseiten an, auf den Hausarbeiten und Abschlußarbeiten angeboten werden, stellt man fest, daß nicht selten zur selben Zeit mehrere Arbeiten zu einem Thema geschrieben worden sind. Die haben nicht abgeschrieben, das hat einfach mit Prozessen in der Gesellschaft und in der Wissenschaft zu tun.
Um es noch einmal zu sagen: wir reden nicht über eine Dissertation. Wir reden darüber zu beweisen, wissenschaftlich arbeiten zu können und vielleicht so eine Ahnung von einer klitzekleinen Erkenntnis herauszuziehen.
Seit dem Auslaufen der Magisterstudiengänge hat es zugenommen, dass in Masterstudiengängen von der Master Thesis verlangt wird, eine „neue“ wissenschaftliche Erkenntnis zu erarbeiten. Dies hat meiner Meinung nach mit der weitergehenden Umstrukturierung der Universität zu tun. Es wird an einem Prozess gearbeitet, bei dem gleitend in die Dissertation übergegangen werden kann. Das bedeutet, dass auch die Dissertation „verschult“ und für einen Großteil der Masterabsolventen anstrebenswert werden soll. Die Master Thesis soll hierbei auf die Dissertation vorbereiten, denn diese soll den Doktoranten auf die „höchste Erkenntnisebene“ seiner Disziplin katapultieren. Das muss er erst lernen. Denn im Studium lernt er es nicht.





























