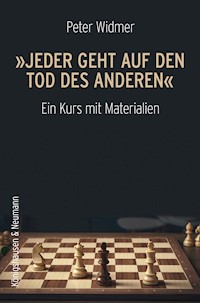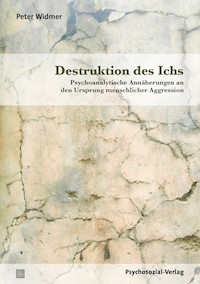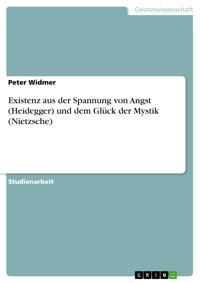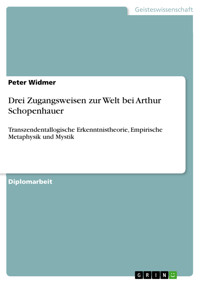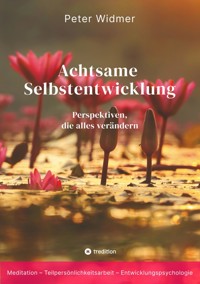
24,99 €
Mehr erfahren.
Achtsame Selbstentwicklung integriert aktuelle Erkenntnisse aus Kindheits-, Jugend- und Erwachsenenentwicklungspsychologie und verbindet sie mit Meditation und Achtsamkeit in der Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen. Dabei wird deutlich, wie wir im Alltag Wachstumschancen erkennen und ergreifen können, um Entwicklung geschehen zu lassen und zu vermeiden, ihr im Weg zu stehen. "Achtsame Selbstentwicklung zeigt die dringen benötigten inneren Ressourcen, um durch die herausfordernde Zeit zu navigieren in der wir heute leben." Susanne Cook-Greuter, Linguistin & Entwicklungspsychologin, Wayland, MA USA
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Es ist eine Freude, dass die Selbstentwicklungstheorie auf der Grundlage des Sentence Completion Test integral (SCTi) in alle möglichen Lebensbereiche hinein ausgeweitet, verfeinert und kreativ angewendet wird, um Einsicht und Wachstum zu fördern. Peter Widmer legt in diesem Buch eine ausgezeichnete Integration des aktuellen Wissensstandes über die Individualentwicklung vor, mit einem tiefen Verständnis der conditio humana.
„Achtsame Selbstentwicklung“ zeigt die dringend benötigten inneren Ressourcen, um durch die herausfordernde Zeit, in der wir leben, zu navigieren. Das fundierte und gut illustrierte Buch bietet detaillierte, praktische Übungen, um die eigene „innere Familie“ der Teilpersönlichkeiten zu erkunden und zu erkennen, welche Entwicklungsstufen diese mit „Energie“ versorgen. Es integriert die Grundlagen der Kindheitsentwicklung und Erkenntnisse der neurobiologischen Forschung hinsichtlich eines gelingenden, guten Lebens. Dieser Einbezug der Kindheitsentwicklung erweitert das ursprüngliche Erwachsenenentwicklungsmodell. Es bietet Hoffnung für Wachstum und den Aufbau von ressourcenreichen Zuständen und gelingenden zwischenmenschlichen Beziehungen, selbst in Zeiten individueller und gesellschaftlicher Krisen, indem es uns auf das fokussiert, was wir wirklich verändern können: unsere inneren Haltungen.
Dr. Susanne Cook-Greuter
Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht in der Suche nach Neuland,
sondern darin, mit neuen Augen zu sehen.
Marcel Proust
Peter Widmer
Perspektiven, die alles verändern
© 2023 Peter Widmer
ISBN Softcover: 978-3-347-79761-1
ISBN Hardcover: 978-3-347-79762-8
ISBN E-Book: 978-3-347-79763-5
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Einleitung
Mit innerer Entwicklung kommt äußere Transformation
Achtsame Selbstentwicklung
Persönlichkeitsanteile entwickeln sich
Was sind Persönlichkeitsanteile?
Wie kann man Persönlichkeitsanteile bei sich erkennen?
Wie wir uns „Teile-weise“ entwickeln
Entwicklungsstufen unserer Anteile
Die empirischen Grundlagen des Selbstentwicklungsmodells
„Sprich!“ – und ich sage dir etwas über deine Selbstentwicklung
Perspektivenübernahme als Grundstruktur von Entwicklung
Grundübung
Innere Friedenskonferenz mit einem Persönlichkeitsanteil
Vorgehensweise
Ein Beispiel
Präkonventionelle Entwicklungsstufen
0. Die vorsprachliche Entwicklungsphase
Das Wachbewusstsein erwacht aus dem Traum
Atmosphärisches Eingenommensein
Ein rudimentäres Verständnis von Körper-Ich – Du – Dinge – Lebewesen
Angeborene, vorsprachliche Tendenzen
Anpassungsfähige, problemlösende Teile
Die Seite, die Dinge intuitiv erklärt (Ursache – Wirkung), und die Seite, die ein intuitives Verständnis davon hat, zielgerichtet zu agieren (Mittel – Zweck)
Die intuitiv empathische, hilfreiche und psychologische Seite
Die intuitiv moralische Seite
Angeborene ungeduldige, rastlose, gestresste, hellwache und ausdauernde Teile
Angeborene impulsive und aggressive Teile
Angeborene Begabungen als Teilpersönlichkeiten
Zwei grundlegende Teile: Urvertrauen und Urmisstrauen
Erfahrungen hinterlassen bleibende Gedächtnisspuren in Gehirnnetzwerken
1. Die impulsive Entwicklungsstufe1
Die 1.-Person-Perspektive: Ein rudimentäres, sprachliches „Ich“ entsteht
Raum, Zeit, Zahl und die mathematische Seite
Konkret anschauliche, sehr einfache, dualistische Sichtweisen
Die Bedeutsamkeit der Befriedigung existenzieller körperlicher und sozialer Grundbedürfnisse für eine gelingende Entwicklung
Abhängige und verletzliche Teile
Sicherheit erwerben – Teile mit Gewohnheiten und Ritualen
Das spielende Kind als Matrix für Flow-Erlebnisse
Impulsive Teile und die Entwicklung hin zu einem Teil, welcher Impulse kontrollieren kann
Die bedürftige Seite und die Entwicklung hin zu einer Seite, die etwas selbst machen kann
Unterschiede zwischen impulsiven Kindern/Jugendlichen und impulsiven Erwachsenen4
2. Die selbstzentrierte Entwicklungsstufe
1.-Person-Perspektive: das auf sich selbst bedachte Teil – das Ich als Nabel der Welt
Inneres mit sich selbst Sprechen
Sprache als Ausdrucksphänomen: Die magisch-animistische, Märchenhaft-mythologische Seite
Sprache als Darstellungsphänomen: Anfänge einer realistischen, einer humorvollen und einer kritisch denkenden Seite
Die loyale und die autonome Seite – angepasste und rebellische Seiten
Der innere Regelmacher
Unterschiede zwischen selbstzentrierten Kindern/Jugendlichen und selbstzentrierten Erwachsenen8
Präkonventionelle Stufen als Durchgangsstufen und Schwerpunktstufen
Durchgangsstufen und Schwerpunktstufen
Faktoren, die Entwicklung hemmen
Neuronale Netzwerke der Selbstentwicklung und Verletzungen, Traumata, Resilienz
Verletzte Seiten und der wunde Punkt
Selbstschützende Persönlichkeitsanteile
Ressourcenreiche Zustände für den Umgang mit verletzten Seiten
Meditationsübung 1: eine selbstmitfühlende Seite entwickeln
Heilung durch die magisch-mythische Seite
Meditationsübung 2: der magische Helfer
Meditationsübung 3: Kraftvoll für sich einstehen
Konventionelle Entwicklungsstufen
3. Die gruppenzentrierte Entwicklungsstufe
Die 2.-Person-Perspektive
Identität durch Gruppenzugehörigkeit
Rollenübernahme als verinnerlichte Teilpersönlichkeiten
Vergleichendes Denken beim Spiel und unter Geschwistern – Gewinner, Verlierer, Neid und Eifersucht
Der Teil, der vor anderen gut dastehen will
Teile, die sich nicht zugehörig fühlen
Gefühle, Gruppenatmosphäre und prosoziales Handeln
Typische Sprache: zweiwertiges Denken, Klischees, Stereotypen und Plattitüden
Recht haben! – Anfänge kritischen Denkens
Tendenz zu unkritischem Verhalten
Wahrheit am Scheideweg
Der vorausschauende, planende Teil
Der Zauderer/„innere Schweinehund“
Die strategische Seite
Der verantwortliche Teil
Sich Dinge erklären: Bevorzugung konvergenten und deduktiven Denkens
Die humorvolle Seite: Ironie und Gruppen-Witze
Die ästhetische Seite
Sexuelle und intime Teile
Die digitale Seite
Das Cyber Self
Intuitive, spirituelle und religiöse Teile
Die politische Seite
Unterschiede zwischen gruppenzentrierten Jugendlichen und Erwachsenen
Abwehrformen und Coping-Strategien
Peinlichkeits- und Schamlügen
Der Beginn „weißer“, prosozialer Lügen
Machtvolle Teile – statt ohnmächtiger
4. Die aufgabenzentrierte Entwicklungsstufe1
Beginn der 3.-Person-Perspektive und der Fähigkeit zur Selbstreflexion
Sich in seiner Besonderheit ausdrücken – Identitätsfindung
Offenheit, Neugier, Erfahrungshunger: Pleasure Seeker, ungeduldige, rebellische, abenteuerliche Teile und die sinnlose Leichtigkeit des Seins
Beginn des formal-operationalen Denkens: der klare Verstand, kühle Logiker und abstrakte Denker
Abstrakte Wahrheit, logisches Schlussfolgern und realistische Erkenntnistheorie
Einfache, monokausale Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge
Eine Seite, die alles weiß und alles verstanden hat: der Experte
Perfektionistische, kritische Teile, äußere Richter und kompetitive, streitlustige Seiten
Selbstsichere Teile, Problemlöser und starke, sich durchsetzende Teile
Die humorvolle Seite: Ironie und Sarkasmus zur Stärkung des noch fragilen Selbstwertgefühls
Wer die Wahl hat, hat die Qual: kreative (divergente) und orientierungslose Seiten
Abwehrmechanismen und Coping-Strategien
Weniger, aber „besser“ Lügen können
5. Die selbstbestimmende Entwicklungsstufe
Zielstufe moderner Leistungsgesellschaften
Erweiterte 3.-Person-Perspektive: die planende, vorausblickende, problemlösende Seite
Wahrheit 1: kritische, skeptische, materialistische und wissenschaftliche Teile
Wahrheit 2: zupackende Pragmatiker
Komplexes „Wissen über“: Theoretiker
Loyale Teamplayer
Familien- und freizeitorientierte Teile
Die psychologisch wissende Expertin
Der Leistungsmensch: zielorientierte, effiziente, effektive und schnelle Seiten
Leistungsunterstützer: innere Kritikerinnen, äußere Richter, Perfektionistinnen, Multitasker, funktionierende, durchhaltende Seiten, Antreiberinnen, gewissenhafte, verlässliche und verantwortliche Teile
Eustress – Glück im Arbeitsflow
Kontrollierende und machtvolle Teile
Die „Geschichten“ erzählende Seite
Die politische Seite
Formen der Verdrängung und Coping-Strategien
Postkonventionelle Entwicklungsstufen
Kernmerkmale postkonventioneller Stufen
Entwicklung als zunehmende sprachliche (symbolische) Komplexität
4.-n.-Person-Perspektive: allgemeine Systemtheorie und Theorie hochkomplexer Systeme
Vom erkenntnistheoretischen Realismus zu einem zunehmend differenzierteren konstruktivistischen Wahrheitsverständnis
Komplexitätsbewältigung durch unterschiedlichste Formen der Komplexitätsreduktion
Zunehmende Integration als Schlüssel zum Verständnis postkonventioneller Entwicklung
Zunehmende Fähigkeit, mit Widersprüchen und Unbestimmtheiten zu leben
6. Die hinterfragende Stufe
4.-Person-Perspektive: der systemische Blick
Vertiefung der kritisch-hinterfragenden Seite
Wahrheit 1: die radikal konstruktivistische, alles relativierende Seite
Wahrheit 2: konsensorientierte, partizipative Teile
Die sich selbst verwirklichende Seite
Die ethische und die ästhetische Seite
Der humorvolle Teil: Selbstironie
Die prozessorientierte Seite – in Bezug auf die Außenwelt
Die prozessorientierte Seite – in Bezug auf die Innenwelt
Das psychologisierend wissende Teil
Die „Geschichten“ erzählende Seite
Sozialkompetente, tolerante, kompromissbereite Teile
Integrative Seiten
Die politische Seite
Ein Teil, welcher Widersprüche und innere Zerrissenheit erkennt und toleriert
Abwehrformen und Coping-Strategien
7. Die selbstaktualisierende Entwicklungsstufe
Erweiterte 4.-Person-Perspektive: Weitblick
Ein SELBST entsteht
Das SELBST, das Verantwortung für die sprachliche Konstruktion von Wirklichkeit übernimmt
Wahrheit als relative Konstruktion
Die metastrategische Seite, die systemische Muster und Längerfristige Trends erkennen kann
Ein Teil, welcher aktiv nach Paradoxien und Widersprüchen Ausschau hält, um neue Erkenntnisse und Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen
In zwischenmenschlichen Wechselwirkungen wachsen
Eine Seite, die „das Beste“ aus sich machen Möchte: Bedürfnis nach unterstütztem Wachstum
Die psychologische Seite: Die innere Psychologin/der innere Coach entsteht
Die Seite, die ihr Potenzial entfalten will
Die ethische Seite
Ein Teil, der sich zurückzieht und Zeit für sich braucht: Muße als Zeit für Selbstreflexion
Intuitive und kreative Teile: freierer Gebrauch von Fantasie und Intuition
Formen der Abwehr und Coping-Strategien
Machtvolle statt ohnmächtiger Seiten
8. Die konstruktbewusste Entwicklungsstufe
5.- bis n.te-Person-Perspektive
SELBSTausdruck als „authentischer Bewusstseinsstrom“
Volle Bewusstheit der Symbolizität: Wir leben in und durch „Geschichten“
Eine Seite, die Ungewissheit ertragen und alles radikal hinterfragen und nochmals neu denken kann
Hochdifferenziertes, konstruktivistisches Wahrheitsverständnis2
Bewusste Verwendung von Analogien zur Erkenntnisgewinnung und Wahrheitsfindung
Drei Tendenzen innerhalb des Spektrums der konstruktbewussten Entwicklungsstufe
Eine vertiefte Bewusstheit, dass das „Erzählen von Geschichten“ ein „Ich“ resp. Teilpersönlichkeiten und ein SELBST als etwas „Seiendes“ hervorbringt
Die humorvolle Seite: entlarvender Humor an den Grenzen des sprachlich Sagbaren6
Eine offene Seite, die große historische Zeiträume und Kulturen überblickt
Intuition und die Fähigkeit, Entwicklungen vorauszuahnen
Die generative Seite
Formen der Abwehr und Coping-Strategien
Gefühle der Einsamkeit und Sehnsucht nach Einfachheit
9. Die universale Entwicklungsstufe
Exkurs: Einheitserlebnisse innerund außerhalb religiöser Traditionen
Spirituelle Erlebnisse an der Grenze des Symbolisierungsprozesses und als non-duales, reines Bewusstsein
Spirituelle Erfahrungen auf allen Entwicklungsstufen und als späteste Entwicklungsstufe
Global denken, sprechen, fühlen, handeln
Wahrheit als Einheit/Nicht-Dualität
Grundstimmungen als innere Haltungen
Neurologische Forschung zu Selbstentwicklung und Meditation
Schlussbemerkungen
Teile und Stufen sind dynamisch und trainierbar
Innere Haltungen sind ansteckend
Bemerkungen zum Älterwerden
Danksagung
Index: Teilpersönlichkeiten
Glossar
Endnoten
Über den Autor
Achtsame Selbstentwicklung
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Einleitung
Index
Über den Autor
Achtsame Selbstentwicklung
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Einleitung
Mit innerer Entwicklung kommt äußere Transformation
Noch vor 30 Jahren waren Viele gewohnt zu denken, dass globale Probleme wie Hungersnöte, Bevölkerungswachstum und Ressourcenknappheit, Kriege, der Verlust von Biodiversität, der Zusammenbruch der Ökosysteme und der Klimawandel sich durch rein äußere, technische, wirtschaftliche und politische Lösungen beseitigen lassen. Auch heute gibt es noch viele Menschen, die so denken und zur vermeintlichen Beruhigung auf mögliche äußere Entwicklungen in der Zukunft vertrauen.
Unabhängig davon, wie schlimm wir die gegenwärtige Situation einschätzen, sollten wir zugleich auch bewusst an einer Gesellschaft arbeiten, die sich innerlich entwickelt. Denn im Kern stehen uns innere Probleme wie Selbstbezogenheit, ein Mangel an Verständnis hochkomplexer Vorgänge, die Illusion, dass diese gezielt kontrollierbar seien sowie ein Mangel an Verbundenheit und Mitgefühl im Weg, um gemeinsam tatkräftige Lösungen zu finden.
Die Lösung globaler Probleme erfordert nicht nur äußere, technische Lösungen, sondern vielleicht sogar vor allem innere Entwicklung. Denn viele Probleme beginnen bei uns selbst und erfordern eine Kombination aus Verstand, Herz und Bauchgefühl.
Erziehung in Schule, Lehre und Studium sollte sich in fundamentaler Weise in Richtung Sinnhaftigkeit und Zweckhaftigkeit in Bezug auf Veränderungen in der Welt orientieren, und nicht so sehr an der Vermittlung von Lerninhalten ausrichten. Doch innere Entwicklung sollte nicht bloß in unseren Bildungseinrichtungen stattfinden. Denn sie nützt uns in allen Bereichen unseres Lebens und betrifft sämtliche Lebensalter. Wir benötigen eine Gesellschaft, die sich innerlich entwickelt. Davon handelt dieses Buch.
Achtsame Selbstentwicklung
Achtsame Selbstentwicklung ist zentral zur Bewältigung globaler Krisen, weil sie uns hilft, auf eine umfassendere und tiefere Art und Weise zu verstehen, was in der Welt vor sich geht, und wie wir dazu beitragen können, diese Herausforderungen zu überwinden. Durch die Förderung von Selbsterkenntnis, Empathie und Mitgefühl können wir uns auf eine konstruktive und lösungsorientierte Herangehensweise konzentrieren, die auf Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung ausgerichtet ist.
Achtsame Selbstentwicklung hilft uns, uns selbst besser zu verstehen und unsere eigenen Stärken, Schwächen und blinden Flecken zu erkennen. Dies kann uns dabei unterstützen, uns als Individuen und als Gesellschaft besser auf die Herausforderungen vorzubereiten, die vor uns liegen, und eine starke und widerstandsfähige Gemeinschaft aufzubauen, die in der Lage ist, gemeinsam Lösungen für die anstehenden Probleme zu finden.
Letztendlich geht es bei achtsamer Selbstentwicklung darum, uns als Menschen mit inneren Ressourcen zu stärken und uns die Fähigkeiten und Einstellungen zu vermitteln, die wir benötigen, um mit hoch komplexen und sich schnell verändernden Herausforderungen, die uns bevorstehen, konstruktiver umzugehen.
Dieses Buch zeigt, wie wir uns in verschiedenen Bereichen, Rollen, Persönlichkeitsanteilen entwickeln. Innere Entwicklung findet ständig statt und konsolidiert sich auf bestimmten Entwicklungsstufen. Es werden Entwicklungsknotenpunkte benannt, die Entwicklungsaufgaben von der Kindheit bis ins hohe Alter in sich bergen. Dabei handelt es sich um Entwicklungschancen, die wir erkennen und ergreifen können, um Entwicklung geschehen zu lassen und um zu vermeiden, ihr im Wege zu stehen.
Offenheit ist hierbei der zentrale Entwicklungsschlüssel.1 Offenheit kann vor allem durch Meditation und Achtsamkeit kultiviert und vertieft werden. Denn Meditation führt in eine erkennende Offenheit im Sinne eines zeitlosen Gewahrseins dessen, was ist, welches frei von Gedanken und Konzepten, frei von Ich-Gefühlen und egoistischen Selbstinteressen ist. Meditation führt so zu einer grundlegend akzeptierenden Aufrichtigkeit sich selbst und allem gegenüber.2 Die in der Meditation gewonnene Offenheit ermöglicht es uns auf vorzügliche Weise, neue Perspektiven, Erfahrungen und Herangehensweisen zu finden und zu integrieren. Wenn wir offen für Veränderungen und bereit sind, neue Dinge auszuprobieren, können wir uns selbst in unseren vielfältigen Rollen und Persönlichkeitsanteilen und deren verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten betrachten und erkennen, welche Verhaltensmuster oder Überzeugungen uns zurückhalten. Außerdem lassen sich durch Offenheit und Neugier neue Fähigkeiten und Interessen entdecken und eigene Grenzen erweitern. Offenheit führt zu größerer Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen und ihren Überzeugungen. Sie hilft uns dabei, uns selbst und die Welt auf eine flexiblere und bereichernde Weise betrachten zu können, was zu einem tieferen Verständnis von uns und anderen führt.
Persönlichkeitsanteile entwickeln sich
Was sind Persönlichkeitsanteile?
„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.“ (Goethe, Faust)
„Jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft.“ (Novalis, Blütenstaub)
Anstelle von Persönlichkeitsanteilen kann man synonym von inneren Zuständen, Tendenzen, Seiten, Haltungen, Teilen oder Teilpersönlichkeiten sprechen. Persönlichkeitsanteile können auch als unterschiedliche Rollen verstanden werden, die Menschen je nach Situation und Kontext „spielen“.
Unsere inneren Zustände ändern sich laufend und es macht einen Unterschied, ob wir mit unserem Partner, unserer Chefin oder unseren Kindern zusammen sind, ob wir Sport treiben, für eine Prüfung lernen oder uns verlieben. Wer kennt die folgenden Anteile, Seiten oder eben inneren Zustände in sich nicht: z. B. den „inneren Antreiber“, der uns zu Leistung anspornt, die „innere Perfektionistin“, der nichts gut genug sein kann, den „Teil, der vor anderen gut dastehen will“ und es am liebsten allen recht machen möchte oder den „Teil, der sich verantwortlich fühlt“ für die Erledigung von Aufgaben oder für andere Menschen. Letzteren gegenüber steht oft das „Lustprinzip“, d. h. ein Teil, der nach Lust und Laune machen möchte, was er gerade will, egal, was die anderen denken, und ohne in die Zukunft zu schauen oder sich um andere zu kümmern. Solche Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. Interessanterweise hat jede Teilpersönlichkeit…
• ihre individuelle Entwicklungsgeschichte
• ihre Sprache und Perspektive auf die Dinge
• ihre Gefühle und Körperempfindungen
• ihre Anliegen und Geschenke
Wenn wir uns mit Persönlichkeitsanteilen beschäftigen, dann erkennen wir nicht bloß einen Persönlichkeitsteil, auch nicht nur „zwei Seelen in unserer Brust“, sondern „eine kleine Gesellschaft“ von Teilen in uns. Dieses System der Anteile organisiert sich in „inneren Teams“ (Schulz von Thun), deren Teammitglieder sich gegenseitig unterstützen oder miteinander zanken und in Konflikt stehen. Anstelle eines inneren Teams kann man auch von einem „inneren Familiensystem“ (Richard Schwarz) oder einem „inneren Orchester“ sprechen. In der Arbeit mit Anteilen geht es darum, dass der „Dirigent“ unseres Orchesters – mit anderen Worten, unser SELBST – immer wieder von neuem entsteht, indem wir uns von unseren Anteilen desidentifizieren.
Ein Beispiel für ein Teileteam: Eine Lehrerin benötigt für ihre Klasse einen planenden, vorausschauenden Ordnungsteil, welcher für einen strukturierten Unterricht sorgt. Sie braucht aber auch einen Teil, welcher einfühlsam, herzlich, verständnisvoll und sozialkompetent ist, welcher auch mal „Nein!“ sagen, Grenzen setzen und etwas fordern kann. Und sie benötigt vielleicht noch einen humorvollen Teil, welcher für Überraschung, Lebendigkeit und Leichtigkeit im Unterricht sorgt.
In diesem kleinen Beispiel wird deutlich, dass drei verschiedene Teile ein Team bilden und sich untereinander abwechseln, damit die Lehrerin ihrer Rolle gerecht werden kann.
Wie kann man Persönlichkeitsanteile bei sich erkennen?
Im Coaching finde ich gemeinsam mit dem Klienten passende Namen für Teilpersönlichkeiten. „Passend“ bedeutet: Die Namen müssen für den Klienten stimmen, zur Situation passen, die er genauer betrachten möchte. Sie sollten nicht abwertend oder negativ, sondern möglichst wertfrei sein, sodass der Klient den Teil wertschätzen kann. Wenn wir Persönlichkeitsanteile als „den inneren Feind in meinem Kopf“, den „Selbstsaboteur“, den „faulen Sack“ und dergl. bezeichnen, ist es schwierig, sie wertschätzen zu können. Dann wollen wir sie eher loswerden. In der Arbeit mit Teilen gehen wir jedoch davon aus, dass jede Tendenz in uns ursprünglich zu Anpassungszwecken entstanden ist, um erfolgreich mit Situationen und Menschen umgehen zu können. Jeder Teil hat daher ursprünglich ein „Geschenk“ resp. eine gute Absicht – auch wenn diese vielleicht auf den ersten Blick nicht erkennbar ist.
Teilpersönlichkeiten sind Konstrukte, die uns über uns selbst Klarheit verschaffen und uns neue Möglichkeiten, Ressourcen und Lösungen für einen gelingenden Alltag und unser persönliches Wachstum aufzeigen können. Die Zahl von Persönlichkeitsanteilen ist daher grundsätzlich unbegrenzt.
Wenn wir ein Stück weit mit den in unserem Leben häufig vorkommenden Anteilen vertraut sind, so fällt es uns immer leichter, sie während des Meditierens selbständig zu erkennen. Ausgangspunkt zur Identifikation unserer Teile sind die während der Meditation aufsteigenden Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Von Interesse ist dabei weniger der Inhalt, also was uns auf dem Meditationskissen beschäftigt, sondern die Frage: Wer spricht da gerade in uns? Welche Seite? Ist es der innere Perfektionist, der uns sagt, was wir noch hätten besser machen können? Ist es die innere Problemlöserin, die gerade nach Lösungen sucht? Sind es Katastrophenfantasien, die uns die schlimmstmögliche Wendung einer Situation vor Augen führen? Oder ist es die innere Terminplanerin, die die kommenden Tage strukturiert und To-Do-Listen erstellt?
Die Beschreibungen von Persönlichkeitsanteilen in den einzelnen Kapiteln dieses Buches dienen dazu, Persönlichkeitsanteile bei sich selbst erkennen zu können.
Wie wir uns „Teile-weise“ entwickeln
Für die Dinge und Themen, mit denen wir uns beschäftigen, entwickeln wir ein sprachliches oder nicht-sprachliches Vokabular- oder „Symbolsystem“1. Nicht-sprachlich sind beispielsweise mathematische Zeichensysteme, Programmiersprachen, Geld, Klaviernoten, Träume, künstlerischer Ausdruck, wie z. B. Tanz, Malerei, Film, religiöse Rituale, Sportarten, und dergleichen. Diese Fähigkeit, sprachliche und nicht-sprachliche Symbole zu verwenden, macht das Wesen unserer kulturellen und individuellen Entwicklung aus. Je intensiver und länger wir uns mit etwas beschäftigen, desto differenzierter wird unser entsprechendes Vokabularresp. Symbolsystem in Bezug auf diese Sache, diesen Lebensbereich, diese Art von Erfahrung. Entsprechend nimmt auch die Komplexität der Verbindungen zwischen den Nervenzellen in unserem Gehirn zu, die diesen Fähigkeiten entsprechen.
Wenn wir beispielsweise Klavierspielen lernen, dann lernen wir, Noten den Tasten zuzuordnen, Notenwerte (Achtel, Viertel etc.), Tonarten, Pausenwerte und den Ausdruck einer Melodie wahrzunehmen und diesen Ausdruck aktiv zu gestalten, indem wir zusammen mit einer Klavierlehrerin, im Selbststudium oder elektronisch angeleitet das Instrument zu spielen lernen. Die Differenziertheit unseres Verständnisses, unseres Spielens, unserer Motorik in den Fingern und unserer Sprache für den Ausdruck unseres Spiels nimmt im Laufe der Zeit beständig zu. Demensprechend bilden sich unser Hören und unser Musikverständnis aus, auch durch die Auseinandersetzung mit anderen Pianisten, die bereits in früheren Zeiten dieselben Stücke interpretiert haben. Dies ist ein Beispiel für die musikalische Seite eines Menschen, die sich im Laufe der Zeit durch zunehmende Differenziertheit und Nuanciertheit entwickelt.
Analog dazu können wir die Entwicklung aller Persönlichkeitsanteile als Herausbildung zunehmender Differenziertheit unseres sprachlichen und nicht-sprachlichen Repertoires verstehen. Entsprechend nimmt auch die Nuanciertheit unseres emotionalen, motorischen und körperlichen Ausdrucks zu. Dies gilt für unsere mathematische ebenso wie für unsere psychosoziale Entwicklung, die Entwicklung der Empathie und unserer Fähigkeiten, andere zu verstehen, der kritischen, hinterfragenden Fähigkeiten in uns, des wissenschaftlichen Denkens und Argumentierens, des ästhetischen Geschmacks, des Humors, der tänzerischen Orientierung im Raum, des ethischen Argumentierens oder der Spiritualität.
Das alltägliche, sprachliche Repertoire, das uns zur Verfügung steht, ist wie ein „Netz“, das sich über unsere Teilpersönlichkeiten ausbreitet. Dieses sprachliche Netz verbindet die Teile miteinander und macht ihre Entwicklung vergleichbar, wechselseitig aufeinander beziehbar, sodass wir den Entwicklungsschwerpunkt eines Menschen und seiner Teilpersönlichkeiten erkennen können.
Einmal entstandene Teilpersönlichkeiten haben die Tendenz, in bestimmten Situationen immer wieder aufzutreten und sich in neuen Situationen weiterzuentwickeln. Sie sind als Gewohnheiten verankert und verfügen über ihr jeweils eigenes autobiographisches Gedächtnis. Teilweise bauen Teilpersönlichkeiten in ihrer Entstehung aufeinander auf und sind wechselseitig voneinander abhängig. Damit beispielsweise ein sorgenfrei spielendes Kind entstehen kann, ist vorweg die Entwicklung von Urvertrauen notwendig. Urmisstrauen bringt in der Regel kein sorgenfrei spielendes Kind in uns hervor, sondern eher ein ernstes, betrübtes, trauriges Kind. Das ungebremste, impulsive Ausagieren von Bewegungen, Bedürfnissen und Wünschen beim Kleinkind kommt vor dem Stoppen und Aufschieben von Bewegungsimpulsen, Bedürfnissen und Wünschen. Die planende Voraussicht baut auf dem impulsiven und in die Gegenwart versunkenen, spielenden Kind auf. Das Kind entwickelt sich in seinen Spielmöglichkeiten, indem es Spielregeln und mit der Zeit strategische Spiele erlernt, die es erfordern, vorauszublicken und sich in das spielende Gegenüber hineinzuversetzen, um dessen mögliche Spielzüge vorhersehen zu können.
Bestimmte Teilpersönlichkeiten und deren Fähigkeiten gewinnen in unseren modernen Gesellschaften auf ganz bestimmten Entwicklungsstufen eine gewisse Prägnanz, d. h., sie spielen in unserer Kultur eine besonders bedeutsame Rolle. So führen unser modernes Erziehungssystem und unsere Arbeitswelt beispielsweise zur zunehmenden Entwicklung unseres kritischen, wissenschaftlichen Denkens. Zur gleichen Zeit bewirkt unsere Leistungsgesellschaft mit ihren innewohnenden Erwartungshaltungen tendenziell die Bildung innerer Antreiber, eines Verantwortungsgefühls und planender, vorausschauender Seiten, welche unsere Kalender mit Terminplänen und To-Do-Listen füllen. Darüber hinaus wird unser lineares, kausalmechanisches Denken auf einer bestimmten Entwicklungsstufe aufgrund der zunehmenden Komplexität der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, durch komplexere, systemische Formen des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und Handelns ergänzt.
Entwicklung ist stets dynamisch. Sie findet immer wieder von neuem in konkreten Situationen statt, was dazu führt, dass wir zunehmend flexibler zwischen einzelnen Persönlichkeitsanteilen hin- und herwechseln können. Diese Fähigkeit zu bewusster innerer Flexibilität lässt sich durch Achtsamkeit und Meditation trainieren.
Entwicklungsstufen unserer Anteile
Entwicklungsstufen sind entweder Durchgangsstufen, die wir in der Kindheit und Jugend mit den sich entwickelnden Anteilen durchlaufen, oder Schwerpunktstufen, auf denen wir längere Zeit oder sogar ein Leben lang verharren können.
Das Modell der Selbstentwicklung beschreibt, wie unsere Perspektiven auf uns selbst, andere und die Welt sich in Richtung eines immer komplexeren Verständnisses, zunehmender Weisheit, Liebe, Wirksamkeit und Leichtigkeit im Umgang mit den Herausforderungen des Alltags entfalten. Entwicklungsstufen bauen aufeinander auf. Keine kann übersprungen werden. Wir können nicht über Nacht vom Anfänger zu einem Meister des Klavierspiels werden, sondern müssen regelmäßig üben, um eine Fertigkeit zu entwickeln. Dies gilt für alle inneren Haltungen. Es entwickeln sich nur diejenigen Anteile in uns, die aufgrund bestimmter Alltagskonstellationen, gewisser angeborener Talente oder Persönlichkeitsmerkmale entstehen, oder für die wir ein Interesse entwickeln. Sind diese Bedingungen nicht gegeben, bleibt die Entwicklung bestimmter Anteile aus.
Unter starkem Stress können Anteile auch regredieren, einfrieren, dominant oder extrem werden, ins „Exil“ verbannt (verdrängt) werden und von dort aus die persönliche Entwicklung in verschiedenen Bereichen sowohl hemmen als auch fördern.
Die stufenweise Entwicklung unserer Anteile führt von einfachen zu komplexen, von statischen zu dynamischen, von selbstzentrierten zu weltoffenen, von konkreten zu immer abstrakteren Sichtweisen, von beruhigenden Eindeutigkeiten zu Zwei- und Mehrdeutigkeiten, von erlerntem, theoretischem zu anwendungsbezogenem, praktischem Wissen, von vagen zu spezifischen, von allgemeinen zu differenzierten, von äußeren zu innerlichen Ansichten, von der Gegenwart im Hier und Jetzt zum Einbezug immer größerer Zeit- und Kulturhorizonte, von einfachen, monokausalen zu immer komplexeren Erklärungen, von unscheinbaren Persönlichkeiten hin zu zunehmender Selbstoffenbarung und Einzigartigkeit, von relativer Unfreiheit zu immer größeren Freiheitsgraden, von rigiden, selbstschützenden hin zu immer subtileren, prosozialen Verdrängungsmechanismen.
Diese Entwicklungsrichtungen vollziehen sich im Modell der Selbstentwicklung von Susanne Cook-Greuter2 über folgende Stufen: die vorsprachliche, impulsive, selbstzentrierte, gruppenzentrierte, aufgabenzentrierte, selbstbestimmende, hinterfragende, selbstaktualisierende, konstruktbewusste und universale Stufe.
Das Modell der Selbstentwicklung lässt sich in drei Bereiche unterteilen: 1. präkonventionelle, 2. konventionelle und 3. postkonventionelle Entwicklungsstufen.
1. „Präkonventionell“ nennt man jene Stufen, die wir in unserer Kindheit durchlaufen. Dazu zählen die vorsprachliche, die impulsive und die selbstzentrierte Stufe. Aufgrund einer Vielzahl von Herausforderungen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Entwicklung einzelner Teilpersönlichkeiten steckenbleiben oder später im Leben, beispielsweise unter ungesundem Dauerstress, auf frühere Entwicklungsstufen zurückfallen. Solche Regressionen können vorübergehend oder langanhaltend sein und einzelne Teilpersönlichkeiten oder die ganze Person betreffen. Etwa 5-15 % der Erwachsenen in unseren modernen Gesellschaften befinden sich nach Cook-Greuter in ihrem Entwicklungsschwerpunkt auf präkonventionellen Stufen.
2. „Konventionell“ nennt man jene Stufen, auf denen die Mehrheit der Menschen in unseren heutigen, „(post-)modernen“ Gesellschaften ihren Schwerpunkt hat. Dies sind die gruppenzentrierte, die aufgabenzentrierte und die selbstbestimmende Stufe. Da unsere Bildungseinrichtungen und die Anforderungen der Leistungsgesellschaft darauf hinzielen, befinden sich etwa 76-80 % der Menschen in ihrem Entwicklungsschwerpunkt auf konventionellen Stufen.
3. „Postkonventionelle Stufen“ bezeichnen eine Weiterentwicklung jenseits der gesellschaftlich vorgegebenen Norm. 10-20 % der Menschen westlicher Gesellschaften befinden sich in diesem überdurchschnittlichen Bereich. Dazu zählen die hinterfragende, die selbstaktualisierende, die konstruktbewusste und die unitive Entwicklungsstufe.
Das Selbstentwicklungsmodell ist ein dynamisches Modell, das sich fortlaufend an neue kulturelle Entwicklungen anpassen kann. Was heute noch als postkonventionell gilt, wird in einigen Jahren zur Normalität gehören und daher auf konventionellen Entwicklungsstufen zu finden sein.
Entlang dieser Dreiteilung werden in den folgenden Kapiteln dieses Buches die Kernmerkmale der einzelnen Entwicklungsstufen dargestellt. Zudem werden die Teilpersönlichkeiten, die auf den jeweiligen Stufen besonders prägnant und wichtig werden, und deren Wachstumsknotenpunkte beschrieben. Diese stellen Entwicklungschancen dar, an denen Menschen weiterwachsen können, wenn sie offen dafür sind und dazulernen wollen.
Die empirischen Grundlagen des Selbstentwicklungsmodells
Die Basis des Selbstentwicklungsmodells bildet der Integrale Satzergänzungstest (SCTi).3 Der SCTi wurde in den 1960er-/70er-Jahren von Jane Loevinger4 an der Washington University entwickelt und durch die Forschungen von Susanne Cook-Greuter an der Harvard University stark verfeinert und auf den spätesten Stufen erweitert. Der SCTi ist bis heute das feinkörnigste, empirisch erprobteste Instrument zur Erfassung menschlicher Entwicklung. Es ist in der Lage, den exakten Entwicklungsschwerpunkt eines Menschen zu bestimmen, d. h. den Ort im Spektrum der Entwicklungsstufen, von dem ein Mensch die Welt bevorzugt erkennt und gedanklich verarbeitet, wie er fühlt, welche Interessen er verfolgt und wie er handelt.
Der SCTi beinhaltet 36 Satzanfänge, die innerhalb eines vorgegebenen, engen Zeitrahmens authentisch ergänzt werden sollen. „Authentisch“ meint, mit Bezug auf unser reales, alltägliches Erleben und Verhalten. Die Auswertung der Satzergänzungen erfolgt mithilfe eines vielschichtigen Verfahrens durch einen zertifizierten Auswerter von Hand. Die Satzergänzungen werden einzeln und anonymisiert anhand zahlreicher Kriterien und mittels eines umfassenden Manuals den neun Entwicklungsstufen zugeordnet. Anhand eines dreistufigen statistischen Verfahrens wird anschließend ein Wert ermittelt, der eine valide Verortung des Entwicklungsschwerpunkts eines Menschen zu Beginn, in der Mitte, am Ende einer Entwicklungsstufe oder am Übergang zu einer späteren Stufe erlaubt.
Die mit dem SCTi über Jahre hinweg gesammelten Daten bilden die Grundlage für die Beschreibung der Entwicklungsstufen im Selbstentwicklungsmodell. Das Selbstentwicklungsmodell hat sich seit seiner Entstehung verändert. Es wurde stets mit Erkenntnissen aus anderen entwicklungspsychologischen Modellen und der psychologischen Forschung verglichen. Das in diesem Buch dargestellte Selbstentwicklungsmodell basiert auf den Erkenntnissen von Susanne Cook-Greuter und wird durch aktuelle Resultate aus der kognitiven Entwicklungspsychologie und den Neurowissenschaften ergänzt. Die entsprechenden Verweise finden sich in den Endnoten.
Der SCTi steht zurzeit in zwölf Sprachen zur Verfügung.5 Die Satzanfänge betreffen universelle menschliche Themen, die in jedem Kulturkreis zu finden sind, wie beispielsweise: „Meine Mutter…“ oder „Wenn ich kritisiert werde…“. Daher eignet er sich zur Anwendung in unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Es gibt eine Version für Erwachsene und eine für Kinder und Jugendliche.6
Wenn du deinen derzeitigen Entwicklungsschwerpunkt mit dem SCTi analysieren lassen möchtest, kannst du gerne per E-Mail mit mir Kontakt aufnehmen:
„Sprich!“ – und ich sage dir etwas über deine Selbstentwicklung
Eine der großen Stärken des Auswertungsverfahrens des SCTis liegt darin, dass die normale Alltagssprache für die Zuordnung einer bestimmten Stufe ausschlaggebend ist. Als studierte Linguistin hat Susanne Cook-Greuter die Analyse der Sprache ins Zentrum der Auswertung des integralen Satzergänzungstests gestellt und das Auswertungsverfahren mittels einer Vielzahl linguistischer Kriterien maßgeblich erweitert.
Wieso die Alltagssprache als Ausgangspunkt für die Bestimmung von Entwicklung wählen? Wir werden nicht in eine fest geformte, bereits klar und detailliert vorstrukturierte Welt hineingeboren, in der wir den Dingen erlernte Laute zuordnen – und fertig ist die Sprache, salopp formuliert, welche die Welt 1:1 abbildet. Unser Sprechen ist vielmehr ein fortlaufender Ordnungsprozess, der auf vorsprachlichen, intuitiven Ordnungsstrukturen des Körpers, der sinnlichen Wahrnehmungen, Empfindungen und Emotionen aufbaut, die sich im Laufe der Evolution in Millionen von Jahren als Anpassungsleistungen an die äußere Welt entwickelt und genetisch verankert haben. Im Unterschied zu diesen genetisch verankerten Ordnungsstrukturen, die sich in der ersten Lebensphase entfalten, markiert der Spracherwerb den eigentlichen Beginn unserer kulturellen Entwicklung.
Wir werden in eine Welt von miteinander kommunizierenden, handelnden Menschen hineingeboren. Als Kinder lernen wir in Wechselwirkung mit unseren Eltern im alltäglichen Handeln sprechen. Die Sprache wird von Generation zu Generation weitergegeben und verändert sich laufend. Unser Sprechen strukturiert kontinuierlich die Dinge, mit denen wir zu tun haben, und haucht unseren Handlungen, Interaktionen und der Welt Sinn und Bedeutung ein. Was wir sprachlich und gedanklich benennen können, entspricht einer Erfahrung, einem Erleben, das für uns und andere etwas bedeutet, und über das wir uns austauschen können. Unser Sprechen formt die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, was wir erkennen, welche Gefühlsnuancen wir erleben, welche Erwartungen wir hegen, wie wir die Dinge gedanklich verarbeiten, welche Handlungsmöglichkeiten wir sehen, wie wir Probleme lösen, wie wir zwischenmenschliche Wechselwirkungen gestalten etc. Unser Sprechen und Denken organisiert unsere Erfahrung laufend und filtert sie auf das hin, was wir als wesentlich oder wichtig erachten, das, was wir wahrnehmen und das, was ungesehen, bewusst oder unbewusst nicht wahrgenommen, ausgegrenzt, für unwesentlich erklärt wird.
Die alltägliche Sprache spiegelt unsere individuelle und kulturelle Geschichte und bildet daher die bestmögliche Grundlage zur Analyse unserer individuellen und kulturellen Entwicklung.
Da wir mit Menschen unterschiedlicher Lebensalter interagieren, verfügen wir alle über ein unbewusstes Vorwissen darüber, was in der Entwicklung früher und was später kommt7, was als unreiferes Verhalten und was als reifer oder weiser gilt. Als Erwachsene wissen wir beispielsweise intuitiv, dass wir kleinen Kindern Dinge mit einfachen, anschaulichen Worten erklären müssen, damit sie uns verstehen. Im Vergleich zwischen einzelnen Menschen oder mit unseren eigenen Fähigkeiten merken wir wiederum, wenn andere komplexer und kompetenter über Dinge sprechen können. Oder wir bemerken beispielsweise, wenn ältere Menschen aufgrund ihres Erfahrungsschatzes Dinge komplexer, gelassener und adäquater erfassen können als jüngere. Dieses intuitive Vorwissen über Entwicklungszusammenhänge, über das jeder Mensch verfügt, macht das Modell der Selbstentwicklung erst möglich.
Für die Bildung der Selbstentwicklungstheorie wurden über mehrere Jahrzehnte zahllose Satzergänzungen gesammelt, geordnet und kategorisiert. Aus den so gewonnenen Daten wurde die Selbstentwicklungstheorie formuliert. In diesem Prozess sind im Laufe der Zeit eine Reihe von differenzierten Kriterien und ein umfassendes Manual erarbeitet worden, welches das ganze Spektrum menschlicher Entwicklung beschreibt. Damit wurde das implizit in jedem Menschen schlummernde Wissen über Entwicklung explizit bewusst. Zahlreiche linguistische Kriterien wurden herausgearbeitet, die wir auf unsere Alltagssprache anwenden können, um die Entwicklung unserer Teilpersönlichkeiten und von uns als Person zu erfassen.
Perspektivenübernahme als Grundstruktur von Entwicklung
Neben linguistischen Kriterien hat Susanne Cook-Greuter strukturelle Aspekte der menschlichen Entwicklung herausgearbeitet, die sich von inhaltlichen unterscheiden. Alle Entwicklungsmodelle, so zeigt sie, haben eine gemeinsame Grundstruktur: die menschliche Fähigkeit, von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe zunehmend umfassendere Perspektiven einnehmen zu können.
Im Laufe der ersten beiden Lebensjahre entwickeln Kinder ein „Ich“ und damit grammatikalisch eine 1.-Person-Perspektive (1. P. P.). Sie lernen, „ich will…“, „gib mir…“, „mein…“ etc. zu sagen. Mit dem „Ich“ lernen sie zugleich, dass es ein davon zu unterscheidendes „Du“ gibt.
Nachdem diese rudimentäre Unterscheidung von „Ich“ und „Du“ etabliert ist, lernen Kinder langsam, dass andere Menschen andere Wünsche, Ansichten und Meinungen als sie selbst haben und dass andere sich in Bezug auf Sachverhalte täuschen können. Sie lernen immer besser, sich empathisch und gedanklich in andere hineinzuversetzen. Damit entsteht eine 2.-Person-Perspektive (2. P. P.). Indem ihr Denken sich immer mehr vom unmittelbaren emotionalen Betroffensein und der direkten Anschauung entfernt, lernen sie, eine neutralere, abstraktere Beobachterperspektive auf sich selbst, andere, zwischenmenschliche Wechselwirkungen und die Dinge in der Welt einzunehmen: Eine 3.-Person-Perspektive entsteht (3. P. P.). Schließlich lernen Menschen, sich selbst, andere und die Wechselwirkungen in der Welt systemisch zu begreifen. Auf diese Weise entsteht eine 4.-Person-Perspektive (4. P. P.), bis hin zu einer multisystemischen Sichtweise, bei der wir Systeme in ihren Wechselwirkungen erfassen lernen. Eine 5. bis n.te Perspektive entsteht (5.-n. P. P.). Zu guter Letzt haben wir als Menschen auch die Möglichkeit, Dinge a- oder transperspektivisch wahrzunehmen, d. h. jenseits sprachlicher oder nicht-sprachlicher Symbolisierung. Gemeint ist damit eine universelle, spirituelle oder „mystische“ Perspektive.
Unser Leben vollzieht sich in ständigem Wechsel zwischen diesen verschiedenen Perspektiven. Dazu ein Beispiel: Angenommen, unser Partner oder unsere Partnerin hat einen wunden Punkt bei uns getriggert und wir fühlen uns für einen kurzen Moment unwohl, vielleicht verletzt. Ärgerlich sagen wir: „So geht das aber nicht! Immer verlangst du von mir…“ Wenn wir uns verletzt oder gekränkt fühlen, innerer Stress zunimmt, unser Körper sich verspannt und wir ärgerlich werden, dann können wir dies als Anzeichen dafür sehen, dass wir vermutlich gerade auf die 1.-Person-Perspektive zurückfallen. Wir leben unsere impulsive, reaktive Wut aus, sagen gekränkt oder beleidigt nichts mehr oder verlassen den Raum, um aus dem Kontakt zu gehen. Vielleicht gelingt es uns im weiteren Verlauf unserer Interaktion, uns von unserer Kränkung und unserem unangemessen großen Ärger zu lösen und uns irgendwann in die Lage der anderen Person zu versetzen, d. h., eine 2.-Person-Perspektive einzunehmen, die Wünsche, Bedürfnisse und Ansichten der anderen Person wahrzunehmen und Verständnis zu zeigen. Das kann bis dahin führen, dass wir unsere eigene 1.-Person-Perspektive verlassen, aufgeben und nur noch mit den Wünschen und der Sichtweise der anderen Person identifiziert sind, sie berechtigt finden und uns um deren Erfüllung kümmern. Damit befänden wir uns ganz und gar in der 2.-Person-Perspektive. Es kann aber auch sein, dass wir uns selbst und die andere Person aus einer 3.-Person-Perspektive, wie von außen betrachten und über sie, uns und unsere Interaktion nachdenken. Dann fragen wir uns beispielsweise: Sieht die andere Person die Situation richtig? Sehe ich sie richtig? Ist sie, bin ich kompetent genug, darüber zu urteilen? Wie reagiere ich gerade? Könnte ich auch anders reagieren? Vielleicht mit weniger Ärger? Etc. Vielleicht wechseln wir sogar in eine 4.-Person-Perspektive und betrachten uns und unsere Partnerin resp. unseren Partner im System „Familie“, mit unserer Vergangenheit und der Vergangenheit des anderen, und entdecken Muster in unseren Interaktionen, die unser momentanes Verhalten beeinflussen. Möglicherweise gelingt es uns sogar, Zugang zu einer transperspektivischen Wahrnehmung zu finden, und wir erkennen plötzlich an einem bestimmten Punkt im Verlauf unserer Interaktion: „Ich und der andere, wir sind letztlich nicht voneinander getrennt, auch wenn wir uns manchmal so fühlen. Wir sind in Wirklichkeit ein und dieselbe Person, mit denselben Ängsten, Nöten und demselben Menschsein.“
Egal um welches Problem oder um welche Alltagssituation es sich handelt, ob ein Streit mit dem liebsten Menschen, ein Konflikt mit den Eltern, die nicht ins Altersheim wollen, der Umgang mit Stress und Druck am Arbeitsplatz oder Abschiedsschmerz. Wenn wir innehalten, achtsam präsent sind, mit dem, was gerade ist, können wir uns wohlwollend den Teilen in uns zuwenden, die momentan aktiv sind, beurteilen, aus welchen Perspektiven wir gerade wahrnehmen, denken, sprechen, fühlen und handeln, und uns fragen: „Was hätten ich und die anderen jetzt davon, wenn ich die gerade vorherrschende Perspektive wechseln würde?“
Grundübung
Innere Friedenskonferenz mit einem Persönlichkeitsanteil
Einerseits vermittelt dir dieses Buch zahlreiche Informationen über den Zusammenhang von Entwicklung und Persönlichkeitsanteilen. Andererseits kann du es auch als Anregung lesen, dir deiner eigenen Anteile und Entwicklungsstufen bewusster zu werden. Dafür benötigst du Zeit, Offenheit dir selbst gegenüber, Neugier und Forschergeist. Meditation ist der in diesem Buch gewählte Weg, weil sie in eine vorurteilslos erkennende Offenheit und grundlegend akzeptierende Aufrichtigkeit sich selbst und allem gegenüber führt.
Du kannst dieses Buch als Einladung sehen, dich abends zur Meditation hinzusetzen, sei es auf einem Stuhl, einem Meditationsbänkchen oder einem Meditationskissen. Konzentriere dich einige Momente lang auf deinen Atem oder, falls du schon länger praktizierst, auf das dir vertraute Meditationsobjekt oder die dir vertraute Meditationsübung, um bei dir anzukommen.
Wenn wir in unserem Alltag meditieren, dann ist es schwieriger, von den Erlebnissen und Eindrücken des Tages, die uns beschäftigen, loszukommen und innerlich still zu werden. Doch gerade diese Schwierigkeit bietet die Chance, unsere inneren „Pappenheimer“ (Schulz von Thun) genauer kennenzulernen. Wenn während unserer Meditation Tagesreste in Form von Gedanken, inneren Bildern, Gefühlen und Empfindungen aufsteigen, können wir uns fragen: Wer, welche Teilpersönlichkeit spricht da? Welche Seite in uns bringt sich gerade zum Ausdruck? Ist es vielleicht der innere Problemlöser? Die innere Kritikerin? Der innere Antreiber? Die Perfektionistin? Oder die Seite, die einfach nur „sein“ will? Etc. Horche hinein, ob es einen passenden Namen für diesen Teil in dir gibt, der sich gerade auf deinem Meditationskissen zum Ausdruck bringt.
Hierbei ist es wichtig, dass deine Bezeichnung nicht abwertend ist, denn es geht darum, dieser Seite gegenüber wertschätzend zu sein und sie genauer kennenzulernen. Sage also beispielsweise nicht: „mein innerer Unterdrücker“, „mein innerer Dummschwätzer“ oder „mein innerer Verunmöglicher“ meldet sich gerade. Versuche, einen neutralen Namen wie „mein innerer Kritiker“ oder „meine genießende Seite“ zu wählen. Teilpersönlichkeiten konstruktiv zu behandeln bedeutet, so mit ihnen umzugehen, wie du selbst behandelt werden möchtest und wie jeder Mensch behandelt werden möchte: wertschätzend, wohlwollend und freundlich. Es fällt uns leichter, unsere Teile wertzuschätzen, wenn wir ihre „Geschenke“ erkennen resp. wenn uns klar wird, was sie für uns sicherstellen und was in unserem inneren Orchester fehlen würde, wenn es genau diesen Teil nicht gäbe. Veränderung wird erst mit Wertschätzung möglich. Dies gilt sowohl im Umgang mit unseren Anteilen wie mit anderen Menschen. Der Fokus liegt also darauf, alle Anteile offen zu akzeptieren, ohne sie „weg haben zu wollen“. Insbesondere, wenn wir sie schon viele Jahre kennen, werden sie nicht einfach ohne weiteres von heute auf morgen aus unserem inneren Team verschwinden. Der erste Schritt zu Wachstum ist offene, wertschätzende Akzeptanz. Nur so lassen die Teile mit sich verhandeln.
Die folgenden Kapitel thematisieren unsere Selbstentwicklung aus Sicht kulturell häufig auftretender Teilpersönlichkeiten. Daher findest du darin auch eine Reihe von Anregungen für die Benennung deiner eigenen Teile. Selbstverständlich kannst du sie auch ganz anders benennen, wenn dies für dich stimmig ist. Achte darauf, wertschätzende Namen für sie zu finden.
Vorgehensweise
Mit ein wenig Übung wird es dir immer besser gelingen, dem „Gebrabbel“ in deinem Bewusstsein während der Meditation und mit der Zeit auch in deinem Alltag einen Namen geben zu können, d. h. die Teilpersönlichkeit, die in dir spricht, zu erkennen und benennen. Indem du dir gewahr wirst, dass nur ein Teil in dir spricht und nicht dein ganzes „Ich“, hast du dich in diesem Moment bereits innerlich ein wenig von diesem Anteil distanziert, mit anderen Worten: desidentifiziert. Nun geht es darum, das Bewusstsein für diesen Teil zu erweitern, indem du ihn auf folgende Weise besser kennenlernst.
Innere Friedenskonferenz zwischen Dir und deinem Teil in Meditation
• Schau genau hin, welche Gedanken diese Teilpersönlichkeit entwickelt, welche Meinungen, Glaubenssätze, Überzeugungen sie hat, was sie denkt, was sie sagt, welche inneren Bilder, Fantasien und Vorstellungen in dir aufsteigen.
• Achte während dieses Prozesses auch darauf, welche Gefühle dieser Teil hat. Sind sie angenehm, unangenehm, neutral oder eine Mischung aus angenehm und unangenehm? Kannst du die Gefühle näher benennen? Glücklich, freudig, neugierig, ängstlich, wütend, ärgerlich, gelangweilt, beschämt, peinlich etc.?
• Gibt es dazu Körperempfindungen? Z. B. ein weites Herz, eine enge Brust, ein Kloß im Hals, Stress im Bauch, „flattert“ das vegetative Nervensystem etc.?
• Seit wann gibt es diese Seite in dir? Was sind deine frühsten Erinnerungen? Wann ist sie zum ersten Mal in deinem Leben aufgetreten?
• Was stellt der Teil für dich sicher? Was sind seine Geschenke? Was wäre, wenn er nicht da wäre? Was würde dann fehlen? Was wären deine Befürchtungen, was geschehen könnte, wenn er im inneren System deiner Teile nicht vorhanden wäre?
Nachdem du dich etwas mit den Entwicklungsstufen in diesem Buch angefreundet hast, kannst du dich fragen:
• Aus welcher Entwicklungsstufe kommen die Gedanken und Gefühle dieses Teils? Was könnte möglich werden, wenn er aus einer anderen Stufe wahrnehmen, fühlen und handeln würde?
Wenn du eine Teilpersönlichkeit in dir auf diese Weise kennengelernt hast, kannst du dir vorstellen, dass sie irgendeine Form, eine Farbe, ein Aussehen hat. Dann wendest du dich mit der Bitte an sie, sich zur Meditation neben dich zu setzen. Dabei kannst du ihr versichern, dass auch sie von der Meditation profitiert!
Sobald sie neben dir sitzt, stelle dir vor, dass du nicht der einzige Mensch auf der Welt bist, der diese Seite in sich trägt, und dass zahlreiche Menschen denselben Teil in sich haben. Vielleicht kommen dir sogar konkrete Menschen in den Sinn, von denen du weißt, dass sie diese Seite ebenfalls besitzen. Es kann sein, dass sie sich bei ihnen ein wenig anders zum Ausdruck bringt als in dir. Diese Vorstellung verbindet dich mit anderen Menschen und fördert deine Fähigkeit, eine 2.-Person-Perspektive einzunehmen.
Löse dich von diesen Vorstellungen, lasse alle Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen ziehen und verbinde dich mit deiner inneren Stille und verweile darin: innere Weite, unendliche Offenheit, Zeitlosigkeit. Verbleibe so lange in dieser Erfahrung, wie du möchtest. Danach springst du auf und das Leben geht weiter – vielleicht anders als zuvor!
Ein Beispiel
Du setzt dich abends zur Meditation hin, zentrierst dich in deinem Atem und merkst plötzlich, wie ein Gespräch, das du mit jemandem oder mit dir allein führst, ein Selbstgespräch, in dir aufsteigt. Vielleicht erkennst du nicht auf Anhieb, welche Teilpersönlichkeit sich hierbei ausspricht. Möglicherweise sind es auch mehrere. Ist es ein innerer Problemlöser, der versucht, ein konkretes Problem zu lösen? Ist es ein wiederkäuender Teil, der vergangene Situationen vor dem inneren Auge endlos wiederholt? Ist es eine innere Kritikerin? Wenn dir Sätze wie „das hätte ich in der Situation noch besser sagen können“, „das hätte ich anders formulieren sollen, damit er mich versteht“ oder „Mist, schon wieder habe ich das falsch gemacht“ in den Sinn kommen, dann klingt es nach einem inneren Kritiker, der sich hier ausspricht. Welche Gefühle und Körperempfindungen treten dabei auf? Du fühlst vielleicht eine „Anspannung in der Brust, im Bauch, in den Armen.“ Es fühlt sich „unangenehm, nicht gut“ an. Seit wann kennst du diese innere Kritikerin? Was sind deine frühesten Erinnerungen? Dir kommt in den Sinn: „Den gibt es schon ziemlich lange. Mein Vater hat mich häufig kritisiert, als ich ein Kind war. Nichts war ihm recht und er wusste immer, was ich noch hätte besser machen können. Von da an wurde ich sehr selbstkritisch.“ Was stellte der innere Kritiker damals für dich sicher? „Es war wohl weniger schmerzhaft, mich selbst zu kritisieren, als das immer von meinem Vater von außen zu hören. Mein innerer Kritiker stellte sicher, dass ich die Dinge besser machte, an alles dachte, damit ich mich ok fühlte. Das ist auch heute noch sein Geschenk. Denn ich bin wirklich gut darin, an vieles zu denken, was wichtig ist.“ Wenn du nun versuchst, die Entwicklungsstufe zu erkennen, aus der die Gedanken und Gefühle des inneren Kritikers kommen, dann schau genau hin, aus welcher Perspektive sie kommen. Ist es die Erste-Person-Perspektive? Die zweite? Die dritte? Oder gar eine systemische?
Ein innerer Kritiker der 1.-Person-Perspektive spricht in Ich-Sätzen: „Ich kann das nicht!“, „Ich bin nicht gut genug!“, „Ich werde das nie können!“ Die begleitenden Gefühle sind beispielsweise tiefe Traurigkeit, Resignation, Scham- oder Schuldgefühle und dergleichen und entsprechen einer frühen Entwicklungsstufe des kleinen Kindes, das von seinem Vater kritisiert worden ist.
In der 2.-Person-Perspektive spricht der innere Kritiker in Du-Sätzen: „Du hättest das doch wissen müssen!“, „Wie konntest du nur?“, „Wieso hast du denn nicht daran gedacht?“ und dergleichen. Auch solche inneren Selbstvorwürfe gehen häufig mit Gefühlen einher, die alles andere als angenehm sind. Hierbei handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Internalisierung eines äußeren Kritikers ins eigene System. Der Vater, die Mutter oder eine andere wichtige Bezugsperson, die einen in der Kindheit kritisiert hat, wurde ins eigene System aufgenommen und spricht nun in „Du-Sätzen“ zu uns.
Die 2.-Person-Perspektive kann jedoch auch an einen äußeren Adressaten gerichtet sein. In diesem Fall kritisieren wir einen anderen Menschen. Er oder sie hat etwas nicht gut genug oder falsch gemacht oder müsste es anders, besser machen, so wie wir es eben gerne hätten. Nun stellt sich die Frage: Ist die innere Kritikerin auch in der Lage, über sich selbst, den anderen Menschen,