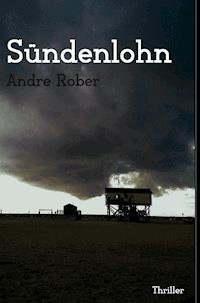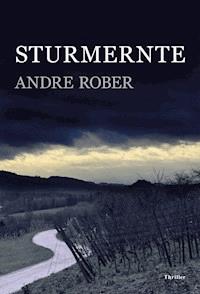Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sarah Hansen, die bei ihrem letzten Fall in ihrer Heimat in Schleswig-Holstein fast ums Leben gekommen wäre, kommt in ihrem neuen Wirkungsbereich in Freiburg im Breisgau an. Kaum hat sie ihre neuen Kollegen kennengelernt, werden sie und ihr Partner Thomas Bierman beauftragt, die Todesumstände eines Demonstranten zu klären, der nach dem Einsatz von Wasserwerfern tot aufgefunden wurde. Doch bevor Rechtsmediziner Dr. Schwarz eine Obduktion durchführen kann, geschieht ein bestialischer Mord, der die Arbeit an diesem Fall zunächst verzögert. Sehr bald kommt der Verdacht auf, dass die beiden Tode zusammenhängen. Was Sarah, Thomas und die Kol¬leg*innen im Laufe der weiteren Ermittlungen herausfinden, hätten sie sich nicht einmal im Traum vorstellen können!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andre Rober
Ackerblut
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
La Jolla, Kalifornien
Freiburg im Breisgau, sechs Monate später
Es war der Wasserwerfer, dessen
Neugierig sah Sarah während
»Der Tote heißt Herbert Meyer.
Obschon die Wolkendecke nur
Die beiden Männer in dem
»Wenn Sie da drinnen
Bucur Enache musste wie immer
Als Polizeimeisterin Imke Gellert
In seinem Auto suchte der Mann,
Etwa 300 Meter oberhalb
Der Mann in dem unscheinbaren
Michael Höller stand mit
»Freiburg hat auch
»Herr Friedemann? Mein Name ist
Sarah und Bierman stellten just
»Guten Tag, Frau Ebersbach.
Das leise Knarren des
»Du bist so nachdenklich.
»Und du bist sicher, dass das
»Müssen wir nicht die Waffen
»Gruezi Max, wie gehts?«
»Vielen Dank, dass Sie sich so kurz nach
Die dramatischen Klänge
Andreas Schmid sog die frische,
Diego Fernowa tat seine Schritte langsam.
Mit geschlossenen Augen
»Vielleicht sollten wir
Oscar Blumberg saß
Vanessa Keller schraubte den Verschluss
Vierzig Kilometer vom Stadtzentrum
Gerade als Vanessa Keller am Polizeirevier
Was war das für ein Geräusch?
»Zunächst muss ich erwähnen,
In dem Jagdschloss kämpften
Sarah erhob sich, rieb ihre Handgelenke und suchte Blickkontakt zu Thomas. Dieser nickte beruhigend.
»Take the bags off!«
Impressum neobooks
La Jolla, Kalifornien
Sarah Hansen, die bei ihrem letzten Fall in ihrer Heimat in Schleswig-Holstein fast ums Leben gekommen wäre, kommt in ihrem neuen Wirkungsbereich in Freiburg im Breisgau an. Kaum hat sie ihre neuen Kollegen kennengelernt, werden sie und ihr Partner Thomas Bierman beauftragt, die Todesumstände eines Demonstranten zu klären, der nach dem Einsatz von Wasserwerfern tot aufgefunden wurde. Doch bevor Rechtsmediziner Dr. Schwarz eine Obduktion durchführen kann, geschieht ein bestialischer Mord, der die Arbeit an diesem Fall zunächst verzögert. Sehr bald kommt der Verdacht auf, dass die beiden Tode zusammenhängen. Was Sarah, Thomas und die Kolleg*innen im Laufe der weiteren Ermittlungen herausfinden, hätten sie sich nicht einmal im Traum vorstellen können!
Andre Rober, geboren 1970 in Freiburg im Breisgau, studierte Volkswirtschaftslehre und arbeitete nach dem Abschluss mehrere Jahre für Banken im In- und Ausland. Mit der Absicht, sich beruflich zu verändern, machte er eine Ausbildung zum Business Coach und arbeitete parallel an seinem Erstlingswerk „Sturmernte“.
Nach „Sündenlohn“ schickt er mit „Ackerblut“ seine Protagonisten Sarah Hansen und Thomas Bierman zum dritten Mal in den Einsatz.
Andre Rober
Ackerblut
Thriller
Ungekürzte Taschenbuchausgabe
1. Auflage April 2019
© Andre Rober, Merzhausen
Korretorat: Christiane Portele, Dr. Friederike Zimmermann
Umschlaggestaltung: Büro für angewandte Reklame, Merzhausen
Umschlagfoto: © Andre Rober
Satz: Andre Rober
Gesetzt aus der Palatino
Papier: Munken Cream
Druck: Online Druck.biz
ISBN: 978-3-947252-02-2
„Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden!“
(Genesis 4, 10)
Ohne seinen Schritt zu verlangsamen, wischte sich Travor Willard mit seinen übergroßen Funktionsschweißbändern über das Gesicht und konnte so verhindern, dass das Transpirat seine Brauen durchdrang und ihm in die Augen lief. Trotz seiner vierundfünfzig Jahre war er in überdurchschnittlicher körperlicher Verfassung und lief die knapp zehn Meilen, die er täglich noch vor dem Frühstück zurücklegte, deutlich unter einer Stunde. Und das, obwohl ihn die Strecke nicht nur über den Sand von La Jolla Shores führte, sondern auch hinauf bis zum Gipfel des Mount Soledad. Zugegeben, dort oben angekommen, hielt er seinen Polar-Trainingschronographen immer für einige Minuten an, und auch heute ließ er die letzten Meter eher lockeren Schrittes hinter sich, bevor er den linken Arm hob, Zeit und Puls kontrollierte und dann die Uhr anhielt. Er stemmte seine Arme auf die Knie und atmete einige Male tief durch. Dass jetzt der Schweiß von seiner Nasenspitze herunter tropfte und auf dem staubigen Asphalt Spuren wie bei einem einsetzenden Herbstregen hinterließ, störte ihn nicht. Ein Mann seines Alters durfte ruhig ordentlich schwitzen, wenn er derart hart an seinem Körper arbeitete. Als sich sein Atem innerhalb kürzester Zeit beruhigt und sein Puls eine Frequenz unter achtzig Schlägen pro Minute erreicht hatte, richtete er sich auf und wandte seinen Blick als erstes gen Westen auf die Weite des Pazifiks, wo der Horizont um diese Uhrzeit noch eine ungetrübte dunkelblaue Farbe hatte. Obwohl er diese Aussicht, seit er dem Ruf an die UCSD vor fünfzehn Jahren gefolgt war, beinahe jeden Tag genießen konnte, war sie für ihn immer aufs Neue überwältigend. Und da sich heute der June Gloom, ein häufig im Frühsommer auftretender Morgennebel, nicht über dem Küstenstreifen gebildet hatte, war die Sicht atemberaubend. Langsam drehte er sich nach links. Im Süden konnte er nun Richtung San Diego sehen. Er erkannte die Bauten des Sea World an den Wasserflächen von Mission Bay. Westlich vom Point Loma waren eindeutig die Umrisse einiger Kriegsschiffe zu erkennen und der Flugzeugträger, der langsam hinter der Landzunge auftauchte, bestätigte Trevors Verdacht, dass gerade ein kompletter Trägerverband den Hafen von San Diego verließ. Richtung Osten konnte er selbst mit zusammengekniffenen Augen nicht schauen, zu grell war bereits das Licht der Sonne, die über den Bergen des Cleveland National Forrest und des Cuyamaca Rancho State Parks stand. Erst als er seine Augen weiter in Richtung Norden wandern ließ und mit ausgestreckter Hand für Schatten auf seinem Gesicht sorgte, konnte er wieder in die Ferne schauen. Er versuchte die weißen Kuppeln des etwa 50 Meilen entfernten Palomar Observatory auszumachen, durch dessen Teleskope er und seine Tochter am letzten Wochenende Sterne und Planeten beobachtet hatten. Die sechzehnjährige Helena, benannt nach der nach Troja entführten griechischen Prinzessin, hatte sich seit langem wieder einmal zu einem Wochenendausflug mit Trevor überreden lassen. Auch wenn er als alleinerziehender Vater alles unternommen hatte, um seine Tochter behütet aufwachsen zu lassen, forderte die Pubertät ihren Tribut. Trotzdem konnte er zufrieden sein, sie war ein anständiges Mädchen, das Zusammenleben mit ihr - angesichts der Geschichten, von denen er bei Elternabenden erfuhr - insgesamt sehr harmonisch. Und dass sie sich seit dem Tod von Christine, ihrer Mutter, gegenseitig umeinander kümmerten, sprach für das gute Verhältnis. Sein Blick traf jetzt den Campus der UCSD und wanderte die Küste entlang bis zu seinem Haus in der Marine Street. Wenn er zurückkam, hatte sie bestimmt schon das Frühstück vorbereitet, peinlich auf die Erfordernisse beider abgestimmt: für ihn, seit bei ihm eine Laktoseintoleranz diagnostiziert worden war, ohne Milch oder mit entsprechend anderen Produkten. Für sie, da sie sich mit dreizehn für ein Leben als Vegetarierin entschieden hatte, ohne Fleisch. Trevor musste lächeln. Er schüttelte die Beine ein wenig aus, startete seine Polar-Watch, und nahm sein Training wieder auf. Das Gipfelkreuz ließ er hinter sich und lief, um seine Knie zu schonen, etwas langsamer durch den Soledad Park hinunter. Als er an der Via Capri ankam, lief ihm bereits wieder der Schweiß durch das Gesicht. Die Abbiegung zur Hidden Valley Road war einer seiner Messpunkte, und als er abbog, sah er auf seine Polar am Handgelenk. Da er fast vierzig Sekunden über seiner Durchschnittszeit lag zog er das Tempo merklich an. Als er sich von hinten einem am Straßenrand geparkten schwarzen Chevrolet Tahoe näherte, bemerkte er ein undefinierbares Gefühl in der Herzgegend. Er maß dem keinerlei Bedeutung bei und lief unverändert weiter, doch das Gefühl wurde stärker. Mit einem Mal glaubte er, sein Herz sei etwas aus dem Rhythmus gekommen. Auch solche Aussetzer beunruhigten ihn nicht. Er hatte dies bereits von einem Kardiologen untersuchen lassen, der ihm versichert hatte, dass nichts so besorgniserregend sei wie ein Herz, das immer stur seinen monotonen Takt schlug. Ein paar Hüpfer waren folglich sogar gesund und mit diesem Gedanken lief er stoisch vor sich auf den Boden blickend weiter. Selbst als das Organ endgültig seinen Dienst einstellte, die Welt um ihn herum dunkel zu werden schien und er aus vollem Lauf auf dem Asphalt zusammenbrach, spürte er keinerlei Schmerzen.
Freiburg im Breisgau, sechs Monate später
Immer näher kamen sich die beiden Gesichter. Inmitten des lauten Tumultes, der sie umgab, zeigte der eine der beiden Männer eine konzentrierte Wachsamkeit, während der andere durch den Sehschlitz seiner schwarzen Wollmütze eine zunehmende Aggression erkennen ließ. Bis auf wenige Zentimeter hatte er seine Nase bereits der seines abwartenden Gegenübers genähert, und wäre da nicht die Plexiglasscheibe zwischen den beiden gewesen, hätte er auch vor einer Berührung nicht zurückgeschreckt. Der Polizist, der den Schild zwischen sich und dem vermummten Mann hochhielt, vermied den direkten Blickkontakt: Er wollte den anderen unter keinen Umständen provozieren, sei es durch ein Signal der Stärke, noch durch die Offensichtlichkeit von Schwäche oder gar Angst. So lag seine Konzentration darauf, in einer Linie mit seinen Kollegen zu bleiben und dem physischen Druck der Menschen vor ihnen standzuhalten, ohne jedoch mit zuviel Dominanz den Schild der aufgebrachten Menge entgegenzuschlagen. Wie lange eine Eskalation durch dieses Verhalten noch verhindert werden konnte, stand für ihn jedoch in den Sternen.
Das Rufen um sie herum wurde lauter, die Stimmung immer explosiver. Plötzlich ging ein Wasserschwall mit der Härte einer Keule über den Mann mit der Wollmütze und seine ebenfalls vermummten Mitstreiter nieder.
Also doch die Wasserwerfer, dachte der Beamte und zog reflexartig die Schultern ein wenig nach oben. Der zwölf Bar starke Strahl trieb die Gruppe vor ihm mit großer Präzision nach hinten. Der Druck auf dem Schild ließ augenblicklich nach. Als klar war, dass sich niemand mehr der phalanxähnlichen Linie der Uniformierten nähern würde, atmete auch der äußerlich immer noch gelassen wirkende Polizist auf und ließ seinen Schild fürs Erste sinken.
»Kann mir vielleicht jemand sagen, warum Gröber uns ins Sitzungszimmer bestellt hat?« Nico Berner knallte, nachdem er sich mit einem kurzen Blick durch den Raum von der Abwesenheit seines Chefs überzeugt hatte, die Tür ins Schloss. Von den drei Beamten, die bereits an dem langen Besprechungstisch saßen, zeigte zunächst keiner eine Regung. Dann lud ihn Thomas Bierman jedoch mit einer knappen Geste zum Sitzen ein. Der Kriminalhauptkommissar war kein Freund vieler Worte, deswegen sagte er nur:
»Die neue Kollegin!«
Nico Berner nahm neben Bierman Platz, ihm gegenüber saßen seine Partnerin Karen Polocek und der dienstälteste Beamte des Dezernats, Hans Pfefferle.
»Aha«, murmelte Berner, »hoffentlich hat er sie nicht persönlich ausgesucht.«
Allein der Tonfall ließ seine Skepsis bezüglich der neuen Kollegin und seine Abneigung gegen den Ressortleiter erkennen. Henning Gröber war, ganz den Klischees eines Chefs entsprechend, ein cholerischer Opportunist, der seinem akademischen Titel zufolge über ein abgeschlossenes Jurastudium verfügte. Was die polizeiliche Ermittlungsarbeit anging, war er jedoch keine große Leuchte. Auch wenn er, bedingt durch die Umstrukturierung der Abteilung und das Ausscheiden des allseits beliebten Leiters Peter Schmitthenner, von Beginn an einen schweren Stand hatte, so trug er durch seine Art keinesfalls dazu bei, die Vorurteile gegen seine Person abzubauen oder seine Untergebenen gar von seinen positiven Seiten zu überzeugen. Allerdings hatten die Ermittler um Thomas Bierman schnell begriffen, dass Henning Gröber kein Rückgrat besaß und sie im Prinzip wie unter der lockeren Führung von Peter Schmitthenner weiterarbeiten konnten. Ankündigungen und Drohungen liefen regelmäßig ins Leere und so hatte sich die Gruppe mit dem neuen Posten des Ressortleiters und der Person Henning Gröber arrangiert.
»Soweit ich weiß, kommt sie irgendwo aus dem Norden und hat ihre Versetzung aufgrund der Härtefallregelung genehmigt bekommen,« teilte Pfefferle in seiner gewohnt gemütlichen Art mit. »Und da bei uns die Planstelle frei war und sie auch unbedingt zu uns wollte, lief das reibungslos durch. Mehr Informationen habe ich auch nicht. Weißt du irgendetwas, Thomas?«
KHK Bierman schüttelte den Kopf.
»Nicht mehr als das, was du gerade gesagt hast.«
»Na, wenigstens handelt es sich um eine Kollegin«, stellte Karen Polocek fest. »Dann bekomme ich hier endlich mal etwas weibliche Unterstützung.«
»Als ob du die nötig hättest“, meinte Nico Berner, der sich bei der aufgeweckten und schlagfertigen Kollegin schon die ein oder andere verbale Ohrfeige geholt hatte, trocken. Er schaute auf die Uhr.
»Mal sehen, ob das so ein karriereversessenes, lesbisches Mannweib ist. Ich würde ja allzu gerne...«
Was er allzu gerne würde, erfuhr niemand mehr, denn noch bevor Thomas oder Karen den sexistischen Redeschwall unter Protest abwürgen konnten, öffnete sich schwungvoll die Tür zum Sitzungszimmer und die hagere, ausgemergelte Figur Henning Gröbers erschien zwischen den weißlackierten Zargen. Der Ressortleiter trat nur halb in den Raum und hielt die Türe für seine Begleitung offen. Unter den abschätzigen Blicken der Tischrunde betrat eine etwa achtundzwanzigjährige schlanke Frau mit langen blonden Haaren den Raum und sah sich offenen Blickes mit einer gewissen Neugier um. Und während Thomas Bierman verblüfft die Augenbrauen hob und Nico Berner der Mund offen stehen blieb, sagte Gröber:
»Meine Dame, meine Herren, darf ich Ihnen Ihre neue Kollegin Sarah Hansen vorstellen?«
Mit ein wenig Herzklopfen folgte Sarah ihrem neuen Vorgesetzten Henning Gröber den Flur entlang. Gleich würde sie ihre neuen Kollegen kennenlernen. Nach all den Anstrengungen, die es gekostete hatte, endlich hier im K11 der Kriminalpolizei Freiburg angenommen zu werden, waren ihre neuen Partner ein erstes Indiz, ob sich all die Mühen gelohnt hatten. Der Leiter, den sie schon zuvor in zwei Gesprächen begutachten konnte, war freundlich aber auf irgendeine Art unangenehm gewesen. Allein seine Warnung vor ihrem neuen Partner Thomas Bierman, den er als ungehobelt, undiszipliniert und eigenbrötlerisch beschrieben hatte, war ihr seltsam aufgestoßen. Wobei diese Anmerkung eher ihre bis dahin unterschwellige Abneigung gegen Gröber nährte, als ihren neuen Partner Bierman zu diskreditieren. Im Gegenteil, die Neugier auf den Mann, mit dem sie zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre eng zusammenarbeiten sollte, wurde dadurch noch mehr geweckt. Auch die anderen Kommissare der Gruppe hatte Gröber kurz angesprochen und in groben Zügen soweit beschrieben, dass sich Sarah sicher war, die vier Kollegen bei ihrer ersten Begegnung zu erkennen. Über keinen der anderen drei hatte Gröber etwas Negatives geäußert und zu guter Letzt auch Thomas Bierman bescheinigt, dass seine Erfolge überdurchschnittlich seien... und sie sich glücklich schätzen dürfe, im Kreis dieser erfolgreichen Gruppe arbeiten zu können. Für Sarah wäre dies die übliche Lobhudelei des Chefs gegenüber der neuen Mitarbeiterin gewesen, hätte sie sich nicht im Vorfeld über das Team erkundigt. So waren ihr bereits die zum Teil spektakulären Ergebnisse zu Ohren gekommen, welche die ihrer Meinung nach höchst heterogene Gruppe in der Vergangenheit hervorgebracht hatte. Vielfalt schafft eben doch immer wieder Vorteile, dachte sie bei sich.
»So, hier wären wir.« Gröber hielt vor der mit Kleiner Sitzungsraum beschrifteten Tür an, wartete noch einige Sekunden, als ob er Sarah Zeit zum Sammeln geben wollte, und drückte dann die Klinke herunter. Sarah versuchte, als sie den Raum betrat, so selbstbewusst wie möglich, gleichzeitig jedoch offen und verbindlich zu wirken. Die kurze Vorstellung, die Henning Gröber an seine Mitarbeiter richtete, hörte sie indes nur beiläufig, weil sie sofort die vier Personen musterte, die an dem Konferenztisch saßen. An der linken Seite, der Tür am nächsten, saß ein übergewichtiger Mann Ende fünfzig, der sie freundlich anlächelte. Das musste Hans Pfefferle sein, der Dienstälteste, der so wie ihr Partner Thomas Bierman den Rang eines Kriminalhauptkommissars bekleidete. Sarah lächelte ein wenig verhalten zurück und wandte den Blick auf die neben Pfefferle sitzende Frau. Da sie die einzige weibliche Person im Team war, musste dies Karen Polocek sein, die Jüngste der Ermittlergruppe, der Gröber eine hervorragende Intuition und ein ziemliches Temperament bescheinigt hatte. Die kleine, schwarzhaarige Frau grinste breit und hob die linke Hand zu einem kurzen freudigen Winken. Sarah erwiderte den Gruß mit einem einladenden Nicken, dann wanderte ihr Blick auf die andere Seite des Tisches, wo ein gutaussehender Mitdreißiger sie unverwandt interessiert anstarrte und, als sich ihre Blicke trafen, Sarah süffisant lächelnd zuzwinkerte.
Oh shit, dachte sie innerlich. Er weiß um sein Aussehen und schämt sich nicht, sich als Macho zu geben. Folglich musste es sich bei ihm um Nico Berner handeln. Bei ihm wurde ihr Lächeln ein kaum spürbares Maß reservierter, bevor sie sich der letzten am Tisch sitzenden Person zuwandte. Ihr neuer Partner Thomas Bierman musterte sie. Seiner Miene konnte man lediglich eine gewisse Neugier entnehmen, sie war weder übermäßig freudig, noch in irgendeiner Weise feindselig und wohl am ehesten als neutral zu bezeichnen. Einen kurzen Augenblick schien er zu überlegen, welche Art der Begrüßung wohl angemessen wäre. Dann nickte er kurz mit dem Kopf und es kam ein knappes Hallo über seine Lippen.
Aha, dachte Sarah bei sich, nicht sehr aufgeschlossen, so wie Gröber es beschrieben hat.
Nichtsdestotrotz ging sie um den Tisch herum auf ihren neuen Partner zu, lächelte charmant und streckte ihm die Hand entgegen.
»Hallo«, sagte sie. »Ich freue mich sehr, hier zu sein.«
Bierman schien etwas verunsichert, stand dann aber doch auf und schüttelte ihre Hand. Ein fester, sehr sachlicher Händedruck.
»Äh, ja, wir uns selbstverständlich auch.«
Sein Blick hielt dem ihren stand und Sarah glaubte in seinen Augen einen Funken freudiger Erwartung aufblitzen zu sehen, seine Mundwinkel zeigten die Andeutung eines Lächelns. Sarah nahm neben ihrem neuen Partner Platz und sah wie die anderen in gespannter Erwartung zu Gröber.
»Frau Hansen kommt aus Flensburg zu uns. Und wir dürfen uns sehr freuen, eine junge und sehr kompetente Kollegin in unseren Reihen zu begrüßen. Frau Hansen war maßgeblich an den Ermittlungen zum Monster von Büsum beteiligt. Sie erinnern sich sicher an die Schlagzeilen vor ein paar Wochen.«
Sarah errötete leicht und versuchte, den Blicken ihrer neuen Kollegen auszuweichen. Den psychopathischen Serienmörder, den sie und ihre Husumer Kollegen vor einigen Wochen zur Strecke bringen konnten, hatte die Presse erst im Nachhinein als Monster von Büsum bezeichnet, da erst während der Ermittlungen klargeworden war, dass er im Laufe der Jahre mindestens sieben junge Frauen entführt und getötet hatte. Dass dieser Fall auch hier im Südwesten bekannt geworden sein musste, entnahm sie den Reaktionen der Kollegen. Während Nico Berner einen anerkennenden Pfiff von sich gab und Hans Pfefferle beeindruckt mit dem Kopf nickte, hob Karen Polocek den Daumen und flüsterte ein Wow in Sarahs Richtung.
Lediglich Thomas Bierman regte sich nicht und Sarah vermutete, dass er über diesen Sachverhalt bereits Bescheid wusste. Gröber, von dem Interesse, auf das die Worte bei seinen Mitarbeitern stießen sichtlich beflügelt, ergriff die Chance, die Ansprache fortzuführen.
»Auch wenn wir Ihnen hier im Schwarzwald solch spektakuläre Fälle nicht bieten können, so bin ich doch zuversichtlich, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Die Stadt und Regio bieten auch in der Freizeit…«
Sarah schaltete ab. Wie immer ihr neuer Vorgesetzter jetzt die Vorzüge Südbadens beweihräuchern würde, sie wollte alles selbst herausfinden und erkunden. Vielmehr musterte sie ihre Kollegen und erkannte an deren Mienen, dass auch sie ganz offensichtlich den Worten des Chefs kein Interesse entgegenbrachten. Karen Polocek, mit deren Blicken sich die ihren trafen, lächelte verschmitzt und verdrehte leicht die Augen nach oben. Sarah grinste wissend zurück. Als Gröber schließlich nach zwei Minuten fertig war, sah sie sich genötigt, aufzustehen und ihm für den herzlichen Empfang zu danken und auch ihrerseits der Zusammenarbeit freudig entgegenzusehen. Dann war die Vorstellung beendet und Gröber ließ die Ermittler allein.
Es war der Wasserwerfer, dessen
Einsatz die Stimmung bei der Demonstration eskalieren ließ. Anfangs wurden die Teilnehmer von dem kalten Strahl nur in die Flucht geschlagen. Jetzt war die Wasserfontäne, die gezielt auf die Personen gerichtet wurde, welche sich den Polizeihundertschaften näherten, so hart und konzentriert, dass die Menschen förmlich weggespült wurden. Kleidung zerriss, mit aufgeschlagenen Knien und gebrochenen Rippen traten die Getroffenen den Rückzug an. Manch einer konnte nur noch durch den Matsch kriechen, um zurück in den Schutz der skandierenden Menge zu gelangen. Der Uniformierte in der ersten Reihe, dem die Demonstranten mehrfach sehr nahegekommen waren, blickte skeptisch auf den gepanzerten Wasserwerfer. Immer wieder lösten sich einige Menschen aus dem Pulk, deren Versuch, sich den Einsatzkräften zu nähern, sofort mit einem Schwall Wasser abgestraft wurde.
Warum musste die Situation derart entgleiten? fragte sich der Polizist. Die Demonstration bot zwar einiges an Konfliktpotential, war bis zu diesem Zeitpunkt aber friedlich verlaufen. Und das Anliegen der aufgebrachten Menge war durchaus hehr.
Gegen die Sammlung privater Daten!
Stopp dem Zugriff der Geheimdienste!
Keine totale Überwachung!
Recht auf Anonymität!
Das Volk wird verkauft!
Mein Privatleben gehört mir!
Die Plakate und Banner waren mannigfaltig und zielten al-le auf dasselbe Thema ab: die zunehmende Überwachung der Kommunikation und des öffentlichen Raumes sowie die Speicherung der Daten seitens der Behörden. Entfacht worden war die Diskussion, als die EU-Länder als Reaktion auf die Anschläge auf die Züge in Madrid weitgehende Maßnahmen angekündigt hatten. Neben der Vorratsdatenspeicherung, dem Ausbau der öffentlichen Überwachung und des verbesserten Informationsaustausches zwischen den Geheimdiensten, war es auch die Neuausrichtung des Joint Situation Center kurz JSC, die den Unmut der Kritiker hervorrief. Der Polizist war gut informiert. Allzu gerne wäre er auf der anderen Seite der sich immer mehr verhärtenden Fronten, denn auch seiner Meinung nach war die Konzentration und Vernetzung von privaten Daten eine sehr diffuse, jedoch ernstzunehmende Bedrohung der freien Gesellschaft. Insofern konnte er nicht verstehen, warum in dieser Härte gegen die Demonstranten vorgegangen wurde. Jenseits der schlammigen Wiese waren auch Mütter mit Kinderwagen, Jugendliche, ältere Menschen, ein Querschnitt aus allen Bevölkerungsgruppen, die mit ihrer Anwesenheit und ihrer Stimme der Sorge um eine Zukunft in Freiheit und ohne staatliche Kontrolle Ausdruck verleihen wollten.
Anke Werth konnte sich inmitten der skandierenden Menge kaum bewegen. Das Gedränge war so dicht, dass sie keine Chance hatte, darüber zu bestimmen, wohin sie ihre Schritte lenkte. Immer wenn die Masse versuchte, den kalten, harten Wasserfontänen auszuweichen, wurde sie mitgerissen; mal in die eine, mal in die andere Richtung. Anfangs, als der Kontakt zu den anderen Demonstranten noch eher locker war und sie, einer Art Schwarmintelligenz folgend, selber aktiv in Deckung gegangen war, fand sie das Ganze noch ein wenig belustigend. Ineinander gehakt vermittelten die gemeinsame Bewegung und die Sprechchöre eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl im Kampf gegen einen überlegenen Gegner. Aber jetzt, da sie keine Kontrolle mehr über ihren Körper hatte, missfiel ihr die Situation zusehends. Nur zwei Meter neben ihr konnte sie beobachten, wie eine junge Frau mit einem bunten Kopftuch über ihrem Rastafari scheinbar lautlos schrie und mit den Armen versuchte, sich an den Schultern der sie Umgebenden nach oben zu drücken. Auf ihrem geröteten Gesicht machte sich zusehends Angst, ja fast Panik breit, während sie, genau wie Anke, in dem Getümmel umhergewirbelt wurde. In der Masse wurde die missliche Lage der jungen Frau offenkundig nicht wahrgenommen, nur Anke schien ihr Schicksal nicht gleichgültig zu sein. Ihre Blicke trafen sich. Für Anke war klar: Sie würde sich nicht ohne dieses Mädchen aus dem Gerangel zurückziehen. Unter dem Einsatz ihrer Ellenbogen und mit lautem Schreien arbeitete sie sich das kurze Stück nach vorne. Sie nutzte die erste Chance und griff nach dem Ärmel der ihr unbekannten Frau, die mittlerweile wieder mit beiden Füßen auf dem Boden stand.
»Halt dich fest«, rief sie und versuchte mit ihrem linken Arm eine kleine Lücke offenzuhalten, die sich für einen Moment gebildet hatte. Noch bevor der Wollpullover, in dessen dicke Fasern Anke ihre Finger krallte, der Belastung nachgab, schaffte es der Teenager ihrerseits, Ankes Handgelenk zu fassen. Sofort zog Anke sie zu sich und machte bereits einen Schritt rückwärts, prallte jedoch mit dem Rücken gegen eine Mauer von Demonstranten. Unfassbar! Es gab immer noch jede Menge Menschen, die weiter in die entgegengesetzte Richtung drückten, um an die Front der Auseinandersetzung zu gelangen. Bilder von der Love Parade in Duisburg kamen Anke in den Sinn. Auch in ihr stieg nun Panik auf. Immerhin konnte sie die junge Frau, die um Luft rang und einen Arm auf ihre offensichtlich schmerzende Brust drückte, an der Schulter fassen. Kaum fühlte sie Ankes Umarmung, knickten ihr die Knie ein und sie drohte, zu Boden zu sinken.
»Wir müssen hier raus«, schrie Anke dem Mädchen ins Ohr. Ein dankbarer Blick und eine merklich erhöhte Körperspannung gaben ihr zu erkennen, dass die junge Frau sich nicht aufgegeben hatte. Gemeinsam stemmten sie sich gegen die nachrückenden Demonstranten und Anke tat alles, um die Reihen zu durchbrechen ohne den Kontakt zu ihrem Schützling zu verlieren.
Nach etwa zehn Minuten hatten sie sich durch das Ärgste hindurchgewühlt. Es befanden sich immer noch sehr viele Menschen um sie herum, jedoch mussten sie sich nicht mehr mit den Ellenbogen den Weg bahnen, sondern konnten meist schon mit einem festen Blick die Reihen öffnen und sich gegen den Strom fortbewegen. Erst als sie nur noch vereinzelt auf jemanden trafen, schlugen sie den Weg zum Rand des Feldes an. An einem tiefen Wassergraben sanken sie schließlich Arm in Arm zu Boden. Die junge Frau weinte bitterlich und musste zwischendurch heftig husten. Anke strich ihr über die Rastalocken und sprach beruhigend auf sie ein.
»Ist ja gut, es ist vorbei! Du hast es geschafft!«
Das Mädchen nickte, hob den Kopf und lehnte ihn an Ankes Schulter. Bis auf die verquollenen Augen war sie sichtlich entspannter, die angestrengte Röte war einer der Erschöpfung geschuldeten Blässe gewichen. Anke betrachtete das hübsche Gesicht des Teenagers. Sie war bestenfalls siebzehn Jahre alt, hätte somit Ankes Tochter sein können. Mit ein wenig Stolz über ihre erfolgreiche Rettungsaktion lächelte sie verhalten, während sie weiter Augen, Nase und Mund des Mädchens studierte. Nach einer Weile öffnete sie die Augen und musste ebenfalls lächeln.
»Glaubst du, du bist verletzt? Soll ich dich zu einem Arzt bringen?«, fragte Anke.
Mit einem Kopfschütteln richtete sich die junge Frau auf und setzte sich auf ihre Fersen.
»Ich bin okay«, sagte sie und tastete ihre linke Seite und die Brust ab.
»Ein paar blaue Flecke, fürchte ich, aber mehr nicht.«
Sie lehnte sich ein wenig zurück und sah sich um.
Anke beobachtete sie, wie sie erst die tobende Menschenmenge betrachtete, dann das freie Feld in Augenschein nahm und schließlich mit müden Augen in den Wassergraben starrte. Zuerst schien es Anke nur ein Blick ins Leere zu sein, doch dann bemerkte sie eine Veränderung im Ausdruck ihres Gegenübers. Ein kaum wahrnehmbares Stirnrunzeln, dann wurde ihr Blick fester, so, als ob etwas ihr Interesse erregt hatte, sie aber noch nicht in der Lage war, zu erkennen um was es sich dabei handelte. Neugierig verfolgte Anke die Nuancen im Mienenspiel des Mädchens, dessen Augen nun eindeutig etwas fixierten. Als die Ungläubigkeit aus dem Gesicht gewichen war und sich zunehmend Entsetzen breitmachte, spürte Anke, dass der Teenager ihre Hand förmlich zerquetschte. Sie folgte dem Blick hin zu einer Stelle, die sich um die fünfundzwanzig Meter entfernt im Wasser des etwa anderthalb Meter tiefen Grabens befand. Erst konnte sie nicht erkennen, was die junge Frau derart erregte. Doch dann erkannte sie die Sohlen zweier Stiefel, die in ihre Richtung zeigten. Anke legte die Hand auf den Mund! Was sie zuerst für einen Ast gehalten hatte, in dem sich eine Tüte oder ein Stück Stoff verfangen hatte, identifizierte sie nun als einen Arm, der seltsam abgewinkelt an der Böschung aus dem Wasser herausragte. Nun war es eindeutig: Im Wasser lag, mit dem Gesicht nach unten, ein menschlicher Körper!
»Thomas?« Helen Dörr, Gröbers Sekretärin und die gute Seele der Abteilung, steckte den Kopf in den Besprechungsraum, wo immer noch Bierman, Polocek und Berner beisammensaßen und Sarah einen Einblick in die polizeiliche Arbeit in der Breisgaumetropole gaben. Natürlich war auch der ein oder andere Tipp zur Wohnsituation, zu Gastronomie oder Freizeitaktivitäten zur Sprache gekommen. Gerade hatte sich Nico Berner Sarah als ihr persönlicher Begleiter für das städtische Nachtleben angeboten, als das Klopfen Berner fürs Erste vor der Peinlichkeit einer höflichen aber sehr bestimmten Abfuhr bewahrte.
»Ja, Helen, was gibt’s?« Bierman unterbrach Berners Redefluss mit einer rüden Geste seiner rechten Hand.
»Wir haben einen Todesfall bei der Großdemo am Flugplatz.« Helen betrat das Besprechungszimmer.
»Nachdem die Situation eskaliert war und die Menge mit Wasserwerfern aufgelöst wurde, fand sich in einem der Abwassergräben eine männliche Leiche. Jetzt werden natürlich die Rufe laut, die Einsatzpolizei hätte den Tod verschuldet. Ziemlich aufgeheizte Stimmung da draußen.«
Nico Berner verzog das Gesicht, sagte aber nichts. Helen fuhr fort.
»Das Einsatzteam der Schutzpolizei, das die Demo betreut hat, kommt aus Stuttgart, so dass nichts dagegenspricht, wenn wir die ersten Ermittlungen durchführen. Gröber möchte, dass du«, sie wandte sich an Bierman, »Frau Hansen mitnimmst und ihr zwei alles in die Wege leitet.«
Bierman stand auf.
»Okay.«
Er richtete seinen Blick auf Sarah.
»Sind Sie bereit? Fehlt noch was in Ihrer Ausrüstung?«
Sarah erhob sich ebenfalls.
»Meine Waffe habe ich noch nicht, die bekomme ich morgen. Ich muss noch auf dem Schießstand den sicheren Umgang demonstrieren und die erforderlichen Schießergebnisse erreichen. Ansonsten bin ich vorbereitet.«
Sie schob ihren Stuhl an seinen Platz.
»Aber ich glaube nicht, dass ich sie jetzt brauchen werde, oder?«
Bierman schüttelte den Kopf.
»Sicher nicht.«
Er packte seine Unterlagen zusammen und steckte sie in eine speckige Ledertasche.
»Und Sie müssen hier nochmal den Umgang mit der Schusswaffe unter Beweis stellen, obwohl Sie schon in Schleswig-Holstein bei der Polizei waren? Seltsam.«
»So wollen es wohl die Vorschriften. Außerdem hatte ich in Schleswig-Holstein die Sig Sauer P225 und hier wird seit kurzem die Heckler und Koch P2000 ausgegeben.«
Bierman zuckte mit den Schultern.
»Habe mir auch sofort eine H&K geben lassen, auch wenn die alten P5 weiterbenutzt werden sollten.«
Er steuerte die Tür an. Sarah folgte ihm aus dem Raum, den er, ohne sich von den anderen zu verabschieden, verließ.
Neugierig sah Sarah während
der Fahrt aus dem Wagen. Da Thomas Bierman nicht zum Reden aufgelegt schien, studierte sie die Umgebung. Sie war noch nie in Freiburg gewesen, und so beschränkte sich ihr Wissen über die Stadt und den Südschwarzwald auf den Text eines alten Baedekers, dessen Auflage ein Copyright aus den späten Achtzigern aufwies. Die entsprechenden Wikipediaeinträge zu lesen war ihr zeitlich nicht mehr möglich gewesen, da sie unmittelbar nach Abschluss ihres Falles in Husum die Umzugsvorbereitungen getroffen hatte. Gestern schließlich, als sie nach nervigen Staus bei Hannover, Kassel und zuletzt auf der A5 bei Karlsruhe erst bei Dunkelheit in Freiburg eingetroffen war, konnte sie nicht wie erhofft etwas von der Stadt erkunden. Sie hatte sich von ihrem Garmin Navigationsgerät direkt ins Park Hotel Post leiten lassen. Dies war für die nächsten knapp zweieinhalb Wochen ihre Unterkunft, denn die hübsche Maisonette, die sie kurzerhand ohne Besichtigung über einen Makler gekauft hatte, war noch nicht bezugsfertig. Sogar den Münsterturm, der die meisten Gebäude in der Stadt deutlich überragte, hatte sie heute Morgen auf dem Weg zum Präsidium lediglich kurz im Rückspiegel gesehen. Jetzt verrenkte sie sich schier den Hals, um sich zu orientieren, konnte aber nichts Markantes erkennen.
»In welche Richtung fahren wir?«, fragte sie Bierman.
»Westen, Richtung Flugplatz.«
Seine lakonische Antwort ließ nicht auf die Aufnahme einer Konversation hoffen, und so unterließ auch Sarah jeden Versuch, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Erst als sie von der Straße auf ein sehr weitläufiges, begrüntes Areal bogen und auf eine etwa fünfhundert Meter entfernte Menschenmenge zuhielten, war es Bierman, der die Stille unterbrach.
»Eine Demo gegen die jüngsten Beschlüsse des Bundestages bezüglich Datenvorhaltung, Vernetzung der internationalen Polizei und so.«
Er wies auf die etwa drei- bis viertausend Demonstranten.
»Ein Teil von denen hat bestimmt schon bei den Wyhl-Demos mitgemacht. Freiburg hat eine sehr ausgeprägte Demonstrationskultur, müssen Sie wissen.«
Sarah konnte dem Tonfall nicht entnehmen, ob das Gesagte lediglich der reinen Informationsvermittlung diente, oder ob Bierman auch eine bestimmte Wertung zum Ausdruck brachte. Sie sah ihn von der Seite an und entschied sich für ersteres. Angesichts seines fast schon rebellischen Äußeren konnte sie sich nicht vorstellen, dass er den Anliegen und Taten des eher linksalternativen Spektrums mit Respektlosigkeit und Sarkasmus begegnete. Ob er überhaupt politisch war? Sie konnte es beim besten Willen nicht sagen.
Sie erreichten eine Absperrung, hinter der die sichtlich erregten Demonstranten von Einsatzkräften einer Hundertschaft in Schach gehalten wurden. Ein uniformierter Beamter winkte sie zu sich. Bierman ließ die Seitenscheibe hinunter und streckte dem Polizisten seinen Ausweis entgegen.
»Dort hinten«, sagte der Kollege und deutete in Richtung eines Einsatzwagens, der mit Blaulicht etwa fünfzig Meter entfernt stand. Auf sein Zeichen hoben zwei weitere Beamte das Absperrband und Bierman steuerte im Schritttempo den Fundort an. Durch das offene Seitenfenster konnte Sarah auch die Sprechchöre verstehen, die die wütende Menge ihnen entgegenbrüllte. Von Datenschutz und Privatsphäre war allerdings nichts zu hören. Vielmehr hallten ihnen Sätze wie Polizisten sind Mörder und Nieder mit der Staatsgewalt entgegen. Das Geschehen hatte sich also, wie nicht anders zu erwarten, wie ein Lauffeuer verbreitet. Innerlich zuckte sie mit den Achseln und auch Bierman schienen die verbalen Attacken kalt zu lassen. Von ihren Psychologieseminaren wusste sie, wie leicht eine Menschenansammlung, die im gemeinsamen Interesse gebildet wurde, und die einen gewissen Grad der Emotionalität erreicht hatte, durch einen kleinen Auslöser und geschickte Verstärkung durch einige wenige in eine andere Richtung dirigiert werden konnte. Insofern nahm sie den einzelnen Personen die verallgemeinerten Angriffe auf sie und ihren Berufstand nicht übel, auch wenn zu diesem Zeitpunkt tatsächlich niemand sagen konnte, wie das Opfer zu Tode gekommen war.
Bierman stoppte den Mercedes Kombi neben dem Einsatzwagen und er und Sarah stiegen aus.
»KTU? Rechtsmedizin?«, fragte er den Polizisten, der an der Motorhaube des Sprinters lehnte und mit einem Camcorder die Menge filmte.
»Noch nicht da!«, antwortete dieser ebenso knapp, ohne sein Auge von dem Okular des Gerätes zu nehmen.
»Da drüben liegt sie.«
Er zeigte auf den Wassergraben, der sich wenige Meter hinter den Fahrzeugen erstreckte und auf beiden Seiten in der Entfernung verlor.
»Sie?«, fragte Sarah und nahm die von Bierman angereichten Latexhandschuhe entgegen.
»Die Leiche. Ist aber offensichtlich ein Mann.«
»Wer hat die Leiche gefunden?« Sarah zupfte den weißen Latex zurecht.
»Zwei Frauen, die sich hier kennengelernt haben. Die eine Ende dreißig, die andere ein Teenager. Waren beide auf der Demo. Die Jüngere hat in dem Gerangel wohl einiges abbekommen und wurde von den Sanis in die Uniklinik gebracht. Die andere wollte sie begleiten.«
Bierman hob die Augenbrauen.
»Aussage? Personalien?«
»Personalien sind erfasst. Aussagen sind mager. Haben den Leichnam von da drüben aus entdeckt. Die Ältere hat nicht lange gefackelt und sofort den Notruf gewählt. Dann ist sie in den Graben gesprungen, hat den Toten irgenwie rausgewuchtet und sofort mit der Wiederbelebung begonnen.«
»Und uns so den Fundort kontaminiert und verwüstet.« Bierman schien die sofortige Reanimation nicht gutzuheißen, auch wenn sie die Person unter Umständen gerettet hätte. Er trat zu dem Leichnam und sah, die behandschuhten Fäuste in die Hüften gestemmt, nach unten. Sarah bezog neben ihm Stellung, versuchte den Lärm im Hintergrund auszublenden und begutachtete ebenfalls die Situation. Die Person, die mit aufgerissenen Augen und ebensolchem Hemd vor ihnen lag, schätzte sie auf etwa einen Meter fünfundsiebzig groß. Sie war, soweit der olivgrüne Parka und die braune Cordhose eine Beurteilung zuließen, normal gebaut. Die Haare waren mittelblond und relativ lang. Sofort fiel ihr auf, dass die eine Hand zur Faust geballt war und etwas Gras und ein kleines Stöckchen umfasst hielt.
»Er war noch nicht tot, als er herunterfiel«, lenkte sie Biermans Aufmerksamkeit auf ihre Beobachtung. »Er hat noch versucht, sich festzuhalten.«
Biermann nickte und förderte einen Teleskopkugelschreiber zutage. Er zog ihn aus und deutete auf eine Stelle, wo am Rand des Kanals in dem grünen Bewuchs etwas braune Erde und deutliche Spuren von Fingern zu sehen waren.
»Dort hat er sich festgekrallt.«
Sarah besah sich die Stelle genau und kam zu demselben Schluss wie ihr Partner.
»Gestolpert, gestoßen oder zusammengebrochen?« Bierman sah vor sich auf den Boden. »Können Sie Kampfspuren erkennen?«
Auch Sarah sah hinunter zu ihren Füßen und versuchte, Anzeichen für eine gewaltsame Auseinandersetzung zu finden, konnte aber keinerlei auffällige Spuren in dem moosigen Bewuchs erkennen.
»Ich sehe nichts«, sagte sie und schaute sich auch das weitere Umfeld an. Doch außer den Knieabdrücken neben der Leiche, die offensichtlich von den gescheiterten Rettungsversuchen der engagierten Krankenschwester stammten, war nichts zu erkennen.
»Warten wir auf die KT. Mal sehen, was die sagen.«
Kaum hatte Bierman ausgesprochen, näherten sich zwei Fahrzeuge. Ein großer Kastenwagen mit Behördenkennzeichen und dahinter ein ziviler Mercedes Kombi. Sarah folgte ihrem neuen Partner, der den Mitarbeitern der KT zuwinkte, aber an dem Wagen vorbeiging und auf den Kombi zuhielt.
»Kommen Sie, Frau Hansen, ich stelle Sie unserem Rechtsmediziner vor.«
Neugierig beobachtete Sarah, wie ein graumelierter Endvierziger dem Wagen entstieg und breit lächelnd auf ihren Partner und sie zukam.
»Tag, Schwarz!« Bierman schüttelte dem sympathisch wirkenden Mann trotz seines Latexhandschuhs die Hand.
»Einen schönen guten Tag, Herr Bierman«, erwiderte dieser und richtete seinen Blick sofort auf Sarah.
»Ihre langersehnte neue Kollegin?«
Sarah sah Bierman lächeln.
»Ja, endlich. Darf ich Ihnen Frau Hansen vorstellen? Frau Hansen, Dr. Schwarz.«
Noch bevor Sarah ihren Latexhandschuh abstreifen konnte, ergriff der Rechtsmediziner ihre Hand und schüttelte sie mit einem kräftigen Griff.
»Herzlich willkommen!«, sagte er. »Und, hat er Sie an Ihrem ersten Tag schon mal so richtig vor den Kopf gestoßen?«
Leicht verlegen sah Sarah ihren neuen Partner von der Seite an. Als sie sich jedoch sicher war, dass der Hinweis auf seine zurückhaltende, wortkarge Art bei Bierman ein Lächeln hervorrief, wagte sie eine kesse Antwort.
»Ständig«, sagte sie. »Wenn ich mir vorstelle, dass wir von jetzt an ein Team sind…«
Bierman lächelte immer noch, wechselte jedoch sofort das Thema.
»Zu dem Toten können wir noch nichts sagen. Wie Sie sehen, ist die KT gerade erst eingetroffen. Es deutet aber einiges darauf hin, dass der Verstorbene noch gelebt hat, als er in den Graben stürzte. Bin wirklich gespannt, was Sie nachher sagen.«
»Nachher? Mein lieber Bierman, Sie schrauben Ihre Erwartungen wieder mal viel zu hoch.«
Schwarz zwinkerte Sarah zu.
»Das ewige Klischee vom Kommissar, der den Rechtsmediziner zur Eile treibt. Herr Bierman erfüllt es, wann immer er mir etwas zum Zerlegen liefert.«
Bierman, der den leicht verstörten Blick Sarahs bemerkt haben musste, konnte ein Lächeln nicht verbergen als er parierte:
»So ist er nun mal, unser Doktor Tod. An ihn werden Sie sich genauso gewöhnen müssen, wie an mich.«
»Der Tote heißt Herbert Meyer.
Um genau zu sein, Professor Doktor Herbert Meyer. Er ist hier in Freiburg gemeldet und hat, unseren bisherigen Ermittlungen zufolge, einen Lehrstuhl an der Fakultät für Mikrosystemtechnik inne. Nach Verwandten wird derzeit noch gesucht.« Thomas Bierman warf mit Hilfe eines Beamers ein Bild des Personalausweises an die Leinwand, den die KTU ihnen nach akribischer Tatortaufnahme überreicht hatte. Mehrere Stunden waren Sarah und Bierman auf dem Feld geblieben, um die Informationen aufzunehmen, die Schwarz und die Kollegen von der Technik schon geben konnten. Erst als klar war, dass nichts auf die Anwesenheit einer zweiten Person hindeutete, hatten sie den Weg ins Präsidium angetreten. Dort hatte Pfefferle sie abgefangen und ihnen mitgeteilt, dass er selbst sowie Berner und Polocek sie mangels anderer Arbeit unterstützen würden. Jetzt saßen alle im Besprechungsraum und horchten den Ausführungen Biermans.
»Der Tote weist, sofern das im bekleideten Zustand festzustellen ist, keine offensichtlichen äußeren Verletzungen auf, was ebenso wie das Nichtvorhandensein anderer verdächtiger Spuren darauf schließen läßt, dass er entweder gestolpert ist, oder aber etwas anderes seinen Zusammenbruch hervorgerufen hat.«
»Wie kann es sein, dass keine weiteren Spuren gefunden wurden?« warf Karen Polocek ein. »Da waren doch an die viertausend Demonstranten!«
Bierman sah Sarah aufmunternd an, die auch sogleich das Wort ergriff.
»Die Demonstration fand etwas abseits dieser Stelle statt. Deswegen haben wir die Vermutung, dass Meyer entweder überhaupt nicht an der Demo teilgenommen hat und bereits vorher dort zu Tode gekommen ist, oder aber sich aus der Menschenmenge zurückgezogen hat. Vielleicht weil ihm schlecht geworden ist? Vielleicht, weil er einen Schwindelanfall hatte? Dr. Schwarz zufolge könnte es sich bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt genau so abgespielt haben. Die genaue Todeszeit und die Ergebnisse der Obduktion werden Aufschluss geben.«
Polocek nickte zufrieden. Bierman setzte seinen Vortrag fort.
»Da es laut Schwarz unter Umständen sehr schwierig sein wird, festzustellen, ob Meyers Tod direkt mit den Einsatzkräften in Verbindung gebracht werden kann, sei es durch den Druck bei Einkesselung von Aufrührern oder durch den Einsatz der Wasserwerfer, werden wir auf alle Fälle Folgendes tun: Hans, du besorgst die Einsatzprotokolle und den Funkverkehr der Kollegen aus Stuttgart. Und auch die Viedeoaufzeichnungen. Karen, Nico, ihr seht bitte nach, ob wir noch weitere Personalien vor Ort aufgenommen haben. Besucht diese Personen und findet heraus, ob es Zeugen gibt, die irgendetwas gesehen haben. Frau Hansen, wir beide ermitteln im Umfeld des Opfers und erkundigen uns bei behandelnden Ärzten, ob Vorerkrankungen bestanden haben et cetera. Noch Fragen?«
Die Ermittler sahen sich kurz gegenseitig an und schüttelten dann den Kopf.
»Also gut.«, sagte Bierman. »Dann an die Arbeit!«
»Guten Abend, Zimmer 432 bitte« Sarah lehnte sich an den Tresen der Rezeption. Der Concierge griff in den Schrank und überreichte Sarah mit einem freundlichen Lächeln den Schlüssel zu ihrem temporären Obdach.
»Bitte schön, keine Post für Sie. Noch irgendwelche Wünsche?«
»Können Sie mir bitte eine Flasche trockenen Riesling aufs Zimmer bringen lassen?«
»Einen Durbacher, selbstverständlich!«
»Danke sehr!«
Sarah nahm den Aufzug. Für die Treppen fehlte es ihr nach diesem ersten Arbeitstag an Motivation. In ihrem Zimmer angekommen, entledigte sie sich erst ihrer Jacke und der Schuhe, ging zu ihrem Koffer, den sie bei ihrer Ankunft am gestrigen Abend noch nicht hatte ausräumen können, und suchte sich etwas Bequemes zum Anziehen. Mit einer Baumwoll-Jogginghose, Kuschelsocken, einem T-Shirt und einem Hoodie begab sie sich ins Bad. Bevor sie sich in den Wohlfühlklamotten auf das Bett lümmelte, nahm sie noch den Weinkühler mit der geöffneten Flasche entgegen, zeichnete auf der Rechnung ab und drückte dem Pagen drei Euro in die Hand. Sie schenkte sich ein Glas ein, legte sich auf das Bett und begann, den Tag zu resümieren. Eigentlich war alles sehr gut verlaufen. Die Kollegen waren alle in Ordnung. Bierman, ihr Partner, etwas verschlossen, aber sicher eine interessante Perönlichkeit. Karen schätzte Sarah als offenherzig und empathisch ein, Nico Berner als ein wenig arrogant und machomäßig. Aber auch er war keinesfalls unsympathisch. Pfefferle mochte sie sehr, er verkörperte so etwas wie den Großvater, der mit seiner gutmütigen Art alles zusammenhielt. Bei Gröber hatte sie im ersten Moment Abneigung verspürt und sie fragte sich, wie manche Menschen es schafften, ohne viel zu sagen oder zu tun, gleich einen negativen Eindruck zu hinterlassen. Nichtsdestotrotz, alles in allem bewertete sie ihre neue Situation als überaus gut. Vor allem, wenn man bedachte, dass sie schließlich gewissen Umständen in ihrer Heimat entfliehen wollte, in der Hoffnung in der Ferne ihre Geschichte besser aufarbeiten zu können.
Als hätte das Schicksal ihre Gedanken mitgelesen, klingelte in diesem Moment Sarahs Handy und im Display blinkte vollkommen unpersönlich Mutter im Rhythmus des Tons.
Sarah verdrehte die Augen, nahm einen Schluck Wein und nahm das Gespräch entgegen.
»Hansen«, meldete sie sich, vielleicht um unterbewusst zu signalisieren, dass ihre Mutter nicht allgegenwärtig war, auch nicht als gespeicherter Kontakt auf ihrem Handy, wo Walburg Hansen durch einen bloßen Anruf eine nicht erwünschte Präsenz entwickeln konnte. Diese Präsenz und die damit verknüpften Reaktionen, die sie unweigerlich bei Sarah auslöste, waren ein Grund für ihren Weggang gewesen. Sie hatte festgestellt, dass die Gefühle und Stimmungen sie weniger hart überfluteten, wenn eine räumliche Distanz zu ihrer Mutter bestand.
»Schatz, ich bin es! Ich habe mir ja solche Sorgen gemacht! Warum hast du denn gestern nicht angerufen?«, klang die Stimme weinerlich aus dem Mobiltelefon.
Der Kloß, der augenblicklich von Sarahs Hals Besitz ergriff, ließ sich nicht leicht wegschlucken, doch es gelang ihr, mit neutralem Tonfall und ohne Zittern in der Stimme zu antworten.
»Ich bin gestern erst sehr spät hier angekommen, es war viel Verkehr und bereits dunkel und ich war einfach hundemüde«, sagte sie und biss sich auf die Lippen, weil sie automatisch in die Verteidigungsrolle geschlüpft war. Das konnte sie so nicht stehen lassen!
»Außerdem habe ich dir gesagt, dass ich sicher sehr viel zu tun haben werde und nicht weiß, wann ich dich erreichen kann«, fügte sie deswegen noch hinzu und wurde innerlich drei Zentimeter größer.
»Ach, deswegen bist du auch den ganzen Tag nicht drangegangen«, stellte ihre Mutter fest, und Sarah war froh, das Handy den Tag über im Hotelzimmer gelassen zu haben.
»Ja genau. Und ich hatte auch gesagt, dass du mich bitte nur in Notfällen anrufen sollst. Aber gut… wie geht es dir denn? «
Die folgende halbe Stunde bereute Sarah jede einzelne Minute, Waldburg Hansen diese Frage gestellt zu haben, denn das Lamentieren über ihre Einsamkeit, ihre Trauer und das öde Grau, in dem sie ihre letzten Lebensjahre jetzt fristen würde, zogen sie tiefer in eine schlechte Stimmung, als sie es sich selbst eingestehen wollte. Doch sie war zu müde, um ihrer Mutter die positiven Seiten ihres Lebens vorzuhalten oder sich mit einem mentalen Panzer zu umgeben und auf eine Diskussion einzusteigen, die, wenn es schlecht lief, zu einem emotionalen Fiasko an beiden Enden der Leitung führen konnte. Also beschränkte sie sich, während sie ihren Wein trank, darauf, brav den aktiven Zuhörer zu mimen und ihrer Mutter am Ende des Telefonats eine gute Nacht zu wünschen.
Obschon die Wolkendecke nur
winzige Lücken ließ, drang vom Vollmond genügend Helligkeit durch, so dass man sich ohne künstliches Licht über den Asphalt hätte bewegen können. Unter den dichtbelaubten Bäumen aber, welche die Merianstraße säumten, war es noch ein wenig dunkler als unter freiem Himmel. Ein Passant hätte das parkende Auto schon genauer in Augenschein nehmen müssen, um zu erkennen, dass eine dunkel gekleidete Gestalt hinter dem Steuer saß. Die Straßenbeleuchtung war schon vor etwa einer halben Stunde ausgegangen und Fußgänger hatten sich seit mindestens anderthalb Stunden nicht mehr gezeigt. Bei den wenigen Fahrzeugen, die seither aufgetaucht waren, hatte es sich allesamt um Kranken- und Rettungswagen gehandelt, die das etwa 100 Meter entfernte Sankt-Josefs-Krankenhaus angesteuert hatten. Trotzdem saß die Gestalt unbeweglich da und starrte wie unter Hypnose auf das Gebäude in der Albertstraße, wo aus einem der abgedunkelten Fenster immer noch ein Lichtschein ins Freie fiel. Vor dem Institut der Rechtsmedizin, das man von dem Standort aus gerade noch einsehen konnte, parkte nur ein Wagen, ein zitronengelber Fiat Panda. Ungeduld zählte sicher nicht zu den Schwächen des wartenden Mannes, trotzdem sah er zum wiederholten Mal auf die Leuchtziffern seiner Rolex. Drei Minuten nach zwei Uhr. Das Licht, das die Anwesenheit eines Institutsmitarbeiters anzeigte, war alles andere als positiv zu bewerten. Wenn die Person nicht anderweitige Fälle aufarbeitete, beschäftigte sie sich wohl mit dem einzigen Leichnam, welcher der Rechtsmedizin seinen Informanten zu Folge am heutigen Tag geliefert worden war. Jener Leichnam, von dem er gehofft hatte, dass er ohne Obduktion zu einem der Bestattungsunternehmen gebracht werden würde. An einen Ort, an dem sein Vorhaben unendlich einfacher gewesen wäre, als jetzt. In Gedanken tüftelte er bereits einen präzisen Plan aus, wie er vorgehen würde, wenn der Mitarbeiter das Institut verlassen hatte.
Michelle Schneider schlug das Laken am Kopfende des Seziertisches zurück, trat ans Fußende und deckte auch dort den Leichnam ab. Das Tuch faltete sie noch zweimal und legte es auf den Beistellwagen zu ihrer Linken. Sie klopfte auf die Außentaschen ihres weißen Laborkittels, brachte ihr Diktiergerät zum Vorschein und drückte den Aufnahmeschalter.
»Aktenzeichen 07/BK-02. Es ist 23:17 Uhr. Beginn der äußerlichen Beschau. Der Tote ist männlich, weiß. Haarfarbe dunkelblond. Geschätzte Größe etwa ein Meter siebzig, geschätztes Gewicht etwa siebzig Kilogramm. Normale Statur.«
Sie hielt den Apparat an. Sorgfältig strich sie mit ihren latexbehandschuhten Fingern durch die Haare und untersuchte die Kopfhaut. Dann sah sie in Nasenlöcher, Mund- und Rachenraum. Langsam arbeitete sie sich über Brustkorb, Arme, Genitalien und Beine bis hinunter zu den Füßen. Schließlich nahm sie das Diktiergerät wieder zur Hand.
»An Gesicht, Front und Armen keinerlei auffällige Verletzung erkennbar. Bei den Okklusionsmalen am Brustkorb handelt es sich um typische Folgen der Reanimationsversuche. Genaueres nach Röntgen und MRT. Erste Anzeichen für das Einsetzen des Rigor Mortis korrelieren mit vermutetem Todeszeitpunkt. Mund, Atem- und Verdauungswege, soweit von außen zu beurteilen, scheinen frei. Hier Genaueres nach Sektion. Es folgt die äußerliche Untersuchung der Rückseite.«
Sie steckte das Diktiergerät in die Tasche und zog den Leichnam ganz an den Rand des Seziertisches. Dankbar dafür, dass die Leichenstarre gerade erst begann einzusetzen, legte sie den rechten Arm unter den Rumpf, winkelte ein Bein und den andern Arm an und hebelte den Toten auf den Bauch. Dann richtete sie die Gliedmaßen wieder aus und setzte ihre Untersuchung fort. Im Analbereich nahm sie eine Leuchtlupe zu Hilfe, fotografierte ihre Entdeckung und beendete die Untersuchung an den Fußsohlen des Toten. Sie griff wieder zu dem Aufnahmegerät.
»Das Rektum weist leichte, circa zwei Tage alte Analfissuren auf, die auf einvernehmlichen, homosexuellen Geschlechtsverkehr schließen lassen. Des Weiteren typische Liegemale an Schultern und Gesäß, postmortal. Ansonsten ist die Rückseite des Leichnams ohne Auffälligkeiten. Es folgt die röntgentechnische Untersuchung.«
Sie legte das Diktiergerät achtlos hinter die Sonnenblende auf die Fensterbank, stellte einen Rollwagen ans Ende des Obduktionstisches, entriegelte die Bahre und schob sie mitsamt dem Leichnam darauf. Nun löste sie mit dem Fuß die Bremse und zirkelte mit dem Edelstahlwagen um den feststehenden Obduktionstisch. Die Doppeltür am Ende des Raumes öffnete sich automatisch und sie bugsierte den Rollwagen mit Herbert Meyers Leichnam hinaus auf den Gang. Es waren nur fünfzehn Meter bis zum Röntgenraum, doch angesichts der Dunkelheit und der flackernden Neonröhre an der Decke fröstelte sie unwillkürlich. Die Arbeit an den Toten hatte sie zwar abgehärtet, aber diese Szenerie erinnerte sie doch allzu sehr an diverse Horrorfilme, als dass sie vollkommen unberührt die Leiche den Flur hätte entlangschieben können. Entsprechend froh war sie, als sie das grelle Licht im Röntgenraum einschalten und den Rollwagen rückwärtsgehend hinter sich durch die Tür ziehen konnte. Hier drin war die unheimliche Atmosphäre sofort verschwunden. Routiniert platzierte sie Herbert Meyers Körper unter dem Röntgenapparat und machte erst Aufnahmen seiner Füße und Unterschenkel, dann von Oberschenkel, Abdomen, Brustkorb mit Armen und schließlich vom Kopf. Gerade diese Nacht war sie dankbar, dass die Rechtsmedizin mit Szintillatorröntgengeräten ausgestattet war. Denn so konnte sie die digitalen Bilder sofort auf einem Computermonitor unter die Lupe nehmen und musste sie nicht erst lange entwickeln. Ein Prozess, den sie zwar beherrschte, der aber ihren Aufenthalt in der heutigen Nacht nochmals deutlich verlängert hätte. An den altmodischen Lichtkästen für die analogen Bilder wäre es außerdem nicht möglich gewesen, einzelne Bereiche zu vergrößern oder mittels Kontrastkurven die Qualität und Interpretierbarkeit zu verbessern. Seufzend ließ sie sich im Regieraum neben dem Röntgenzimmer auf einen Drehstuhl fallen und rollte an das Computerterminal. Zuerst die Bilder der unteren Extremitäten. Nichts Auffälliges. Dann die Bilder des Abdomens. Ebenfalls nichts. Bei den Aufnahmen der Arme konnte sie einen gut ausgeheilten Bruch der linken Elle erkennen, der schon einige Jahre zurückliegen musste. Auf dem Foto des Brustkorbs waren wie vermutet einige Rippen in der Nähe des Sternums gebrochen, was auf sehr engagierte Reanimationsversuche schließen ließ. Aber die Lage der Rippen verriet Michelle, dass sie weder Herz noch Lunge verletzt haben konnten und diese Verletzung definitiv nicht zum Tode geführt hatten. Im Gegenteil, hätte nicht irgendein anderer Umstand den Erfolg der Reanimation vereitelt, hätte sie, was Ausführung und Kraft anging, durchaus Meyers Leben retten können.
Gespannt klickte sie die Aufnahme des Schädels an. Da eine Hirnblutung schon am Nachmittag in Erwägung gezogen worden war, lenkte der dunkle Fleck, der sich ziemlich zentral im inneren des Schädels befand, sofort ihre Aufmerksamkeit auf sich. So wie es aussah, musste eine Arterie in der Region des Stammhirns geplatzt sein. Der zunehmende Druck auf die Formatio Reticularis hatte sicher schnell zu Atem- und allgemeinen Lähmungen geführt und schließlich den Tod Meyers verursacht. Angesichts der Ausdehnung des Fleckes musste es recht schnell gegangen sein. Ein Zusammenhang zwischen der Hirnblutung und dem Einsatz des Wasserwerfers würde sehr schwer zu beweisen, aber genauso schwer zu widerlegen sein. Immerhin war die Todesursache praktisch sicher geklärt. Die genaueren Umstände, zum Beispiel das Vorhandensein eines Aneurismas, konnte nur eine Sektion des Hirns enthüllen. Dafür war es aber diese Nacht definitiv zu spät. Mit einem lauten Gähnen lehnte sie sich zurück und blickte auf die Uhr an der gegenüberliegenden Wand. Kurz nach halb zwei. Bis sie den Leichnam in ein Kühlfach verfrachtet, die Systeme heruntergefahren und ihr Zeug zusammengepackt hätte, würde es zwei Uhr morgens sein, die Autopsie musste also warten. Sie wandte sich wieder dem Computer zu. Als sie aus dem Bild herauszoomte, um die Datei zu archivieren und zu schließen, blieb ihr Blick an einer winzigen Stelle im Innenohr hängen, die deutlich weißer war als die Knochen des Schädels und des Ohres. Ein Bildfehler, dachte sie, denn so hell zeigten sich auf Röntgenbildern normalerweise nur Strukturen aus Metall, Implantate etwa oder auch Projektile. Für beides war die betreffende Stelle viel zu klein und ein reiner Zufall, dass sie sie bemerkt hatte. Beim Vergleich mit den Ohrknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel schätzte Michelle die Größe des Objektes auf bestenfalls einen viertel Millimeter. Stirnrunzelnd griff sie zur Maus und zoomte auf die ominöse Stelle.
Enttäuscht lehnte sich Michelle Schneider in dem Bürostuhl zurück. Die Auflösung des digitalen Röntgenbildes gab einfach nicht genug her, um Form und Struktur des winzigen Fremdkörpers - und als solchen stufte sie den weißen Fleck mittlerweile ein – genauer zu spezifizieren. Sie kaute auf dem Ende eines Bleistiftes, der hinter der Tastatur gelegen hatte, und dachte angestrengt nach. Ein CT, nur von der Ohrregion, würde ihr erstens ein dreidimensionales Abbild verschaffen und auch die Auflösung nochmals um einiges heraufsetzen. Wieder blickte sie auf die Uhr an der Wand. Auch wenn ihre Neugier geweckt war, ihr Wissensdurst quälend nagte, sie war einfach zu müde!
Schluss, sagte sie halblaut zu sich selbst. Besprich das morgen mit Dr. Schwarz.
Sie legte den Bleistift weg, druckte die Bilder aus und versah sie mit einer Büroklammer. Dann drückte sie den Standby-Button an dem Computermonitor, schaltete das Licht aus und ging zu der Leiche im Röntgenraum. Sie deckte Herbert Meyer zu und klemmte die Bilder unter dessen Ellenbogen. Als sie den Rollwagen auf den Gang schob, das Licht im Raum ausschaltete und auf dem Flur wieder dem flackernden Licht ausgesetzt war, überkam sie von neuem das flaue Gefühl. Ohne sich umzudrehen steuerte sie den Kühlraum mit den Leichenfächern an. Dort angekommen, wählte sie ein Fach, an dem noch kein Zettel an der chromblitzenden Tür steckte, nahm die Röntgenbilder an sich und schob den Toten in die dunkle, gähnende Leere. Als der Stahlhebel das Fach verriegelt hatte, ging sie zu der Anrichte, nahm einen Namenszettel und schrieb gut leserlich Herbert Meyer darauf. Diesen steckte sie in den Einschub an dem Kühlfach. Sie zog sich die Latexhandschuhe aus, warf sie in den Mülleimer und wusch sich die Hände. Zu guter Letzt löschte sie das Licht und begab sich zu den Aufzügen, um in ihrem Büro ihre Tasche, Handy und Autoschlüssel zu holen. Sie sehnte sich nun wirklich nach ihrem Bett!
Jetzt wurde der Mann in dem Auto vor der Rechtsmedizin doch ein wenig unruhig. Wollte er seine Aufgabe wie gewohnt perfekt erledigen, wurde die Zeit allmählich knapp. Denn sein Job war Präzisionsarbeit, aufwändig, zeitintensiv. Und er hasste halbe Sachen. Zumal jeder noch so kleine Fehler das Potential barg, sich zu ernst zu nehmenden Problemen zu entwickeln. Doch just in dem Moment, als er abermals auf die Uhr sehen wollte, flammte hinter den Fenstern des Treppenhauses im zweiten Stock das Licht auf. Kurz darauf war auch im Fenster, das er bereits zuvor als das Büro des Institutsmitarbeiters identifiziert hatte, das Licht wieder an. Schemenhaft konnte er eine Gestalt erkennen, die in dem Raum umherlief. Dann ging das Licht aus. Wenige Augenblicke später öffnete sich die Eingangstür und eine Frau mit langen dunklen Haaren steuerte auf den gelben Fiat Panda zu. Sie setzte sich hinter das Steuer, die Bremslichter leuchteten auf, kurz darauf auch die Rückfahrleuchten. Der Panda parkte aus und bog vor ihm in die Merianstraße Richtung Norden. Der Mann ging auf Nummer sicher. Er griff nach seinem Handy und drückte eine Kurzwahltaste. Nach nur zwei kurzen Sätzen beendete er das Gespräch, ohne eine Antwort des Anderen abzuwarten, steckte das Handy ein, zog den Zündschlüssel ab und stieg aus. Er ging quer über die menschenleere Kreuzung und zog sich im Laufen Einmalhandschuhe an. Am Eingang zur Rechtsmedizin angekommen studierte er die Zutrittskontrolle. Ein müdes Lächeln huschte über sein Gesicht. Er förderte ein Lederetui aus seiner Jackentasche zutage und wählte eine Karte von der Größe einer EC-Karte aus. Diese zog er einmal langsam durch den Schlitz der elektronischen Zugangskontrolle. Danach schob er die Karte in einen kleinen Apparat im Taschenrechnerformat und beobachtete das Spiel der auf der Front rot blinkenden LEDs. Eine nach der anderen wechselte die Farbe, bis die ganze Reihe grün leuchtete. Das Gerät verschwand wieder in seiner Innentasche, die Karte zog er abermals durch den Schlitz der Zutrittskontrolle. Als ein leises Summen die Entriegelung des Schlosses anzeigte, stieß er die Glastür auf und trat in das Dunkel des Raumes.
Die beiden Männer in dem
schwarzen Land Rover warteten geduldig, bis das Fahrzeug, das ihnen eben am Telefon beschrieben wurde, um die Ecke bog und, die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km/h peinlich genau einhaltend, an ihnen vorbeischlich. Erst als die Fahrerin an der nächsten Kreuzung den Blinker rechts setzte, startete der Mann hinter dem Steuer des Geländewagens den Motor und fuhr los. Nicht dass er damit gerechnet hätte, dass die Fahrerin des vorausfahrenden Wagens ihn sonst bemerkt hätte – sie war ja schließlich kein Profi – aber die Macht der Gewohnheit ließ sich nicht so leicht abschütteln. Ohne sich dem Auto weniger als fünfzig Meter zu nähern, folgte er dem Zielobjekt Richtung Süden. Das Lörracher Kennzeichen ließ darauf schließen, dass die Verfolgte entweder den Weg über den Schauinsland nach Todtnau oder über die Autobahn in Richtung Lörrach einschlagen würde. Beide Strecken boten mehrere Optionen, den Auftrag mit geringem Risiko zu erledigen. Sollte es nicht während der Fahrt gelingen, würden sie die Mitarbeiterin der Rechtsmedizin bis nach Hause verfolgen und dort einen alternativen Plan entwickeln.
»Autobahn«, sagte sein Beifahrer, als der Fiat am Basler Tor rechts auf die Ausfallstraße in Richtung Eugen-Keidel-Bad abbog. Tatsächlich fuhr der Wagen vom Zubringer Süd auf die A5 nach Basel. Außer der Verfolgten war kein Auto zu sehen. Der Fahrer fasste einen Entschluss.
»Wir nehmen eine Notausweiche. Die Rastplätze stehen um diese Zeit voll mit LKW.«
Der Beifahrer nickte und bediente das Navi in der Mittelkonsole.
»In etwa zwölf Kilometern«, sagte er und drehte sich zum Rücksitz. Er öffnete einen Koffer und entnahm ihm eine Polizeikelle. Er testete kurz die Beleuchtung und nickte dem Fahrer aufmunternd zu. Einige Minuten fuhren sie schweigend weiter, dann setzte der Fahrer zum Überholen an. Rechtzeitig vor der Nothaltebucht ließ der Beifahrer die Seitenscheibe hinunter und schwenkte die Kelle, während der Fahrer sukzessive die Geschwindigkeit verringerte. Aufmerksam beobachtete er im Rückspiegel, wie die Fahrerin des Pandas ebenfalls langsamer wurde und ihnen gehorsam über den Seitenstreifen in die Haltebucht folgte. Kaum war der Land Rover zum Stillstand gekommen, stiegen die beiden Männer aus und gingen betont langsam auf den Opel zu. Während der Fahrer so tat, als würde er auf einem Notizblock das Kennzeichen notieren, trat der Beifahrer an die Fahrertür. Das Fenster hatte die Frau bereits heruntergekurbelt, im Schein seiner Taschenlampe meinte der Mann zu erkennen, dass sie leicht nervös, jedoch nicht ängstlich war.
»Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben?«
»Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Ich habe mich genau an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten.«
»Ihr rechtes Rücklicht ist kaputt. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte.«
Der Mann wählte bewusst einen nicht sehr freundlichen, aber auch nicht unverschämten Ton. Die Frau nahm ihre Handtasche vom Beifahrersitz und kramte eine Weile darin herum. Schließlich fand sie ihr Portemonnaie und zückte einen rosafarbenen Euro-Führerschein, den sie dem Mann hinhielt. Während er diesen entgegennahm, versuchte Michelle Schneider, sich aus der Situation herauszureden.
»Sehen Sie, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich natürlich an eine Tankstelle gefahren und hätte eine neue Birne gekauft. Aber ich habe das nicht bemerkt und der TÜV ist gerade mal vier Monate her. Können Sie nicht…«
»Die Fahrzeugpapiere«, unterbrach der Mann, behielt den Führerschein in der Linken und streckte die Rechte Michelle entgegen.
»Die müssen wohl im Handschuhfach sein…«, stotterte sie, löste den Sicherheitsgurt und beugte sich hinüber zum Beifahrersitz.
»Stop!«
Michelle hielt inne.
»Steigen Sie bitte aus.«
Sie zögerte einen Moment, seufzte hörbar, stieg aus, schlug die Tür zu und blieb daneben stehen.
»Hören Sie, bitte, die Papiere sind im Handschuhfach und es ist doch nur ein kaputtes Rücklicht. Ich…«
»Öffnen Sie bitte den Kofferraum.«
»Den Kofferraum? Aber ich…«
»Den Kofferraum, jetzt!«
Der scharfe Ton veranlasste Michelle sich in Bewegung zu setzen und um das Auto herumzugehen. Um die Frau nicht unnötig nervös zu machen, folgte der Mann ihr in gebührendem Abstand. Ohne zu bemerken, dass beide Rücklichter rot leuchteten, öffnete sie den Kofferraumdeckel, wandte sich dem Mann wieder zu und sagte in leicht trotzigem Ton:
»Bitte schön, wie Sie wünschen.«