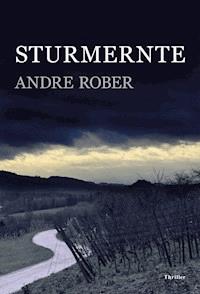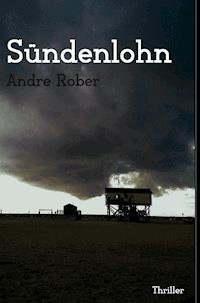
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"Sündenlohn" ist das lang erwartete Prequel zu dem Politthriller "Sturmernte" mit der Ermittlerin Sarah Hansen, die ihren letzten Fall im Norden Deutschlands zu lösen hat, bevor sie nach Freiburg im Breisgau versetzt wird. Begleiten Sie Sarah und ihre Kollegen auf der Jagd nach einem psychopathischen Serienkiller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andre Rober
Sündenlohn
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Impressum neobooks
1
Im Watt beim Tetenbüller Sielzug wird eine Leiche angeschwemmt. War es ein unvorsichtiger Wattwanderer, oder hat es Inge Westerhus mit einem Mordfall zu tun? Noch am Fundort wird der Husumer Ermittlerin klar, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Die Spuren am Leichnam der jungen Frau lassen bei der Kriminalhauptkommissarin alle Alarmglocken schrillen! Obwohl es der erste Fall dieser Art ist, liegt die Vermutung nahe, dass sie es mit einem brutalen Serienmörder zu tun hat. Bei der Lösung des Falls bittet sie ihre Kollegin Sarah Hansen aus Flensburg um Hilfe. Nur gemeinsam haben sie vielleicht eine Chance, den Täter zur Strecke zu bringen.
Andre Rober, geboren 1970 in Freiburg im Breisgau, studierte Volkswirtschaftslehre und arbeitete nach dem Abschluss mehrere Jahre für Banken im In- und Ausland. Mit der Absicht, sich beruflich zu verändern, machte er eine Ausbildung zum Business-Coach und arbeitete parallel an seinem literarischen Erstlingswerk „Sturmernte“. "Sündenlohn" ist das lang erwartete Prequel zu dem Politthriller mit der Ermittlerin Sarah Hansen, die ihren letzten Fall im Norden Deutschlands zu lösen hat, bevor sie nach Freiburg im Breisgau versetzt wird.
Andre Rober
Sündenlohn
Thriller
Ungekürzte Taschenbuchausgabe
1. Auflage März 2017
© Andre Rober, Merzhausen
Umschlaggestaltung: Andre Rober
Umschlagabbildung: Andre Rober
Satz: Andre Rober
Gesetzt aus der Palatino
Papier: Munken Print Cream
Druck: Online Druck.biz
Printed in Germany
ISBN: 978-3-947252-01-5
„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod“
(Römer 6, 23)
Vorsichtig, fast bedächtig, schob sich die kleine Strandkrabbe vorwärts, um nicht die Aufmerksamkeit einer der Möwen oder Austernfischer auf sich zu lenken, die sich bereits eingefunden hatten. Stück für Stück näherte sie sich langsam ihrem Ziel, schwenkte ihre kleinen Stielaugen wachsam, ständig bereit, sich durch einen kurzen Sprint vor einem Angriff aus der Luft in Sicherheit zu bringen. Doch die großen Vögel beachteten sie überhaupt nicht, sondern pickten in aller Ruhe nach den zahllosen Würmern und Schnecken, über die die kleine Krabbe schon hinweggekrochen war. Sie hatte ein bestimmtes Ziel. Obschon sie zum ersten Mal in ihrem bisherigen Leben solch ein riesiges Festmahl vorgefunden hatte und die Fresskonkurrenz wahrhaft groß war, steuerte sie zielstrebig über den wiechen Untergrund auf eine bestimmte Stelle zu. Dort angekommen begann sie sofort, sich über die Delikatesse herzumachen, die trotz des verlockenden Duftes bisher von dem Gewürm und den Möwen verschont geblieben war. Dass sich der Untergrund sachte mit den leichten Wellen hin- und herbewegte, störte sie nicht. Wenn eine etwas größere Woge ihren Standort überspülte, krallte sie sich kurz fest, dann setzte sie ihr Werk fort. Mit beiden Scheren hieb sie gierig in ihr Mahl und hielt nicht eher inne, bis sie den letzten Rest des Festschmauses verspeist hatte, und an dessen Stelle eine dunkle, leere Höhle verblieb.
Gedankenversunken stecktePetra Klausmann das schmutzige Taschentuch in den Beutel mit Babyutensilien. Seit vier Tagen war Luca nun schon erkältet, und sie musste ihm alle paar Minuten die laufende Nase abwischen. Trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen, an diesem schönen Frühlingstag einen kleinen Morgenspaziergang zu unternehmen. Schließlich war es ja nicht kalt, und sie hatte ihren Sohn ausreichend eingepackt, um ihn in seinem Kinderwagen mit auf den Deich zu nehmen und gemütlich am Meer entlangzuschlendern. Sie packte die Hallo-Kitty-Tasche, die sie von ihrer Schwester zur Geburt von Luca bekommen hatte, wieder in das Netz am Kinderwagen und setzte sich erneut in Bewegung. Die verbleibenden einhundert Meter bis zur Sielanlage legte sie zurück, ohne noch einmal anhalten und Luca die Nase putzen zu müssen. Dort stellte sie ihren Sohn mit Blick auf das Meer in den Schatten des Sielwerkes und setzte sich auf die graue Steinmauer daneben, um gemütlich angelehnt auf das auflaufende Wasser zu blicken. Sie genoss den leichten Wind, der ihre schwarzen Locken durchfuhr und beobachtete freudig das Spiel zweier Austernfischer und eine Schar Möwen, die sich laut krächzend um etwas zu Fressen stritten. Sie folgte ihrem Flug und entdeckte etwa 50 Meter entfernt weitere Möwen auf einem länglichen, etwa ein bis zwei Meter großen Gegenstand, der sich im flachen Wasser leicht bewegte.
Oh Nein!, dachte sie, nicht schon wieder eine Robbe. Wie schon einige Jahre zuvor waren im Frühjahr vermehrt tote Robben angespült worden, die einer zyklisch auftretenden Virusinfektion zum Opfer gefallen waren. Die Anwohner wurden aufgerufen, die Funde unverzüglich zu melden, damit die Kadaver möglichst schnell fortgeräumt und untersucht werden konnten. Sie selbst hatte dieses Jahr schon zwei tote Tiere gemeldet, und jedes Mal tat es ihr in der Seele weh, wenn sie solch ein niedliches Wesen tot, halb angefressen und zum Teil verfault vor den Füßen liegen hatte. Sie seufzte tief, ließ sich von der Mauer herab und schob Luca, so nah es möglich war, zu der Stelle, wo sich die Möwen mittlerweile heftige Kämpfe lieferten. Dann drehte sie den Kinderwagen mit dem Rücken zur Sonne, griff in die Tasche ihrer Windjacke und holte ihr Handy heraus. Die Nummer von der Schutzstation Wattenmeer hatte sie in ihren Kontakten gespeichert. Leider, dachte sie mit einem Anflug von Traurigkeit. Sie ging die paar Meter zu dem mit Fasern und Seetang umwickelten, unförmigen Kadaver, um sich zu vergewissern, dass es sich dabei tatsächlich um eine Robbe handelte. Die ersten Zweifel kamen ihr, als sie nur noch wenige Schritte entfernt war. Skeptisch trat sie etwas näher, ungeachtet dessen, dass sie knöcheltief im Wasser stand. Dann kam eine kleine Welle und drehte den Kopf des Kadavers in ihre Richtung. Unvermittelt starrte sie in ein entsetzlich zugerichtetes menschliches Gesicht, aus dessen leeren Augenhöhlen eine drekckige, ölige Brühe rann. Petras Schrei erstickte im Keim, und reflexartig fing sie ihr Handy auf, das ihr im Augenblick des Schocks aus den Fingern geglitten war.
Der Anruf erreichte Inge Westerhus während der Montagmorgenbesprechung. Seit zwei Wochen halfen sie und ihr Team, so gut es ging, bei den anderen Dezernaten aus, sofern diese überhaupt Arbeit übrig hatten. Den letzten Fall, einen wegen der Lebensversicherung als Unfall getarnten Suizid, hatten sie abgeschlossen, die Berichte und Dokumentationen lagen beim Staatsanwalt. Seither war nichts in ihrem Zuständigkeitsbereich passiert. Eine Kneipenschlägerei hier, ein Überfall mit einem Taschenmesser dort…, nichts wirklich Herausforderndes. Inge Westerhus konnte sich nicht daran erinnern, wann oder ob dies in ihrer siebenundzwanzigjährigen Karriere als Polizistin zuletzt der Fall gewesen war. Auch wenn die Abteilung Gewaltverbrechen in Husum nicht unbedingt chronisch überbeschäftigt war, so ruhig war es ihrer Meinung nach lange nicht gewesen. Gerade hatten sie in der Besprechung festgestellt, dass niemand mehr Überstunden hatte, die er hätte abbauen können, als das Telefon des Besprechungsraumes kleingelte. Der Beamte der Dienstbereitschaft setzte sie davon in Kenntnis, dass in der Nähe des Sielwerks am Wasserspeicher eine im Wasser treibende Leiche gefunden worden war. Ob es sich dabei um ein Unfallopfer, einen Freitod oder ein Gewaltverbrechen handelte, sei wohl nicht ohne weiteres zu bestimmen.
OK dachte Inge Westerhus, dann also das volle Programm: Kriminaltechnik, Leichenbeschau und natürlich auch Ermittler aus dem Team. Sie überlegte schon, wen sie zum Tetenbüller Sielzug schicken sollte, entschied dann aber, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Nicht, dass sie tatsächlich einen Kriminalfall hinter dem Leichenfund vermutete. Sie ging eher davon aus, dass ein einsamer Wattwanderer wieder unvorsichtig gewesen war, und die Umstände relativ schnell geklärt werden würden. Aber da ihre Schwiegermutter diese Woche, und so Gott wollte, auch nur diese Woche, zu Besuch war, brauchte sie wenigstens keine Notlüge aufzutischen, wenn sie wegen eines aktuellen Falles länger im Büro bleiben musste. Ein Blick auf die Uhr machte ihr die Hoffnung zwar zunichte, schließlich war es erst kurz nach halb zehn. Dennoch, entschloss sie rasch, würde der Leichenfund ihr als Vorwand dienen, nicht zum Abendessen zu erscheinen. Also winkte sie noch während des Gesprächs ihrem Assistenten Arved Munz und deutete energisch auf das Telefon in ihrer Hand. Arved, der wie die anderen schon aufgestanden war, sah sie mit gehobenen Augenbrauen fragend an.
»Arbeit«, flüsterte Inge Westerhus, die eine Hand auf dem Mikro des Schnurlostelefons, und so wartete er geduldig, während seine Chefin das Gespräch weiterführte. Bernd Hagen, die spärlichen Unterlagen peinlichst genau sortiert unter dem Arm, und Feit Müller mit dem obligatorischen Schokoriegel in der Hand und braunen Spuren um die Lippen, waren ob des wilden Winkens ihrer Vorgesetzten zunächst auch stehengeblieben. Ihnen bedeutete Inge Westerhus jedoch mit einem zielgerichteten Kopfschütteln, dass sie gehen durften. Sie glaubte nicht, dass sie noch jemanden am Fundort brauchen würde.
Als Arved Munzden silbergrauen Opel Astra Caravan mit etwas zu scharf dosiertem Bremsen auf dem Schotter gerade noch vor der Polizeiabsperrung zum Stehen brachte, war am Sielwerk die Hölle los. Der Fundort war zwar weiträumig abgesperrt, und alle paar Meter wachte ein uniformierter Beamter darüber, dass die Bannmeile auch respektiert wurde, aber außerhalb des gelben Bandes tummelten sich jede Menge Menschen. Die Landwirte, Handwerker und Servicemitarbeiter diverser ansässiger Firmen, die aus beruflichen Gründen die Abkürzung am Damm entlang nahmen, machten jedoch nur einen verschwindend geringen Teil der Menschenmenge aus, die sich hier versammelt hatte. Die überwiegende Mehrheit, und Inge Westerhus verspürte sofort Abscheu und Unverständnis, waren Touristen und Bewohner der nahegelegenen Campingplätze und Ferienunterkünfte. Junge Pärchen mit Kinderwagen oder Hunden, drahtig wirkende Jogger, Familien mit kleinen Kindern, die Schaufeln und Eimerchen noch in der Hand, Radfahrer mit ihren bei Scotty`s Bikeverleih gemieteten Rädern, oder übergewichtige Halb-Senioren mit Nordic Walking Ambitionen - nahezu aus jeder Alters- und sozialen Gruppe fand sich zumindest ein Repräsentant, um der Sensation jenseits der von der Polizei gezogenen und mitunter heftig verteidigten Linie beizuwohnen oder gar ein Foto zu machen. Noch in Gedanken gelangte Westerhus zu den Beamten, die unermüdlich auf die Menge einredeten und sie zum Weitergehen aufforderten. Sie hob zur Begrüßung die Augenbrauen, worauf einer der Uniformierten einen Schritt zu Seite trat und ihr Zugang gewährte. So wie sie sich in gebückter Haltung unter der Absperrung hindurchgeschoben hatte, sorgte ihr Kollege dafür, dass den lüsternen Gaffern der Zutritt wieder verwehrt blieb.
Inge Westerhus bedeutete Arved Munz, schon einmal zu der Stelle im seichten Wasser vorzugehen, wo einige Beamte weiße Folien gespannt hielten, um den Blick auf den Leichnam abzuschirmen. Sie selbst hatte es sich in ihrer langjährigen Dienstzeit zur Gewohnheit gemacht, erst einmal ihren Blick über die komplette Szenerie eines Tat- oder Fundortes schweifen zu lassen, bevor sie sich den Details widmete oder anfing, Fragen zu stellen. Auch wenn in diesem Fall mit Sicherheit davon auszugehen war, dass es sich nicht um einen Tatort handelte, sondern die Leiche mit der auflaufenden Flut angespült worden war und mitunter etliche Kilometer von hier ihren Tod gefunden hatte, nahm sie sich die Zeit. Doch es gab in der Tat nichts, was ihre gesteigerte Aufmerksamkeit erregte. Also folgte sie nach einigen Minuten ihrem Kollegen und schlüpfte durch die Lücke in der weißen Folie, die ihr ein uniformierter Kollege bereitwillig öffnete. Auch hier besah sich Westerhus erst einmal das komplette Bild: der nasse Sand, einige Tangreste, und inmitten eines kleinen Priels des wieder abfließenden Wassers ein unförmiger Klumpen von der Größe eines menschlichen Körpers. Davor kniete ihre Hausärztin Alice Peters, die, da Husum nicht über eine eigene Gerichtsmedizin verfügte, für die erste Leichenbeschau zuständig war. Die durch zahlreiche Kurse und Weiterbildungen für die Zusammenarbeit mit der Polizei qualifizierte Medizinerin war mit Gummistiefeln und einer Anglerhose ausgerüstet und kauerte neben dem Leichnam. In ihrem Rücken standen auf einer hastig über zwei Klappschemeln ausgebreiteten Folie zwei geöffnete Aluminiumkoffer mit den Utensilien der Ärztin. Sie war gerade dabei, über die Armenden der Leiche kleine Plastiktüten zu stülpen und mit Gummiringen zu fixieren. An den Füßen hatte sie diesen Transportschutz bereits angebracht. Inge Westerhus wusste, was das zu bedeuten hatte.
»Also kein natürlicher Tod. Jetzt schon sicher?«, fragte sie, ohne Alice Peters lange zu begrüßen. Da sie erst gestern gemeinsam zu Mittag gegessen hatten, befand sie diese Floskel im Moment für überflüssig. Ohne sich umzudrehen nickte die Angesprochene.
»Ja, jetzt schon sicher! Schau dir das mal an.«
Sie winkte die Polizistin näher zu der Leiche. Inge Westerhus trat heran. Dass der Körper schon mehrere Tage im Wasser gelegen haben musste, war auch ihr sofort klar. Die Reste der Kleidung waren schon stark verschmutzt und gräulich. Um den Körper herum hatten sich dicke Büschel Seegras und Tang in irgendetwas verfangen, das ein Seil sein konnte. Die Haut der nackten Arme und Beine hatte ebenfalls eine gräuliche Farbe angenommen und war an einigen Stellen schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das typische Aussehen einer Wasserleiche eben, kein schöner Anblick. Der einsetzende Geruch nach Verwesung sprach ebenfalls für eine längere Liegezeit. Teile des Körpers mussten schon eine ganze Weile der Luft und der Sonne ausgesetzt gewesen sein.
»Eine Frau!«, entfuhr es Inge Westerhus.
»Kannst du schon etwas zur Todesursache sagen?«
Peters schüttelte den Kopf.
»Nein. Aber sie ist, wie ich schon sagte, keines natürlichen Todes gestorben, soviel ist sicher.«
»Du meinst das Seil?«, fragte Inge Westerhus.
»Das und Folgendes.«
Sie hob einen Arm der Toten an. Trotz der beginnenden Verwesung und den Spuren, die wohl Seevögel und anderes Getier an dem Leichnam hinterlassen hatten, war um das Handgelenk eine breite, tief violette Verfärbung zu erkennen. Eindeutig Spuren einer groben und länger andauernden Fesselung.
Inge Westerhus verzog das Gesicht.
»Was hat man dir nur angetan?«, entfuhr es ihr kopfschüttelnd.
»Du findest das schon schlimm? Dann pass mal auf.«
Peters drehte den Kopf so, dass Inge Westerhus die Reste des Gesichts sehen konnte. Sofort zog es der Polizistin eiskalt durch alle Glieder. Auch wenn die Augäpfel nicht mehr vorhanden waren und auch erste Teile der Lippen offensichtlich den gierigen Würmern, Schnecken und Vögeln zum Mahl gedient hatten, konnte sie genau erkennen, was die Pathologin meinte: Vor den Augen und dem Mund war etwas, das aussah wie ein kleines Gitter, das dort platziert worden war. Doch auf den zweiten Blick erkannte sie, dass die Stäbchen, wie sie zuerst annahm, nicht parallel sondern in leichtem Zickzack verliefen. Es wurde ihr schlagartig klar, dass der Peiniger der Frau mit einem besonders dicken Garn Augen und Mund zugenäht haben musste!
Sie schlug die Hand vor den Mund.
»Oh, mein Gott!«, sagte sie leise und beobachtete dann wortlos, wie Alice Peters auch an der linken Hand des Opfers die Plastiktüte sicherte.
Nur unbewusst nahm sie die zwei Mitarbeiter des Bestattungsinstitutes wahr, die drei Meter neben der Leiche den grauen Epoxydharzsarg in den nassen Sand stellten, einen festen Leichensack entfalteten und schweigend auf das Signal warteten, aktiv zu werden.
»Willst du nochmal alles begutachten, oder können wir sie wegschaffen?«
»Was?«
Inge Westerhus hatte Alice Peters wohl gehört, aber irgendwie war ihr die Bedeutung der an sie gerichteten Worte entgangen.
»Ob wir sie einpacken können, oder ob du noch etwas brauchst?«, wiederholte die Ärztin.
Inge Westerhus sah sich noch einmal um.
»Ist alles fotografiert?«, fragte sie.
»Arved hat schon alles dokumentiert, noch bevor ich angefangen habe«, nickte Peters.
»OK, dann könnt ihr sie einpacken.«
Sie sah schweigend zu, wie die beiden in dunkle Anzüge gekleideten Männer den Leichensack neben den toten Körper legten, sich feste Gummihandschuhe überstreiften und die Frau vorsichtig in das dicke Plastik packten, nicht ohne die Liegestelle noch einmal genau abzusuchen, um gegebenenfalls verwertbares Material der Spurensicherung zu übergeben. Erst als der Reißverschluss zugezogen, das schwere Bündel in den Sarg gelegt und dieser von den beiden Männern davongetragen worden war, wandte sich Inge Westerhus um und hielt nach Arved Munz Ausschau. Ihr Kollege war mittlerweile damit beschäftigt, eine sichtlich erschüttert wirkende junge Frau mit Kind und Buggy zu befragen und hatte ihr gegenüber eine sehr verständige Miene aufgesetzt. Sie war schon im Begriff hinüberzugehen, als ihre Aufmerksamkeit von einer lautstark geführten Diskussion auf sich gezogen wurde. Einige Meter vom Fahrweg entfernt war einer der Uniformierten damit beschäftigt, einen etwa fünfzig Jahre alten Mann unter dessen heftigem Protest wieder aus dem abgesperrten Bereich zu bugsieren. Dabei fielen lautstark Worte wie Pressefreiheit oder Recht auf Information. Inge Westerhus schüttelte den Kopf, obwohl innerlich leicht belustigt, und bedeutete Arved Munz durch eine Geste, schon einmal zum Auto zu gehen. Sie selbst steuerte das streitende Duo an, das die Absperrung wieder erreicht hatte, und rief just in dem Moment, in dem sich der hartnäckige Eindringling zum wiederholten Male losgerissen hatte, laut:
»Klaus! Lass gut sein!«
Einmal noch stieß der angesprochene Beamte den Störenfried, der gleich zwei Spiegelreflexkameras um den Hals hängen hatte, zurück, trat dann von ihm weg und hob seine Hand zum Gruß kurz an die Mütze.
»Moin, Frau Hauptkommissarin!«, nuschelte er und behielt den jetzt stillstehenden Mann weiter im Auge.
»Er war schon fast bis an den Fundort herangekommen und hat wie wild drauflosgeknipst. Er…«
»Schon gut, Klaus, ich übernehme hier! Danke einstweilen.«
Sie stellte sich vor den Mann, der ihren Blicken immer wieder auswich, und stemmte die Hände streng in die Hüfte. Warum Arndt Aasman den uniformierten Kollegen nie Folge leistete, vor ihr aber einen ziemlichen Respekt zu haben schien, fragte sie sich, seit der leicht retardierte Endvierziger zum ersten Mal bei einem ihrer Tatorte aufgetaucht war und mit dem Presseausweis des Lokalblattes herumgewedelt hatte. Arndt Aasman war im Alter von siebzehn zum Waisen geworden und hatte mit einundzwanzig das Erbe, ein kleines Häuschen und eine nicht unbeträchtliche Summe an Bargeld, ausgezahlt bekommen. Er war, damals schon stark zurückgeblieben und verhaltensauffällig, seither zu einer kleinen Lokalberühmtheit geworden. Den Presseausweis hatte der arbeitslose Mann eher aus Mitleid bekommen, und seither fuhr er mit seiner Schwalbe und seinen Kameras um den Hals durch die Gegend und fotografierte alles, was in irgendeiner Art für ihn interessant war. Und tatsächlich war alle zwei bis drei Wochen eine seiner Aufnahmen in der Zeitung zu sehen.
»Herr Aasman, Herr Aasmann! Sie wissen doch, dass Sie das nicht dürfen! Wie oft habe ich Ihnen das gesagt?«
»Ein paarmal«, antwortete Arndt Aasmann fast schon kleinlaut und mit der Miene eines ertappten Kindes.
Er schaute ziellos umher, mied ihre Augen und blieb schließlich mit seinem Blick an seinen Fußspitzen hängen.
»Also, was tun Sie jetzt?«
»Ich bleibe hinter der Absperrung und warte bis zur Pressekonferenz.«
Der Satz war genaugenommen eine wörtliche Wiederholung ihrer Anweisung vom allerersten Zusammentreffen und klang fast wie auswendig gelernt. Seinen Blick hob er nicht.
»Sehr gut! Ich verspreche, Ihnen als Erstes mitzuteilen, wenn es etwas für die Presse gibt.«
Arndt Aasman nickte schnell mit leicht angezogenen Schultern und stellte sich brav hinter die Absperrung. Er würde, solange sie vor Ort war, keinerlei Ärger mehr machen.
Inge Westerhus drehte sich um und musste abermals den Kopf schütteln. Ob es Mitleid, Sympathie oder auch Sorge war, die sie für ihn empfand, konnte sie nicht sagen. Tatsache aber war, dass er zum festen Bestandteil von Husum gehörte und irgendwie auch aus ihrem dienstlichen Alltag nicht mehr wegzudenken war.
Nachdenklich setzte sich Inge Westerhus auf ihren Bürostuhl und legte die spärlichen Notizen der vorangegangenen Besprechung mit dem Oberstaatsanwalt vor sich auf den Schreibtisch.
Kein LKA!, gingen ihr die Worte von Heinrich Quedlin durch den Kopf. Als sie äußerte, die junge, noch nicht identifizierte Frau könne entweder einem grausamen Ritualmord zum Opfer gefallen oder aber das erste oder zumindest das einzig bisher gefundene Opfer eines psychisch gestörten Täters mit Potential für weitere Taten sein, war Quedlin zunächst nervös und verunsichert dagesessen. Es schien, als wolle er etwas derart Schreckliches in seinem Zuständigkeitsbereich nicht wahrhaben. Als er dann die behutsam vorgetragene Theorie, die auch Alice Peters in Betracht gezogen hatte, immer mehr hinterfragt hatte und dabei untypischerweise sogar fast aggressiv wurde, war Inge Westerhus klar, wie er über die Ermittlungen in diese Richtung dachte: Der Fall sollte bis auf Weiteres durch die Kräfte vor Ort bearbeitet werden. Zum einen seien ihm die Rückschlüsse zu voreilig und lediglich durch das Tatbild eines einzelnen Opfers begründet. Und außerdem sei die Hauptkommissarin schließlich in der forensischen Psychologie geschult. Er hatte natürlich Recht: Sie hatte entsprechende Kurse und Weiterbildungen im Bereich des Profiling gemacht, aber sie war die Einzige hier in Husum, die über diese eigentlich als rudimentär zu bezeichnende Ausbildung verfügte. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie bisher in ihrem Wirkungsbereich noch nicht die Gelegenheit hatte, irgendwelche praktische Erfahrung zu sammeln. Immerhin hatte Quedlin ihr zugestanden, sich Unterstützung zu suchen, soweit dadurch nicht unnötig Staub aufgewirbelt wurde.
Jemand, mit dem ich meine Theorien besprechen kann, murmelte sie halblaut und durchforstete ihr Gedächtnis nach einer Person, die nicht aus der Medizin oder Psychologie kam, sondern einen polizeilichen Hintergrund hatte.
Jemand, der bei der Erstellung von Täterprofilen, geschult war. Jemand, mit dem sie ohne Rücksicht auf ihre Schweigepflicht ihre Gedanken teilen konnte. Jemand der wie sie davon angetrieben wurde, die Wahrheit zu ergründen und den Täter auch zu verstehen. Und der nicht beim LKA arbeitete. Ihr dämmerte etwas. Ein geradezu leidenschaftliches Gespräch mit einer Kollegin kam ihr in den Sinn. Bei den letzten beiden Seminaren war sie dabei gewesen.
Wie hieß sie noch?
Eine junge Kollegin, noch in der Ausbildung, war tief in der Materie verankert. Obwohl auch Teilnehmerin, diskutierte sie unglaublich gut mit den Seminarleitern und stellte ihre Ansätze nach mühevoller Gruppenarbeit auch immer coram publico vor.
Sie war aus Kiel!
Westerhus erinnerte sich an den vorletzten Abend: Eine kleine Gruppe hatte noch bis spät in die Nacht hinein einen aufsehenerregenden Fall des FBI diskutiert. Ihre teils provokativen Annahmen, teils bestechend scharfsinnigen Analysen hatten schon tagsüber ihre Ausbilder beeindruckt und einige Seminarteilnehmer desavouiert. Im Hotel hatte sich die zum Teil hitzige Diskussion fortgesetzt. Vor ihrem inneren Auge sah Westerhus die schlanke junge Frau mit dem blonden Pferdeschwanz und den großen blauen Augen, die bei so einem jungen Menschen ruhig etwas fröhlicher hätten dreinblicken dürfen.
Diese hübsche junge Frau… Sabine, Susanne…Sarah!
Es war ihr wieder eingefallen!
Sarah Hansen!
Sarah Hansen saß im Garten des Café Sostenuto und starrte argwöhnisch auf ihr Handy. Eigentlich hätte sie ihre Mutter schon am Vormittag anrufen müssen. Sie hatte den heutigen Tag freigenommen, und Waldburg Hansen hatte das dummerweise mitbekommen. Selbstverständlich, Sarah spürte die Ungeduld ihrer Mutter auch über die Distanz, wurde eine Kontaktaufnahme in irgendeiner Form von ihr erwartet. Den Vormittag über war es Sarah gelungen, das schlechte Gewissen, welches jahrzehntelange Konditionierung stets erfolgreich aus dem Dunkel heraufbeschwor, erfolgreich zu verdrängen. Doch jetzt, da die vielen Telefonate, Internetrecherchen und Formulare, die sie erledigt und bearbeitet hatte, keine Ablenkung mehr boten, drängte sich das ungute Gefühl wieder subtil in den Vordergrund. Sie schüttelte kurz den Kopf.
Nein Mama, dachte sie, jetzt genieße ich erst ein Stück Kuchen und meinen Kaffee.
Die Kellnerin, die in der Tür zu den Gasträumen erschien und leicht humpelnd ein Tablett die Stufen zum Garten herunterbalancierte, lenkte Sarahs Aufmerksamkeit weg vom Telefon. Auf dem Tablett befand sich, das konnte Sarah auch von hier aus erkennen, eine große Latte Macchiato. Wie schon drei Male zuvor wünschte sie sich inständig, dass es diesmal ihre sei. Erst als die Kellnerin mit ihrem offensichtlichen Hüftleiden zwei Tische umrundet hatte und sich zielstrebig auf dem Weg zu Sarahs Platz befand, konnte sie sich sicher sein: endlich!
»Der Apfelkuchen kommt auch gleich. Ohne Sahne, richtig?« Sie bekam die Latte direkt vor sich hingestellt.
»Nein, es war Zwetschgenkuchen und mit Sahne!«
Auf ein Bitte verzichtete sie, da die Frage bereits mehrfach gestellt worden war, immer ohne Sahne, nur mit verschiedenen Sorten Kuchen, die das Sostenuto offensichtlich auch im Angebot hatte. Die Kellnerin nickte wild, deutete auf ihren Kopf und winkte im Weggehen ab. Sarah blickte ihr kurz nach, senkte dann den Kopf und sog den Duft des Kaffees ein. Mit geschlossenen Augen atmete sie einige Male tief durch.
Meine Zeit!
Ganz beiläufig bekam sie eine kurze Konversation am Nebentisch mit. Erst wenige Minuten zuvor hatte dort eine alte Dame in Begleitung einer Mittfünfzigerin Platz genommen. Dem Altersunterschied und dem Umgang nach handelte es sich um Mutter und Tochter. Die etwa neunzigjährige Frau blickte interessiert zu Sarahs Tisch. Dann wandte sie sich an ihre Tochter und meinte.
»Ich will meinen Kaffee auch mit zwei Strohhalmen. So wie die da drüben.«
Mit der einen Hand zerrte die Dame ihre Tochter am Ärmel, mit der anderen zeigte sie auf Sarahs Getränk.
»Das ist eine Latte Macchiato«, entgegnete die Angesprochene in aller Ruhe, »und natürlich bekommst du eine, wenn du das möchtest.«
»Nein«, insistierte die Alte. »Ich will einen Kaffee! Aber auch mit Strohhalm! Sorg bitte dafür, dass ich das bekomme.«
Sarah Hansen musste schmunzeln, als sich ihre Blicke mit denen der jüngeren Frau trafen. Sie bekam noch mit, wie der Kellnerin mit Verweis auf ihre Latte so ein Kaffee wie der dort drüben in Auftrag gegeben wurde, dann widmete sie sich wieder ihrem eigenen Glas. Doch bevor sie an dem Strohhalm nippen konnte, begann ihr Handy zu vibrieren und sich langsam in Richtung der Tischkante vorzuarbeiten.
Nein Mutter, nicht jetzt dachte sie und war kurz davor, den Anruf einfach wegzudrücken. Doch die Nummer im Display war nicht die ihrer Mutter, sondern kam eindeutig aus der Polizeidirektion Flensburg. Das Dezernat für Kapitalverbrechen konnte Sarah noch aus der Nummer herauslesen, die Durchwahlen jedoch wurden einheitlich mit „0“ weitergegeben.
Ihr freier Tag! Aber dann musste es wohl wichtig sein. Sie seufzte, fing das Handy geschickt neben der Tischkante auf und nahm das Gespräch entgegen.
Als das Mädchen an der Ampel stehen blieb und sich verstohlen nach rechts und links umblickte, um möglicherweise doch noch schnell bei Rot die Fahrbahn zu kreuzen, konnte er das erste Mal ihr Gesicht sehen. Sein Atem ging schneller. Auch spürte er, wie sein Puls sich merklich beschleunigte.
Sie war es! Sie musste es einfach sein! Sofort senkte er den Blick und drehte sich weg, hin zu dem Schaufenster, an dem er gerade vorbeigegangen war. Sie durfte ihn nicht sehen! Seit sie ihm wegen ihrer schlanken Beine und Arme und den kurzen braunen Haaren aufgefallen war, hatte er sie nur von hinten gesehen. Vor ungefähr fünfzehn Minuten war das gewesen, und von diesem Moment an war er ihr nachgegangen. Durch die komplette Fußgängerzoneblieb er in ihrer Nähe und konnte den Blick nicht von ihrem Rücken lassen, von den Haaren, die mit ihrem Schritt leicht wogten, von der leicht gebräunten Haut ihrer Arme. Es war ihm leicht gefallen, mit den Touristen zu verschmelzen und ihr so unentdeckt zu folgen. Erst als sie den Innenstadtbereich verlassen hatte und weniger Menschen zu Fuß unterwegs waren, musste er etwas mehr Abstand wahren, um nicht aufzufallen. Ohne sich ganz umzudrehen schielte er in ihre Richtung. Sie hatte sich mit einer Hand an den Ampelmast gestützt und einen Fuß auf die Zehen gestellt. Das angewinkelte Knie bewegte sie ungeduldig hin und her. Er starrte auf das weiße T-Shirt, unter dem sich leicht ihre kleinen Brüste abzeichneten, auf die schmale Röhrenjeans, die einen eher knabenhaften Po erkennen ließ und etwa zwanzig Zentimeter über ihren Fesseln endete, auf die rot gepunkteten Ballerinas, die sie barfuß zu tragen schien. Noch während er ihren Körper, ihre Bewegungen studierte, begann es. Sein Kopf fing an, leicht hin- und herzuzucken, sein Kiefer begann, sich zu verkrampfen, und seine Knie drohten ihm wegzuknicken. Sofort wandte er sein Gesicht ab, kniff die Augen gewaltsam zu und widerstand dem Drang, die Arme zu heben und sich die Ohren zuzuhalten. Er atmete nun so schnell, dass es einem Hecheln gleichkam. Vor seinem inneren Auge sah er nur bunte Muster, psychedelische Bilder wabernder, bewegender Formen. Doch bevor er das Gleichgewicht verlor, machte er einen ersten tiefen Atemzug. Es folgte ein zweiter. Und noch ein dritter. Nach wenigen Sekunden hatte er sich wieder unter Kontrolle, seine Beine stützten ihn, sein Kiefer entkrampfte, und er konnte die Augen wieder öffnen. Ängstlich sah er sich um. Niemand schien den kurzen Anfall bemerkt zu haben. Dann blickte er - fast schon panisch - in ihre Richtung. Die Ampel war grün geworden, und sie hatte sich wieder in Bewegung gesetzt. Bis er aus seiner Starre herauskam und ihr schnellen Schrittes hinterherstürzen konnte, hatte sie bereits die Straße scchon überquert.
Ich darf sie nicht aus den Augen verlieren!
Als sie beherzt zu einem Bus spurtete, der unmittelbar nachdem sie sich über das Trittbrett geschwungen hatte, die Türen schloss und losfuhr, ergriff ihn blanke Angst! Er warf alle Vorsicht über Bord und rannte aus voller Kraft hinter dem Bus her.
Nein, das darf nicht sein!
Doch er besann sich, wurde langsamer und blieb stehen. Er kniff die Augen zusammen und sah angestrengt dem kleiner werdenden Bus hinterher. Linie Drei. Er atmete einige Male tief durch und lächelte. Dann drehte er sich um und kehrte gemächlichen Schrittes zur Haltestelle zurück, um den Fahrplan genau zu studieren.
Ungeduldig lauschte Inge Westerhus dem Tuten in der Leitung. Das Gespräch mit dem Dezernatsleiter der Polizeidirektion in Flensburg, wo die junge Kollegin derzeit arbeitete, war so unerwartet positiv verlaufen, dass sie es jetzt kaum erwarten konnte, mit Sarah Hansen persönlich zu sprechen. Sie hatte sich im Vorfeld große Sorgen gemacht, ob und wie es ihr überhaupt gelingen konnte, die junge Kollegin zu dem Fall hier auf dem Lande hinzuzuziehen. Doch was ihr Peter Haberstroh mitteilte, hatte sie augenblicklich in eine bessere Stimmung versetzt. Offensichtlich strebte Frau Hansen derzeit ziemlich hartnäckig eine Versetzung in den Süden der Republik an, und da dem Antrag höchstwahrscheinlich relativ kurzfristig stattgegeben werden sollte, war es für Haberstroh leichter gewesen, Sarah Hansen von ihren Aufgaben in Flensburg freizustellen und sie den Ermittlungen in Husum zuzuweisen. Frau Hansens Einverständnis vorausgesetzt, man wolle ihr, da sie ihre letzten Wochen vor sich hatte, keine vermeidbaren Unannehmlichkeiten bereiten. Also hatte Inge Westerhus den Rückruf brav abgewartet und nun, spät am Abend, da sie das OK seitens der Dienststelle und Frau Hansens Handynummer übermittelt bekommen hatte, gleich zum Hörer gegriffen.
»Sarah Hansen?«
Das Gespräch dauerte nur wenige Minuten. Erfreut stellte Inge Westerhus fest, dass ihre Kollegin während der Jahre nichts von ihrem Elan eingebüßt hatte. Schon nach wenigen Details, die Inge Westerhus ihr zu dem Fall nannte, war Sarah Hansen Feuer und Flamme und hatte ihr Kommen für den übernächsten Abend zugesagt. Westerhus` Angebot, für die Zeit der Ermittlungen bei ihr im reetgedeckten Haus im Püttenweg direkt hinter dem Deich zu wohnen, hatte sie auch dankend angenommen.
Als nächstes rief Inge Westerhus ihren Mann an, um ihm und ihren beiden Kindern Marie-Claire und Lars mitzuteilen, dass eine junge Kollegin auf unbestimmte Zeit bei ihnen einziehen werde. Sie verband mit dieser aufrichtig als Hilfe für Sarah Hansen gedachten Aktion auch die Hoffnung, die neuen Umstände würden dem Besuch ihrer Schwiegermutter ein vorzeitiges Ende bescheren. Zwingend war das nicht, Zimmer gab es in dem Haus mehr als genug. Trotzdem würde eine fremde Person im intimen Umfeld möglicherweise Isolde Westerhus` Gefüge derart erschüttern, dass sie es vorzog, sich dem zu entziehen. Und wenn sich Peters Mutter durch Frau Hansens bloße Anwesenheit oder subtile Andeutungen nicht zur Abreise bewegen lassen sollte, würde Inge beim ersten Abendessen das Gespräch auf den Fall lenken: Ihr Mann Peter wäre interessiert und engagiert dabei, und ihre Schwiegermutter war so zart besaitet, dass ihr ein Verbleib am Tisch, besser noch im Haus, unmöglich sein würde. Vorteil Inge Westerhus, dachte die passionierte Tennisspielerin verschmitzt. Sie erwog sogar, zur Not Alice Peters zu einem weiteren Abendessen einzuladen, mit ihrer ungebremsten Art ein Übriges zu ihrem perfiden Plan beisteuern würde.
Flexible Response am Familienkriegsschauplatz, fuhr es Inge Westerhus unter einem weiteren Lächeln durch den Kopf. Zum Schluss schrieb sie noch eine Mail an die IT-Abteilung, die Kollegen mögen doch bitte im Laufe des morgigen Tages auf der gegenüberliegenden Seite ihres Schreibtisches einen der alten PCs installieren, einen Zugang zum lokalen Netz einrichten und ein Telefon aufbauen. Die Mail schickte sie Arved Munz, Feit Müller und Bernd Hagen in Kopie, damit sie gleich morgen Vormittag zumindest formal vom Eintreffen der jungen Kollegin unterrichtet waren. Sie selbst würde ihren Arbeitstag mit Alice Peters in der Gerichtsmedizin in Kiel beginnen, um sich von Professor Doktor Herrmann über die Ergebnisse der Obduktion genauestens unterrichten zu lassen. Sie blickte auf die Uhr: Viertel nach acht! Das war nicht spät genug, um ihrer Schwiegermutter nach deren allabendlichen Averna nicht mehr über den Weg zu laufen, aber zumindest würde sie ihr Abendessen in der Gesellschaft ihres pflichtbewussten Sohnes und der ihrer beiden Enkel, so sie sich denn rechtzeitig zuhause eingefunden hatten, bereits zu sich genommen haben. Inge Westerhus fuhr ihren PC runter, packte ihre Tasche und verließ ohne Eile das Polizeirevier.
»Von dir hört man ja gar nichts mehr!«
Sarah musste alle Beherrschung aufbringen, nicht gleich auf dem Absatz kehrtzumachen, sondern lächelnd ihre Mutter in den Arm zu nehmen und ihr rechts und links ein flüchtiges Küsschen auf die Wange zu drücken. Ein verärgertes Verdrehen der Augen ließ sie sich jedoch nicht nehmen, es war jedoch nur für sie selbst gedacht, achtete sie doch peinlich genau darauf, dass es Waldburg Hansen nicht mitbekam. Da sie diesen Satz immer vor einer Begrüßung entgegengeschleudert bekam, egal ob sie drei Wochen auf Fortbildung gewesen war, oder sie noch am Vortag telefoniert hatten, war Sarah ziemlich abgestumpft. Auch wenn der beleidigte Tonfall über die letzten Jahre fordernder, härter geworden war, konnte sie immer besser mit dem Opferspiel ihrer Mutter umgehen. Sie hatte verschiedene Strategien ausprobiert. Anfangs war sie noch in die Rechtfertigung verfallen, später hatte sie angriffslustig den Ball zurückgegeben, dann versucht, verständnisvoll auf ihre Mutter einzugehen. Mit der Zeit hatte sich ziemlich klar herauskristallisiert, dass die wirkungsvollste Maßnahme schlicht war, solch unterschwellige Angriffe komplett zu ignorieren.
»Hallo Mama, gut siehst du aus! Du warst beim Friseur, richtig?«
Heute war Waldburg Hansen hartnäckiger. Sie sah auf die Uhr.
»Jetzt ist es schon nach acht, den ganzen Tag habe ich mich gefragt, wann du dich wohl melden wirst!«
Und, um Sarah wirklich aus der Reserve zu locken, setzte sie noch „wo du doch den ganzen Tag Zeit hattest“, hinzu.
Gerade noch konnte Sarah das: Ja, aber ich hatte furchtbar viel zu tun hinunterschlucken, das sie wieder in die Defensive gedrängt hätte und konterte statt dessen in lockerem Ton mit einem
„Aber jetzt bin ich ja da!“
Innerlich war sie aber keinesfalls so selbstsicher wie es ihre unermüdlich eingeübten Antwortsätze vermuten ließen.
»Ich habe dir einiges zu erzählen.«
Ihre Mutter musterte sie argwöhnisch. Ihr prüfender Blick war von einer solchen Intensität, dass Sarah schon wieder drohte, in ihre alten Verhaltensmuster zu verfallen. Sie hielt dem aber stand und schaffte es sogar, das aufgesetzte Lächeln weiter glaubhaft zur Schau zu stellen. Allerdings merkte sie, wie ihr innerlich schlagartig heiß wurde, eine Schweißperle im Nacken den Weg unter ihre Bluse fand und langsam den Rücken hinunterrann. Sie nutzte den Moment, um hinter sich zu greifen und aus dem auf dem Boden abgestellten Einkaufskorb den in Papier eingeschlagenen Blumenstrauß zu nehmen und ihn ihrer Mutter zu überreichen.
»Für dich«, sagte sie nur und hatte einige Sekunden gewonnen, in denen ihre Mutter ihre Aufmerksamkeit auf das Gebinde richtete. Das reichte, um einmal tief durchzuatmen und sich innerlich wieder Stütze zu verschaffen.
»Danke, aber das wäre doch nicht nötig gewesen.«
Sarah verabscheute solche Floskeln, fehlte ihnen doch jegliche Wärme und Authentizität.
»Aber Mama, natürlich bringe ich dir Blumen mit, ich weiß doch, wie sehr du Papageientulpen liebst.«
Waldburg Hansen erwiderte nichts, sondern steuerte durch die monumentale Halle in Richtung der Küche, die einem noblen Restaurant alle Ehre gemacht hätte. Sarah folgte ihr und fühlte sich wie immer von den schweren Teppichen, dem dunklen Mobiliar und den hohen Decken fast erschlagen. Die üppige Ausstattung mit Ölgemälden in barocken, goldenen Holzrahmen, die Lüster an der Decke und die beiden brusthohen Vasen, die die Doppelflügeltür zum Wohnraum flankierten, all das drückte auf ihr Gemüt. Auch in der Küche, die von einem zentralen gusseisernen Herd mit gigantischer Abzugshaube dominiert wurde, besserte sich ihre Stimmung nicht. Auch wenn die Kochinsel seit sie denken konnte nicht mehr in Betrieb war, und ihre Mutter mittlerweile sogar auf Induktion kochte, war die zweihundert Jahre alte Küchenausstattung des Herrenhauses praktisch unverändert geblieben und hatte den Charme eines Burgverlieses. Innerlich schüttelte sich Sarah. Wie sie trotz dieser Umgebung ihre Liebe zum Kochen entwickeln konnte, war ihr stets ein Rätsel geblieben. Trotzdem bezeichnete sie sich als leidenschaftliche und – so viel Stolz durfte sein – als exzellente Köchin. Ihre Menüs und Kreationen wurden, so selten sie dazu kam, Freunde zu aufwändig vorbereiteten Festessen einzuladen, stets in den Himmel gelobt. Und die Anerkennung tat ihr jedes Mal gut.
Sarah beobachtete ihre Mutter, wie sie schweigend jeden einzelnen Stängel der Tulpen penibel anschnitt und den Strauß in einer mit Jagdmotiven verzierten Zinnvase mit Henkel neu arrangierte. Als das recht grotesk wirkende Ensemble ihren Ansprüchen zu genügen schien, drückte sie es Sarah in die Hand.
»Wollen wir in den Wintergarten gehen? Dort ist es um diese Zeit am schönsten.»
Sarah nickte und ließ ihrer Mutter den Vortritt, die forschen Schrittes die Küche auf dem Weg zum Speisezimmer verließ.
2
Da war sie!Also hatte sich das Warten gelohnt! Er hatte nicht damit gerechnet, sie heute, wo er sie doch am Vormittag gesehen hatte, noch einmal an der Bushaltestelle anzutreffen. Aber offensichtlich war sie am Mittag zurück in die Stadt gekommen und befand sich - es war mittlerweile dunkel - wieder auf dem Nachhauseweg. Sie hatte dieselben Kleider an wie vor einigen Stunden und wieder beobachtete er genau, wie sie sich bewegte, die unbekümmerte, fast kindliche Art, wie sie ihre Arme schlenkerte. Wie sie ihre Schritte wie im Tanz setzte und sie ausgelassen und, ohne auf die anderen Leute zu achten, den Kopf zu dem Rhythmus aus ihren Ohrhörern hin- und herbewegte und dabei stumm den Liedtext mit den Lippen mitsang. So nah war er ihr heute Morgen nicht gekommen. Er selbst saß auf einem der verzinkten Stühle der überdachten Bushaltestelle, wo in Kürze ein Bus der Linie drei ankommen und die hier wartenden Menschen auf dem Weg nach Hause mitnehmen würde. Sie kam über die Straße direkt auf ihn zu, und wieder folgte er ihr mit seinem Blick aufs Genaueste. Aus einer unverfänglichen Kopfhaltung schielte er zu ihr, immer darauf gefasst, dass sich ihre Blicke treffen könnten und er dann schnell woanders hinsehen musste. Doch sie war so vertieft in ihre Musik und ihre Gedanken, dass diese Gefahr nicht bestand. Jetzt erreichte sie die Bushaltestelle, schaute auf ihre Armbanduhr und blickte sich um. Obwohl etwa acht Leute ebenfalls auf den Bus warteten, war der Sitz zu seiner Rechten nicht belegt. Ob sie sich dort hinsetzen würde? Innerlich spannte er sich an und hoffte, dass sie die paar Schritte in seine Richtung machen würde, um sich neben ihm niederzulassen. Dann wäre sie in Berührweite. Nicht, dass er es gewagt hätte, sie in irgendeiner Form anzufassen, auch eine scheinbar zufällige Berührung wollte er auf keinen Fall riskieren. Aber für ihn bedeutete die physische Nähe eine ungeheure Intimität, fast, als würden sich ihre Auren überlagern. Er würde den Luftzug spüren, den sie beim Hinsetzen verursachte, er würde hören, wie beim Umdrehen ihre Schuhsohlen leise über die Betonplatten scheuerten, vielleicht würde er sogar ihren Körpergeruch oder ihr Parfüm riechen können. Doch es kam anders. Sie lief zwar noch ein paar Schritte auf ihn zu, lehnte sich jedoch an die Stahlstrebe des Haltehäuschens und stellte, wie am Morgen an der Ampel, einen Fuß auf die Zehenspitzen und wiegte mit dem Bein im Takt der für ihn und die anderen Menschen unhörbaren Musik.
Er starrte vor sich auf den Boden. Seine Augen so weit nach rechts zu verdrehen konnte zu leicht von den Umstehenden gesehen werden. Außerdem, die Erfahrung hatte er schon mehrfach gemacht, erhöhte die extreme Augenstellung einen der, Gott sei Dank, selten gewordenen Krampfanfälle. Also beobachtete er zwischen seinen Schuhen, wie sich ein paar Ameisen fleißig an einem für sie gigantischen Stückchen Brot zu schaffen machten, Stück für Stück abtrennten und mit ihrer Last zwischen den Fugen der Betonplatten verschwanden. Obwohl sie nur in der Lage waren, verhältnismäßig kleine Bröckchen aufs Mal wegzutransportieren, war, als nach wenigen Minuten die Motorbremse des eintreffenden Busses zu hören war, fast das gesamte Stück Brot im Erdboden verschwunden.
Er hob den Kopf.
Linie drei.
Sie machte sich bereit einzusteigen. Folglich erhob auch er sich bemüht lässig, ließ den meisten der Mitwartenden den Vortritt und stieg dann durch die hintere Tür in den Bus ein. Er wandte sich nach links in der Hoffnung, dort noch einen Platz vorzufinden, denn nur, wenn er hinter der letzten Tür saß, konnte er, ohne sich verdächtig zu verhalten, überwachen, wo sie ausstieg. Er hatte Glück. In der letzten Reihe, wo sich normalerweise immer ein Haufen Jugendlicher lautstark breitmachte, saß niemand. Also wählte er den Platz links außen, so konnte er alle drei Türen bestens einsehen. Als auch der letzte Fahrgast Platz genommen hatte – der Bus war nur gut zu einem Drittel gefüllt – versuchte er, sie zu erspähen. Er ließ den Blick schweifen und fand sie relativ zügig. Sie saß direkt hinter der mittleren Tür mit dem Rücken zu ihm und bewegte immer noch ihren Kopf im Takt.
»Was wolltest du mir denn jetzt so Wichtiges erzählen? Hast du dich doch dazu entschlossen, etwas zu tun, was deiner Intelligenz und deiner Erziehung mehr entspricht, als eine kleine Beamtin bei der Polizei?«
Der Augenblick war gekommen, wo Sarah Hansen ihrer Mutter reinen Wein einschenken musste. Ob sie wollte oder nicht, durch diese Konfrontation mussten sie beide durch. Bevor sie ansetzen konnte, ihrer Mutter von der bevorstehenden Versetzung zu berichten, brachte ihr Gegenüber die immer wieder und wieder aufs Neue geführte Diskussion über Sarahs Beruf auf den Tisch.
»Wie oft habe ich dir gesagt, dass solch ein Beruf nicht gut für dich ist! Seine Zeit mit Halunken, Schlägern, Mördern und Prostituierten zu verbringen, ist nichts für eine junge Frau aus so gutem Hause, wie du eine bist.« Waldburg Hansen stellte den gut gefüllten Schwenker mit Armagnac auf das Beistelltischchen neben ihrem Fauteuil und beugte sich mit übertriebener Gestik nach vorne.
»Für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften ist es noch nicht zu spät! Du weißt, ich habe immer noch Kontakte in höchste Kreise. Es wäre kein Problem, dich in einer herausragenden Position in einem namhaften Unternehmen unterzubringen!«
Noch vor wenigen Jahren hätte sich Sarah zu diesem Zeitpunkt den Beistand ihres zu damals schon verstorbenen Vaters gewünscht. So wie damals musste sie hier aber alleine bestehen und die langwierige Therapie, mit der sie ihre Mutter-Tochter-Beziehung zuerst analysiert und dann aufgearbeitet hatte, gab ihr jetzt den nötigen Rückhalt.
»Mama, das hatten wir doch schon so oft. Du weißt doch, dass BWL oder VWL nun mal nichts für mich ist. Ich…«
»Nein, Kind, du weißt einfach nicht, was gut für dich ist und was nicht! Und ihren Kindern das beizubringen, dafür sind Eltern ja nun mal da!«
Sie hob kurz den Zeigefinger, lehnte sich dann wieder zurück und nahm einen ausgiebigen Schluck von dem Armagnac.
»Dein Vater hätte auch gewollt, dass du etwas Ordentliches machst. Ein richtiges Studium, das zu einem anständigen Beruf führt. Polizistin! Was für einen Ruf haben denn Frauen, die als Polizistinnen arbeiten?«
Dass ihre Mutter am heutigen Abend nicht in die Rolle der sorgenvollen, vor Angst um ihre Tochter leidgequälten Mutter schlüpfen würde, hatte Sarah schon bei der Begrüßung gemerkt. Heute war also die strenge, um Ansehen und Ruf bemühte Waldburg Hansen ihr Gegner in der Diskussion und so, wie sie ihren letzten Satz betont hatte, würde auch die du-beschmutzt-das-Ansehen-deines-Vaters-Karte rücksichtslos ausgespielt werden. In welcher Rolle sich ihre Mutter am Ende der Diskussion befinden würde, war sich Sarah noch nicht sicher, aber eines war klar: Beide würden verletzt sein, sie würden sich wieder ein Stück, wahrscheinlich ein sehr großes Stück, voneinander entfernen. Ob es zum Bruch kommen würde, vermochte Sarah zu diesem Zeitpunkt nicht zu sagen, aber sie war entschlossen, auch das zu riskieren.
»So? Mama, erkläre mir bitte mal, welchen Ruf Polizistinnen, so wie ich eine bin, denn haben.«
Natürlich hätte sie gleich auf den Punkt kommen können, ihre Mutter mit ihrer Entscheidung konfrontieren und dann, abhängig von ihrer Reaktion, darüber diskutieren oder einfach aufstehen und das Haus verlassen können. Aber sie fühlte sich von der gereizten Art Waldburg Hansens so provoziert, dass sie – und so stark war sie im Moment – ruhig auch ein wenig gegenprovozieren konnte.
»Nun, das… das… das weißt du doch!«, schnaubte ihre Mutter zurück. »Jeder weiß das!«
»Ich nicht«, entgegnete Sarah unschuldig und schwieg beharrlich.
Erstaunlicherweise ließ ihre Mutter das Thema Ruf und Ansehen schnell fallen und versuchte es auf einem anderen Kanal.
»Ein junger Mensch mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Bildung muss einfach etwas aus sich machen. Stell dir vor, was du als Ökonom in einer Bank alles bewegen könntest. Du vergeudest dein Potenzial.«
Die Antwort Aber ich tu das nicht mit übermäßigem Alkoholgenuss schluckte Sarah schon im Ansatz hinunter. Die Wunde war zu groß, um sie wieder aufzureißen. Aber sie blieb angriffslustig.
»Da bewege ich doch lediglich Unsummen von Geld, meinen Hintern nicht vom Bürostuhl und das Ganze nur zum Vorteil der Bank. Abends könnte ich wahrscheinlich nicht mehr guten Gewissens in den Spiegel schauen.«
»Jaja, du willst mit Menschen zu tun haben und bist wohl geradezu versessen auf die, die auf die schiefe Bahn geraten sind.«
Waldburg Hansens Tonfall war so abwertend, dass Sarah Hansen innerlich getroffen war. Doch ihre Mutter war noch nicht fertig.
»Wenn das dein innigster Wunsch ist, dann wäre ein Jurastudium die richtige Wahl. Als Anwältin in der Kanzlei von Dr. Klöbner zum Beispiel. Oder meinetwegen auch bei der Staatsanwaltschaft. Kind, mach etwas aus deinen Talenten!«
Bevor Sarah ihre Erziehung, die Reit- und Ballettstunden, die Segelausbildung, überhaupt alles, was in sie investiert worden war, zum x-ten Male vorgehalten wurde, hob sie ziemlich energisch die Hand und sagte mit leicht erhobener Stimme:
»Mama, ich bin Polizistin und das werde ich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Und genau darüber möchte ich mit dir heute Abend sprechen: Ich werde in etwa drei Wochen versetzt, und zwar sehr weit weg.«
Nun war es raus. Und an der selbstmitleidsvollen Miene, die ihre Mutter unmittelbar nach dem zuerst kurz schockierten und dann verärgerten Blick aufsetzte, erkannte Sarah, für welche Rolle sich ihre Mutter entschieden hatte.
Während der ganzen Fahrt hatte er sie nicht aus den Augen gelassen. Er war konzentriert darauf, wo sich der Bus gerade befand, darauf, wie die Gegebenheiten an der nächsten Haltestelle waren, darauf, ob die Menschen um ihn herum sein gesteigertes Interesse an ihr vielleicht bemerken könnten. Zu konzentriert, um sich den Fantasien hinzugeben, die er sonst üblicherweise aussann. Fantasien, in denen er sich ihr unbemerkt näherte, ihr zärtlich den Nacken streichelte oder im Vorbeigehen mit seiner Hand die ihre streifte. Fantasien, in denen er den Mut aufbrachte, sich an den Vierersitz zu ihr zu setzen, ihr ins Gesicht zu lächeln und es zu genießen, wenn sich ihre Knie während der Fahrt sacht berührten und ihn in jedes Mal Ströme von Glücksgefühlen durchfluteten.
Jetzt aber nahm er sich selbst kaum wahr. Außer dem leichten Druck im Kopf, den er immer verspürte, wenn er körperlich oder geistig angestrengt war, fühlte er nur Leere.
In diesem Moment nahm sie die Hand vom Schoß, erhob sich halb vom Sitz und beugte sich weit nach vorne. Sein Atem beschleunigte sich minimal, als sie den schlanken Arm mit der leicht gebräunten Haut, die er so gerne berühren, streicheln wollte, anhob und mit der kleinen, grazilen Hand zu dem Haltewunsch-Knopf griff und mit ihren langen Fingern dreimal in schneller Folge darauf drückte. Dann sank sie wieder zurück in den Sitz, schüttelte kurz den Kopf in beide Richtungen und strich sich das kurze braune Haar wieder hinter die Ohren.
Er löste seinen Blick von ihr, sah auf die Anzeige der kommenden Haltestelle und begann, sich die Landschaft, die voraus lag, aufs Genaueste einzuprägen, so gut dies im Dunkeln möglich war. Als der Bus schließlich mehr oder weniger auf freier Strecke zum Stehen kam, war sie die Einzige, die aufstand, sich um die Haltestütze schwang und den Bus verließ. Noch ehe sich das Fahrzeug wieder in Bewegung setzte, war sie hinter dem Heck herumgegangen und stand jetzt, nur durch die Fensterscheibe und die Rückenlehne von ihm getrennt, keinen halben Meter hinter ihm. Sie blickte kurz nach links und rechts, lief dann schnellen Schrittes über die halbdunkle Straße und steuerte einen unbeleuchteten Feldweg an, der im rechten Winkel abzweigte und sich im Schwarz der Nacht verlor. Erst in etwa zwei Kilometern konnte er die Lichter von einem Haus erkennen. Entspannt lehnte er sich zurück und stieg erst an der Endstation aus.
»Was bedeutet das, weit weg?«, fragte Sarahs Mutter in leicht weinerlichem Ton. »Du bist doch schon weit weg. Flensburg! Musstest ja unbedingt fort von Kiel.«
»Mama, ich rede nicht von einer Stunde Fahrt.« Die Diskussion vor eineinhalb Jahren war ihr noch gut im Gedächtnis. Das vorwurfsvolle Gesicht, das ihre Mutter damals gemacht hatte, als klar wurde, Sarah würde keinesfalls jeden Morgen und jeden Abend eine Stunde Fahrt auf sich nehmen, war auch jetzt wieder zu erkennen. Dennoch: Die Entscheidung, auszuziehen und sich direkt an der dänischen Grenze eine Bleibe zu suchen, also die größtmögliche Entfernung zwischen sich und ihre Mutter zu legen, hatte sie zu keiner Sekunde bereut.
»Es ist richtig weit weg. Ich werde nicht spontan zu einem Abendessen bei dir vorbeischauen können. Selbst ein Wochenendbesuch wird schon aufwändig.«
Mit leerem Blick sah Waldburg Hansen ihr in die Augen.
»Aber Kind, das geht doch nicht! Wie kannst du mich nur alleine hierlassen? Du bist doch alles, was ich habe!«
Die typische Reaktion ihrer geradezu verabscheuungswürdig egozentrischen Mutter. Wie sehr hätte sich Sarah gewünscht, dass sie nachgefragt hätte, wo sie denn hinginge, was es für eine Stelle sei, welche Aufgaben und Herausforderungen sie erwarteten… nein, Waldburg Hansen dachte wie immer nur an sich und an ihr Leid, das mit dem Wegzug – wohin auch immer – über sie hereinzubrechen drohte. Obwohl Sarah dieses Verhalten schon, seitdem sie denken konnte, gewohnt war, traf es sie. Trotzdem gelang es ihr, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten und ihrer Mutter nicht aus tiefster Seele: Wieso? Du hast doch immer noch deinen Scheißalkohol, ins Gesicht zu schreien. Sie schloss kurz die Augen, atmete tief ein und entschied sich für die rationale Taktik.
»Mama, das stimmt doch nicht. Du hast den Yachtclub, deine Bridgerunde, die Empfänge bei Freunden und nicht zuletzt den Kulturverein, alles respektable Menschen, mit denen du häufig und intensiv Kontakt hast. Außerdem liebst du das Haus und den Garten über alles. Dein Glück ist doch nicht davon abhängig, dass ich in Reichweite lebe.«
Waldburg Hansen verdrückte ein paar Tränen, von denen Sarah sich nicht sicher war, ob sie wieder Produkt des theatralischen Moments waren oder wirklich infolge bebender Emotionen in die Augen ihrer Mutter traten. Da Sarah ein bestimmtes Thema unbedingt vermeiden wollte, beschwichtigte sie ihre Mutter weiter.
»Außerdem, Mama, gibt es ja Telefon! Erinnerst du dich, was die Peeks immerzu erzählen? Seit ihre Tochter nach Australien ausgewandert ist, ist ihre Beziehung noch viel enger als zuvor! Sie telefonieren drei bis vier Mal pro Woche. Das tun wir nicht, und ich bin nur fünfundneunzig Kilometer entfernt und nicht sechzehntausend!«
Doch Sarah sah ihrer Mutter an, dass sie nicht zuhörte, sondern sich sukzessive nach innen wandte. Sie starrte mit leeren Augen an ihr vorbei und schüttelte in kleinen, ruckhaften Bewegungen den Kopf. Dabei verfiel sie in eine Stoßatmung, und das fast schluchzende Geräusch, das beim Auspressen der Luft entstand, hätte einen Unwissenden zu ehrlichem Mitleid, wenn nicht gar ernster Sorge gebracht. Sarah hingegen kannte dieses Verhalten seit jüngster Kindheit. Ihre Mutter hatte es immer dann eingesetzt, wenn sie gewahr wurde, dass Worte alleine nicht erfolgreich ihren Willen durchzusetzen vermochten. Dass sie als Kind auf die so übermittelten Botschaften ihrer Mutter immer erwartungsgemäß reagiert hatte, verwunderte Sarah nicht im Geringsten. Dass allerdings auch ihr Vater angesichts eines solchen, zugegebenermaßen perfekt inszenierten Schmierenstücks sofort in den Fürsorglichkeitsmodus schaltete und in der Regel alles tat, um seine Frau zu beruhigen, das entzog sich Sarahs Verständnis. Immerhin verzichtete Waldburg Hansen im Moment noch darauf, ihre Hand auf die Brust zu legen und über Schmerzen zu klagen, wo doch ihr Blutdruck so hoch und die Folgen für das Herz nicht abzuschätzen waren! Sarah entschied, erst einmal abzuwarten, ob sich ihre Mutter nicht auf einer verbalen Ebene an sie wenden würde und die Diskussion wie unter Erwachsenen weitergeführt werden konnte. Doch als nach einigen Minuten herzerweichendem Schluchzen vermehrt Tränen in die Augen ihrer Mutter traten, wusste Sarah, was nun kommen würde. Das Thema, das Waldburg Hansen sicher gleich anschneiden würde, war das Einzige, mit dem auch sie zutiefst getroffen werden konnte! Und so sehr sie sich gewünscht hatte, es am heutigen Abend nicht mit in die Diskussion einzubeziehen, war sie sich sicher, dass sich ihre Mutter genau dort hineinsteigerte, um mit emotionaler Authentizität ihren letzten Trumpf ausspielen zu können.
»Kind«, flüsterte Waldburg Hansen kaum hörbar mit geschlossenen Augen. »Dass du mich nun auch verlässt! Kannst du überhaupt nachempfinden, wie eine Mutter sich fühlt, die ein Kind, ihre geliebte Tochter, verloren hat? Wenn ihr eigen Fleisch und Blut das Leben hingeben musste, und sie keine Möglichkeit hatte, dies zu verhindern?«
Sarah verdrehte die Augen und seufzte ebenfalls, doch sie erwiderte nichts und ließ ihre Mutter weiterreden.
»Das ist der größte, ja der größte Schmerz,« - sie riss ihre Augen weit auf und fixierte Sarah - »den eine Mutter ertragen muss. Die härteste Prüfung, die dir im Leben auferlegt werden kann.«
Sie schloss die Augen wieder und lehnte sich zurück. Sarah war jetzt auch aufgewühlt, jedoch schaffte sie es immer noch, das Ereignis, auf das ihre Mutter anspielte, rational zu bewerten.
»Und wenn dein Vater nicht auf Geschäftsreise gewesen wäre, und ich nicht diese entsetzliche Migräne gehabt hätte, dann wäre deine Schwester heute noch am Leben.« Die Worte kamen zwar in einem Tonfall von Bedauern über die Lippen ihrer Mutter, doch Sarah wusste um die theatralische Begabung ihrer Mutter nur zu gut. Folglich fiel es ihr schwer, an sich zu halten. Die Art, wie sich ihre Mutter die Welt um sich zurechtlegte, widerte sie an. Seit jenem Tag versuchte Waldburg Hansen, die Verantwortung, die sie am Tod von Sarahs Schwester Lena hatte, von sich zu schieben. Der Hinweis auf die Abwesenheit ihres Mannes stand dabei zwar nicht im Vordergrund, wurde aber jedes Mal angebracht, wenn dieser schreckliche Tag zur Sprache kam. Maßgeblicher – und in Sarahs Augen um etliches verwerflicher – war, dass man die Unfähigkeit, Lena zu helfen, die beim Spielen in den Pool gefallen war, keineswegs durch eine schwere Migräne begründen konnte. Auch wenn es Sarah damals nicht bewusst gewesen war – schließlich war sie erst fünf Jahre alt – da sie sich heute noch an kleinste Details an jenem Tage erinnern konnte, hatte sie sich später zusammenreimen können, dass ihre Mutter damals sturzbetrunken auf der Chaiselongue im Salon gelegen hatte. Die Zeit, die Sarah damals benötigt hatte, um ihre Mutter an den Pool zu bekommen, waren möglicherweise die entscheidenden Minuten gewesen, die ihrer siebenjährigen Schwester das Leben gekostet hatten. Migräne! Sarah drehte es auch heute noch den Magen um, als ihre Mutter zum wiederholten Mal auf diese Art und Weise versuchte zu entschuldigen, was damals geschehen war. Doch sie hielt sich zurück. Bei einer einzigen Gelegenheit hatte Sarah geglaubt, ihre Mutter mit der Wahrheit konfrontieren zu müssen. Dass jener Abend mit einem Anruf beim Notarzt und einer aufreibenden Nacht in der Klinik geendet hatte, war ihr immer noch als fast traumatisches Erlebnis in Erinnerung. Und eines hatte sich in ihren Gefühlen gegenüber den Lügen ihrer Mutter ohnehin grundlegend geändert: Was lange Zeit Trauer und vor allem Wut bei ihr ausgelöst hatte, machte heute einem anderen, sehr starken Gefühl Platz: Verachtung! Ja, sie verachtete ihre Mutter! Für die Lügen, für das, was sie ihr in der Kindheit angetan hatte, für die Verletzungen, die sie durch ihre Mutter bis zum heutigen Tag erfahren hatte. Und so sehr sie die Erinnerungen an ihre Schwester im Moment auch schmerzten, spürte Sarah, dass nun etwas zum Abschluss gekommen war. Und die Freude über die Tatsache, dass sie in wenigen Wochen einen entscheidenden Schritt aus dem Leben ihrer Mutter hinaustreten würde, ließ sie sogar ein wenig lächeln.
Es machte ihm nichts aus, durch die Dunkelheit zu laufen. Die Dunkelheit war sein Freund. Wenn er an die schönsten Momente in seinem Leben zurückdachte, war es stets dunkel gewesen. Nicht die absolute Dunkelheit, die einen schnell die Orientierung verlieren ließ, die einen Schwindel hervorbrachte, in dem man schnell panisch um sich schlug. Nicht um ein Möbelstück, eine Wand oder eine Tür zu ertasten, die einem seine Position verriet. Sondern um sich schlug, um irgendetwas zu ertasten. Irgendetwas, das einem versicherte, dass da tatsächlich um einen herum etwas existierte. Das einem versicherte, dass die Welt, die normalerweise zu sehen man gewöhnt war, einen noch immer umgab. Das einem versicherte, dass man sich nicht in einer schwarzen Realität befand, die körperlos war, unendlich in Raum und Zeit. Nein, es war die Dunkelheit, in der er sich, wenn sich die Augen den Gegebenheiten angepasst hatten, sehr gut bewegen konnte, sehr gut beobachten, sich zu verstecken vermochte. Die Dunkelheit, die ihm Sicherheit gab, weil sie sein Freund war, aber jedem anderen Feind. Die er liebte, weil sie ihn bevorzugte. Weil ihn die Erfahrung gelehrt hatte, dass es allen anderen mit ihr unwohl war, sie ihm aber Schutz und Geborgenheit bot.
Orientierung war für ihn kein Problem, und selbst wenn sich die schmalen Feldwege, die sich schier endlos durch die ebene Landschaft zogen, kreuzten, musste er nicht lange überlegen, welchem davon er folgen sollte. Und so bewegte er sich so zügig vorwärts, wie es manch einer selbst am Tage nicht schaffen würde. Die Stunden, die er von der Endhaltestelle aus unterwegs war, hatte er mit Gedanken ausgefüllt. Gedanken unterschiedlichster Art. Viele betrafen Erinnerungen, die wenigsten die Gegenwart, die meisten die nahe Zukunft. Er wusste nun, wo sie den Bus verließ und welche Richtung sie danach einschlug. Er konnte schon morgen… nein! Er verwarf den Gedanken. Erstens würde er noch einige Zeit in die genaue Planung investieren müssen. Zweitens konnte er, da er seit gestern wusste, wie er sie auffinden konnte, die Momente, in denen er in ihr Leben trat, auch genießen. Die Momente, in denen er sie beobachten konnte, ohne dass sie dies auch nur erahnte. Ihre Gestik, ihre Bewegungen, ihren zarten Körper, das hübsche Gesicht. In denen er ihr so nahe war, dass er ihre Stimme hören und den Duft ihrer Haare riechen konnte. Er würde ihr also die nächsten Tage aus zwei Gründen folgen, wobei das Studieren ihrer Gewohnheiten wie immer zu Anfang lediglich zweitrangig war. Er erinnerte sich an das erste Mal. Damals war es ihm überhaupt nicht darum gegangen, herauszufinden, in welcher Situation er sie zu sich holen konnte. Er wollte nur in ihrer Nähe sein, wie ein unsichtbarer Begleiter an ihrem Leben teilhaben, das Leben in ihr spüren. Das Leben, die Freude, die er selbst eben nicht mehr imstande war, zu empfinden. So ging es über ein Jahr, bis er der rein optischen und auditiven Wahrnehmungen überdrüssig wurde und sich noch mehr Nähe, physische Nähe wünschte. Damals verging wohl ein wieteres halbes Jahr, bis das Verlangen tatsächlich darin mündete, sich mit der akribischen Planung auseinanderzusetzen, wie er sie auf Dauer in seiner Nähe haben konnte. Mit der Zeit begann das Verlangen einer physischen Verbundenheit immer früher einzusetzen, nichtsdestotrotz versetzten ihn die Beobachtungen, das scheue, unbemerkte Annähern nach wie vor in Glücksgefühle und waren somit wichtiger Bestandteil seines Tuns und Handelns. Bei der nächsten Weggabelung hielt er einen Moment inne. Er wandte sich gen Osten und glaubte am Horizont einen leichten blauen Schimmer erkennen zu können. Bis zum Sonnenaufgang war nicht mehr viel Zeit. Selbst wenn er sich mittlerweile auch bei Tageslicht sicher und unauffällig bewegen konnte, so war er doch froh, dass es nicht mehr weit bis zu dem Parkplatz war, wo er seinen VW-Transporter am Nachmittag abgestellt hatte. Nach den verbleibenden zwanzig Minuten, die er deutlich schnelleren Schrittes weiterlief, war der Himmel tatsächlich zur Hälfte in ein dunkles, fast ins Lila gehende Blau getaucht. Als er den Schlüssel in das Schloss der Fahrerseite steckte, zögerte er einen Moment. Im Laderaum lag eine Matratze, frisch bezogen, verlockend. Er hatte die nächtliche Wanderung genossen, trotzdem war er jetzt müde. Nicht erschöpft, sein
Körper war trainiert und er hätte leicht die doppelte Strecke zurücklegen können, aber müde. Er zog den Schlüssel wieder aus dem Schloss, begab sich an das fensterlose Heck des Transporters und öffnete die Tür. Er zog sie hinter sich zu, verriegelte von innen, ging auf die Knie und rollte sich auf der Matratze ein wie ein Embryo.
Die wärmende Sonne