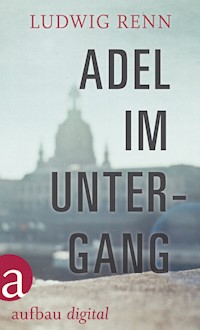
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leutnant Arnold Vieth von Golßenau, letzter Sproß eines uralten Adelsgeschlechts, der sich später den Namen Ludwig Renn gibt, will als junger, strebsamer Offizier in seinem Leben vorwärtskommen. Ihm gefällt die Welt der schönen Uniformen, der glänzenden Paraden, des lässigen militärischen Alltags. Er mag die meisten seiner draufgängerischen Kameraden, man trinkt und tanzt zusammen, besteht Mutproben und macht sich lustig über die im Dienst ergrauten Chargen. Alle rechnen mit einem Krieg, den aber niemand fürchtet, im Gegenteil. Doch irgendwann wird das Inferno der Grabenschlachten alles verändern. Vorbei sind die Zeiten der prunkvollen Bälle und der ausufernden Offiziersgelage, der kleinen und großen Intrigen, der freundlichen Anekdoten — ein Zeitalter ist zu Ende.
Als sich Ludwig Renn 1944 daranmacht, seine Erinnerungen an diese widerspruchsvoll-glückliche Vorkriegszeit mit der Genauigkeit des Offiziers und dem Humor eines großen Schriftstellers aufzuschreiben, lässt er den Dresdener Hofstaat jener Jahre noch einmal erstehen: Das Freundlich-Morbide dieses gesellschaftlichen Endzustandes atmet eine südliche Fin-de-siècle-Stimmung, gleich der, die damals im habsburgischen Wien herrscht. Je unbeschwerter der Vordergrund des Geschehens bei Hofe, in den Kasernen und Kasinos erscheint, desto deutlicher zeichnen sich die tiefen Klüfte im Hintergrund ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ludwig Renn
Adel im Untergang
Roman
Impressum
ISBN 978-3-8412-0727-2
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, November 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Bei Aufbau erstmals 1947 erschienen.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Anika Wienunter Verwendung eines Motivs von Susann Städter / photocase.com
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Inhaltsübersicht
Impressum
Adlige Fräulein um 1900
Die Flucht der Erzherzogin
Die Prinzenschule
Berufswahl
Fahnenjunker im Leibgrenadierregiment
Auf Kriegsschule
Siegfried Vitzthums Geheimnis
Meine erste Audienz beim König und der Etagenkopf
Prinzeß Mathilde
Die Remonteschau
Weihnachten in der Kaserne
Die Cour und die Assemblée mit Hofspiel
Das Fest des 2. Januar
Der neue Oberst
Kommerzienrat Lingner und die Gräfin Montgelas
Winterende
Eine Wache
Die Gräfin Kielmansegg
Die Anmaßungen des Miltitz
Erstaunliche Toaste
Das Vergnügen wird vom Dienst unterbrochen
Ein kalter Wachtaufzug
Der sächsische Kronprinz
Die Prozession mit dem Herzen des Königs
Gegen den Strich
Miltitz unterrichtet uns
Ehrengericht
Diskussion um das Duell
Ein Fall von Spionage
Offizierstollheiten
Auf Ehrenwache für Großfürst Kyrill
Neue Hoffestlichkeiten
Böse Unruhe
Tango tanzen
Raskolnikow
Die Rebellion der Prinzen
Bälle
Das Paukensolo mit Orchesterbegleitung
Die letzten Bälle
Bei meinem Bruder
Kommandos
In der königlichen Villa
Bei der Arbeiterabteilung
Der Hofgartenanzug
Editorische Notiz
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Adlige Fräulein um 1900
Bei uns verkehrten Leute sehr verschiedner Art. Ich besinne mich, wie wir als Kinder allen möglichen Damen die Hand küssen mußten, die Visite machten, wie man das damals vor 1900 nannte. Da war vor allem eine ältere Dame in einem schwerseidenen Kleid, das rauschte, sobald sie sich bewegte. Sie sprach meistens französisch mit scharfem russischem R und hatte die ganze Liebenswürdigkeit des vorigen Jahrhunderts. So ähnlich sprach auch meine Mutter, die glücklich war, wenn sie uns zwei Jungen von ihrer Heimatstadt, dem bunten Moskau, erzählen konnte. Aber sobald mein Vater erschien, schwieg sie.
Ich konnte meine Mitschüler nicht verstehen, weil sie nicht backen und packen unterscheiden konnten. Aber das waren ja alles reine Sachsen. Mein Vater aber rühmte sich, ein halber Ire zu sein, und las fast nur englische Bücher. Von deutschen ließ er Schiller gelten. Und meine Mutter las Goethe mit tiefer Inbrunst und Moskauer Akzent.
Noch unsächsischer war die Atmosphäre bei ihrem Vater. Da gab es jeden Sonntagmittag große Tafel, zu der die meisten seiner sieben Kinder, unsre Familie und einige Gäste erschienen. Unter ihnen war Herr Taube, ein zierlicher junger Mann, von dem man wohl hoffte, daß er eine meiner Tanten heiratete.
»Stellen Sie sich vor«, rief Herr Taube über die Tafel hin, »jemand wollte auf sächsisch große Gedanken ausdrücken!«
Meine Tanten lachten, und mein Großvater lächelte durch seine goldne Brille meinen Vater an, der nicht gern zugab, daß er sächsisch sprach.
»Große Gedanken?« rief mein Vater mit blitzenden Augen. »Das kommt mir vor wie die Spießbürger vor fünfzig Jahren!«
»In der Tat«, erwiderte mein Großvater herablassend, »damals erklärte man die Seele noch nicht mit dem Sauerstoff.«
»Aber«, rief Herr Taube, »man hatte noch eine Seele!«
»Seele ist Unsinn!« schrie mein Vater.
Mein Großvater öffnete die sauber rasierte Mundöffnung in seinem großen Bart. »Ich glaube ja auch nicht an die Seele in dem Sinne, daß man sie irgendwo finden und in einem Reagenzglas analysieren könnte. Aber ich sehe nicht recht, wie ich mich freuen könnte, wenn ich keine Seele hätte.«
»Und Sie könnten auch keine edlen Gedanken haben!« rief Herr Taube.
Mein Vater, der den zierlichen Mann nicht leiden konnte, wandte sich jäh zu ihm. »Und Sie meinen, daß da ein Zusammenhang zwischen Mangel an edlen Gedanken und der sächsischen Sprache bestünde?«
Herr Taube erhob begeistert seine beiden dünnen Hände. »Ja, Herr von Vieth! Großartig haben Sie das ausgedrückt!«
»Und Sie meinen, daß auch ich sächsisch spräche?« fragte mein Vater mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Ja, ohne Zweifel.«
Ich fürchtete schon, mein Vater würde wieder einmal so brüllen, daß es einem angst und bange würde. Aber da sah ich, wie mein Großvater in seinen Bart hineinkicherte und anfing, heftig zu husten.
»Ist dir nicht gut, Papa?« rief meine Mutter ängstlich.
»Im Gegenteil«, flüsterte er, von seinem Husten unterbrochen. »Mir ist zu gut. Und ein bißchen Freude schadet meiner Lunge nicht.«
Die Großmutter lächelte am anderen Ende der Tafel mit ihrem dünnen russischen Munde und ihren Schlitzaugen. »Was redet ihr da wieder für Unsinn!«
»Unsinn?« rief eifrig Herr Taube. »Große Gedanken sind kein Unsinn! Und man kann das Erhabne doch nicht auf sächsisch ausdrücken! Oder wollen Sie etwa auf der Bühne deklamieren:
Verlassen hab ich Feld und Auen,
Die eine diefe Nachd beteckt,
Mit ahnungsvollen heilchen Krauen
In uns die pessre Saele weggd?
Es kann doch keine Seele ohne Form geben!«
Der Bart meines Großvaters wackelte vor Lachen, während mein Vater schrie: »Als ob Sachsen nicht Dichter, und vor allem Maler, hervorgebracht hätte!«
»Eben das ist es«, rief meine Tante Manja. »Es gibt wenige sächsische Dichter und viele Maler und Komponisten. Vor lauter Verzweiflung über ihre Sprache griffen sie zur Farbe und zum nicht gesprochenen Ton!«
Jetzt redeten alle durcheinander. Ich hörte meinen Vater empört schreien: »Sie wollen doch nicht etwa behaupten, Herr Taube, daß in Deutschland alles schlecht wäre?«
»Nein«, sagte mein Großvater, »nicht schlecht. Aber dumm. Rußland ist korrupt und um Jahrhunderte zurück. Aber man ist dort viel gescheiter als in diesem spießigen Deutschland oder gar in Sachsen.«
»Da fehlt wirklich nur noch«, rief mein Vater, »der Angriff auf unser Königshaus!«
»Aber, Herr von Vieth!« rief Herr Taube. »Ich habe von Ihnen sonst immer nur gehört, wie Sie Ihr Königshaus, die Wettiner, als verkommen und maßlos hochmütig bezeichnet haben!«
»Das ist es eben, was Sie als Russe nicht verstehen.«
»Doch, gerade das verstehe ich. Wir haben selbst einen Zaren ...«
»Und Sie haben auch den Anarchismus und Nihilismus!«
»Erlauben Sie, ich bin weder Anarchist noch Nihilist!«
»Ach, alle Russen haben diesen Geist der Auflehnung und Zersetzung!«
»Hansi!« sagte meine Mutter beschwichtigend.
Aber er ließ sich nicht beruhigen. »Natürlich taugt unser Königshaus nicht viel. Und der Kaiser in Berlin, dem fehlt es wieder an Takt. Und trotzdem dürfen wir den Geist der Zersetzung nicht aufkommen lassen. Denn wenn das Volk diese Gedanken in sich aufnimmt, so wird es rebellisch!«
Mein Großvater lachte wieder in seinen Bart hinein. »Das Essen wird dir auf dem Teller kalt vor lauter Nihilismus und Königshäusern. – Ich glaube übrigens, daß gerade du unter uns allen der am wenigsten Konservative bist.«
Nach dem Essen drängte meine Mutter zum Aufbruch.
Als wir nach Hause kamen, meldete das Stubenmädchen: »Graf und Gräfin Bülow sind im Salon.«
»Sind sie schon lange da?« fragte Mama.
»Schon zwei Stunden, gnäd’ge Frau.«
»Ach, wie schade«, und Mama flüsterte meinem Vater zu: »Sie haben sicher bei uns zu Mittag essen wollen.«
»Warum essen sie nicht zu Hause?« fragte mein Bruder.
»Still, Viktor! Sie sind sehr arm.«
»Bitte«, sagte Papa, »erspare mir diesen Besuch. Nachher komme ich zum Kaffee für ein paar Minuten hinüber.«
Wir Kinder mußten mit Mama in den Salon gehen. Die beiden erhoben sich von den Polsterstühlen unter den großen Ölbildern eines unsrer Vorfahren, der da in rotem Samt und mit langer gestickter Weste saß, und seiner Frau in weißem Atlaskleid und dicken Ohrgehängen aus vielen Perlen. Die Gräfin kam meiner Mutter mit zuckenden Augen entgegen. Wir küßten ihr die Hand und wandten uns dem Grafen zu, von dem wir wußten, daß er blind war. Wir faßten nach seiner Hand, und er sagte freundlich in falscher Richtung: »Guten Tag.«
Meine Mutter beugte sich vor. »Liebe Komtesse, es tut mir so leid, daß wir nicht da waren. Ich habe angeordnet, daß sofort etwas bereitet wird – was wir gerade im Hause haben. Bitte, gedulden Sie sich noch ein halbes Stündchen!«
Wir setzten uns. Die Gräfin erzählte etwas vom preußischen Hof, was uns Kinder nicht interessierte. Ihr Ton war nicht angenehm. Ich wußte nicht weshalb, aber ich fürchtete mich vor ihr. »Kinder!« sagte Mama, »Geht und sucht eure Freunde! Und wenn ihr sie zum Kaffee herüberbringen wollt, so könnt ihr das tun.«
Wir zwei Brüder gingen über die Straße, um Viktors Freund, Otto von Erdmannsdorff, zu treffen. Als wir die Treppe hinaufstiegen, kam er uns entgegengestürzt. »Wißt ihr schon, daß der Prinz Friedrich August zu uns kommt? Mit seiner Frau! Sie ist eine Erzherzogin.«
»Warum kommen sie denn zu euch?« fragte ich.
»Nu, fressen!« rief Otto. »In drei Tagen kommen sie! Mein Vater ist verrückt geworden vor Aufregung! Ich sage euch, den solltet ihr herumbrüllen hören. Kommt mit rauf! Da könnt ihr sehen, wie er mit umgebundener Schnurrbartbinde die Polsterstühle hin und her schiebt! Fein, sage ich euch!«
Meine Mutter behielt die Geschwister Bülow auch zum Abendessen da. Bei uns wurde zu allen großen Mahlzeiten serviert. Zuerst reichte man der Komtesse, dann dem Grafen. Da er aber nicht sah, legte ihm meine Mutter alles vor. Seine Schwester beherrschte mit meinem Vater zusammen das Gespräch. Sie sprach von einem Besuch bei ihrem ältesten Bruder, dem Majoratsherrn von Grünhoff.
Mein Vater unterbrach sie: »Glauben Sie, daß die Einrichtung der Majorate gut ist?«
»Wir jüngeren Geschwister können wohl kaum von gut sprechen. Denn von der Auszahlung, die wir erhalten haben ...«
»Bitte nicht!« sagte ihr Bruder.
»Gut, eben nicht. Aber, Herr von Vieth, selbst wenn Sie den Punkt der jüngeren Geschwister nicht berühren, so ist das System nicht gut. Der älteste Sohn erbt doch alles. Zuerst geht er zum Militär und wird Leutnant, natürlich im teuersten aller Kavallerieregimenter. Dort gewöhnt er sich das hemmungslose Schuldenmachen an, weil ihm jeder in Voraussicht der kommenden Erbschaft pumpt. Wenn dann der Vater stirbt, zieht er sich mit den ungeheuren Ansprüchen, an die er sich gewöhnt hat, auf sein Schloß oder Herrenhaus zurück. Außerdem versteht er nichts, absolut nichts von der Landwirtschaft und den Geschäften. Er wird zu einem ...«
»Bitte nicht!« sagte der Graf und wandte sich freundlich an meine Mutter. »Der Käse ist ganz ausgezeichnet. Darf ich noch um etwas bitten?«
Es klingelte. Vom Flur her hörte ich laute Frauenstimmen, darunter die der Schwester meines Vaters. Sie, die Tante Mieze, liebte mich ganz besonders.
Die Tür wurde aufgemacht, und herein trat die Tante in einem Kleide, das in der Mitte mit unglaublich vielen Knöpfchen geschlossen war. Mit ihr kam eine Dame, die mich gleich lebhaft interessierte. Sie war groß und sagte mit einer Stimme, die dunkel und tönend war: »Entschuldigen Sie, daß wir so spät kommen.« Ihr Gesicht war rot und wie von innen geheizt.
Meine Mutter stellte vor: »Fräulein von Schimpff und meine Schwägerin Fräulein von Vieth, Komtesse Bülow, Graf Bülow.«
Ich betrachtete unentwegt das rotgesichtige Fräulein von Schimpff. Sie setzte sich hochaufgerichtet auf einen Stuhl. »Wir kommen eben von einer Festlichkeit im Karolahaus – Sie wissen wohl, das ist eines der großen Krankenhäuser hier. Ihre Majestät war da, und natürlich alle Ärzte und Schwestern. Die Königin war sehr leutselig und gab allen die Hand.«
»Entschuldigen Sie meine Unkenntnis«, sagte die Gräfin, »aber ich kann mich nicht erinnern, aus welchem Hause die Königin von Sachsen ist?«
»Sie ist eine Wasa und die Letzte aus dem alten schwedischen Königshause. Haben Sie nie die Königin gesehen, gnädigste Gräfin?«
»Doch, einmal. Sie benahm sich sehr liebenswürdig gegenüber einigen Damen.«
»O ja!« rief Fräulein von Schimpff. »Sie ist stets sehr liebenswürdig gegen Damen! Sehen Sie! Dieses Armband hat sie mir neulich geschenkt.« Sie zeigte ein schweres goldenes Armband an ihrem Handgelenk. »Die Königin hat es von ihrem Arm gezogen und mir über die Hand geschoben. Aber es ist mir sofort heruntergefallen. Zwar habe ich eine mächtige Pranke, aber es war für mich so weit, daß ich mehrere Glieder herausnehmen mußte, damit es paßte.«
Wir betrachteten interessiert das königliche Armband.
»Ja«, sagte die Gräfin, »es ist mir auch aufgefallen, was für gewaltige Arme die Königin hat.«
Sie hat wirklich Pranken, dachte ich. Solche hat niemand sonst, der bei uns verkehrt. Jetzt starrte ich abwechselnd auf ihr erhitztes Gesicht und ihre roten, derben Hände und horchte auf den dunklen Ton ihrer Stimme.
Meine Tante beugte sich vor: »Und wir sind bei dieser Gelegenheit Schwestern geworden.«
Ich verstand nicht, was das bedeutete. Alle starrten sie so eigen an. Papa lehnte sich zurück: »Was soll das heißen? Krankenschwester, du?«
Die Tante lachte: »Natürlich ich! Und auch meine Freundin hier.«
»Aber«, sagte mein Vater drohend, »ich hoffe, das läßt sich noch rückgängig machen! Ein junges Mädchen aus guter Gesellschaft ...«
Die Tante fuhr auf: »Ach ihr mit eurer guten Gesellschaft! Hast du dich denn um die gute Gesellschaft gekümmert, als du Lehrer wurdest statt Offizier? Und was bedeutet denn das, gute Gesellschaft? Es bedeutet, daß wir Frauen ein völlig unnützes Leben führen müssen! Ich will dir mal aufzählen, was wir adligen Fräulein tun dürfen! Zum Tee gehen, auf Bälle gehen – und dort natürlich nur mit ganz bestimmten Leuten tanzen, nicht etwa mit einem Arzt oder jemand, der was gelernt hat und darüber zu sprechen weiß, sondern nur mit den albernen Leutnants, denen man ebenso albern antworten soll! Das ist eure gute Gesellschaft!«
»Ja«, rief Fräulein von Schimpff, »Kälber zu werden, das erlaubt man uns! Und wir dürfen auch mit drei Groschen die Woche so tun, als wären wir reich und brauchten nichts zu verdienen!«
Die Gräfin nickte stumm auf ihren Teller.
Papa sagte: »Meine Schwester hat ein Vermögen geerbt, so groß wie mein eigenes. Sie malt, sie kann Reisen machen, sie kann ...«
»Aber was ich nicht kann«, schrie die Tante, »ist, ein nützliches Wesen werden! Du, Hans, hast dich gegen die Gesellschaft aufgelehnt, um kein blöder Leutnant, sondern ein nützlicher Mensch zu werden. Du darfst das, weil du ein Mann bist! Aber deine Schwester ...?«
»Ich bin«, sagte die Gräfin und bemühte sich, ruhig zu sprechen, »in der Berliner Hofgesellschaft ausgeführt worden – angebissen hat niemand!«
Der Graf schien wieder sagen zu wollen: Bitte nicht. Aber er schloß den Mund wieder. Denn niemand sprach, so betroffen waren alle.
Die Freundin der Tante richtete sich noch steifer auf. »Herr von Vieth, können Sie uns überhaupt verstehen? Man führt uns auf Bälle, doch nur, um verheiratet zu werden. Einige ja, denen gefällt das. Die wollen. Aber ich nicht! Absolut nicht! Und weil man uns dazu erzogen hat, den Leutnants zu gefallen, deshalb werden wir so schief und unangenehm, wenn wir erst einmal über die Jugend hinaus sind.«
Meine Mutter hatte an dem rot blinkenden Kupferkessel hantiert, der neben ihr auf einem schmiedeeisernen Gestell stand. Jetzt rief sie übertrieben fröhlich: »Das Teewasser kocht! Ich habe einen guten russischen Karawanentee da.«
Die Flucht der Erzherzogin
Das Fest mit dem prinzlichen Paar ging vorüber. Wir Jungen wurden am nächsten Tage zu Erdmannsdorffs hinübergerufen, um den Rest der Mandelmilch auszutrinken und allerhand gute Sachen zu essen, die übriggeblieben waren.
Nicht lange danach klingelte es eines Nachmittags an unsrer Tür viele Male hintereinander.
Alle stürzten hin.
Otto kam hereingestürmt, strahlend. »Die Prinzessin ist ausgerissen!«
»Was für eine Prinzessin?«
»Na, die Erzherzogin, die damals bei uns zu Abend gefressen hat! Sie ist mit dem französischen Lehrer der Prinzen durchgegangen!«
»Ich finde das gar nicht so lustig«, sagte meine Mutter.
Otto lachte. »Wenn ich mir vorstelle, wie sie da heimlich aus dem Schloß fort ist und sich dann irgendwo mit Herrn Giron getroffen hat! Viktor, weißt du was!? Wenn wir mal wieder Theater spielen, Betrunknentanz und Burenkrieg, dann nehmen wir eine neue Nummer dazu, die Flucht der Erzherzogin!«
Mama lächelte. »Da werden aber deine Eltern nicht so ganz einverstanden sein – ich übrigens auch nicht.«
»Warum denn nicht?« rief Otto. »Wir spielen dann, wie sie um die Ecke kommt, und Giron gibt ihr einen Kuß, daß es nur so knallt!«
»Das könnt ihr doch gar nicht«, sagte Mama. »Ihr habt doch kein Mädchen.«
Otto sah den Viktor fragend an. Der sagte mit zusammengezogenen Brauen: »Mit einem Mädchen können wir nicht spielen!«
»Dann spielt eben Arnold die Erzherzogin«, rief Otto.
»Ich mich küssen lassen? Mädel küssen sich untereinander, nicht Jungen!«
Aber es kam gar nicht dazu. Warum, weiß ich nicht mehr.
Dann erschien ein Buch, in dem die Prinzessin selbst die Gründe für ihre Flucht erklärte. Ihr Haß hatte sich nicht gegen ihren Mann, sondern gegen den Minister von Metzsch gerichtet, der auch im Volke sehr unbeliebt war, und gegen ihren Schwiegervater, den König Georg, einen steifen Mann, der sich nicht die geringste Mühe gab, seine Verachtung für alle Welt zu verbergen. Er hatte lange auf den Thron gewartet. Endlich war sein Bruder, der König Albert, gestorben, dessen Frau die gewaltige Königin gewesen war, die so gern ihre Armbänder verschenkte. Prinz Georg kam auf den Thron und verzichtete nicht zugunsten seines Sohnes Friedrich August. Das war von seinem Standpunkt aus auch verständlich. Der Prinz nämlich und seine Erzherzogin Louise von Toscana hatten sehr wenig Sinn für die Steifheit des Hofes und das altspanische Zeremoniell, das da noch herrschte. Er wollte die Krone nicht an einen Prinzen ausliefern, der sich so benahm.
Einige Jahre vorher war der Prinz Friedrich August Kompaniechef im Schützenregiment geworden. Eines Tages rückte er mit seinen hundert Mann zum Felddienst aus. An einem Waldrand ließ er halten, die Gewehre zusammensetzen und austreten. Er selbst stieg vom Pferde und stellte sich auch an einen Baum. Seinen Soldaten war er bisher als ein unerreichbar hohes Wesen erschienen, und sie schielten zu ihm hinüber. Da wandte er den Kopf. »Ihr denkt wohl, ich hätte einen andern als ihr?«
Noch weniger förmlich war die Prinzessin. Das mißfiel dem alten steifen König und gefiel dem Volke.
»Unsre Köchin«, sagte meine Mutter, »liest das Buch der Prinzessin in der Küche offen. Die Herrschaften in allen den Häusern hier herum lesen es auch, aber heimlich.«
Wir pflegten alljährlich in den großen Schulferien eine größere Reise zu machen. Es mochte etwa im Jahre 1905 gewesen sein, als wir nach Linz in Oberösterreich fuhren, um eine Tante zu besuchen, eine alte Dame, die gern französisch sprach und eine etwas altmodische Höflichkeit hatte. Wir aßen mit ihr ausgezeichnete Wiener Backhendel und Marillenknödel und fuhren am folgenden Tage mit ihr nach dem Salzkammergut. In Gmunden besahen wir von außen das große Schloß des Herzogs von Cumberland, das uns deswegen interessierte, weil er der Prätendent auf den Königsthron von Hannover war und ein geschworener Feind der Hohenzollern. Das Schloß war enttäuschend neu und sah so aus, als ob da nirgends auch nur das geringste Geheimnis wäre.
Bei einem der Ausflüge am Ufer des Traunsees kamen wir aber zu zwei Schlössern, von denen man sich vorstellen konnte, daß da nachts Geister umgingen und allerhand Düsteres geschehen war. Das eine stand am Lande und war alt und dunkel, das andre lag im See. Eine Brücke aus Holzbohlen führte zu ihm hinüber. Wir gingen auf ihr bis zu dem verwitterten hohen Tor und kehrten um.
Dieses Schloß ließ meine Phantasie nicht los.
Die Tante war nicht mitgekommen. Sie konnte so weit nicht mehr gehen.
Aber am Abend fragte ich sie.
»Ach, Kind«, sagte sie, »ihr seid sicher bei den beiden Schlössern Orth gewesen. Dort hat Johann Orth gewohnt, bevor er unterging.«
»Wer war denn Johann Orth?«
»Das weißt du nicht? Ja, ich vergesse, du bist kein Österreicher. Er hieß eigentlich Erzherzog Johann und war der Sohn des Großherzogs von Toscana. Seine Schwester Louise ist dir vielleicht bekannter. Sie ist mit einem Franzosen durchgegangen.«
»Das«, rief ich, »muß doch die Louise von Toscana sein, die heute unsre Königin wäre, wenn sie ihren Mann nicht verlassen hätte?«
»Das mag sein. In der ganzen Familie hat es nichts als solche Geschichten gegeben. Ein andrer Bruder hat sich mit einer lockern Frau eingelassen und sie sogar geheiratet. Darauf ist er aus dem Hause Habsburg ausgestoßen worden, genau wie seine Schwester, und er lebt unter dem Namen Wölfling, in Wien, glaube ich. Auch sein Bruder, der Erzherzog Johann, hatte sich in ein Bürgermädchen verliebt und verlangt, sie zu heiraten. Das war aber etwas, was der Kaiser Franz Joseph nicht verträgt. Auch Johann wurde ausgestoßen und bekam den Namen Johann Orth, nach seinen Schlössern, die ihr heute gesehen habt.«
»Und seine Frau? Aus was für Kreisen war sie denn?«
»Sie war eigentlich vernünftiger als er, aber eine Kleinbürgerin.«
»Was hat er denn Dummes gemacht?«
»Ja, sieh mal, Arnold, er war so ähnlich wie deine Tante Mieze. Er konnte das faule Herumsitzen auf seinen Schlössern nicht vertragen. Er wollte etwas Nützliches tun. Da ist er auf den Gedanken gekommen, sich ein Schiff zu kaufen und auf dem Meere herumzufahren.«
»Eine schöne Jacht?«
»Ach nein, einen Frachtdampfer. Er wollte eben was Nützliches tun und Güter befördern. Seine Frau, die eine praktische Person war, hat ihm beim Anheuern der Mannschaft geholfen. Aber da kam ihm etwas in die Quere, was er nicht gelernt hatte. So einem Erzherzog wird doch von Kindheit auf jeder Wunsch erfüllt. Er hatte das Warten nicht gelernt. Der Steuermann ließ sich seinen Ton nicht gefallen und ging fort. Ungeduldig wie er war, fuhr er ohne ihn ab.«
Die Tante machte eine Pause und blickte zum Fenster hinaus.
»Und?«
»In irgendeinem Hafen ist er noch angelaufen. Dann hat man weder von ihm noch von seinem Schiffe oder seiner Mannschaft je wieder etwas gehört.
Mein Bruder entwickelte sich ganz anders als ich. Von geistigen Interessen wollte er nichts wissen, und er tat so, als wäre er gänzlich ungebildet. Sein Interesse waren Pferde, Kühe, Hunde, und er setzte es durch, daß er in den Schulferien nicht eine schöne Reise mitmachte, sondern auf dem Lande arbeitete. Er suchte sich selbst den Pächter zweier großer Güter als Arbeitgeber und machte da wie ein Knecht alles. Aber deshalb war er durchaus nicht demokratisch gesinnt, sondern er kaufte sich zum Entsetzen meines Vaters den Gothaer Hofkalender und die Taschenbücher des Adels und studierte tagelang darin. Manchmal hielt er mir lange Vorträge darüber, wer die Kronprätendenten von Frankreich wären, der bourbonische und der bonapartistische. Als Prinz Johann Georg, ein Bruder des Königs, seine Frau, Isabella von Württemberg, verloren hatte, heiratete er die Prinzessin Immaculata von Bourbon. Da erzählte mir Viktor sofort, wie die Bourbon-Frankreich mit den Bourbon-Spanien und den Bourbon-Parma verwandt wären und außerdem mit den Bourbon-Sizilien, aus deren Haus die neue Prinzessin stammte. Ihr Urgroßvater war der Re Bomba gewesen, der die Revolution in Neapel und Palermo niederkartätscht hatte.
So lernte ich einiges über die Geschichte der europäischen Fürstenfamilien, wenn auch auf eine kühle Weise. Denn ich konnte mir die einzelnen Persönlichkeiten nicht vorstellen, außer den großartigen und wahnsinnigen König Ludwig den Zweiten von Bayern und den Prinzen Max von Sachsen.
Das war ein Bruder unsres Königs, der sich entschlossen hatte, katholischer Priester zu werden. Er war groß und schlank, und es war von ihm bekannt, daß er oft tagelang fastete. Der eher urwüchsige König, der gerne aß und trank, liebte und verehrte seinen asketischen Bruder, wenn er auch manchmal über ihn lachte.
Eines Tages kam im Schloß ein Telegramm an:
komme morgen zug elf dreißig stop
schickt kleider und geld prinz max
»Da hat er sicher«, sagte der König, »wieder einmal seine Sachen einem Bettler geschenkt und sich selbst dessen Lumpen angezogen. Das Oberhofmarschallamt soll einen Wagen nach der letzten Station vor Dresden schicken, damit man meinen Bruder nicht in seinem Aufzug in der Stadt sieht.«
Auf der kleinen Station erschien also ein Hofwagen, auf dessen Bock der Kutscher und der Lakai hellgelbe Livreen trugen und ein helles Band um den hohen Zylinder. Kinder sammelten sich und gafften den Wagen an, und auch Erwachsene kamen. Der Bahnhofsvorstand lief in sein Diensthäuschen und setzte sich seine beste rote Mütze auf. Als dann der Zug ankam, sah er nach den Kupees erster Klasse. Aber es stieg nur aus der dritten Klasse jemand aus, ein magerer Mann mit viel zu kurzen Hosen. Ihn grüßte der Hofkutscher, indem er die Peitsche gerade hochhob und so verharrte, bis der Lakai dem Mann mit den zu kurzen Hosen in den Wagen geholfen hatte.
Die Prinzenschule
Für die übrigen Mitglieder der Königsfamilie hatte ich kein Interesse, bis mein Vater an die Prinzenschule berufen wurde. Als nämlich die drei Söhne des Königs etwas älter geworden waren, beschloß dieser, ihnen Schulkameraden zu geben. Das waren adlige Jungen und auch zwei oder drei sogenannte Renommierschulzen, Bürgerliche, deren Väter aber ebenfalls Offiziere oder höhere Beamte waren. Im Taschenbergpalais neben dem königlichen Schloß wurden einige Schulzimmer eingerichtet, und mein Vater sollte dort den Unterricht in Mathematik geben.
»Euer Vater«, sagte meine Mutter, »ist wirklich komisch. Statt daß er sich über die Berufung freut, ist er furchtbar aufgebracht. – Freilich habe ich ihm gesagt, er dürfte da nicht mehr die Frackhose zum Alltagsanzug anziehen und auch nicht den Gehrock mit seiner schlechtesten Hose. Diese Zumutung hat ihn so ...«
In diesem Augenblick kam mein Vater hereingepoltert.
»Warst du etwa mit dem schiefen Schlips im Schloß?« fragte Mama entsetzt.
»Ach, dieses Interesse für Schlipse! Morgen wirst du gar noch verlangen, daß ich in meinen engsten Lackschuhen zum Unterricht gehe!«
»Nein, das wäre in der Tat nicht passend. Aber – du solltest von nun an zu den Hofbällen gehen. Bei deinem Namen hast du ein Recht dazu.«
Mein Vater richtete sich noch militärischer auf, als er es sonst schon tat. »Und dazu soll ich mir meine Hauptmannsuniform wieder herrichten lassen? Oder denkst du, ich lasse mir für einige hundert Mark eine goldgestickte Hofuniform anfertigen?«
»Aber, Papa«, sagte Viktor, »dein Vermögen ist groß genug, um dir viele Hofuniformen machen zu lassen. Ich habe ja auch nie verstanden, warum du dir nicht Wagen und Pferde hältst.«
»Ich mag aber keine Pferde! Das ist doch alles nur Großmannssucht!«
Mama schüttelte den Kopf. »Auf den Hofball zu gehen ist noch keine Großmannssucht. Und was die Pferde anbelangt, so bin ich eher froh, daß wir keine haben. Da können sie auch nicht mit mir durchgehen.«
»Ich habe mich heute im Schloß sehr geärgert«, sagte mein Vater. »Der Baron O’Byrn, der Gouverneur der Prinzen, hat mich empfangen und mir den Wunsch des Königs mitgeteilt, die Prinzen nicht mit Seidenhandschuhen anzufassen. Sie sollen stramm antworten. Darauf sagte ich ihm, ich wäre gar nicht für das Exerzieren im Unterricht. Es käme nicht darauf an, mit Antworten herauszuplatzen wie beim Militär, sondern den Kindern funktionelles, mathematisches Denken beizubringen. Da wurde aber der Baron ungeduldig und sagte scharf: ›Herr von Vieth, bitte, machen Sie es so, wie es Seine Majestät wünscht!‹ – Ich bin aber überzeugt, daß der König nur gemeint hat, man soll seine Söhne nicht verziehen. Aber Schulexerzieren, richtiges Einpauken, das dürfte er kaum gemeint haben. Aber ewig diese Irländer! Nur deshalb, weil die Wettiner im siebzehnten Jahrhundert katholisch geworden sind, um Könige von Polen zu werden, und weil es in Sachsen außer ein paar Iren fast keinen katholischen Adel gibt, ist schon der heutige König von dem Baron von Oer erzogen worden. Das war ja sicher ein sehr rechtlicher Mann, aber von ihm haben weder der König noch seine Geschwister gelernt, wie sich ein Fürst benimmt. Bei allen zeremoniellen Gelegenheiten stehen sie steif herum und wissen nicht, wie man Leute anredet, die darauf warten.«
Mama lächelte. »Warum greifst du nur die Iren so an? Schließlich war deine eigne Großmutter eine Baronin von O’Bourk, und du pflegst zu sagen, daß du das vollkommene Spiegelbild deiner irischen Vorfahren bist, was ja nach den Bildern auch stimmt. Und mit dem Baron O’Byrn – er weiß sehr gut, wie man sich benimmt.«
»Aber«, rief mein Vater plötzlich fröhlich, »wißt ihr auch, wen der König als Leiter der Prinzenschule ausgesucht hat? Eine ganz sonderbare Wahl! Und ihr kennt ihn alle.«
»Wen?« fragte Viktor ungeduldig.
»Den Hofrat Jakob.«
»Aber der ist doch protestantischer Theologe!« sagte Mama.
»Das ist ja das Merkwürdige!« erwiderte mein Vater. »Damit hat der König sicher etwas gegen die ultrakatholische Erziehung seiner Kinder tun wollen.«
»Papa!« sagte ich. »Mich wundert das nicht so sehr. Der Hofrat ist ja mein Religionslehrer. Und neulich hat er uns erzählt, daß die Heiligen ganz besonders gut röchen. Das wäre wissenschaftlich festgestellt. Sie röchen süß oder sonstwie angenehm. Wir waren ganz erstaunt, daß sich der protestantische Theologe für die katholischen Heiligen einsetzt.«
Die Eltern lachten. Aber Viktor sagte mit Energie: »Ich finde das sehr richtig von dem Hofrat. Er hat sich eben den Sinn für die mystischen Zusammenhänge bewahrt. Er ist übrigens ein ausgezeichneter Lehrer!«
Ich protestierte innerlich heftig dagegen, daß er ein guter Lehrer wäre. Ich hatte neulich einen Aufsatz geschrieben, voll glühender Begeisterung. Und als der Hofrat ihn zurückgab, verhöhnte er mich mit bösem Blick wegen der Verwendung von Worten mit falschem Sinn. Ich aber glaubte ihm hier nicht. Er war einfach ein trockener Schleicher, und ich haßte ihn.
»Aber«, sagte Mama, »er hat Benehmen. Er ist der einzige Lehrer, den ich kenne, der weiß, wie man einer Dame die Hand küßt.«
Als mein Vater zum ersten Male zum Prinzenunterricht gehen sollte, zupften und bürsteten meine Mutter und ein Stubenmädchen an ihm herum, während er in immer neuen Ausbrüchen über diese Albernheiten schimpfte. Die beiden Frauen aber waren so bei ihrem Zupfen und Bürsten, daß sie ihn überhaupt nicht hörten.
Als er dann zu Mittag zurückkam, war er friedlich, aber er weigerte sich, etwas zu erzählen. »Ach, was soll so Besonderes sein! Schuljungen sind Schuljungen, auch wenn sie Prinzen heißen!«
Auf die Dauer änderten sich aber seine Reden. Einmal sagte er: »Je länger ich den Prinzen Unterricht gebe, desto lieber gewinne ich sie, besonders den Kronprinzen Georg. Das ist ein richtig guter Junge, nicht in seinen Schulleistungen – da ist er eher schlecht –, aber als Mensch. – Wenn er nur nicht von diesem Baron O’Byrn so dressiert würde! – Übrigens sagt da neulich der Kronprinz in der Pause: ›Morgen habe ich Geburtstag, da will ich aber Kuchen fressen!‹ O’Byrn hört das und sagt: ›Prinz, woher haben Sie diesen Ausdruck?‹ – ›Von Papi.‹«
Als dann das Frühjahr kam, wurde meinem Vater oft aus dem Schlosse abtelefoniert. Die Prinzen hatten Heuschnupfen. »Und wißt ihr«, rief mein Vater, »wie man sie behandelt? Da werden Pfaffen geholt und müssen vor ihnen beten, so eine Art Teufelsaustreibung. Ich weiß wirklich nicht, wozu es eine Medizin gibt!«
»Vielleicht«, erwiderte meine Mutter still, »ist das gar nicht so dumm. Der Heuschnupfen ist doch nichts als eine Überempfindlichkeit. Das aber ist an sich eine positive Eigenschaft, nur sehr störend in einer so gröblichen Gesellschaft wie unsrer.«
»Mittelalterliche Narrenpossen!« rief mein Vater. »Was hat denn die Empfindlichkeit der Schleimhäute mit der Grobheit oder Feinheit der Gesellschaft zu tun?«
»Doch vielleicht etwas«, sagte Viktor. »Die Gedanken der Menschen sind es, die sich auf den übertragen, der besonders fein und empfänglich ist. Und unsaubere Gedanken erzeugen die Empfindlichkeit.«
Mein Vater sah Viktor an und zog die Brauen hoch. »Ich glaube nicht an geistige Einflüsse. Wir denken mit dem Gehirn, und das ist materiell. Geist gibt es nicht.«
»Die Materie«, sagte Mama, »ist eine Illusion. Es gibt nur Geist und keine Materie.«
»Dagegen kann ich nichts mehr sagen«, erwiderte mein Vater lächelnd. »Wenn du diese philosophische Auffassung hast, ist es natürlich auch richtiger, den Heuschnupfen zu besprechen. Aber ich gehe zum Arzt.«
Nach dem Essen rief ich unsern Pudel. Er kam, weiß und wollig, angeschossen und hatte seinen Maulkorb in der Schnauze. Dazu hatte ich ihn abgerichtet. Draußen schnüffelte er an den Bäumen, während ich die Straße entlangmarschierte und dabei die Arme besonders stark schwang. Das erschien mir männlich, weil ich es immer an den Soldaten sah, die in unsrer Gegend herumwimmelten.
Auf der Schillerstraße kam eine Kutsche angefahren, auf deren Bock ein Hofkutscher und der königliche Leibjäger saßen, der eine mit hohem, hellem Zylinder, der andre mit grünem Federbusch. Ich blieb stehen und zog meine Mütze. Der König, in Zivil, nickte lachend, und die drei Prinzen winkten mit beiden Händen zum Wagen heraus. Auch die drei Prinzessinnen benahmen sich höchst ausgelassen. Natürlich galt der Gruß nicht mir. Es war bekannt, daß der König es liebte, sich mit seinen Kindern zu zeigen, und daß sie dabei recht ungezwungen waren.
Eines Tages war er allein in den Wald hinausgefahren, hatte seine Kutsche an einer Wegbiegung stehenlassen und war weitergegangen. Da sah er einen Fleischerwagen, der ein Rad verloren hatte. Er unterhielt sich mit dem Mann, während der an seinem Rade arbeitete, und fragte ihn nach dem Gang seines Geschäfts. Als der Fleischer mit der Reparatur fertig war und abfahren wollte, fragte er den König: »Sie sin wohl och Fleescher?«
»Nee, ich sehe nur so aus.«
Bei einer seiner sogenannten Landesreisen hatte der König eine Textilfabrik besichtigt. Zum Schluß stellte ihm der Besitzer einen jungen Mann vor und sagte mit einer Verbeugung: »Und dies, Euer Majestät, ist mein Sohn.«
»Und neues Leben blüht aus den Ruinen«, sagte der Monarch heiter.
Als er dann in seinen Wagen einstieg, sah er, daß am Straßenrand drei Herren in schwarzen Gehröcken standen. Sie hatten alle Bäuche und warteten, den Zylinder in der Hand, darauf, angeredet zu werden. Er gab das Zeichen zum Abfahren, beugte sich aber noch einmal heraus und sagte wohlgelaunt: »Na, ihr drei Dicken?« Und fuhr ab.
Das waren alles Geschichten, die unter den Offizieren umgingen, welche bei meinen Eltern verkehrten. Mein dicker Onkel Hans von Welck erzählte besonders gern, wie sich der König eines Tages in einem Dorfe rasieren ließ. Der Barbier war so aufgeregt über die Ehre, die ihm widerfuhr, daß ihm die Hände zitterten und er den hohen Kunden in die Backe schnitt.
»Das kommt vom vielen Saufen«, sagte der König und meinte das Handzittern. »Ja«, erwiderte der Barbier, »davon wird die Haut so spröde.«
Ich begann um diese Zeit, mich für die Kunst zu interessieren, und besuchte die vielen Dresdner Museen, meistens allein. Ich ging auch in die Orgelkonzerte in der Kreuzkirche, wo ich mich möglichst auf die höchste Empore setzte, um die Fugen und Toccaten zu hören. Oft auch streifte ich an schulfreien Nachmittagen durch die Stadt auf der Suche nach alten Bauten, vor allem aus der Zeit Augusts des Starken. Dabei kam ich eines Tages auf die Schloßstraße, wo über dem gewölbten Georgentor der König wohnte. Dahinter lag rechts die düstere Seitenfront des Schlosses, vor dessen Eingang in einer über und über betreßten Livree ein ungeheuer großer und dicker Mann stand. Er stützte sich auf einen langen Stock mit einer großen goldnen Krone darauf. Dieser Mann wurde von allen Kindern bewundert, wie er da mit der ganzen Würde seines reichgeschmückten Bauches stand, und man erzählte sich, daß Jungen vom Lande scheu vor ihm die Mütze zogen, weil sie dachten, es wäre der König, der da mit seinem riesigen Zepter aus dem Schloß getreten wäre, um sich seine Untertanen ein bißchen anzusehen. Ich in meinem halbwüchsigen Alter sah ihn natürlich überhaupt nicht an, um nicht in den Verdacht zu kommen, ich wüßte nicht, wer das wäre. Sondern ich ging zu dem großen Schaufenster der Kunsthandlung Arnold gegenüber, die an dieser bevorzugten Stelle ihre Bilder und Plastiken zeigte. Ein Offizier stellte sich neben mich. Als ich mich nach ihm umsah, war es der König in Generalsuniform, der wirklich aus seinem Schloß getreten war, um sich die Schaufenster anzusehen. Ich war erzogen, ihn zu grüßen. Aber auf so nahe Entfernung, das kam mir vertraulich vor. Was konnte sich der König für irgendeinen Schuljungen interessieren? Da ging er zum nächsten Schaufenster, und ich floh befreit um die Straßenecke.
Im übrigen galt er nicht gerade für kunstverständig. Seine Vorliebe beschränkte sich auf Bilder, wo im morgendlichen Walde Hirsche röhren. Wenn man dann auch noch den Hauch des Hirsches als kleinen Nebel sah und das Tier recht viele Enden an seinem Geweih hatte, so war das für den König Kunst.
Dagegen malte eine seiner Schwestern, die dicke und häßliche Prinzeß Mathilde, und zwar gut. Nahe unsrer Wohnung führte ein Reitweg in den Wald hinaus. Da sah ich sie oft mit ihrem Kammerherrn, dem Grafen Wilding, vorbeireiten. Oder besser gesagt, ich hörte sie. Denn sie pflegte sich schallend mit dem Grafen zu unterhalten. Er war das rechte Gegenteil zu ihr, äußerst liebenswürdig und schon zu fein in seinem Gang und seinem Benehmen.
Als einmal der dicke Onkel Welck bei uns zu Abend aß, erzählte er, daß die Prinzeß Mathilde bei ihm gewesen wäre, um ein Pferd zu kaufen. Der Onkel wog an die drei Zentner und hatte natürlich Pferde, wie man sie sonst nur auf alten Denkmälern sieht.
»Und hat sie ein Pferd gekauft?« fragte Viktor.
»Nein«, sagte der Onkel listig, »sie waren ihr alle zu kurz.«
Berufswahl
Ich besuchte das Königliche Gymnasium, und manche meiner Mitschüler bildeten sich genug auf den Namen und die blau-goldne Mütze ein. Aber ich empfand Haß gegen die klassische Bildung, und vor allem gegen das Lateinische.
Auch mein Vater sprach mit Verachtung von den hochmütigen und vertrottelten Altphilologen. Übrigens hat es auf diesem Gymnasium während meiner ganzen Schulzeit nie einen einzigen Juden gegeben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























