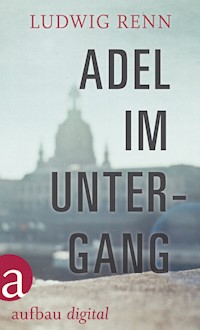9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Als Ludwig Renn im Oktober 1936 in Barcelona ankommt, will er nicht nur der spanischen Republik helfen, er hat auch die unersetzlichen Erfahrungen des Weltkriegsoffiziers im Gepäck. Er wird zum Stabschef der 11. Internationalen Brigade ernannt, bewertet das Kriegsgeschehen mit bestechender Genauigkeit und handelt danach. Aus dem Exil in Mexiko zurückgekehrt, beschreibt der Schriftsteller und Offizier seine spanischen Erlebnisse und Erfahrungen später so genau wie kaum ein anderer.
In der ursprünglichen Form durfte das wahrhaftige Buch dazumal nicht veröffentlicht werden. Jetzt ist es endlich erschienen: ungekürzt und unzensiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 948
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ludwig Renn
Der Spanische Krieg
Dokumentarischer Bericht
Mit einem Vorwort von Günther Drommer
Informationen zum Buch
Als Ludwig Renn im Oktober 1936 in Barcelona ankommt, will er nicht nur der spanischen Republik helfen, er hat auch die unersetzlichen Erfahrungen des Weltkriegsoffiziers im Gepäck. Er wird zum Stabschef der 11. Internationalen Brigade ernannt, bewertet das Kriegsgeschehen mit bestechender Genauigkeit und handelt danach. Aus dem Exil in Mexiko zurückgekehrt, beschreibt der Schriftsteller und Offizier seine spanischen Erlebnisse und Erfahrungen später so genau wie kaum ein anderer. – In der ursprünglichen Form durfte das wahrhaftige Buch dazumal nicht veröffentlicht werden. Jetzt ist es endlich erschienen: ungekürzt und unzensiert.
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Die Front war so still, daß ich den einzelnen Schuß hörte Vorwort von Günther Drommer
Schwere Nachrichten
Durch Frankreich nach Barcelona
Bei der PSUC in Barcelona
Im Gefängnis
Die Entführung
Der Sturm auf die Kasernen
Die Centuria Thälmann im Oberen Aragon
Madrid
Aufstellung des Bataillons Thälmann
Kämpfe um den Cerro de los Angeles
Kämpfe um Palacete
Umformierung der Elften Brigade
Schlacht bei Las Rozas
In Murcia
Der Zusammenbruch von Málaga
Schlacht am Jarama
Schlacht bei Guadalajara
Ereignisse an anderen Fronten
Gegen die Schädlinge
Die Front wird lebhafter
Der antifaschistische Kongreß in Valencia und Madrid
Schlacht bei Brunete
Am Mittelmeer
Im offiziellen Auftrag in den Vereinigten Staaten
Trotz Sprechverbots in Havanna
Die faschistische Aragon-Offensive
Die Feldwebelschule von Cambrils
Die Internationalen werden zurückgezogen
Der Zusammenbruch Kataloniens
Im französischen Konzentrationslager
Der Verrat besiegt Spanien
Über Ludwig Renn
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Die Front war so still, daß ich den einzelnen Schuß hörteVorwort von Günther Drommer
In dem spanischen Land
In dem Unterstand
Sitzen unsre Genossen.
An dem Grabenrand
Wo der Posten stand
Ward ein Kamerad erschossen.
Blutig sank er hin
Doch in unserm Sinn
Gab und gibt es nie ein Wanken.
Nach der Freiheit hin
Nach der Freude hin
Ziehen alle die Gedanken.
So kann es gewesen sein: Ludwig Renn hat diese zwölf Zeilen auf dem Kongreß zur Verteidigung der Kultur 1937 in Madrid während einer Pause aufgeschrieben. Er reicht Hanns Eisler den Zettel, der vertont die Worte, gibt Text und Melodie an Ernst Busch weiter und übt am Flügel beides mit ihm ein. Und dann singt Busch mit unvergleichlicher Stimme das kleine Lied, eindringlich, voller Wehmut und Zuversicht.
Es wird bleiben für alle Zeiten, und wer es je gehört hat, weiß alles über die Interbrigadisten im Spanischen Krieg, weiß alles über die Gefühle dieser Menschen. Weiß, warum weder die Soldaten des Putschgenerals Franco, noch die Nazi-Legion Condor oder Mussolinis italienische Interventionstruppen dieses Lied überwältigen konnten.
Hat die Spanische Republik, von heute her gesehen, siebzig Jahre nach Francos Revolte, überhaupt eine Chance gehabt?
Einerseits trieb terroristisches Unrecht, dem die unvorstellbar hart arbeitenden Bauern und Industriearbeiter ausgesetzt waren, das Geschehen an, verfehlte die jahrhundertealte, zuletzt in schrecklicher Weise aktualisierte tödliche Grausamkeit der Putschisten, ihrer Hinterleute und Sympathisanten in Staat und Kirche ihre Wirkung nicht.
Auf der anderen Seite staute sich die daraus resultierende Wut, wuchsen die Hoffnung und die überlegene Würde einer festen Solidarität, der die Vision einer gänzlich neuen und besseren Art zu leben entsprang. Die Volksfront aller zur Verteidigung der rechtmäßig gewählten Regierung zusammengeschlossenen Parteien, Organisationen und Gruppierungen war brüchig seit Beginn. Ziele, Vorstellungen und Methoden gingen weit auseinander und entsprachen allesamt nicht den durch die Vergangenheit Spaniens bestimmten Möglichkeiten. Aber wer von den Unverzagten, die damals den Traum von der gerechteren Welt träumten, konnte und wollte wissen, was wirklich möglich war?
Als die Chance noch bestand, wirkungsvoll gegen Franco vorzugehen, war die Republik mangelhaft befähigt, unentschieden und viel zu langsam. Traditionelle Bürokratie hemmte ihre organisatorische Leistungsfähigkeit, und ihre militärische Kraft war eingeschränkt durch eine überlieferte Methodik der Kriegsführung des 19. Jahrhunderts ohne die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, worüber die Hilfstruppen Francos, Nazi-Deutsche und Italiener, in reichem Maße verfügten.
Mit seinen unterschiedlichen nationalen und internationalen Interessen nimmt das Ausland Einfluß auf das spanische Geschehen: Hitler und Mussolini unterstützen die Putschisten mit brachialer Gewalt, Hitler mit Flugzeugen und modernen Waffen, die einer letzten Übung mit scharfem Schuß vor dem Beginn des längst geplanten Zweiten Weltkriegs unterzogen werden. So läßt zum Beispiel Hermann Göring in Guernica als erster genau jenes System Flächenbombardement an wehrlosen baskischen Zivilisten ausprobieren, das er dann im Kriege perfektioniert, bis Engländer und Amerikaner es schnell gelernt haben und acht Jahre später in Dresden so überaus effektiv beherrschen. Mussolini schickt vor allem Infanterie-Einheiten in gewaltiger Zahl, Franco selbst bedient sich ihm in beträchtlicher Truppenstärke unterstellter und mit äußerster Grausamkeit kämpfender Marokkaner.
Die beiden Völkerbundmächte Großbritannien und Frankreich nennen Nichteinmischung, was in Wahrheit Unterstützung Hitlers und Mussolinis bedeutet. Die Republik kauft Waffen, Frankreich sperrt die Landgrenze, England und Deutschland blockieren die Seeverbindungen. Katalonien fällt auch deshalb, weil es der Regierung in Valencia unmöglich gemacht wird, Waffen in diesen kleineren Teil der Republik zu bringen.
Die inzwischen ganz und gar unter Stalins despotische Herrschaft geratene Sowjetunion will das ferne Land am anderen Ende Europas nach eigenem Muster umgestalten. So endet zum Beispiel der schwierige Umgang mit den selbstbewußten, sich militärischer Disziplin oft nur widerwillig unterwerfenden Anarchisten nach deren Aufstand von Barcelona in einem erbarmungslosen, maßgeblich von der GPU organisierten Kampf, zu dessen Vorgeschichte allerdings auch der ebenso blutige Schaden gehört, den bestimmte anarchistische Kreise der ums Überleben kämpfenden Republik zugefügt hatten.
Abgesehen von jener kleinen Gruppe von Parteibeauftragten und Agenten, die auf direkten Befehl des Stalinschen Apparats und dessen Geheimpolizei handeln, haben sich Tausende Ausländer in Spanien eingefunden. Sie sind gekommen, um der Republik militärisch beizustehen: aus Idealismus, Gerechtigkeitssinn, Solidaritätsgefühl, mancher auch, um in dem von Wirtschaftskrisen oder Terror geschüttelten Europa einfach zu überleben, kaum einer aus reiner Abenteuersucht.
Vor allem von den in den Schlachten verwundeten und gefallenen Männern, Spaniern und Internationalen, von den fähigen Befehlshabern des spanischen Volksheeres, von Politikern, von Bauern und Arbeitern, Frauen und Männern handelt Ludwig Renns authentischer Bericht über den Verlauf des Spanischen Krieges. Mit der Qualifikation eines erfahrenen deutschen Weltkriegsoffiziers ist er dessen handelnder Zeuge – vom weitgehend unorganisierten Anfang bis zum bitteren Ende.
Als Stabschef der Elften Internationalen Brigade unter dem Kommando von Hans Kahle, zeitweise selbst als Kommandeur, als Chef einer Feldwebelschule, aber auch als Beauftragter der Spanischen Republik in den USA und in Kuba sammelt er Eindrücke und Erfahrungen an vielen Fronten dieses Krieges von den ersten chaotischen Tagen der Verteidigung Madrids im Winter 1936/37 bis zur Ankunft im französischen Internierungslager Saint Cyprien Anfang Februar 1939.
Seine Aufzeichnungen bestechen durch Detailgenauigkeit in den Beobachtungen und schonungslose Analyse des militärischen Verhaltens direkt an der Front. Fast durchgängig berichtet er selbst leidenschaftslos, der Leser wird aber die mitgeteilten Ereignisse nicht ohne innere Anteilnahme zur Kenntnis nehmen. Renn teilt nur das mit, was er ganz genau zu kennen glaubt. Trotzkisten sind damals für ihn Verräter, deshalb nennt er sie verallgemeinernd auch so. Als Soldat zieht er Vertrauen in Vorgesetzte intellektueller Skepsis vor. Anarchisten sind tapfer wie alle anderen Soldaten auch, manchmal behindern manche ihrer Führer den erfolgreichen Abschluß einer immerhin auf Leben oder Tod hinauslaufenden militärischen Auseinandersetzung mit dem Feind. Der Offizier Renn ist im Krieg an ein durch Befehl und Gehorsam reguliertes Leben als Voraussetzung für jedweden militärischen Erfolg gewöhnt. Als Stabschef hat er auf einfache Dinge zu achten: Soldaten werden nicht von Reden satt, sie brauchen vor der Schlacht eine warme Suppe.
Wenn ein grobschlächtiger Kommandeurstyp ohne wirkliche Erfahrung wie der vermutlich im Moskauer GPU-Auftrag handelnde Richard Staimer Feigheit zeigt und den Spaniern gegenüber Arroganz, dann spricht Renn offen und ohne ängstliche Rücksicht darüber. Warum soll er aber gegenüber jenen russischen Beratern, die er im Kampf kennenlernt, Vorbehalte haben, wenn dazu kein Grund besteht? – Allerdings gibt es in Renns Aufzeichnungen eigenartige Löcher: Hans Beimler, den Beauftragten der KPD für alle Deutschen in den Internationalen Brigaden, trifft Renn gleich am Anfang in Barcelona. Sie teilen das Zimmer, fahren gemeinsam in die vordersten Linien. Renn verehrt Beimler ob seines Mutes und schätzt dessen Gerechtigkeitsempfinden. Beimler seinerseits achtet die militärischen Kenntnisse, das Organisationstalent, den Ordnungssinn des Weltkriegsoffiziers und schärft Renn ein, sich zum Nutzen der Spanischen Republik nur in einer seinem Können entsprechenden Funktion einsetzen zu lassen.
Am 1. Dezember 1936 fällt Beimler vor Madrid. Die Schilderungen von seinem Tod sind zwiespältig. Renn bleibt in der seinen auffällig zurückhaltend, er erwähnt Beimler danach an keiner Stelle mehr.
Staimer nennt in seinem Bericht Hans Beimler, Louis Schuster (Fritz Vehlow) und sich selbst. Beimler, so berichtet Staimer, wird bei der Rückkehr von den vorderen Linien am frühen Morgen, als sie zu dritt einen kleinen Abhang hinunterrennen, von einer feindlichen MG-Salve tödlich getroffen, »dreht sich einmal wie ein Kreisel um seine eigene Achse« und ruft dreimal »Rot Front«. Schuster und Staimer laufen an Beimler vorbei in Deckung, dann gehen beide zu Beimler zurück, rufen einen Sanitäter. Als der kommt, legen sie Beimler auf eine Trage. Jetzt läuft Staimer los, um eine Ambulanz zu holen. Der Sanitäter erhält einen Schuß in den Arm, Schuster wird, wie Beimler, tödlich getroffen.
Im Augenzeugenbericht von Tomas Calvo Cariballos, des Fahrers von Beimler, den Staimer gar nicht erwähnt, findet das Geschehen am Nachmittag statt, und Staimer kommt in ihm überhaupt nicht vor.
Ludwig Renn schreibt nur knapp: »Nach einiger Zeit erfuhr ich Genaueres: Richard [Staimer], der vorläufige Führer des Bataillons Thälmann, war mit den beiden Politkommissaren Beimler und Louis Schuster nahe dem Gehöft Palacete vorgekrochen, als zwei Schüsse fielen. Beimler soll: ›Rot Front!‹ gerufen haben und regte sich nicht mehr. Aber auch der gute, milde Louis Schuster war gefallen.«
Wer hat Renn berichtet? Staimer doch offenbar nicht, obwohl Renn zu dieser Zeit als Stabschef der Elften Brigade einer von seinen zwei unmittelbaren Vorgesetzten ist. Sonst könnte doch Renns Mitteilung über diesen bedeutendsten Toten unter den Deutschen in Spanien nicht so lapidar sein. Selbst wenn Renn vermutet, daß Staimers veröffentliche und damit gewissermaßen amtliche Schilderung von Beimlers Ende nicht der Wahrheit entspricht, wie soll er das beweisen, zum Zeitpunkt kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als er sich mit dem Manuskript beschäftigt und Staimer inzwischen zum Chefinspekteur der Volkspolizei des Landes Brandenburg aufgestiegen ist? Und wenn Staimer tatsächlich im Auftrag des KGB in Spanien war und vielleicht sogar an Beimlers Tod nicht völlig unschuldig, wer verschafft ihm Gewißheit? Alle, die später die Geschichte vom KGB-Agenten erzählen, der Beimler hinterrücks erschossen haben soll, sind bis heute jeden handfesten Beweis schuldig geblieben. Renn jedenfalls reiht sich in den Kreis dieser »Zeugen« nicht ein, weil auch ihm Beweise fehlen. – Renn schreibt nur auf, wessen er sich sicher ist, das macht ihn unbeliebt bei den einen wie bei den anderen: Für die einen sagt er zu viel, für die anderen zu wenig, der Leser dieses Buches wird es selbst bemerken.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch Gustav Regler, Kriegskommissar der Zwölften Brigade, später in gegenseitiger erbitterter Feindschaft mit den deutschen Kommunisten im Exilland Mexiko lebend.
Bei dem Versuch, die Stadt Huesca nördlich von Zaragoza zu nehmen, wird General Lukácz (Maté Zalka) am 17. Juni 1937 in seinem Auto tödlich verwundet. Wenn man Reglers Beschreibung folgt, so geschah das durch eine feindliche Granate, die einschlug, als »wir gerade an den anarchistischen Bataillonen vorbeifuhren. Unser Auto wurde hochgehoben, dann mit einem Ruck wieder hingesetzt.« Als Renn, der schon im Weltkrieg spezielle Erfahrungen mit dem Flug von Granaten gesammelt hatte, das las, wird er gezweifelt haben: Granaten, von einem tiefer gelegenen Standort abgeschossen, treffen stets von oben, entweder schlagen sie in ein Auto ein und zerfetzen es, oder sie explodieren daneben, dann schleudern sie es horizontal davon. Unter einem Auto explodieren und es dadurch hochschleudern können sie nicht.
Eine Bombe oder ein Bündel Handgranaten könnten allerdings aus einer Position direkt neben dem Auto leicht unter das Fahrzeug geworfen oder geschoben werden und die von Regler geschilderte Wirkung auslösen. Übrigens heult in Reglers Bericht die nächste Granate ballistisch korrekt dann über das zerstörte Auto hinweg.
Renn, der mit Lukácz lange militärisch zusammengearbeitet hatte, schildert das folgenreiche Ereignis so: »Bald erfuhren wir genauer, was geschehen war. Lukácz hatte den Auftrag, zusammen mit katalanischen Truppen die Stadt Huesca nördlich Zaragoza einzunehmen. Der Abschnittskommandeur der dortigen Front war der Führer der POUM-Truppen [Kerntruppen der Anarchisten]. Lukácz zeigte ihm die Karte und fragte, wie es mit der Besetzung der Vorberge der Pyrenäen stünde, die sich bis dicht nördlich an Huesca heranzogen.
›Dort stehen keine Faschisten‹, sagte der POUM-Führer obenhin. ›Man kann da einfach durchmarschieren.‹ Als die Stunde des Vorstoßes kam, weigerten sich die trotzkistischen und die anarchistischen Truppen, aus ihren Gräben herauszugehen und anzugreifen. Dadurch lag die ganze Last des Angriffs auf der Zwölften Brigade. Der General selbst fuhr im Auto eine Straße entlang, in deren Nähe angeblich keine Faschisten standen. Er bekam plötzlich Feuer [!] und war sofort tot, seine Begleiter ebenfalls zum Teil, zum anderen verwundet. Auch die Truppen erlitten schwere Verluste und mußten sich zurückziehen. Der POUM-Führer hatte den General Lukácz und seine Truppen absichtlich dorthin geschickt, wo sie umkommen mußten.«
Besteht die Möglichkeit, daß Gustav Regler, der später einen durchaus nachvollziehbar antikommunistischen politischen Standpunkt einnimmt, in seiner resümierenden Lebensgeschichte »Das Ohr des Malchus« eine bestimmte Teilschuld von den Anarchisten wegzunehmen bemüht ist, um die Schuld der Kommunisten in deren Verhalten den Anarchisten gegenüber größer zu machen?
Wie wichtig wäre einst eine sachliche Diskussion der Vorgänge gewesen, aber – von den politischen Bedingungen in der frühen DDR und im Westen abgesehen – wie sollte Renn auf eine süffisante Hören-Sagen-Verleumdung Reglers reagieren, die ihn ausgerechnet bei seiner damals längst bekannten Homosexualität zu treffen sucht. Stabschef Renn sei 1938 von dem »Parteimann« Franz Dahlem (immerhin Nachfolger Beimlers in Spanien) und Staimer bei großer Hitze nackt mit einem »spanischen Ganymed« in einer irgendwie zweideutigen Situation in seinem Zelt überrascht worden. Diese von Regler veröffentlichte sogenannte »groteske Anekdote« ist ebenso billig wie unwürdig.
Nach seiner Amerika-Reise ist Renn im Sommer 1938, für den Regler seine Geschichte datiert und die mitzuteilen ihn »spanische Freunde gebeten« haben, gar nicht Stabschef, und in Cambrils, wo er in einem Steinhaus wohnt, hat er mit Staimer nicht das geringste zu tun.
Sollte Regler allerdings das Jahr 1937 meinen (ein dritter Sommer käme nicht in Frage), so hat Stabschef Renn tatsächlich in den heißen Tagen von Brunete (als Staimer im sicheren Hinterland seine Magenbeschwerden kurierte) mit kühlem Kopf seine tapferste Schlacht geschlagen. Um ihn herum begannen, außer dem umsichtigen jungen österreichischen Leutnant Helfeldt mit seinen Soldaten, alle zurückzugehen. Da hat Renn tatsächlich in großer Hitze mitten im Kampf zwar nicht seine Hose, wohl aber sein Hemd ausgezogen, es vergessen und am Abend nicht wiedergefunden. Für eine Lesung aus Platons »Symposion« in spanischer Sprache wird er wohl kaum Zeit gefunden haben.
In einer dieser stillen Nächte, die damals auf jeden der heißen Tage folgten, wird jener Holländer erschossen, der aus Feigheit fliehen wollte, um dessen Begnadigung alle anwesenden Spanier bitten und der seine Verurteilung selbst akzeptiert. – Man lese die Stelle und bedenke Reglers bösartiges Urteil auch über Renns angeblichen literarischen »Stilzerfall«.
Regler kann in seiner »Anekdote« mit kolportagehafter Leichtigkeit einen Feldstuhl, ein Thermometer, eine Entfernung zwischen den beiden angeblich nackten Männern von genau drei Metern, das Symposion von Platon (auf spanisch) und einen wutschnaubenden Dahlem hinzuerfinden. Aber waren die »spanischen Freunde« selbst dabei, als Dahlem und der magenkranke Staimer »in das Zelt ihres Opfers« eindrangen?
Renn vermag in einer solchen Art nicht zu erzählen. Hingegen stimmen bei ihm nicht nur die Zeitangaben, er läßt uns auch mit großer Sachkenntnis militärische Abläufe und vor allem die nicht selten lebensbedrohenden Schwierigkeiten, den Heldenmut und den Alltag der Freiwilligen in jenen Jahren nachempfinden.
Das kann er als Schriftsteller und Militär wie kaum ein anderer der zahlreichen Spanienberichterstatter. – Ohne falsches Pathos und ohne papierenen Haß.
Als Renn im Sommer 1935 nach anderthalbjähriger Haftzeit aus dem Zuchthaus Bautzen entlassen wurde und es den Nazis nicht gelungen war, ihn für ihre Reichsschrifttumskammer anzuwerben, kam er bei einem seiner Anwälte in Caputh in der Nähe von Potsdam unter, ehe ihm die Nazis die Auflage erteilten, sich unter seinem eigentlichen Namen, Arnold Vieth von Golßenau, ausschließlich im badischen Land, weit entfernt von der Reichshauptstadt, aufzuhalten. Renn läßt sich in Überlingen am Bodensee nieder, von wo aus ihm auf einem Fischerboot die Flucht in die Schweiz gelingt.
In Davos lebte er mit dem an Tuberkulose schwer erkrankten Freund Reinhard Schmidthagen zusammen. Wie auf Thomas Manns »Zauberberg« – so hat es den Anschein. Wie oft in seinem Leben, muß er auch jetzt mit großen materiellen Schwierigkeiten kämpfen. Er arbeitet an seinem authentischen Roman aus Nazideutschland »Vor großen Wandlungen«, ehe er sich, gleich nach dessen Veröffentlichung bei Opprecht in Zürich, im Oktober 1936 auf den Weg nach Spanien macht.
1947 kehrt Renn aus mexikanischem Exil nach Deutschland zurück. Er geht in die sowjetische Besatzungszone und erhält in seiner Geburtsstadt Dresden eine Professur an der Technischen Hochschule. Dort beginnt er, seine Erinnerungen an den Spanischen Bürgerkrieg aufzuschreiben. Es soll eine Art persönlicher Chronik werden. 1950 wird er, der Schriftsteller, Kunstwissenschaftler und Militärhistoriker, zum Mitglied der Akademie der Künste der DDR berufen. Er siedelt nach Berlin über und bereitet das Manuskript für den Aufbau-Verlag zum Druck vor. Verlagsleiter ist zu dieser Zeit Walter Janka, Renns Freund aus der Emigrationszeit in Mexiko.
Janka, im Spanischen Krieg ebenfalls Offizier auf republikanischer Seite, hatte zuvor schon Renns Weltbestseller von 1928 »Krieg«, das dazugehörige Buch »Nachkrieg« und den in Mexiko geschriebenen Roman »Adel im Untergang« neu herausgebracht.
Nach Abschluß der Lektoratsarbeiten werden Aushänger vom »Spanischen Krieg« gedruckt und auf Renns Wunsch verschiedenen Parteistellen, Behörden und in hohe Parteiämter aufgestiegenen ehemaligen Teilnehmern des Spanischen Bürgerkriegs zur Kenntnis gegeben. – Andere, die ebenfalls dabei gewesen waren, sollen vorab wissen, was Renn über die spanischen Jahre zu sagen hat.
Die unerwartete Kritik ist so heftig, daß die Fertigstellung des für Ludwig Renn überaus wichtigen Buches aufgegeben werden muß. Entwürdigende Belehrungen gegenüber dem loyalen Autor über das, was mitgeteilt werden sollte und was nicht, schließen sich an.
Der tiefenttäuschte Renn weigert sich heftig, das Buch umzuschreiben. Aber das Thema ist ihm so nahe – es ist ja die beste Zeit seines Lebens, um die es geht –, daß er sich, um sein Buch zu retten, am Ende zu Streichungen und Hinzufügungen bereitfindet.
Als der Bericht 1955 dann endlich in der DDR erscheinen kann, hat er nicht nur einen anderen Titel – er heißt mit der vierten Nachauflage einschränkend »Im Spanischen Krieg« –, Ludwig Renn selbst hat ihn inhaltlich verändert und in seinem Umfang beträchtlich reduziert. Auch fast alle Namen von Personen, die dazumal im öffentlichen Leben der DDR eine Rolle spielten, hat er selbst aus der neuen Druckfassung herausgenommen.
Zur Rekonstruktion des ursprünglichen Manuskriptes, das nun, nach mehr als einem halben Jahrhundert, ungekürzt veröffentlicht werden kann, standen dem Herausgeber ein nicht leicht lesbarer letzter Durchschlag des Originalmanuskriptes, wie es der Autor mit seinen eigenen handschriftlichen Korrekturen einst in den Verlag gegeben hatte, ein Exemplar der erwähnten Aushänger in der ursprünglichen Fassung, ein zweites mit allen Ergänzungen und Streichungen und natürlich das veröffentlichte Buch zur Verfügung. Grundlage dieser Ausgabe ist die von Ludwig Renn ursprünglich zum Druck in den Verlag gegebene Fassung.
Für die Bereitstellung aller Materialien danken Herausgeber und Verlag Herrn Jürgen Pump, dem Alleinerben Ludwig Renns.
Schwere Nachrichten
Es war im Juli des Jahres 1936. Vor einem halben Jahr war ich noch in Deutschland gewesen, nicht mehr eingesperrt, aber auch nicht richtig frei. Da hatte mir die heimliche Leitung der Kommunistischen Partei sagen lassen: »Du bist in Deutschland nicht mehr sicher. Versuche ins Ausland zu kommen!«
Nun war ich in der Schweiz, in einem ihrer schönsten Teile am Luganer See, dicht an der Grenze Italiens. Da hatte ich ein Buch über die ersten Jahre der Hitlerherrschaft geschrieben. Das befand sich nun im Druck, und ich empfand mit Unruhe, daß ich nicht dauernd im schönen Tessin bleiben konnte, sondern irgendwohin mußte, wo der Kampf gegen Hitler aktiver geführt wurde.
Wie jeden Tag, so ging ich heute, für den jungen Maler Reinhard Schmidthagen Milch zu holen und kaufte mir dabei eine Zeitung. Es war so warm, daß die Burschen des Dorfes schon am frühen Morgen nur mit Hose und Sandalen herumgingen und ihre braunen Oberkörper von der Luft umspülen ließen.
Ich fand Reinhard in der kleinen Küche am Herde. Auf einen Stuhl hatte er ein angefangenes Bild gestellt.
»Ich möchte es jetzt nicht weiter malen«, sagte er. »Ich werde mich gleich wieder hinlegen.«
Er konnte eben erst aufgestanden sein. Seine Augen waren müde und hatten blaue Ringe. Er war knapp über zwanzig. Vorgestern waren wir nachmittags ausgegangen, nur bis in die Mitte des Dorfes. Da es im Café keine Milch für ihn gab, nippte er an einer Tasse Kaffee. Während er vorher lebhaft mit einer Malerin gesprochen hatte, wurde er plötzlich ruhig. Er zog sein Taschentuch heraus, wischte sich den Mund und faltete es rasch zusammen. Aber ich bemerkte doch, daß ein roter Fleck darin war. Schon zweimal hatte er Blutstürze gehabt.
Beim letzten telegrafierte man seinen Eltern nach Deutschland.
Im Bemühen, ihn nicht merken zu lassen, was ich dachte, blickte ich in die Zeitung und erschrak: Gestern, am 18. Juli, hatten sich in Spanien die Generale gegen die republikanische Regierung erhoben.
Ich las das Reinhard vor. »Ach ja«, sagte er, »gestern hat mir mein Arzt gesagt, daß die spanische Regierung schwere Fehler macht. In ihrer liberalistischen Blindheit hat sie die faschistischen Offiziere nach Marokko versetzt. Als dann dem Ministerpräsidenten Giral berichtet wurde, daß diese Offiziere dort ganz offen faschistische Propaganda betrieben und sich zum Aufstand vorbereiteten, da bestellte er sich einen der Generale nach Madrid und soll ihm gesagt haben: ›Sie bereiten sich doch nicht zum Aufstand vor?‹ Natürlich versicherte darauf der General, er täte das nicht. Weiß man nicht aus der Geschichte, wie Generale und Fürsten zu lügen verstehen! – Wenn ich nur verstünde, ob ein Mann wie Giral so saudumm ist oder einfach ein Verräter! Aber wie kann man das Bürgertum überhaupt noch verstehen?«
Reinhard war sehr lebhaft geworden, erregter als ihm gut tat. Daher sagte ich: »Leg dich hin! Ich werde das Geschirr abspülen.«
Er ging auch gleich ins Nebenzimmer und lag dann im Bett, ohne sich zu rühren.
Nach dem Abtrocknen des Geschirrs ging ich hinaus in die Wärme des Sommermorgens. Ein Ziel hatte ich nicht, sondern die Unruhe trieb mich. Über Weinberge und Hügel weg sah ich weit unten einen Schimmer. Das war die Fläche des Sees. Im Sonnendunst war sie nur zu ahnen. Die Berge standen in weichen Farben da.
Wie viele Deutsche wären froh, auch nur einmal in ihrem Leben einen solchen südlichen Sonnenglanz zu sehen. Wir aber hier, die Begünstigten, können uns nicht freuen. Reinhard kann es nicht, denn seine Krankheit verbietet ihm, in die Sonne zu gehen, ihm, dem jungen, schönen Menschen. Und er leidet auch noch, so wie ich, darunter, daß drüben in Deutschland Hitler herrscht und alle Menschen, die uns lieb waren oder an deren Zukunft wir glaubten, unter der Drohung des Beils leben!
Am nächsten Tag meldeten die Zeitungen aus Spanien, daß sich das Volk erhoben hatte. Arbeiter stürmten zusammen mit treugebliebenen Soldaten fast ohne Waffen die Kasernen von Madrid und Barcelona. Nun waren die größten Städte wieder ganz in der Hand der Regierung. Aber was an treuen Truppen übriggeblieben war, hatte fast keine Offiziere, und alles war durcheinandergekommen. Die aufständischen Generale aber erhielten von Mussolini und Hitler Flugzeuge zum Transport der Mauren und Fremdenlegionäre aus Afrika über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien.
Ich ging mit der Zeitung zu Reinhard und setzte mich an sein Bett. Er öffnete kurz die Augen und lag dann wieder still auf dem Rücken.
»Reinhard«, sagte ich, »einmal habe ich eine Gelegenheit verpaßt. Das war in Wien im Juli 1927. Ich hatte bei Pötzleinsdorf auf einer Wiese gelegen und ein Buch über chinesische Geschichte gelesen. Als ich gegen Mittag nach Hause kam, sagte meine Wirtin aufgeregt: ›Am Ring sollen sie schießen!‹
Sofort machte ich mich auf den Weg. Dann erlebte ich, wie eine vor Furcht schwitzende Polizei gegen die Arbeiter vorging. Ich stand am Straßenrand und sah mit meiner Kriegserfahrung, was man gegen diese im Straßenkampf gänzlich unerfahrene Ordnungsgarde tun konnte. Und doch war ich festgebannt. Die Arbeiter hatten meine ganze Sympathie. Aber konnte ich zu ihnen hinübergehen? Sie hätten mich doch für eine verdächtige Person halten müssen. So stand ich auf der Straße und schämte mich! Weshalb war ich nicht politisch organisiert? Und weshalb konnte ich nun, in der entscheidenden Stunde, nichts tun? Nur wegen diesem bürgerlichen Rest, dem blödsinnigen Individualismus!«
Reinhard öffnete die Augen und sagte leise: »Und jetzt willst du nach Spanien?«
»Wenn ich nur könnte! Wie soll ich ohne Papiere aus der Schweiz heraus?«
Während ich nach einem Weg suchte, Spanien zu erreichen, verstrichen Juli, August und der größte Teil des September.
In den ersten Tagen des Aufstands verfügte General Franco über 40000 Mann organisierte Truppen. Dazu kamen 34000 Zivilgardisten und 16000 Mauren aus Marokko, zusammen 90000 Bewaffnete.
Sie standen aber nicht in einem, sondern in zwei Gebieten. Das größere lag im Norden, vor allem in Alt-Kastilien. Im Süden besaß Franco zuerst nur wenig mehr als die andalusischen Städte Sevilla und Cádiz. Aber dorthin brachten die italienischen und deutschen Flugzeuge Mauren und Fremdenlegionäre.
Viele der Mauren glaubten wohl, die Zeit wäre gekommen, Spanien wiederzuerobern, das sie im Mittelalter beherrscht hatten. Vielleicht teilte man ihnen das auch unter der Hand mit, um sie für den Einsatz ihres Lebens zu gewinnen. Sie wußten wenig von den Finanzgewaltigen in Berlin und Rom, in London, Paris und vor allem New York. Diese kalten Rechner schoben die Mauren für ihre selbstsüchtigen Zwecke hin und her. Wegen dieses heimtückischen Spiels ließ man die Mauren dort wüten, wo es den Finanzgewaltigen nicht wehtat, bei den spanischen Armen.
Die Mauren drangen in Andalusien in die Wohnungen ein, aus denen angeblich geschossen worden war, und machten alles tot, Männer, Frauen und Kinder.
Die Parks, auf die Spanien so stolz war, wurden verwüstet, Bäume und Sträucher zum Essenkochen abgehackt, und die faschistischen Offiziere sahen dabei zu. Besonders schlimm hauste man in Triana, einem Stadtteil von Sevilla, in dem sich die Arbeiter gegen die Faschisten verteidigten. Die Offiziere ließen Triana mit Kanonen zusammenschießen. Dann drangen ihre Truppen ein und zerstörten alles, Lebendes wie Totes.
In Sevilla setzte sich General Queipo de Llano fest und ließ auch dann noch weitermorden, als schon jeder Widerstand aufgehört hatte. Dadurch aber erzeugte er neuen Widerstand, so daß sich die Offiziere fürchteten, nachts allein aus der erleuchteten Stadt zu gehen.
Queipo de Llano pflegte abends betrunken über das Radio von Sevilla zu sprechen. Jede seiner Reden war voller Drohungen, die er in einer witzlosen Soldatensprache hinausschrie.
Sein Chef, General Franco, wurde von deutschen Nazis beraten und glaubte, es würde leicht sein, die Hauptstadt Madrid zu erobern. Anfang August stieß er mit 15000 Mann Nordtruppen auf die Sierra de Guadarrama zu, einem Gebirge, das sich nördlich von Madrid in weitem Bogen hinzieht, auf der Karte etwa in der Form einer hochgewölbten Augenbraue über dem Auge Madrid.
Die demokratische Regierung Giral hatte es unterdessen nicht verstanden, ihr Land, drei Viertel von Spanien, in der Verwaltung zusammenzufassen. Das lag an ihrer Inaktivität, und die wieder kam daher, daß man nicht an die Kraft der Volksmassen glaubte. Nicht eine einzige große Losung warf die Regierung ins Volk, das so bereit war, jede anzunehmen, wenn sie nur seinem Siegeswillen entgegenkam.
Die Arbeiterparteien und Gewerkschaften forderten Taten. Die Kommunistische Partei erklärte, man müßte eine Armee aufstellen, das Land der Großgrundbesitzer den armen Bauern geben und gegen die verborgenen Faschisten vorgehen. Da aber Giral nichts von all dem tat, begannen die Parteien überall dort, wo sie Einfluß hatten, selbst die Verwaltung in die Hand zu nehmen und aus ihren Anhängern Milizen zu bilden.
So verlor die Regierung Giral die zentrale Leitung der Verwaltung und der Truppen, und in Barcelona wurden die Anarchisten, in Madrid die Kommunisten Herren der Lage. Es entstanden Partei- und Gewerkschaftstruppen ohne eine wirksame gesamtspanische Leitung. Der Generalstab in Madrid war eine bürgerliche Behörde, in der noch manche Offiziere saßen, die wohl lieber bei Franco gewesen wären.
Als die faschistischen Nordtruppen auf das Guadarrama-Gebirge marschierten, raffte die Kommunistische Partei von Madrid alles zusammen, was sie an aktiven Kämpfern hatte, und schickte sie auf Lastautos nach dem Norden. Mit ihnen kamen als militärische Hauptführer Mangada, Perea und Galán.
Es fehlten aber die Brigade-, Bataillons- und Kompanieführer. Dafür gab es einige Leute mit Initiative, die zwar wußten, worauf es politisch ankam, aber ohne jede militärische Erfahrung waren. Die Milizen erreichten den Kamm des Guadarrama-Gebirges, bevor die Faschisten da waren. In einer einfachen Linie lagen sie im Gelände und schossen mit dem Gewehr auf das, was vor ihnen erschien. Dadurch wurden sie zu einer Truppe.
Vielleicht hätten diese improvisierten Truppen nichts erreicht, wenn die Faschisten militärisch gut gewesen wären. Aber welche Kriegserfahrung besaß schon ein spanischer Offizier? In Afrika hatten sie gegen Eingeborene gekämpft, die ein paar Gewehre besaßen, zu wenig Munition und eine Stammesdisziplin, die vielleicht im Alltag hervorragend, aber militärisch nicht zweckmäßig war. Die faschistischen Offiziere waren sich ihrer militärischen Untüchtigkeit möglicherweise halb bewußt, aber sie glaubten nicht an die Organisationsfähigkeit der Volksmassen und auch nicht an den Mut der Arbeiter. Sie dachten, einfach draufzugehen und zu siegen.
Aber sie siegten nicht, sondern wurden auf den Kämmen des Guadarrama-Gebirges aufgehalten und gezwungen, gegenüber den Milizionären eine Front zu bilden, die nun von Siguenza bis in die Nähe des Königsschlosses Escorial reichte.
Largo Caballero war der Leiter der großen sozialistischen Gewerkschaft UGT, ein etwas selbstgefälliger Mann, der von seinen Anhängern als der spanische Lenin bezeichnet wurde. Er zog aus dem Erfolg der Milizen im Guadarrama-Gebirge den Schluß, daß man keine regelrechte Armee brauchte und sich mit den Milizen begnügen könnte. Diese Meinung kam dem Gefühl der Massen des spanischen Volkes entgegen. Es verachtete den Soldatenberuf, vor allem aber die militärische Unterordnung, die es als menschenunwürdig empfand. Largo Caballeros Auffassung traf sich vor allem mit den gefühlsmäßigen Haltungen vieler Anarchisten, die gegen jede Disziplin waren.
Die Kommunisten aber erklärten, der russische Bürgerkrieg hätte die Notwendigkeit einer regelrechten Armee gezeigt. Da sie sich mit dem starrköpfigen Largo Caballero nicht verständigen konnten, begründeten sie in Madrid eine zunächst noch kleine Armee als Beispiel dafür, wie man so etwas machen müßte, und nannten sie aus irgendeinem Grunde: Fünftes Regiment. Von nun an wurde dieses Fünfte Regiment immer häufiger in den Zeitungen genannt, ohne daß wir in der Schweiz recht wußten, was das war.
Mich zog es mit allen Fasern nach Spanien, um mitzuhelfen. Aber immer noch mußte ich im schönen Lugano untätig sitzen.
Als Francos Vorstoß gegen Madrid von Norden her mißlungen war, beschloß er, seine beiden Gebiete zu vereinigen und längs der portugiesischen Grenze von Süden nach Norden vorzustoßen. Seine Truppen kamen am 14. August vor Badajoz am Guadiana-Fluß an. Die Stadt wurde von 2800 Soldaten und Milizionären verteidigt, die außer Gewehren nur vier Maschinengewehre besaßen, während Franco über Kanonen, Panzer und Flugzeuge verfügte. Trotzdem gelang es den Faschisten erst nach 24 Stunden, die Stadt zu nehmen.
Die republikanischen Soldaten und Milizen zogen sich auf die portugiesische Grenze zurück in der Annahme, daß sie dort nach allgemeinem Kriegsrecht entwaffnet, aber aufgenommen würden. Die portugiesischen Truppen jedoch griffen sie an. So wurden die Milizen eingekreist und niedergemacht.
Nur einigen gelang die Flucht in die Kathedrale. Aber auch dahinein drangen die Faschisten und töteten sie in der Kirche. Einer hatte sich in einem Beichtstuhl versteckt. Ein katholischer Geistlicher mit Namen Juan Galán Bermejo hatte das bemerkt und schoß den Milizionär im Beichtstuhl mit seinem Revolver nieder. Er rühmte sich, daß er diese Pistole stets trüge und mit ihr über hundert »Marxisten« erschossen hätte. Der Bischof war mit ihm einverstanden und zeigte das noch öffentlich dadurch, daß er bei offiziellen Anlässen in Begleitung dieses Priesters erschien. Viele andere Geistliche entsetzten sich darüber. Aber die meisten wagten nicht, etwas dagegen zu sagen, um nicht als Rote verschrien zu werden.
In der andalusischen Stadt Carmona hatte die Falange, die der SA der Nazis entsprach, eine Menge Leute auf der Straße ermordet und sie da liegengelassen.
Einer der Priester des Ortes ging zum Führer der Falange und protestierte gegen das Gemetzel. »Gott«, rief er, »wird für dieses Verbrechen Rechenschaft fordern!«
Die Falangisten versuchten ihn zu überzeugen, daß ihr Vorgehen zur Vermeidung größeren Übels nötig wäre. Aber der Priester ließ sich nicht überreden, sondern sagte hart: »Ihr seid Mörder!« Wenige Tage später lag auch er auf der Straße bei den Toten, die immer noch nicht beerdigt worden waren.
Nachdem in Badajoz die 2800 Soldaten und Milizionäre mit portugiesischer Hilfe niedergemetzelt worden waren, holten die Faschisten alle sogenannten unerwünschten Elemente aus ihren Häusern und trieben sie in die Stierkampfarena. Unter ihnen waren Gewerkschafter, kleine Beamte, die der Republik gedient hatten, wie sie auch jeder anderen Regierung dienen würden, ferner alle Arbeiter, die man erreichen konnte – zusammen 1500 Menschen. Sie alle wurden mit Maschinengewehren niedergeschossen.
Mancherlei Gräßlichkeiten hatten die Faschisten vertuschen können, aber die Nachricht von dieser Metzelei ging durch die Weltpresse. Groß war die Entrüstung darüber auch in der Schweiz, obwohl man dort eine Politik betrieb, die eher gegen die Republik gerichtet war. So hatte die spanische Regierung vor Ausbruch des Bürgerkrieges moderne Postautos in der Schweiz bestellt. Als die Generale sich erhoben, wurden die schon fertigen Wagen nicht nach dem republikanischen Spanien gesandt, sondern standen nutzlos herum. Unter uns Antifaschisten wurde das viel besprochen, und ein Arzt sagte mir: »Da sehen Sie, es ist kein Zufall, daß die Schweiz viele Jahre lang ihre Außenpolitik durch den Bundesrat Motta betrieben hat, den man allgemein als Faschisten kannte.«
Nach der so besonders blutigen Einnahme von Badajoz vereinigten sich die faschistischen Süd- und Nordtruppen am 19. August. Nun wandten sie sich von der portugiesischen Grenze weg und marschierten das Tal des Tajo aufwärts nach Osten auf Madrid zu. Die Stadt Toledo lag etwas abseits von diesem Wege. Dort bot sich den Faschisten die Möglichkeit, einen weithin sichtbaren Sieg zu erringen.
Beim Aufstand der Generale im Juli hatten die Arbeiter und Soldaten die Faschisten in der Stadt besiegt. Es war aber dem faschistischen Oberst Moscardo gelungen, sich mit 800 der berüchtigten Zivilgarden nach dem Alcázar zurückzuziehen, der alten Burg hoch über der Stadt. Dieser Alcázar war zwar in seinen Oberbauten zum Teil Ruine, hatte aber sehr starke Mauern und feste Keller.
Mehrere Male versuchten die Milizen, die Burg zu nehmen. Aber sie hatten keine Ahnung vom Festungskampf. Ihre Offiziere besaßen nicht viel Ansehen und waren auch nicht sehr energisch. Da war es für Franco bei seiner großen Überlegenheit an Menschen und Waffen leicht, die schlecht geführten Milizen zu vertreiben und die Belagerung des Alcázar zu beenden.
Auch italienische Truppen Mussolinis hatten mitgesiegt.
Hitler und Mussolini und mit ihnen alle Reaktionäre der Welt boten ihren ganzen Propaganda-Apparat auf, um diesen angeblich so heldischen Sieg zu feiern. Jeden Tag las man in den Zeitungen davon und konnte in den Kinos den Bildern vom befreiten Alcázar nicht entgehen, so daß noch heute viele vom ganzen spanischen Kriege nur diese eine Episode kennen.
Aber der Fall von Toledo zeigte auch der Republik ihre ganze militärische Schwäche. Man erkannte, daß die Untätigkeit des Ministerpräsidenten Giral untragbar geworden war. Selbst Spaniens Präsident Azaña sah das endlich ein. Er war ein schwacher Mann, der nie recht an die Möglichkeit eines Sieges der Republik über die Faschisten geglaubt hat. Nach einer heftigen Kabinettskrise ersetzte er Giral durch Largo Caballero, der auch das Kriegsministerium übernahm. Mit ihm kamen einige starke Kräfte ins neue spanische Kabinett, als Außenminister der Sozialist Alvarez del Vayo, als Landwirtschaftsminister Vicente Uribe und als Unterrichtsminister Jesús Hernández. Diese beiden waren die ersten kommunistischen Minister Spaniens.
Etwa zur gleichen Zeit erfand der französische Sozialist Léon Blum die Nichteinmischung, gerade als ob er der Festigung der Spanischen Republik etwas entgegenstellen wollte. Diese Nichteinmischung in die spanischen Angelegenheiten war eine Hilfe für die Faschisten. Die Deutschen, Italiener und Portugiesen kümmerten sich nicht darum und hatten die besseren Möglichkeiten, Waffen und Truppen an Franco zu liefern. Auf italienischen und deutschen Schiffen kamen ganze ausländische Truppeneinheiten an und Waffen aller Art. Wenn die Nazis und Faschisten es einmal für nicht ratsam hielten, spanische Häfen direkt anzulaufen, so landeten sie in Portugal, das alle Waffentransporte durchließ. Portugal bildete eine faschistische Halbkolonie Englands, das dem Spiel wohlwollend zusah und im Komitee der Nichteinmischung und im englischen Unterhaus beruhigende Worte sagte.
Im Gegensatz dazu hatte die Republik im wesentlichen nur einen Weg, auf dem sie Waffen bekommen konnte: die Eisenbahn durch Frankreich. Dort aber ließ Léon Blum sie nicht durch.
Die Pasionaria beschloß, mit ihm zu sprechen. Sie, die berühmteste Frau Spaniens, stammte aus einer Bergarbeiterfamilie, und verfügte als Kommunistin über die Gabe, so zu reden, daß es jedem zu Herzen ging. Als sie mit Léon Blum sprach, weinte er und beteuerte seine Unschuld.
Um diese Zeit fuhr von Lugano ein antifaschistischer Journalist, ein Italiener, nach Spanien, um über die Kämpfe zu berichten. Als er zurückkam, war Reinhards Befinden etwas besser, und wir gingen zusammen zu ihm.
Es wurde schon dunkel, und die Tageshitze hatte nachgelassen. Lange saßen Reinhard und ich mit dem Italiener und seiner Frau am offenen Fenster und hörten ihm zu. Er sprach mit der ganzen italienischen Lebendigkeit: »Dort herrscht eine unglaubliche Unordnung!« rief er. »Die Anarchisten haben das Heft völlig in der Hand. Daher müssen auch wir mit ihnen rechnen. Sie wollen sich nicht organisieren lassen und lehnen jede Disziplin ab, politisch wie militärisch. Aber so kann man doch nicht Krieg führen! Wenn die Spanier nicht so herrliche, tapfere Menschen wären, hätten sie schon längst verloren!«
»Und in Madrid? Von dort sind die Nachrichten doch besser.«
»Ich konnte nicht nach Madrid. Die Anarchisten in Barcelona ließen mich nicht hin. Sie sagten, dort sähe es noch schlimmer aus.«
Es war spät, als wir fortgingen. Nicht das leichteste Lüftchen brachte etwas Kühle vom nahen See. Beide sprachen wir nicht, vor Bedrücktheit.
Als ich Reinhard nach Hause gebracht hatte, ging ich hinüber zu meiner Wohnung. Um niemanden zu stören, schlich ich die Stufen hinauf und drehte das Licht erst an, als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte. Auf dem Tisch lag ein Brief. Er trug als Absender einen unbekannten Namen. Ich riß ihn auf und las Vorwürfe. Der Fremde hatte erfahren, daß ich im Tessin ein friedliches Leben führte. Aber bei meinen militärischen Erfahrungen wäre wohl für mich der richtigere Platz in Spanien.
Ich dachte verzweifelt: Besser wäre es, wenn der Briefschreiber, statt mich anzuklagen, mir einen Weg zeigte, wie ich ohne Papiere hinkommen kann!
Durch Frankreich nach Barcelona
Anfang Oktober 1936 saß ich endlich im französischen Zug und fuhr nach Cerbères an der spanischen Grenze. Dort sollte ich mein Empfehlungsschreiben vorzeigen, das mir Schweizer Sozialdemokraten mitgegeben hatten.
Als der Zug hielt, stieg ich aus und befand mich auf einer kleinen Station mit wimmelndem Verkehr. Im Schatten eines Hauses stand ein Tisch, und daran saß ein Mann, der mit raschen Bewegungen Papiere ausfertigte. Ich stellte mich dort an.
Als ich drankam, blickte er auf mein Empfehlungsschreiben und sagte: »Ah, Anarchist!«
»Nein, ich bin kein Anarchist!«
Er blickte auf: »Aber jedenfalls haben Sie eine Empfehlung zu den Anarchisten.« Schon schrieb er mir einen Zettel aus.
Verwirrt stieg ich in das Abteil zurück. Dort saß schon wieder der Deutsche, den mir die Schweizer anvertraut hatten, mit einer Verlegenheit, die ich mir bis jetzt nicht deuten konnte. Diese Sozialisten waren sehr nett, ja herzlich gewesen. Aber die Mitgabe dieses undurchsichtigen Reisebegleiters hatte mich doch etwas kühl gestimmt. Konnte ich ihre Verlegenheit anders verstehen, als daß der Kerl irgendwie übel war?
Und nun stellte sich auch noch heraus, daß sie mich an die Anarchisten empfohlen hatten! Das begriff ich um so weniger, als es in Barcelona, meinem nächsten Reiseziel, eine Vereinigte Sozialistische Partei gab, die PSUC.
Freilich hatte es mich in der Schweiz schon gewundert, daß die Sozialdemokraten dort zu den Anarchisten bessere Beziehungen zu haben schienen als zu ihren eigenen Bruderparteien. Viele hatten sogar behauptet, Sozialisten und Kommunisten gäbe es in Spanien so gut wie nicht.
Der Zug ruckte an. Nach wenigen Minuten trat ein französischer Grenzbeamter ein und sagte: »Ihre Papiere, meine Herrn!«
Der Deutsche mir gegenüber reichte etwas hin. Das war ja ein deutscher Paß! Mir hatte ein wohlmeinender Nazi noch in Deutschland gesagt: »Verlangen Sie nie einen Auslandspaß! Sonst verschwinden Sie ins Konzentrationslager oder überhaupt. Wenn Sie über die Grenze gehen wollen, gehen Sie so!« Wie kam dieser Mensch zu einem deutschen Paß?
Der Grenzer blätterte die Seiten um: »Sie haben kein französisches Visum! Wie kommt das?«
Mein Gegenüber zuckte die Achseln.
Da schrie ihn der Franzose an: »Sie müssen eins haben!« Aber er gab ihm den Paß zurück. Dann wandte er sich unfreundlich an mich: »Ihre Papiere!«
Ich dachte: Wie soll das erst mit mir werden? und sagte: »Ich habe keine.«
Sein Gesicht hellte sich auf. Lächelnd grüßte er und ging hinaus. Ich war verblüfft. Aber dann schoß es mir durch den Kopf: Ja, was macht denn eine Behörde mit einem unerwünschten Ausländer? Sie schiebt ihn über die nächste Grenze ab. Da ich aber augenscheinlich freiwillig hinüber wollte, war für den Beamten das Problem gelöst. Der andere, der wenigstens Papiere hatte, war angeschrien worden, und ich, der viel schlimmere Fall, hatte einen freundlichen Abschiedsgruß bekommen. Das erheiterte mich.
Plötzlich wurde es dunkel. Langsam fuhren wir durch einen Tunnel. Das ist die Grenze, dachte ich. Mehr als zwei Monate habe ich mich vergeblich bemüht, nach Spanien zu kommen. Nun bin ich drin.
Es wurde wieder hell, und der Zug hielt. Junge Männer mit roten Binden rannten den Bahnsteig entlang. Man riß unser Abteil auf. Laut und schnell redeten sie auf uns ein und gaben uns Zeichen auszusteigen, betrachteten unsere Übertrittsscheine und führten uns zu einem anderen Zug. Er hatte lange D-Zug-Wagen und war außen mit Gestalten bemalt. Da sah man Kapitalisten mit Geldsäcken und Zigarre, dicke Bischöfe und Arbeiter mit erhobenen Hämmern.
Welch lebendiger Geist hier! Nichts von der bürgerlichen Gelassenheit der Schweiz, in der ich noch gestern lebte.
Die Nachmittagswärme und dumpfe Luft ließen mich einschlafen. Erst in der Abenddämmerung wachte ich auf, als wir in einen großen Bahnhof einfuhren: Barcelona.
Wieder stürmten junge Leute mit roten Binden den Wagen.
Ich zeigte mein Schreiben. Sie winkten andere heran und schienen ihnen zu sagen: »Der ist für euch!«
Meinen Reisebegleiter behandelten sie betont geringschätzig, und ich hörte das Wort: »Trotzquista«. Da endlich begriff ich den Fall. Plötzlich stutzten meine Gedanken: Ein Trotzkist mit einem Nazipaß? Das ist doch erst wirklich verdächtig! Und so jemanden hat man mir anvertraut, um ihn mit nach Spanien zu nehmen!
Ein junger Mann packte mich am Ärmel und winkte mir mitzukommen. Ein anderer ergriff einen meiner kleinen Koffer. Den andern trug ich selbst. Fast rannten wir den Bahnsteig entlang und in einen Raum hinein. Dort betrachtete man mich mißtrauisch, schrie herum, telefonierte.
Nur eins war mir klar: Jede Partei empfing ihre Neuankömmlinge getrennt, und das hier waren Anarchisten. Gefährlich sahen sie gerade nicht aus. Aber sie schienen Vernunft durch Aufgeregtheit zu ersetzen.
Nach einiger Zeit kam ein Mensch herein, der gar nicht spanisch aussah und auch nicht aufgeregt war. Er sah sich um, blickte mich an und sagte auf deutsch: »Bist du es, der aus der Schweiz kommt?«
»Ja.«
»Dann komm mit! Draußen haben wir einen Wagen.«
Die jungen Leute sprangen herum und halfen mir, das Gepäck zu tragen. Wieder ging es im Laufschritt fort und zum Auto. Als ich drinsaß, winkten sie mir zu, und wir fuhren mit einem ungestümen Ruck ab. Der Fahrer sauste durch die Straßen, obwohl sie von Menschen wimmelten. Er bog so wild um die Ecken, daß sich jedesmal das Oberteil des Wagens zur Seite bog. Rums! Ich fiel vornüber auf die Vorderlehne. Es war nichts geschehen. Er hatte nur auf seine Weise gehalten.
Irgendeine Aufregung war außerhalb des Wagens. Ich wurde herausgerissen und durch eine Tür gezerrt. Dann saß ich in einem Raum und wartete, diesmal allein, wie ein Gefangener.
Nach wenigen Minuten drang ein Schwarm lärmender Menschen herein.
»Nein, ich mag nicht!« schrie einer auf deutsch. Dann wandte er sich an mich: »Wozu bist du nach Spanien gekommen! Euch können wir nicht brauchen! Hier herrscht die FAI!«
Ich wußte nicht, was die FAI ist.
»Unsinn!« entgegnete ein anderer. »Wir gehen jetzt zu Abend essen!« Er wandte sich höflich zu mir: »Bitte, komm mit!«
Die ganze Gruppe sprach deutsch. Wir zogen als Schwarm auf die Straße, gingen um ein paar Ecken und kamen zu Tischen und Stühlen, die auf dem Gehsteig standen. Da setzten wir uns.
Der Mann von der FAI blickte mich gehässig an. Neben ihm saß eine Frau. Sie wandte sich zu mir und sagte in einer Mischung von Verachtung und guter Erziehung: »Wozu bist du gekommen?«
»Um gegen die Faschisten zu kämpfen.«
»Verstehst du denn was vom Militär?«
»Ein wenig. Ich war zehn Jahre dabei, darunter den ganzen Weltkrieg lang.«
»Da hast du wohl gar einen Rang?«
»Ich war einmal Hauptmann.«
Entrüstet wandte sich der FAI-Mann ab und sagte durch die Zähne: »Da habt ihr’s! So ein Lumpenpack kommt hierher. Und ihr ladet ihn noch in unsere Gesellschaft ein! Merke dir eins!« damit wandte er sich wieder zu mir: »Hier gibt es keine Disziplin! Von Strammstehen und so was kann bei uns keine Rede sein!«
Ich nickte belustigt: »Ich weiß, worauf es im Gefecht ankommt. Da wurde selbst im alten kaiserlichen Heer nicht strammgestanden.«
»Jetzt lobst du auch noch das kaiserliche Heer!« Er spuckte aus.
»Aber Mensch!« fuhr ihn der Vernünftige an: »Halte doch mal deinen Mund!«
Während die andern beim Kellner bestellten, fragte er mich leise: »Willst du mit uns, das heißt mit den Anarchisten kämpfen?«
»Ich bin hergekommen, um gegen den Faschismus zu kämpfen. Mit wem? Mit allen, die wirklich kämpfen wollen, also auch mit euch Anarchisten, wenn ihr mich bei euch braucht.«
Er beugte sich zu mir: »Ärgere dich nicht über den da! Mit ihm kommt niemand aus. Wir werden später weitersprechen.«
Auf dem Rückweg blieb er an meiner Seite und erklärte mir, daß ich im anarchistischen Parteihaus gelandet war.
Nun mußte ich wieder warten, eine Stunde, zwei, drei. Schließlich, tief in der Nacht, kam er wieder: »Der Chef möchte dich sprechen.«
Wir stiegen in die oberen Stockwerke und gingen Korridore entlang. Da war es totenstill. Der Anarchist flüsterte nur. Das war ein Benehmen des Geheimnisses und fast der Verschwörung. Aber wozu? Das war wohl eine etwas kindliche Romantik, die sich sagte: Revolution heißt, sich ungewöhnlich benehmen.
Er ließ mich in ein Geschäftszimmer.
Hinter einem riesigen Schreibtisch saß, ungleichmäßig von einer Tischlampe beschienen, ein Mann in mittlerem Alter. Der sagte auf deutsch: »Du bist Ludwig Renn? Wir kennen dich natürlich.«
Ich war erstaunt, daß auch er ein Deutscher war. Unter dem Chef hatte ich mir natürlich einen Spanier vorgestellt. Aber er ließ mich nicht nachdenken, sondern redete ununterbrochen weiter. Er erzählte, wie der Aufstand hier in Barcelona vor sich gegangen war und wie die Anarchisten als die einflußreichste Partei die städtischen Betriebe in ihre Hand genommen hatten, vor allem die Straßenbahn. »Es gibt die anarchistische Gewerkschaft CNT und die FAI, die so etwas wie eine Partei ist, obwohl es manche von der FAI ableugnen, weil ihnen eine Partei zu sehr im Geruch der Über- und Unterordnung steht. – Als wir nun die Macht in der Hand hatten, standen wir plötzlich vor der Aufgabe, entweder in die Regierung hineinzugehen oder auf unsern Einfluß zu verzichten. Du weißt sicher, daß wir den Staat grundsätzlich ablehnen und daher auch jede Regierung. Aber was half es, wir mußten hinein! Das gab natürlich Auseinandersetzungen, und die Masse unserer Anhänger hätte es wohl nicht verstanden, wenn Mitglieder der Gewerkschaft CNT oder der FAI Minister geworden wären. Wir halfen uns so, daß wir sie nicht Minister, sondern Räte nannten.«
Ich hörte mit wachsendem Erstaunen zu. Weshalb sagte er mir so deutlich, daß seine Partei ihre alten Ideale aufgab? Mehr noch verwunderte es mich, daß er sich vor mir wegen dieses Verrats sozusagen entschuldigte.
Schon über eine Stunde mochte er zu mir gesprochen haben, und ich hatte noch kein Wort gesagt. Da fragte er: »Bist du bereit, der anarchistischen Bewegung beizutreten?«
Vor Überraschung fand ich zunächst kein Wort. Dann sagte ich langsam: »Ich will hier gegen den Faschismus kämpfen, auch mit den Anarchisten. Aber eurer Bewegung werde ich nicht beitreten.«
Ohne eine Spur von Erregung zu zeigen, antwortete er: »Dann hat es keinen Zweck, dich länger hierzubehalten. Wir werden dich zur PSUC hinüberschicken.«
Wieder brachte man mich in das Zimmer unten zu meinen Koffern. Meine Gedanken waren noch bei den Eröffnungen des anarchistischen Chefs. Wie wenig tüchtige Leute mußten sie haben, daß sie sich solche Mühe gaben, einen erklärten Kommunisten wie mich zu gewinnen! Er hatte das so falsch angefaßt wie die Nazis. Auch sie hatten mir bei ihren Bekehrungsversuchen im Gefängnis und später gesagt, daß bei ihnen vieles nicht in Ordnung wäre. Aber so etwas sagt man doch nicht zu einem Menschen, der davon überzeugt ist, daß seine eigene Partei sich auf dem richtigen Wege befindet. Oder wissen sie gar nicht, wie das bei uns ist? Vielleicht sind sie so von Zweifeln zerfressen, daß sie sich Menschen, die ihrer Sache sicher sind, gar nicht mehr vorstellen können.
Jemand kam herein, ergriff eines meiner Köfferchen und winkte mir mitzukommen. Draußen stand ein winziges Auto. Wir fuhren nicht weit und hielten an einem großen Hotel, vor dem ein Milizionär als Posten stand.
Der weite Platz davor war leer. Ich hörte die Schritte eines Mannes, der nun in den Schein einer Straßenlampe kam. Wer ist das? fragte ich mich etwas verwirrt. Den mußte ich doch kennen. Richtig, ich habe mich mit ihm in einem Vorort von Zürich zu einer heimlichen Besprechung getroffen. Es ist der ehemalige Reichstagsabgeordnete Hans Beimler. Damals hatte er mir einiges vom Konzentrationslager Dachau erzählt, und wie er von dort entkommen ist.
Er war herangekommen, streckte mir die Hand entgegen und sagte frisch: »Dich brauche ich gerade!«
»Das ist ein Wort! Bisher habe ich in Barcelona nur Anarchistengeschwätz gehört.«
Bei der PSUC in Barcelona
Das Hotel Colón, in dem ich nun mit Hans Beimler zusammen wohnte, war das Haus der PSUC, der Partei, in der sich die Sozialisten und Kommunisten Kataloniens vereinigt hatten.
Am nächsten Tag führte mich Beimler in ein Zimmer nebenan. Da lagen so viele Akten auf dem Boden, daß wir kaum hineinkamen. Nur ein schmaler Gang war zwischen den Papierstößen gelassen. Auf einem etwas größeren freien Platz stand, von uns abgewendet, ein untersetzter Mann und diktierte etwas in spanischer Sprache.
Beimler unterbrach ihn: »Das hier ist Ludwig Renn.« Der Mann drehte sich um und blickte mich freundlich aus dunkelblauen, ernsten Augen an: »Wir können zueinander nicht kommen, der Akten sind viel zu viele«. Er deutete auf die Unordnung im Zimmer. »Du siehst uns hier bei einer schmutzigen Arbeit. Diese Papiere stammen aus dem deutschen Generalkonsulat in Barcelona. Die Nazis haben so fest an den Sieg ihrer spanischen Generale geglaubt, daß sie vor dem Aufstand kein einziges Papier verbrannt haben, und wenn es noch so belastend war. Als dann die Arbeiter rasch siegten, ist uns alles in die Hände gefallen. In diesen Akten haben wir den Beweis dafür, daß die deutschen Diplomaten und Konsularbeamten den Aufstand der Generale direkt vorbereitet haben. Dazu hatten sie ein Heer bezahlter Agenten, und deren Listen liegen hier. Diese Papierstöße müssen jetzt durchgearbeitet und für die ausländische Presse vorbereitet werden. Die spanische Regierung möchte diese Unterlagen natürlich recht bald haben.«
»Nehmen die Anarchisten an dieser Arbeit auch teil? Ich habe drüben in ihrem Haus einen ganzen Haufen von Deutschen gefunden.«
»Ach, diese Gesellschaft! Die wollen den Krieg nur mit dem Gefühl und der leeren Phrase gewinnen! Hier muß man aber arbeiten. – Entschuldige, wenn ich für dich jetzt keine Zeit mehr habe.«
Nun brachte mich Beimler in ein anderes Zimmer. Darin saß telefonierend ein dicker, blonder Mann in Majorsuniform. Immer wieder schrillte das Telefon, und dann sprach er auf spanisch eifrig hinein. Endlich gab es eine Pause, und er streckte erleichtert die Beine von sich: »Waffenbeschaffung ist kein Genuß hier. Du siehst in mir einen Gehilfen unseres militärischen Stabes. Eigentlich bin ich natürlich alles andere als Offizier. Unser großes Problem ist, die Milizen zu bewaffnen. An Freiwilligen fehlt es nicht, die kommen in Massen. Aber der französische Sozialist Léon Blum – es ist eigentlich eine Beleidigung für jeden ehrlichen Sozialisten, ihn so zu nennen! – schneidet uns mit seiner Nichteinmischung von allen Waffen ab. Schwer haben wir es auch mit den Anarchisten. Hast du diese Bürschchen schon in den Cafés sitzen sehen, mit umgehängtem Gewehr, weil das so kriegerisch aussieht? Kriegerisch sind auch die Namen, die sie ihren Bataillonen geben. Da gibt es eine besondere Rasselbande, die nennt sich Rote Löwen. An der Front siehst du diese Helden nie. Die Gewehre, die wir vorn so nötig brauchen, tragen sie hier in der Stadt herum, und wir können sie ihnen nicht abnehmen, weil das gleich einen schweren Konflikt mit den Schwätzern von der CNT und FAI gibt.«
Wieder schrillte das Telefon. »Ja, ja!« rief er auf spanisch hinein. »In zehn Minuten bin ich unten.« Dann sagte er nachdenklich: »Glücklicherweise gibt es unter den Anarchisten auch einige vernünftige Leute. Da ist vor allem Durutti, der in seiner Kolonne, trotz aller Widerstände seiner Genossen, Disziplin einführt. Er steht auf dem Standpunkt, daß Anarchisten ehrlich mit Kommunisten und Sozialisten zusammen kämpfen müssen. Trotzdem ist es hier noch schlimm. In Madrid sieht es ganz anders aus. Dort herrschen die Kommunisten. Da haben wir das Fünfte Regiment. Da ist Ordnung. – Aber ich muß zur Sitzung.«
Später am Vormittag kamen Journalisten, um mich zu interviewen. In den vielen Gesprächen des Tages bekam ich etwas mehr Klarheit darüber, was los war. Wir Deutschen pflegen ja gar nicht zu wissen, daß die Katalanen eine andere Nation sind als die Spanier. Sie wohnen nicht nur entlang eines Teils der Mittelmeerküste bis hinunter nach Alicante, sondern auch jenseits der Grenze in Frankreich. Ihre Sprache ist dem Provençalischen nahe verwandt und wird vom ganzen Volke gesprochen. Darin liegt ein gewisser Protest gegenüber den Spaniern, den Castellanos. Das hat geschichtliche und wirtschaftliche Gründe. Katalonien, seit dem 12. Jahrhundert vereinigt mit Aragon, gehörte zu den blühendsten Ländern Europas. Zu ihm gehörten nach dem Untergang der Hohenstaufen im 13. Jahrhundert auch Sardinien, Sizilien und das Herzogtum Athen in Griechenland. Es bildete zu dieser Zeit die größte Seemacht des nördlichen Mittelmeers. Durch seine Vereinigung mit Kastilien zum Königreich Spanien um 1500 geriet es aber ins Hintertreffen, besonders weil das Bürgertum ungefähr zur gleichen Zeit durch die Könige seiner demokratischen Vorrechte beraubt und niedergeschlagen wurde. Davon erholte sich Katalonien erst im 19. Jahrhundert. Barcelona wuchs damals rasch zur größten und reichsten Stadt Spaniens heran, mit anderthalb Millionen Einwohnern. Überall entstanden aus Handwerksbetrieben Industrieunternehmen. Die waren zumeist nicht sehr groß. In ihnen hatte der spanische Anarchismus seinen Ursprung. Die Arbeiter suchten die Besserung ihrer Lage nicht mittels einer großen, landesweiten Bewegung zu erreichen, standen sie doch vor allem kleinen Unternehmen gegenüber, die sich noch nicht zu Unternehmerverbänden zusammengeschlossen hatten. Es gab Lohnkämpfe, die sich auf wenige Köpfe beschränkten, und es schien zu genügen, wenn die Arbeiter jedes einzelnen Betriebes ihrem Unternehmer das Werk wegnahmen und es für sich selbst arbeiten ließen.
»Darin besteht die große Illusion des Anarchismus«, sagte mir ein Deutscher, der schon lange in Barcelona lebte. »Wenn die Anarchisten jetzt noch an diesen alten, individuellen Methoden des Klassenkampfes festhalten, so ist das um so unverzeihlicher, als heute die Industrie zusammengeschlossen ist. Juan March, dem größten Kapitalisten, gehörte halb Katalonien. In der reaktionären Regierung Leroux spielte er die Rolle des Drahtziehers hinter den Kulissen. Die Anarchisten, diese zum Aussterben verurteilte, vorsintflutliche Rasse, will auch nicht sehen, daß sich Katalonien allein nicht vom Faschismus befreien kann, sondern nur zusammen mit dem übrigen Spanien. Leider scheint auch Companys, der Präsident Kataloniens, diese Ansicht zu teilen. Diese Leute stehen auf dem Standpunkt: Wenn auch das übrige Spanien zusammenbricht, so werden wir uns hier in Katalonien zu verteidigen wissen. Jetzt, wo in Madrid Hilfe so dringend ist, stehen sie hier ruhig an der Front und führen weiter einen lässigen Bezirkskrieg.«
Gegen Abend trat ein langer Kerl in der Halbuniform der Milizen in mein Zimmer. Er stammte aus Sachsen und war dann in Berlin in der Kommunistischen Jugend gewesen. Daher kannte ich ihn.
»Kommst du mit zum Essen?« fragte er. »Ich weiß ein gutes Lokal in der Nähe des Hafens.«
Wir gingen quer über die weite Plaza de Cataluña und in die Rambla hinein, die belebteste Straße Barcelonas. Lautsprecher schrien von den Häusern. Jede Partei hatte einen, und die überkrähten sich gegenseitig. Dazu aber unterhielt sich die dichte Menschenmenge, die auf und ab spazierte. Um sich im Lärm der Lautsprecher, beim Hupen der Autos und zwischen den Ausrufen der Verkäufer verständlich zu machen, schrien auch sie sich an. Man wurde angestoßen, aber niemand entschuldigte sich. Auch mein Begleiter schrie auf mich ein und erklärte mir das brausende Leben, das ihm gefiel. Ich aber war dankbar, als wir in stillere Stadtviertel kamen und das etwas düstere Lokal betraten.
Von der niedrigen Decke hingen Würste, Fische, Schinken im rötlichen Lichtschein, der aus einer Art Hütte in der weiten Gaststube kam. Das war die Küche. Man hörte allerhand Speisen schmoren und roch das Öl.
»Hier ißt man ausgezeichnet. Wir trinken doch eine Flasche Muskateller? Und du überläßt es wohl meinem Geschmack, was ich aussuche!« Er rief einen Kellner und bestellte in katalanischer Sprache.
»Du wirst viel besser bedient und nicht so übers Ohr gehauen, wenn du sie in ihrer Sprache anredest. Ich habe das gelernt, als ich von England herüberkam und nichts zu beißen hatte. Da stand auch ich auf der Rambla und rief meine Schnürsenkel aus. Den andern Straßenhändlern horchte ich bald ab, wie man das hier macht. So lernte ich rasch Katalanisch. Das war noch unter der Regierung Leroux. Damals war es hier in diesem berühmten Freßlokal noch voller als heute. An allen Tischen saßen die Schieber und machten ihre Geschäfte. Das war ein Gezischel ringsum! Und merkwürdig war, daß so viele in Kartoffeln schoben. Der Spanier ißt aber wenig Kartoffeln. Weißt du, worin sie in Wirklichkeit geschoben haben? In Waffen! In Madrid saß ein Vertreter der Junkerswerke. Das war ein ehemaliger deutscher Fliegeroffizier und natürlich ein Nazi. Er war die Stelle, wo die Waffen herkamen. Er hatte auch Beziehungen zum spanischen Kriegsministerium. Dort saßen genügend Offiziere, die mithalfen und für die Nazis Propaganda trieben. Auch heute noch soll da nicht alles ganz sauber sein.«
»Ist denn das spanische Volk käuflich?« fragte ich.
»Das spanische Volk?« rief er. »Das ist das prachtvollste Volk! Es ist ehrlich und tapfer! Aber die, von denen ich sprach, das ist eine ganz kleine Gruppe. Freilich standen hinter ihnen sehr mächtige Leute, die adligen Grundbesitzer, die Offiziere und natürlich Kapitalisten, vor allem der Multimillionär Juan March. Dieses Pack darfst du nicht mit dem spanischen Volk verwechseln! Du möchtest ja auch nicht mit einem Schieber vom Kurfürstendamm verwechselt werden.«
Das Essen kam, zuerst eine Suppe mit kleinen scharfen Würstchen, dann gebratener Fisch. Dazu tranken wir den schweren, süßen Muskateller, der den Kopf warm macht.
»Morgen«, begann er wieder, »wird die PSUC eine Demonstration machen. Das ist zur Erinnerung an den Aufstand der asturischen Bergarbeiter vor drei Jahren. Er hatte sich gegen die halbfaschistische Regierung Leroux gerichtet, unter der die Grundbesitzer und der Großkapitalist Juan March tun und lassen konnten, was sie wollten. Der Aufstand dauerte mehrere Monate und wurde dann grausam niedergeschlagen. In Asturien haben die Zivilgarden gehaust wie die Nazis in Deutschland.
Leider haben es die Anarchisten abgelehnt, morgen mitzudemonstrieren. Da wird es eine klägliche Kundgebung werden, denn die PSUC hat zwar in der letzten Zeit an Mitgliedern zugenommen, aber noch nicht entfernt die Massen erreicht wie die Anarchisten.«
Am Morgen des 6. Oktober blickte ich gleich früh aus dem Fenster. Es regnete in Strömen. Ich ging hinunter in den Speisesaal. Alle waren mißgestimmt. Ein Katalane sagte auf deutsch: »Regen, niemand wird kommen. Spanier gehen nicht auf die Straße, wenn es regnet.«
Wir traten aus dem Hause. Es gehörte wirklich ein Entschluß dazu, bei diesem Wetter auf dem Platz anzutreten.
Wir bildeten eine kurze Kolonne. »Willst du das Spruchband der Deutschen mit tragen?« fragte mich Beimler.
»Natürlich, gern. Wir werden es so hoch halten, daß alle sehen, wo wir sind! Da schließen sich leichter Leute an.«
Ich hatte das in einer Art Galgenhumor gesagt. Denn schon lief mir der Regen aus den Haaren ins Gesicht. Aber merkwürdig: Wirklich stellten sich Leute hinter unser Grüppchen, und trotz des Gusses kamen immer mehr.