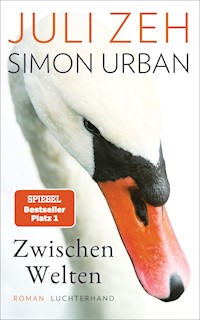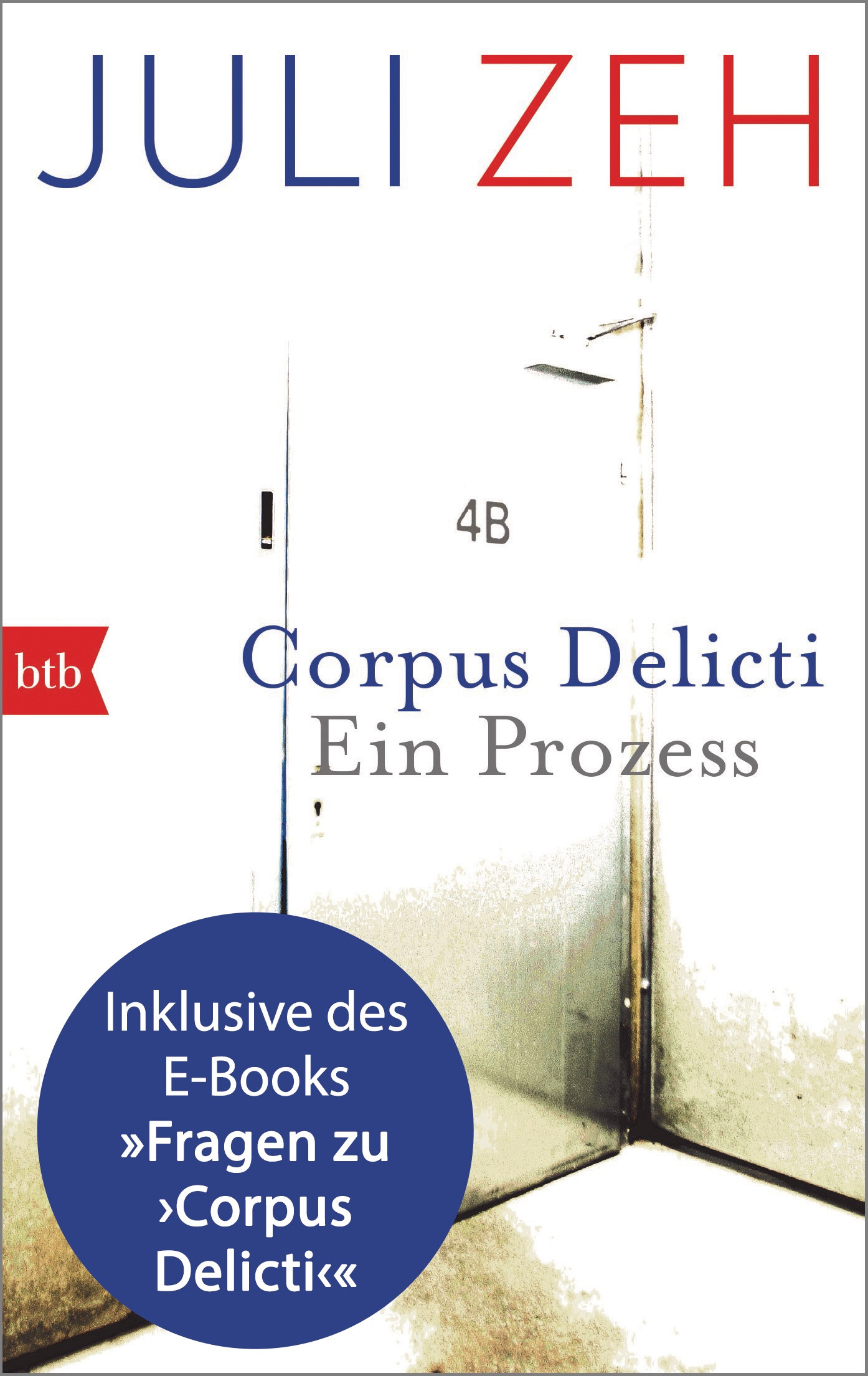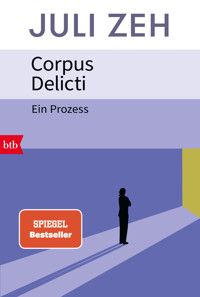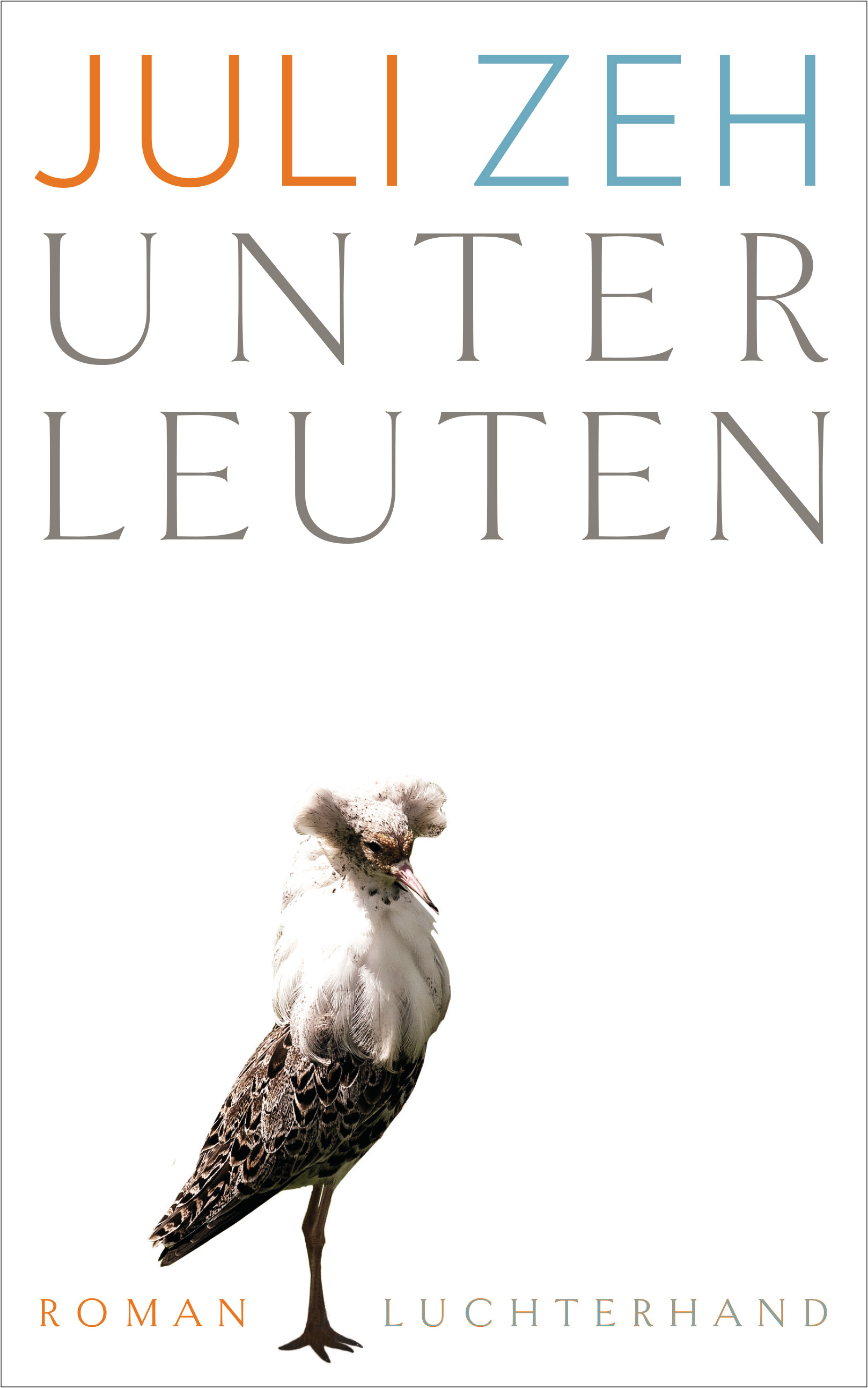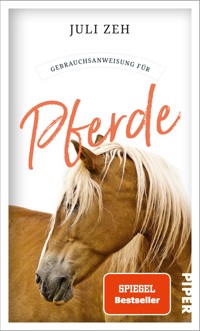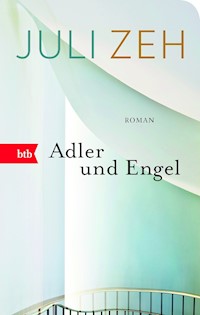
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebesgeschichte, Kriminalroman, Entwicklungsgeschichte, Politthriller furios zu einem Roman verwoben – das ist das Buch von Juli Zeh, einem der überragenden Talente der deutschen Literatur. Für ihre Geschichte um den Völkerrechtsexperten Max, der nach dem Selbstmord seiner einzigen Liebe Jessie ins Bodenlose stürzt, wurde die Autorin mit dem Deutschen Bücherpreis, mit dem Rauriser Literaturpreis und dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet, die Kritik lag ihr zu Füßen. Juli Zeh erzählt lakonisch und doch voller Poesie vom Schicksal einer Liebe, die sich im Geflecht von Politik und Profit verfängt. Ihr Roman entwirft das eindrucksvolle Szenario einer Welt nach dem Zusammenbruch der Ideologien – und das in einer Sprache, die rasant und absolut zeitgemäß ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Jessie ist tot. Die junge Frau hat sich erschossen, während sie mit Max telefonierte, ihrem Freund. Zu Schulzeiten der geborene Versager, hat Max aus sich selbst das Projekt seines Lebens gemacht: Einen Vorzeigejuristen. Innerhalb von zehn Jahren hat er sich hochgearbeitet, aus eigener Kraft, wie er glaubt. In die angesehene Kanzlei Rufus nach Wien, auf den Olymp des Völkerrechts. Aber dann ist Jessie wieder aufgetaucht und mit ihr das einzige echte Gefühl in Max’ Leben: Die bodenlose Liebe zu der kindlich-verrückten Tochter eines Drogenhändlers. Jessies Tod wirft Max völlig aus der Bahn. Er schmeißt seinen Job hin und beschließt, den Rest seiner Lebenszeit nach der Menge an Kokain zu bemessen, die er sich noch kaufen kann. Max ist am Ende. Und meldet sich bei der abgebrühten Radiomoderatorin Clara, in ihrer Nachtsendung für die Verzweifelten und Gestrandeten. Clara nimmt sich seiner an: Nicht aus Mitgefühl, sondern aus Interesse an seinem »Fall«. Sie zwingt Max zu einer Rückschau auf sein Leben, zwingt ihn zurück in die Vergangenheit.
Zur Autorin
Autorenfoto: David Finck
JULI ZEH, 1974 in Bonn geboren, wurde u. a. mit dem Thomas-Mann-Preis (2013), dem Heinrich-Böll-Preis (2019) und dem Hannelore-Greve-Literaturpreis (2023) ausgezeichnet. Im Jahr 2018 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz und wurde zur Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg gewählt. Ihr Roman »Über Menschen« war das meistverkaufte belletristische Hardcover des Jahres 2021. Zuletzt erschien der zusammen mit Simon Urban verfasste Bestseller „Zwischen Welten“.
www.juli-zeh.de
Juli Zeh bei btb und Luchterhand
Nachts sind das Tiere. EssaysDie Stille ist ein GeräuschSpieltriebKleines Konversationslexikon für HaushundeAlles auf dem Rasen. Kein RomanSchilfCorpus Delicti. Ein ProzessTreidelnNullzeitUnterleutenLeere HerzenNeujahrFragen zu »Corpus Delicti«Über Menschen
Juli Zeh
Adler und Engel
Roman
btb
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien erstmals 2001.
© 2018 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Semper Smile
Covermotiv: Palinpicture/O.Mahlstedt
ISBN 978-3-641-24267-1V005
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
für m.
Leipzig
1 Walfisch
Sogar durch das Holz der Tür erkenne ich ihre Stimme, diesen halb eingeschnappten Tonfall, der immer klingt, als hätte man ihr gerade einen Herzenswunsch abgeschlagen. Ich nähere ein Auge dem Türspion und sehe direkt in einen übergroßen, weitwinklig verbogenen Augapfel, als läge im Treppenhaus ein Walfisch vor meiner Tür und versuchte, in die Wohnung hereinzuschauen. Ich fahre zurück und drücke vor Schreck auf die Klinke.
Ich war sicher, dass sie schwarzhaarig ist. Aber sie ist blond. Sie steht auf meiner Fußmatte, das linke Auge zugekniffen, den Oberkörper leicht vorgebeugt zu der Stelle, an der sich eben noch, bei geschlossener Tür, die Linse des Spions befand. Ohne Eile richtet sie sich auf.
Oh Scheiße, sage ich. Komm rein. Wie geht’s.
Gut, sagt sie, hast du vielleicht Orangensaft da?
Habe ich nicht. Sie guckt mich an, als müsste ich jetzt sofort losrennen und im Supermarkt an der Ecke drei Flaschen von dem Zeug erstehen. Wahrscheinlich wäre es dann die falsche Marke und sie würde mich noch einmal losschicken. Ich sehe sie zum ersten Mal, und soweit ich es erkennen kann, während sie in meine Wohnung hineinspaziert, hängt an ihr keine Gebrauchsanweisung dran. Sie hat geklingelt, ich habe geöffnet.
Drei Sekunden später sitzt sie am Küchentisch und wartet auf gastgeberische Aktionen meinerseits. Ich bin wie gelähmt von der Erkenntnis, dass es sie erstens wirklich gibt und dass sie zweitens tatsächlich hier auftaucht. Sie macht sich nicht die Mühe, ihren Namen zu nennen. Offenbar geht sie davon aus, dass zu einer Stimme wie ihrer nur ein Mädchen wie sie gehören kann, und irgendwie ärgert es mich, dass sie recht hat damit, trotz der langen blonden Haare, die sie jetzt zurückwirft, damit sie hinter der Stuhllehne herunterhängen. Schon nach den ersten zwei Minuten mit ihr wird es schwierig, mich daran zu erinnern, wie ich sie mir vorgestellt habe, während ich ihrer dämlichen Sendung zuhörte. Ein bisschen wie Mata Hari, glaube ich. Sie wirkt definitiv zu jung, sie sieht aus wie ihre eigene kleine Schwester. Aber sie hat diese unverkennbare Stimme, deren beleidigter Klang sich immer auf die Ungerechtigkeit der Welt im Ganzen zu beziehen scheint, während sie den albernen Geschichten ihrer Anrufer zuhört. Es sind vor allem Männer. Sie hört sie an und macht ab und zu Hmhm-hmhm, dasselbe tiefe, brummende Hmhm, mit dem ihre Mütter sie in den Armen gewiegt haben. Manche fangen an zu heulen. Ich nicht. Dafür begeisterte mich von Anfang an die unglaubliche Kälte, mit der sie ihre schluchzenden Anrufer mitten im Satz abwürgt, wenn sie die vorgeschriebenen drei Minuten Sprechzeit überschritten haben. Sie muss grausamer sein als die Inquisition. Schon vor Monaten, lange bevor ich selbst eine alberne Story zu erzählen hatte, habe ich mir angewöhnt, sie Mittwoch- und Sonntagnacht einzuschalten.
Wahrscheinlich notieren sie im Sender die Nummern aller Anschlüsse, von denen aus angerufen wird. Ich nannte einen Vornamen und der war auch nicht echt. Aber über eine Telephonnummer lässt sich die Adresse herausfinden, wenn man unbedingt will. Das habe ich jetzt davon.
Draußen vor dem Fenster klebt der Mond am Himmel, rot, viel zu groß und mit zerfleischtem Rand an einer Seite. Er sieht nicht aus wie ein gutes Zeichen, auf einmal kriege ich Angst. Ich habe seit Wochen keine Angst mehr gehabt, warum jetzt plötzlich. Ich benehme mich komisch. Ich muss ihr etwas anbieten.
Orangensaft ist alle, sage ich, aber du könntest Apfelsaft haben.
Nein danke, sagt sie, wenn es keinen Orangensaft gibt, dann will ich gar nichts.
Sie schaut mich verächtlich an. Ich bin Max-der-Orangensaftvernichter und werde erleben müssen, wie sie unter meinen Augen verdurstet. Ich schütte Kaffee in die Espressomaschine, um mich in Bewegung zu halten. Dann steht die Tasse vor ihr, sie schnuppert daran und verzieht angeekelt das Gesicht, als handelte es sich um Schweineblut.
Apropos Blut, sagt sie.
Ich habe nichts von Blut gesagt. Vielleicht gehört Gedankenlesen zu ihrem Job.
Wo ist es passiert?
Niemandem ist es gestattet, danach zu fragen. Ich müsste eigentlich gleich in ihre Haare greifen und sie daran über den Flur zerren, ihr die Füße wegtreten, falls sie versuchen sollte, auf die Beine zu kommen. Sie rauswerfen. Aber ich tue es nicht. Ich habe zu lange mit niemandem gesprochen, außer mit denen im Supermarkt und mit der Schwuchtel, die die Pizza bringt. Er schaut mir ständig aufs Kinn und überlegt, ob mein Bart schon wieder gewachsen ist, und wenn ich ihn in die Küche lasse, während ich nach Kleingeld suche, gerät er außer sich vor Begeisterung darüber, dass die Spüle an Ketten von der Decke hängt und der Herd aus Sandstein gemauert ist. Einmal hat er im Treppenhaus versucht, mir an den Arsch zu fassen, und als ich ihn wegstieß, ist er rückwärts die Stufen runtergefallen. Er kommt trotzdem wieder, jeden Tag außer sonntags, ich weiß nicht, wie oft schon.
Huhu, sagt sie, wo es passiert ist?
Sie lächelt. Dieses Lächeln passt zu ihrer Stimme wie ein bequemes Kleidungsstück, und die Stimme geht einmal durch den Raum und stellt sich neben mich und tippt mir auf die Schulter. Jetzt spüre ich es auch: diesen Wunsch zu heulen. Genau wie die anderen. Aber nein. Nicht mehr. Nie wieder.
Heulen war schon. Zwei Tage und Nächte lang ohne Unterbrechung, ohne Schlaf, ohne mich vom Boden des Zimmers zu erheben. Alle paar Stunden, immer wenn meine Augen so ausgetrocknet waren, dass sie sich wie aufgestochene Brandblasen anfühlten, trank ich einen Schluck Wasser aus der halbvollen Flasche, die herumstand und aus der auch Jessie getrunken haben musste, bevor sie es tat. Ich hatte sie sogar schlucken gehört, am Telephon, ich hatte gehört, wie Wasser aus genau dieser Flasche von den Muskeln in ihrem Hals durch die Kehle gedrückt wurde.
Mit dem bisschen Flüssigkeit gelang es mir, neue Tränen hervorzubringen, und als die Flasche ausgetrunken war, glaubte ich sicher, blind zu werden. Das war mir willkommen. Ich hatte ohnehin nicht vor, jemals wieder die Augen zu öffnen. Zur Hälfte taub war ich schon, meine linke Hand presste ich unablässig gegen das linke Ohr, von dem ich wusste, dass darin die Fetzen meines geplatzten Trommelfells herumflatterten wie Vorhänge an einem offenen Fenster. Auch das war mir willkommen. Ich heulte ohne Feuchtigkeit weiter, mein Körper lag auf den Dielen, erst zusammengekrampft und hart wie ein Holzklotz, später schlaff wie ein abgeworfenes Kleidungsstück. Ich hoffte, aus eigenem Antrieb zu sterben. Stattdessen schlief ich ein, irgendwann. Als ich wieder aufwachte, irgendwann, tastete ich mich in die Küche zum Kühlschrank und entnahm dem Gefrierfach ein Siegel Koks, und weil meine Nase mit sich selbst verwachsen war zu einem festen Klumpen, ohne jede Öffnung, riss ich den Mund auf und warf das Koks hinein und schluckte schnell, bevor mir der Hals so taub wurde, dass das Schlucken nicht mehr ging. Dann ging ich aus der Wohnung, ließ die Tür offen stehen und verließ das Haus. Das ist etwa acht Wochen her. Seitdem habe ich keine Träne mehr vergossen und auch nicht das Bedürfnis danach verspürt. Bis jetzt. Das Radiomädchen hat mit Sicherheit ein besonderes Talent. Für einen Moment denke ich, dass alles gut wird.
Im Arbeitszimmer, sage ich.
Sie guckt durch die offene Küchentür schräg über den Flur. Eine der beiden Flügeltüren ist mit Brettern vernagelt. Sie schaut noch eine Weile hin und nimmt aus Versehen den ersten Schluck von ihrem Kaffee. Es vergeht eine halbe Ewigkeit, während der sie beweist, dass ihre Finger klein genug sind, um drei davon durch den Henkel der Tasse zu schieben.
Woher kanntest du sie denn, fragt sie.
Ich hab sie in den Trümmern einer eingestürzten Stadt gefunden, sage ich.
Als sie mir unvermittelt ins Gesicht sieht, erkenne ich, was mit ihren Augen los ist: Blau sind sie beide, aber das eine wie Wasser und das andere mehr wie Himmel.
Bisschen komisch bist du schon, sagt sie.
Du hast ja keine Ahnung, was in dieser Welt abgeht, sage ich, und wenn ich es dir erzählte, würdest du es nicht glauben.
Nee, sagt sie ironisch, schließlich lebe ich auch erst seit dreiundzwanzig Jahren.
Jetzt hat sie mich wohl darüber informiert, wie alt sie ist. Zehn Jahre jünger als ich. Wenn es überhaupt stimmt.
Du lebst in einer anderen Zone, sage ich. Du kriegst das nicht mit.
Vielleicht solltest du mal darüber sprechen, sagt sie.
Und du, denke ich, solltest vielleicht mal bäuchlings über einen Couchtisch geworfen und kräftig durchgevögelt werden. Nur nicht von mir. Den Job kann ein anderer haben.
Ich erklär’s dir, sage ich.
Sie fummelt an meiner Pfeffermühle herum. Wahrscheinlich stellt sie sich vor, es sei ein Mikrophon, weil sie nicht zuhören kann, wenn sie kein Mikrophon vor sich hat. Mir fällt ein, dass die Leute beim Radio mit einem Kopfmikrophon arbeiten und dass das nicht aussieht wie eine Pfeffermühle.
Siehst du den Großteil Europas verwüstet, frage ich, die Überlebenden betrogen, geschändet und gedächtnislos?
Nein, sagt sie.
Ich aber, antworte ich.
Es vergeht die zweite Hälfte der Ewigkeit. Wir könnten genauso gut getrennt voneinander sitzen, jeder in seiner eigenen Küche, grübelnd oder vollkommen leer, Löcher in die Luft starrend, in genau dieser Haltung, aber an verschiedenen Orten. Dann hätten wir auch nicht weniger miteinander zu tun als jetzt. Sie schiebt möglichst viele Finger durch den Henkel ihrer Kaffeetasse, ich zeichne mit dem Löffel Fluchtpläne in das Kästchenmuster der Tischdecke.
Wie hieß sie überhaupt, fragt sie.
Ich erschrecke, obwohl ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie wieder mit dem Sprechen anfängt.
Das geht dich einen Scheißdreck an, sage ich.
Zeig mir das Zimmer, wo es passiert ist.
Einen Scheißdreck zeige ich dir.
Bitte, sagt sie.
Ich werde das Zimmer nie wieder betreten, sage ich.
Du willst ein Zimmer deiner eigenen Wohnung nie wieder betreten, fragt sie, und das in einer Drei-Zimmer-Wohnung?
Halts Maul, brülle ich.
Ich lasse eine Hand flach auf den Tisch fallen, dass der Kaffeelöffel auf den Boden hüpft.
Dann hast du nur noch zwei Zimmer, sagt sie.
Nur noch eins, flüstere ich, es ist in einem Durchgangszimmer passiert.
Das solltest du dir noch mal überlegen, sagt sie.
Ich erhebe mich leicht von meinem Stuhl, um besser ausholen zu können, und schlage ihr mit dem Handrücken quer über den Mund. Ihr Kopf wird zur Seite geschleudert, und der Zopf, den sie gerade erst locker zusammengebunden hat, löst sich unterwegs, die Haare fliegen durch die Luft und fallen wirr über Gesicht und Schultern. In Zeitlupe hätte das mit Sicherheit gut ausgesehen. Wie eine Shampoo-Werbung. Ich stehe auf und gehe zum Fenster, um ihr Zeit zu geben, ihr Haar wieder in Ordnung zu bringen. Rechts unten in der Ecke sind drei Marienkäfer in einem tüllartigen Spinnennetz verendet, alle mit der gleichen Anzahl von Punkten auf den Rücken. Ich frage mich, ob irgendeine Spinne auf der Welt in der Lage ist, an das Weiche, Essbare in ihrem Innern heranzukommen.
Beim nächsten Blickkontakt hat das Radiomädchen Flecken im Gesicht, an Stellen, wo ich sie gar nicht getroffen habe, und in ihrem rechten Auge, das wie Wasser ausgesehen hat, mischt sich etwas Rot ins Blau. Jetzt sieht es aus wie Wasser, in dem irgendwo ein Verletzter schwimmt. Das erinnert mich an den Mond und ich sehe hinaus. Er hat sich inzwischen von seinem Blutsturz erholt, ist hellorange und kleiner geworden und schärfer konturiert. Er ist hoch aufgestiegen, den Sternen zu.
Im nächsten Satz, den sie sagt, kommt das Wort »Diplomarbeit« vor. Kurz denke ich darüber nach, ihr noch einmal ins Gesicht zu schlagen, aber die Vorstellung hat nicht den geringsten Reiz. Ich setze mich wieder hin.
Noch Kaffee, frage ich.
Orangensaft, wimmert sie.
Ihr Tonfall erinnert mich viel zu sehr an Jessie, die auch immer gewimmert hat, wenn sie nicht bekam, was sie wollte. Um mich von dem Gedanken abzulenken, konzentriere ich mich auf meine Mundhöhle. Mein Rachenraum schmeckt wie das Wartezimmer eines Internisten. Steril. Gaumen, Zunge, Lippen taub, ich werde lallen bei den nächsten Worten, ich hoffe, dass mir der Speichel nicht aus dem Mund trieft. Alles ist toll. Alles wird immer toller, alles ist ohnehin nur ein Spiel, alles ist alles. Und Erinnerungen sind einfach nur wie Fernsehen.
Ich lächele die Frau an meinem Küchentisch an, es ist ein ehrliches Lächeln, und als sie zurücklächelt, vorsichtig, wegen der geschwollenen Lippe, fange ich an zu strahlen. Wie 1000 Watt, wie Halogen. Toll. Ich bin toll. Ich denke darüber nach, sie »Baby« zu nennen.
Was hast du gerade gesagt, Baby, frage ich.
Orangensaft, wiederholt sie.
Nein, sage ich freundlich, noch davor.
Dass du ein Thema wärst für meine Diplomarbeit.
Oh, sage ich, du arbeitest nicht nur, du erwirbst auch Bildung. Das finde ich toll. Hast du Zigaretten?
Jetzt werde ich redselig. Sie beäugt mich misstrauisch.
Willst du mich verarschen?
Nein, sage ich, ich finde das wirklich klasse. Studieren ist super. Was studierst du?
Interessiert schaue ich ihr ins Gesicht. Ihre Lippe schwillt weiter an, das steht ihr gut, meine Lippen sind möglicherweise auch geschwollen, jedenfalls hängen sie herunter, das ertaste ich mit den Fingerspitzen. Komplett taub. Beim Sprechen gerät mir ständig die Unterlippe zwischen die Zähne, sie fühlt sich an wie ein Stück weichen Radiergummis, und ich muss es ausspucken. Wir sehen uns an.
Soziologie und Psychologie, sagt sie.
Klar, sage ich, toll. Das passt zu deiner Arbeit.
Ich gehe jetzt, sagt sie.
Und steht auf.
Nein nein nein nein!
Ich greife nach ihr, um sie wieder auf ihren Stuhl zu drücken. Sie entwischt. Ich will reden.
Geh nicht, sage ich.
Das 1000-Watt-Lächeln blendet sie, sie weicht weiter zurück. Vom Flur aus wirft sie mir ein Päckchen Zigaretten zu.
Rauchen wir eine zusammen, rufe ich.
Ich rauche nicht, sagt sie. Die Kippen gehören zur Arbeitsausstattung. Bei Besuchen wie diesem.
Sie nimmt ihre Jacke und ich höre mich weiterfaseln, dass sie bleiben soll, das Reden klappt mit Hochgeschwindigkeit, trotz der halbgelähmten Sprechwerkzeuge. Ich muss mich mit jemandem unterhalten. Es gibt so viele feine strahlende Wörter in mir, sie brauchen einen Adressaten. Ich fühle mich wie ein Gefäß, in dem Glühwürmchen durcheinander wirbeln. Ich will sie verschenken. Ich gehe zu Grunde, wenn das Radiomädchen jetzt abhaut.
Tschüs, sagt sie, ich komme wieder.
Die Tür kracht hinter ihr ins Schloss, und ich lasse mich auf den kühlen Kachelboden fallen und fange an, die Nationalhymne zu singen. Ein anderes Lied fällt mir nicht ein.
2 Tiger (Eins)
Ich erwache vom Klingeln des Weckers. Meine Finger sind um die Kante des untersten der kreuz und quer an den Türrahmen genagelten Bretter gekrallt. Der anschwellende, elektronische Ton dringt durch die Wände der Wohnung, als wären sie aus Papier, jeden Morgen und Abend regelmäßig um sieben, zur Stunde, in der er Jessie und mich an ihrem letzten Morgen geweckt hat. Ich höre ihn von der Küche aus, im Wohnzimmer, und erst recht hier im Flur. Ich danke Gott, dass ich damals zufällig einen Voice Control gekauft habe.
Sei ruhig!, rufe ich.
Weil er nicht reagiert, räuspere ich mich, hebe leicht das Gesicht und rufe noch einmal, so laut es geht.
Halts Maul!
Er verstummt. Noch viermal werde ich ihn anschreien müssen, wahlweise mit Fäusten oder Stirn gegen die zugenagelten Türen trommeln, im Abstand von jeweils drei Minuten. Falls ich mich noch auf irgendetwas freue, dann auf den Tag, an dem seine Batterie endlich erschöpft sein wird.
Getrockneter Schweiß hat eine spröde Salzkruste über meiner Oberlippe und auf der Stirn hinterlassen. Wenn ich mit dem Finger darüber reibe, bröselt er weiß und fein herunter. Auf dem Boden, dicht vor meinen Augen, entsteht ein Mikrokosmos, eine Schneelandschaft. Ein Knäuel Staub ist der Wald, die kleine Speichelpfütze, die mir aus dem Mund gelaufen ist, ein See. Es schneit. Ich mache weiter, bis nichts mehr nachkommt. Dann blase ich hinein und stehe auf.
Der Flur ist lang wie ein Eisenbahnwaggon und leer bis auf das Telephonschränkchen aus Aluminium neben der Eingangstür und einen schmalen, geknüpften Läufer, der schnurgerade darauf zuläuft, als könnte man sich ohne seine Hilfe auf dem Weg dorthin verirren. Auf dem Aluminiumschränkchen liegen das schnurlose Telephon und das Zopfband des Radiomädchens. Die beiden Gegenstände beißen sich. Ich nehme das Zopfband mit spitzen Fingern und lasse es hinter das Schränkchen fallen. Als ich das Telephon anfasse, stellen sich die Haare auf meinen Unterarmen auf. Da muss doch Blut und Gehirn dran gewesen sein, hat das Radiomädchen während meines Anrufs gefragt. Die ganze Zeit bin ich nicht auf ihren Namen gekommen, jetzt fällt er mir wieder ein: Clara.
Jedenfalls nennt sie sich so in der Sendung.
Die Hör- und Sprechmuscheln hatte jemand anderes sauber gemacht, und ich wunderte mich selbst, wie leicht es war, wieder ein Telephonat damit zu führen. Irgendwie gelang es dem Gegenstand, eine gewisse Neutralität zu wahren. Ich stand im Wohnzimmer, hatte das Gerät in der Hand und konnte den Blick nicht davon abwenden. Es passiert mir öfter, dass ich auf diese Art einraste. Vor meinen Augen verschwimmt alles, und im Kopf sehe ich Szenen und höre Stimmen. Es ist meine Art, mich zu erinnern. In jener Nacht blieb mein Blick starr im Leeren stehen, als ich ihm schließlich das Telephon entzog. Die Nummer von Claras Sendung kenne ich auswendig, sie wird alle zehn Minuten eingespielt und dabei in einer Melodie gesungen, die man sich leicht merken kann. Diese Melodie glaubte ich zu hören, während ich die Ziffern eintippte, und so war es mehr ein Mitsingen als das Wählen einer Telephonnummer. Ich drückte das Gerät an das gesunde Ohr. Obwohl das Radio nicht lief, wusste ich, dass sie auf Sendung war. Es war Mittwochnacht zwischen Mitternacht und eins. Mir war nicht ganz klar, was ich tat. Als sich jemand meldete, erschrak ich fürchterlich. Trotzdem nannte ich dem Telephonisten das Thema meines Anrufs und wurde sofort durchgestellt.
Sie fing mit ihren Begrüßungsformeln an, ich ließ sie nicht ausreden. Ich sagte ihr, dass ich von einem Telephongespräch erzählen wollte, das auf dem Apparat geführt worden war, von dem aus ich jetzt anrief.
Wie lange ist das her, fragte Clara.
Acht Wochen, und jetzt halt die Fresse und lass mich reden, sagte ich.
Okay, sagte Clara.
Weil es mich aufwühlte, Jessies Namen zu nennen, beschloss ich, »meine Freundin« zu sagen. Das klang in meinen eigenen Ohren, als würde ich von einer fremden Person erzählen.
Nicht ich hatte diesen Apparat in der Hand, sondern meine Freundin. Ich saß in der Kanzlei und hatte sie angerufen, um zu sagen, dass es spät werden würde. Meine Freundin sprach nicht viel, sie gurrte eher.
Ein oder zwei Stunden, mein Kleines, sagte ich.
Hm – hm – hk-hk-hk, machte meine Freundin.
Komm, nicht meckern, sagte ich.
Wann kommst du denn?
Sie zog jeden Vokal unnatürlich in die Länge.
Bald, sagte ich, gleich.
In den Wochen davor war es noch schlimmer gewesen als sonst, man konnte tageweise kein vernünftiges Wort mit ihr wechseln. Natürlich war sie süß. Auch anstrengend. Vor allem aber machte ich mir Sorgen.
Cooooper, sagte sie, ich glaube, die Tiger sind wieder da.
Das ist doch Unsinn, sagte ich, hör auf damit.
Du kommst doch wiiiieder, oder?
Natürlich komme ich wieder, sagte ich, spinn nicht rum.
Ich spinne nicht, sagte sie.
Dann fiel der Schuss. Erst erkannte ich ihn gar nicht als ein Geräusch, er fuhr mir wie ein Messer ins linke Ohr, der Schmerz war scharf und schnell, und danach begann es zu pfeifen. Ich besaß die Geistesgegenwart, den Hörer blitzschnell ans andere Ohr zu wechseln, und so hörte ich gerade noch das dumpfe Aufschlagen eines Körpers und gleich darauf das harte Klappern, als der Apparat, den meine Freundin gehalten hatte, über den Boden schlitterte. Dann war Stille. Die Leitung war nicht tot, aber es war still. Ganz leise das Winseln eines Hundes. Ein paar Mal rief ich ihren Namen. Halbherzig. Manchmal heißt es, der Schock würde die Dinge dämpfen und einen am Verstehen hindern. Ich wusste alles sofort. Ich wusste, dass es zu spät war. Ich wusste nur nicht, warum sie es getan hatte.
Zu Hause fand ich sie. Das Telephon hatte nicht einmal einen Kratzer abbekommen.
Und mit dem Telephon rufst du jetzt bei mir an, fragte Clara, da muss doch Blut und Gehirn dran gewesen sein.
Für ihre Verhältnisse klang sie aufgeregt.
Das stimmt, sagte ich. Sie hat sich ins Ohr geschossen.
Dann legte ich auf, um mich zu übergeben.
Der Wecker piepst, ich schreie ihn an. Nachdem das Zopfband hinter dem Schränkchen verschwunden ist, schleudere ich das Telephon auf den Boden, dass es über die Dielen bis in die Küche rutscht und Akku und Plastikdeckel vom Akkufach in verschiedene Ecken fliegen. Ich habe es schon oft auf diese Art hingeworfen. Es geht nicht kaputt. Nur der Akku fliegt raus und manchmal nicht einmal das.
Ich gehe zum Kühlschrank und sniefe so heftig, dass meine Nase zu bluten anfängt. Es läuft mir über das Kinn und in den Hemdkragen. Ich wische es nicht ab. Schon wieder drei Minuten um, ich schreie dem Wecker zu, diesmal vom Wohnzimmer aus, wo ich mich auf das Matratzenlager werfe, den Kopf nach hinten über den Rand des Polsters klappen lasse und nur noch der Pfeife lausche in meinem linken Ohr, die mich wissen lässt, dass Jessie an mich denkt.
Mit Hilfe von Wandkalender und Armbanduhr versuche ich mich zu orientieren. Die Berechnungen ergeben Montag und Anfang eines Monats, den ich noch weit vor mir vermutet hätte. Damit ist es nur noch eine Frage von wenigen Tagen, möglicherweise wenigen Stunden, bis die Firma anruft. Und dann wird offiziell, dass ich es nicht packe. Dass es ohne Jessie keinen Job mehr gibt, kein Geldverdienen, kein normales Leben. Damals, als sie bei mir ankam, dachte ich noch, dass es MIT ihr kein normales Leben mehr geben könne. Das ist der Humor des Schicksals, ich zwinge mich zu lachen:
Ha ha ha.
Als das Radiomädchen das nächste Mal bei mir auftaucht, um ihr Zopfband abzuholen, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde nicht versuchen, ein neues Leben anzufangen. Für das, was Jessie getan hat, fehlt mir zwar die Phantasie. Aber ich kann den Dingen ihren natürlichen Lauf lassen, dann mache ich es auch nicht mehr lange. Der Gedanke beruhigt mich. Ich begrüße das Radiomädchen mit einem weisen Lächeln auf meinen trockenen Lippen.
Dein scheiß Haarband, sage ich, ist aus dem Fenster geflogen und an der Hinterachse eines LKW hängen geblieben und jetzt wird es mitgeschleift bis zum Bosporus und löst sich in einzelne Fasern auf, und du ziehst am besten los und sammelst sie auf und strickst dir ein neues. Und dann kommst du wieder, wenn du fertig bist.
Du kennst aber lange Sätze, sagt sie.
Sie marschiert an mir vorbei in meine Küche und setzt sich auf den Platz vom letzten Mal. Sie legt beide Hände flach auf den Tisch.
Orangensaft, sagt sie.
Ich habe welchen da und überlege, ob ich lügen soll. Es ist mir zu anstrengend. Ich schenke ein Glas ein und stelle es vor sie hin. Sie schaut zu mir auf mit einem Ausdruck hilfloser Dankbarkeit. Das bringt mich auf die Idee, meinen Entschluss über den Haufen zu werfen und doch etwas Handfestes zu tun, zum Beispiel den Kopf in den Gasofen zu stecken.
Es ist gar nicht das scheiß Haarband, sagt sie.
Sie gießt den Orangensaft aus dem Glas zurück in die Flasche, ohne einen einzigen Tropfen zu verschütten. Die Flasche setzt sie an und trinkt sie leer bis auf einen fingerbreiten Rest.
Ich wollte dir was erzählen, sagt sie.
Nur zu, sage ich.
Ich habe eine neue Lieferung erhalten, der Kühlschrank ist voll, und vor diesem Hintergrund kann ich mir was auch immer anhören.
Ich habe geträumt letzte Nacht, sagt sie, und du bist darin vorgekommen.
Nickend und lächelnd entnehme ich dem Kühlschrank eine weitere Flasche Orangensaft für sie und ein Siegel Pulver für mich.
Du warst der Regisseur eines Films, sagt sie, und der Film war gerade fertig. Du wolltest ihn mir zeigen. Es ging um eine Frau, die von ihrem Mann betrogen wird.
Originell, näsele ich.
Mit zurückgelegtem Kopf klopfe ich mir auf die Nasenflügel.
Sie war schwanger im letzten Monat, sagt sie.
Red ruhig weiter, sage ich.
Ich gehe ins Wohnzimmer, um meine Zigaretten zu suchen. Als ich in die Küche zurückkomme, hat sie tatsächlich alleine weitergesprochen.
Gynäkologenstuhl, sagt sie gerade. Ein Arzt hantiert mit der Geburtszange. Du sagst, dass es deine Lieblingsszene ist. Die Frau windet sich unter ihren Presswehen und schreit, und der Arzt holt schließlich etwas zwischen ihren Beinen hervor und hält es ihr hin. Es ist das großformatige Photo eines Neugeborenen, ganz knitterig und blutbeschmiert. Ein Schwarm Fliegen schwirrt drum herum.
Ich blase ihr Zigarettenrauch ins Gesicht, weil mir eingefallen ist, dass sie nicht raucht. Es scheint sie nicht zu stören. Sie öffnet die zweite Flasche Orangensaft.
Wie findest du das, fragt sie.
Unwichtig, sage ich.
Das war doch dein blöder Film, sagt sie. So was Krankes kann ich mir gar nicht ausdenken.
Vielleicht eben deshalb unwichtig, sage ich.
Jedenfalls wusste ich nach diesem Traum die Antwort auf etwas, das ich mich schon die ganze Woche frage, sagt sie.
Und, frage ich.
Ich wollte wissen, sagt sie, warum du bei mir in der Sendung angerufen hast. Jetzt weiß ich es. Weil du mir die ganze Geschichte erzählen wirst.
Einen kurzen Moment herrscht Schweigen. Dann erhebe ich mich. Es ist an der Zeit, sie ein zweites Mal zu schlagen, und diesmal werde ich erst damit aufhören, wenn sie am Boden liegt.
Das Telephon unterbricht mich. Eigentlich bin ich ganz froh. Sie hat keinen Mucks von sich gegeben, und das rührt mich so, dass ich nicht richtig ausholen kann. Außerdem ist es heiß, bislang der heißeste Tag im Jahr. Während ich das verdammte Telephon in allen Ecken suche, kriecht Clara über den Flur und lehnt sich gegen die Wand. Unter den Laken auf meinem Matratzenlager werde ich fündig. Ich bin außer Atem und schwitze. Das Klingeln macht mich nervös. So nervös, dass ich drangehe ohne mich zu fragen, wer das überhaupt sein kann.
Rufus will Sie sprechen, sagt die Sekretärin.
Es ist meine Firma. Nicht die kleine Korrespondenzkanzlei hier in Leipzig, sondern das Büro vom großen Häuptling in Wien. Ich lasse mich auf die Matratze fallen. Es bleiben wenige Sekunden zum Durchatmen, während ich durchgestellt werde.
Scheiße, flüstere ich, Scheiße.
Mäx, sagt Rufus.
Er ist Amerikaner, und ich habe es nie gewagt, ihn davon abzubringen, meinen Vornamen wie »Mäx« auszusprechen. Als ich die ersten Erfolge feierte in seiner Kanzlei, begann er, mich manchmal »Mäx the mäximal« zu nennen. Er ist einer der größten Spezialisten im Europäischen und Internationalen Recht, und ich vergötterte ihn schon, als ich ihn in Gastvorlesungen auf der Uni hörte. Einen Tag nach der letzten, mündlichen Prüfung des Zweiten Staatsexamens klingelte das Telephon und eine sachliche Frauenstimme bot mir einen Job an. Bei Rufus in Wien. Sie nannte als monatliches Einstiegsgehalt einen Betrag, von dem ich zuvor ein halbes Jahr gelebt hatte. Ich hätte auch nur für Kost und Logis bei ihm gearbeitet. Er ist ein Genie. Und er hat keine Ahnung davon, was mit mir los ist.
Rufus, sage ich.
Wie geht es Ihnen, fragt er.
Sein Wienerisch mit amerikanischem Akzent klingt niedlich wie immer. Wer ihn nicht kennt, unterschätzt ihn gern.
Fein, sage ich.
Dann wundere ich mich, warum Sie nicht arbeiten, sagt er.
Na gut, sage ich, es geht mir beschissen.
Das dachte ich mir, sagt er. Ich erfuhr etwas von einem Unglücksfall, aber ich überblicke zu wenig, um zu kondolieren.
Machen Sie sich keine Mühe, sage ich.
Mäx, sagt er, Sie wissen, dass die Firma Sie braucht. Ich rufe an, um daran zu erinnern, dass SIE die FIRMA brauchen.
Am hallenden Klang seiner Stimme höre ich, dass er sich im Konferenzzimmer befindet. Der Raum ist so groß wie meine ganze Wohnung, doppelt so hoch und hat Fenster, die vom Boden bis zur Decke reichen. Als ich das zum ersten Mal sah, dachte ich, Rufus sei einer, der alles im Leben erreicht hat. Und ich selbst einer, der alles erreichen würde.
Es tut mir leid, sage ich, aber Sie irren sich.
Nein, sagt er, Sie wissen es selbst. Sie kennen die beruhigende Wirkung des Rechtssystems, Mäx. Gebrauchen Sie das für sich.
Rufus, ich bin drogenabhängig.
Eine Weile ist die Leitung wie tot. Dann lacht er schallend.
Mäx, sagt er, Sie wissen doch, dass dreißig Prozent aller bewundernswerten Juristen drogenabhängig sind. Und von denen arbeiten hundert Prozent bei uns.
Der Witz ist mir zu mathematisch, um schnell genug hinterherzukommen. Natürlich weiß ich, wie es läuft. Alle haben Stress. Aber ich wusste nicht, dass er es weiß.
Ich kann nicht zurück, sage ich. Ich habe schon aufgegeben.
Was aufgegeben, fragt er.
Etwas gegen das Rieseln an allen Mauern und Brückenpfeilern zu unternehmen, sage ich.
Mäx, sagt er, haben Sie etwa zu dichten begonnen?
Nein, sage ich.
Sie wissen, sagt er, dass es eine Unzahl von jungen Rabulisten gibt, die alles opfern würden für Ihren Job?
Ja, sage ich.
Sie wissen auch, sagt er, dass es nicht vielen Menschen zustößt, nach neun Wochen Fehlzeit noch zum Bleiben aufgefordert zu werden?
Das, sage ich, kann nur jemandem passieren, der bei Ihnen arbeitet.
In meiner Vorstellung wird er noch kleiner, lederner und sonnenbrauner, als er ohnehin schon ist. Sein Bürozimmer in Wien ist das kleinste von allen und das einzige mit antiquarischen Möbeln anstelle der minimalistischen Holzkonstruktionen im Japanstil. Ich sehe Rufus vor mir, wie er zehn knallrote, beindicke Gesetzesbücher zu einem Podest aufeinander türmt, um in seinem Büro an das obere Regal mit den frühen NATO-Dokumenten aus den fünfziger Jahren heranzukommen. Er ist ein Phänomen. Das Radiomädchen erscheint kriechend im Türrahmen des Wohnzimmers. Ihre Backen sind ein bisschen feucht, sonst sieht man ihr fast nichts an. In gebührendem Abstand zu mir bleibt sie sitzen. Es tut gut, sie anzusehen.
Außerdem, sagt Rufus, verdienen Sie ein Schweinegeld.
Ach, das, sage ich.
Sind Sie sicher, fragt Rufus, dass Sie nicht danach trachten, ein Dichter zu werden? Man weiß nie bei euch Deutschen.
Ganz sicher, sage ich lächelnd.
Sie bitten mich also um die Kündigung?
Wir wissen beide, worum es geht. Ich hole tief Luft.
Ich bitte Sie um eine betriebsbedingte Kündigung, verbunden mit einer gewaltigen Abfindung, sage ich.
Sie haben nicht viel mehr als drei Jahre bei uns gearbeitet, sagt er.
Ich antworte nicht. Ich weiß, dass er jetzt gegen sich kämpft. Auch wenn er mich mag, ich gehe zu weit.
Alles Weitere schriftlich, sagt er schließlich. Viel Glück, Mäx.
Viel Glück, Rufus, sage ich. Sie sind …
Er hat schon aufgelegt. Ich lasse das Telephon aus der Hand fallen und beschließe, es endgültig abzuschaffen. Ich brauche es nicht mehr. Ich stopfe mir Bettzeug unter dem Nacken zusammen und suche eine kühle Stelle für mein Gesicht.
Na dann, sagt das Radiomädchen plötzlich leise, dann hast du ja jetzt viel Zeit.
3 Loch
Ich habe sie vor die Tür gesetzt und nach zehn Minuten klingelt es wieder.
Bevor ich gehe, sagt sie, möchte ich doch gerne mein Haarband zurück.
Ich bin müde. Sie bringt einen kühlen Luftzug aus dem Treppenhaus mit herein. Die Haare hängen ihr ins Gesicht. Ich zeige auf das Aluminiumschränkchen und gehe in die Küche. Ich höre, wie sie es beiseite schiebt. Es dauert lange, bis sie das nächste Mal spricht.
Ist das eigentlich normal, fragt sie, wenn bei dir in der Wohnung die Dielen zersägt sind?
Ich schaue über den Flur. Der Telephonschrank steht immer noch von der Wand abgerückt, das Radiomädchen beugt sich über den Boden. Ihr Zopfgummi hat sie gefunden, sie trägt jetzt wieder Pferdeschwanz. Erst will ich gar nicht hingehen, es ist offensichtlich, dass sie den allerkleinsten Anlass nutzt, um mir noch ein paar Minuten länger auf die Nerven fallen zu können.
Dann komme ich doch näher.
Wir stehen nebeneinander wie Freunde und gucken auf das Loch. Es ist rechteckig und hat unglaublich stümperhaft ausgeführte Schnittkanten, mit denen es wie die Laubsägearbeit eines Schulkindes aussieht. In einer Ecke befinden sich mehrere Bohrlöcher, die gemeinsam den Ansatzpunkt für die Säge gebildet haben müssen. An den beiden kurzen Enden sind von unten schmale Pappstreifen in die Öffnung geklebt, die den ausgesägten Deckel trugen, ein etwa vierzig Zentimeter langes Dielenstück, das Clara herausgehoben hat. Sie muss starke Daumennägel haben. Jessie hatte auch so starke Daumennägel. Krampfhaft versuche ich mich zu erinnern, wann das Schränkchen zuletzt bewegt worden ist. Mir fällt keine einzige Gelegenheit ein. Folglich kann sich das Geheimfach schon seit unserem Einzug in die Wohnung dort befinden, seit maximal zwei Jahren. An diesem Loch erkenne ich Jessies einzigartige Naivität – zu glauben, etwas so schlecht Verstecktes könne nicht gefunden werden. Eine Naivität, von der sich der Zufall korrumpieren lässt, so dass letzten Endes Raffinesse dabei herauskommt.
Ich war sicher, alles, was zu Jessie gehört hat, in den beiden Zimmern eingeschlossen zu haben, spurlos getilgt. Jetzt gibt es hier etwas von ihr, das erstens unerträglich typisch für sie ist und sich zweitens nicht wegräumen lässt. Ein Loch. Es schmerzt so sehr, dass ich mich abwenden muss. Ich schenke das Loch dem Radiomädchen.
Ich gehe ins Wohnzimmer und fange an, zerknüllte Taschentücher und Zigarettenkippen vom Boden aufzuheben. Clara zieht draußen im Flur etwas aus dem Loch, es raschelt und hört gar nicht mehr auf. Ich öffne das Fenster, werfe die Kippen und die Taschentücher hinaus und lehne mich über die Fensterbank, so dass ich nichts mehr hören muss außer dem Verkehrslärm. Wenn die Straßenbahn vorbeifährt, oder einer der Baustellenlaster mit klappernder Ladefläche, vibriert die Fensterbank und ich mit ihr, und ich genieße es, für ein paar Momente mein eigenes Zittern nicht spüren zu müssen. Draußen ist es noch viel heißer als in der Wohnung. Ich befeuchte die Lippen, um eine filterlose Zigarette dazwischenschieben zu können, und als sie brennt und ich sie in die Hand nehmen will, bleibt sie an meiner Unterlippe kleben. Ich verbrenne mir die Fingerknöchel an der Glut, reiße die Zigarette von der Lippe los, ein kleiner Fetzen Haut bleibt am Papier hängen. Der Rauch sticht in den Lungen, als wäre er künstlich aufgeheizt worden, mein eigener Schweiß brennt mir in den Augen. Unten betrachten zwei kaum bekleidete dreizehnjährige Mädchen den Teppich aus Taschentüchern und Kippen auf dem Bürgersteig, dann schauen sie zu mir hoch. Ich spucke aus. Es ist heiß.
Die Silhouette aus Schornsteinen, Erkern und Antennen auf der anderen Straßenseite, mit einzelnen Lichtern dazwischen, könnte beinahe einem Ozeandampfer gehören. Dahinter verströmt die Sonne rote Farbe in den Himmel, als hätte sie Nasenbluten und nicht ich. Gleich wird die Welt den Kopf zurücklegen und sich die Nacht als ein kühles Tuch in den Nacken pressen. Ich gebe mir selbst kleine Ohrfeigen, rechts und links. Die Straßenbahnen winden sich, von innen erleuchtet, zwischen den Häuserreihen hindurch. Vielleicht habe ich geschlafen, bäuchlings über der Fensterbank.
Im Flur hockt das Radiomädchen auf dem Boden. Ich dachte, sie sei längst weg. Als nächstes sehe ich den schräg stehenden Telephonschrank und das hässliche Loch. Das Radiomädchen ordnet Geldscheine zu Stapeln, die sie in Zehnerreihen sammelt, der halbe Flur ist damit bedeckt. Als sie mich hört, dreht sie sich um.
Grad fertig, sagt sie. Fünfhunderttausend Schilling, fünfzigtausend Dollar und dann noch hundertdreißigtausend D-Mark. Was macht das zusammen?
Ich spüre, wie meine Augen sich mit Tränen füllen.
Die Schillinge geteilt durch sieben, sage ich, rechne selbst.
Fast eine Drittelmillion Mark, sagt sie. Weißt du, wo das herkommt?
Ich habe keine Ahnung, flüstere ich.
Es muss deiner Freundin gehört haben, sagt sie.
Sehr schlau, sage ich, und jetzt pass mal gut auf. Ich will allein sein. Du nimmst die Kohle und verschwindest. Viel Spaß damit.
Ein Geschenk, fragt sie.
Ja, sage ich.
Ohne ein Wort stopft sie die Geldbündel zurück in die Plastiktüte. Sie legt auch die herausgesägte Diele wieder ein und rückt das Schränkchen darüber. Dann fällt die Tür hinter ihr ins Schloss.
Ich gehe zurück zum Fenster. Diesmal setze ich mich auf die Fensterbank. Der Mond steigt in den Himmel, blass und rund wie ein Aspirin.
Der Verkehrslärm weckt mich. Ich muss den Geräuschen schon eine ganze Weile im Halbschlaf gelauscht haben. Durch meinen tauben Magen zucken ab und zu kleine Adrenalinaufwallungen, kitzeln das Zwerchfell und bringen es zum Vibrieren. Mit diesem Zustand reagiere ich immer auf die Wahrnehmung von Alltagsleben draußen. Das Fenster ist offen, ebenso die Vorhänge, vielleicht hat mich der Schlaf überrascht auf der Fensterbank und es ist pures Pech, dass ich in die Wohnung hinein und auf die Matratze gekippt bin und nicht hinaus auf die Straße. Ohne die Augen zu öffnen weiß ich, dass es hell ist, ekelerregend schönes Wetter. Es ist heiß. Kinder rennen zur Schule, ich höre ihre Stimmen und die der Eltern unter meinem Fenster. Ströme von Autos bewegen sich am Haus vorbei, alle auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht auch in den Urlaub, vielleicht zu einem Arztbesuch. Die Unzahl von Autos, die allein schon während der Viertelstunde vorbeifährt, in der ich darauf achte, macht mich schwindeln. Hochgerechnet auf den ganzen Tag ergibt das eine erdrückende Menge von menschlichen Beschäftigungen, Berufstätigkeiten, Einkäufen und Schulwegen; es presst mich zu Boden, es trinkt mich aus, als würde der ganze Fleiß und Eifer da draußen allein mit Energien gespeist, die aus dem Abbau meines Geistes und Körpers gewonnen werden.
Es gibt keine Möglichkeit, den Straßengeräuschen zu entgehen. Selbst wenn ich das gesunde Ohr im Kissen vergrabe und das kaputte nach oben richte; selbst wenn ich Fenster und Vorhänge schlösse und mir einen ganzen Kissenberg auf den Kopf türmte – ich würde Autos, Schritte und Stimmen noch hören, gedämpft zwar, aber mit dem identischen Effekt auf meinen Magen und mein überreiztes Gehirn. Ich ziehe meine Arme unter dem Körper hervor, lege die schlaffen Finger ineinander und bete für einen Giftgasangriff, der da draußen alles stilllegt, die aufdringliche Geschäftigkeit anhält, Ruhe einkehren lässt.
Dann klingelt das Telephon. Ein Blick aus halbgeöffneten Augen zeigt mir die weizenblonde Farbe meiner Dielen, davor die Berge und Täler im Faltenwurf des verrutschten Lakens. Staubkugeln erscheinen groß wie Wüstenteufel auf einer amerikanischen Landstraße, dazwischen ein paar Papiertaschentücher, zerknüllt, zusammengehalten von dem Kitt aus angetrocknetem Rotz in ihrem Inneren. Teller mit Pizzaresten. Dann sehe ich das Telephon. Es liegt außer Reichweite, mit leerem Akkufach. Ich bin sicher, dass es das Radiomädchen ist, und ich will drangehen. Nach fünf Mal Klingeln schaltet sich der Anrufbeantworter ein. Keine Chance, vorher an Telephon und Akku heranzukommen. Ich schaffe es noch nicht mal, einen Arm auszustrecken.
Der AB ist laut gedreht, ich kann den Anruf mithören. Piep.
Max, sagt eine Frauenstimme, jetzt reicht’s.
Es ist nicht Clara, und es dauert eine Weile, bis mir einfällt, wer es ist. Maria Huygstettens Gestalt erscheint vor meinem inneren Auge, so wie ich sie immer durch den Spalt meiner angelehnten Bürotür an ihrem Pult sitzen sehen konnte: ihr weißes Porzellangesicht, dahinter die rötliche Frisur auf den Hinterkopf getürmt, dem Licht vom Fenster zugewandt. Manchmal, wenn ich in die Luft starrte, anstatt zu arbeiten, stellte ich mir zum Spaß vor, ihr perfekt rosafarbener Mund würde sich plötzlich verspannen und durch die aufeinandergepressten Lippen würde sich aus ihrem Gesicht heraus eine dicke braune Wurst Scheiße schieben. Vermutlich war es ihre unzerstörbare Sauberkeit, die mich zu solchen Phantasien trieb.
Mit diesem rosa Mund spricht sie jetzt auf meinen AB.
Rufus hat angerufen und gesagt, dass du nicht mehr kommst, sagt sie.
Im Büro siezte sie mich immer. Ich habe vielleicht zehn Nächte bei ihr verbracht, nicht mehr. Zehn Nächte in zwei Jahren, und auch das nur, wenn ich es gar nicht mehr aushielt. Jedes Mal danach bereitete mir das Schuldgefühl körperliche Schmerzen. Maria argumentierte logisch, hatte aber trotzdem nicht recht, während sie bewies, dass es vollkommen normal sei, was ich tat. Ich brauchte nur zehn Sekunden lang Jessie zuzuhören, wie sie sich mit zerquältem Gesicht in ihre Beteuerungen hineinsteigerte: es würde nicht mehr lange dauern, bis sie es mit mir tun könne, nicht mehr lange, bald bestimmt. Ich solle sie nicht schimpfen. Dann hielt ich ihr den Mund zu, mit aller Gewalt, und wusste, dass Maria log und ich ein Teufel war. Maria ist die Einzige, die von Jessies Existenz in meinem Leben gewusst hat, und ich wurde die Angst nie ganz los, sie könnte eines Tages, aus welchen Gründen auch immer, bei Jessie anrufen, und ihr erzählen, dass ich in jenen zehn Nächten nicht wegen Arbeitsüberlastung im Büro übernachtet hatte.
Ich weiß natürlich, warum sie anruft. Man kann seelische Zustände verdrängen, aber nicht Jacques Chirac.
Hör zu, sagt Maria Huygstetten, ich weiß, dass wir nichts mehr miteinander zu tun haben werden. Keine Illusionen. Aber du kommst jetzt vorbei und holst den Hund.
Wahrscheinlich habe ich insgeheim gehofft, sie könnte sich an ihn gewöhnen und ihn behalten wollen. Falls ich überhaupt daran gedacht habe. Natürlich liebe ich Jacques Chirac. Aber er ist Jessies Hund, und er sollte tot sein wie sie. Wenn ich ihn sehe, muss ich daran denken, wie er sich morgens immer über uns beugte, auf seinen langen Beinen, die ihn tragen wie ein Gestell, und wie der Hautüberschuss in seinem Gesicht dabei von der Schwerkraft heruntergezogen wurde und ihm diesen gramvollen, verzweifelten Ausdruck verlieh. Wie laut Jessie immer gelacht hat über diesen Gesichtsausdruck, der eigentlich keiner war, sondern nur eine anatomische Besonderheit. Sie fasste seinen dicken Kopf mit beiden Händen und beutelte ihn, und ich stützte mich auf einen Ellenbogen und sah ihnen zu. Jacques Chirac freute sich jeden Morgen von neuem, uns beide wach und munter zu finden. Unser Schlaf muss für ihn wie ein befristeter Tod gewesen sein, von dem er nie sicher wusste, ob er wirklich enden würde bei Tagesanbruch. Jetzt kann ich seine Anwesenheit nicht mehr ertragen. Ich weiß, dass er immer noch denkt, Jessie würde vielleicht zurückkommen. Ich kann die Hoffnung nicht ertragen, mit der er vor der verrammelten Tür des Arbeitszimmers liegt, und wie er aufhorcht, wenn der Wecker drinnen zu piepsen beginnt. Jacques Chirac wartet.
Ich robbe, die Bettdecke hinter mir herziehend, zu dem Häufchen, das meine abgeworfene Jacke ist, ich finde das Koks und nehme es, schnell und viel, und lege mich zurück aufs Bett. Ich warte. Aber es geschieht nichts. Oder jedenfalls fast nichts. Bis Panik in mir aufsteigt. Es gibt Phasen, in denen die Wirkung nachlässt, und man muss eine Pause einlegen, um danach normal weitermachen zu können. Eine Pause von mindestens drei oder vier Tagen. Damit ist klar, was mir bevorsteht.
Ich schlüpfe in die Anzughose, die mir an den schwitzenden Schenkeln kleben bleibt, setze eine Sonnenbrille auf und verlasse das Haus. Es ist eine Odyssee. Trotz allem kann ich nicht anders, als mich auf Jacques Chirac zu freuen. Der Gedanke an ihn hilft mir, dem Starren der Leute und dem immer drängenderen Brüllen der Straße standzuhalten, er hilft mir, das Straßenbahnticket zu bezahlen und den Fahrplan zu entziffern. Wäre ich zum ersten Mal auf diesem Planeten, könnte ich nicht fremder sein.
Als sie die Tür öffnet, stürmt Jacques Chirac sofort an ihr vorbei und stürzt sich auf mich. Er legt mir die Pfoten auf die Brust, um mit der Zunge an mein Gesicht heranzukommen, und meine Beine halten sein Gewicht nicht aus, ich gehe in die Knie. Um mich wieder aufzurichten, stütze ich mich auf seinen Rücken. Dabei spüre ich, wie dünn er geworden ist. Er fühlt sich an wie ein Holzgerüst, über das ein Stück Tuch gespannt ist. Ich bin sicher, dass Maria versucht hat, alles für ihn zu tun. Meine Hand bleibt auf seinen Rücken gestützt, auch abgemagert ist er immer noch stärker als ich. Eine Art Schwächeanfall lässt mich keuchen. Ich stehe gebückt. Als Maria nach mir fasst, schüttele ich den Kopf. In ihrer Miene lese ich, welchen Anblick ich abgebe. Sie fängt schnell und leise an zu sprechen, sagt irgendwas davon, dass ich bleiben soll, dass sie in der Lage ist, mich zu schützen. Ich nehme die Sonnenbrille nicht ab, danke ihr nicht und gehe, bevor sie mich küssen kann.
Am Abend verstehe ich, wie gut es ist, Jacques Chirac wieder bei mir zu haben. Ich verbiete ihm, vor der Arbeitszimmertür zu liegen. Er frisst nicht, aber ich spüre, dass er sich freut, bei mir zu sein. Er liegt auf der Seite und hechelt, dass sein Körper sich dehnt und zusammenzieht wie ein Blasebalg, der Speichel läuft ihm pfützenweise seitlich zum Maul heraus. Gerne würde ich die Hitze abstellen für ihn, aber ich kann nicht, ich habe nichts zur Erleichterung, für keinen von uns. Deshalb gehen wir spazieren. Es macht ihm keinen Spaß mehr, er läuft nicht freudig voraus, fordert mich nicht zum Spielen auf, aber es lenkt ihn ab. Und mich auch. Es hilft ein bisschen, die Zeit zu verkürzen, bis die Drogen wieder wirken. Jedes Mal, wenn ich kurz vor dem Durchdrehen bin, gehen wir spazieren. Wenn wir zurück in die Wohnung kommen, bleibe ich einen Moment vor dem Telephonschränkchen stehen. Es ist absolut nichts Auffälliges daran. Ich glaube nicht mehr, dass es je bewegt worden ist. Ich glaube auch nicht, dass das Radiomädchen jemals hier war. Ich glaube, dass ich schon seit Wochen so lebe: immer eine kurze Runde mit Jacques Chirac, dann hinlegen und zu schlafen versuchen, liegen bleiben, bis das Hundehecheln mich hochtreibt. Ab und zu klingelt der Wecker hinter den verschlossenen Türen und ich rufe etwas.
Dann gehen wir wieder eine Runde.
4 Motten
Die Senke wird erhellt vom rotgelben Licht der Shell-Tankstelle. Ich lehne an dem verschnörkelten Geländer einer kleinen Brücke. Unter mir liegen Fernwärmerohre wie die fetten Leiber zweier Schlangen, in eine Schneise zwischen Gestrüpp und Unkraut gebettet. Blassgrau streben sie dem Stadtzentrum zu, schnurgerade, an manchen Stellen aber zu Bögen gekrümmt, die aufrecht stehen wie mannshohe Tore oder seitlich liegen im Gras. Jessie hat mich immer gefragt, wozu die meterdicken Rohre solche Krümmungen brauchen, und ich habe etwas von Dehnungsausgleich wegen der Hitze gemurmelt. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht tun sie es nur, damit es bizarr aussieht.
Der Frischhaltebeutel in meiner linken Hand ist silbern und mit blauen Frostflocken bedruckt. Darin befindet sich ein Magnum Weiß in seinem goldenen Stanniolpapier. Ich habe es an der Tankstelle gekauft, einer plötzlichen Eingebung folgend – obwohl ich es nicht essen will. Natürlich mache ich mich lächerlich, wenn ich Clara das Eis bringe. Es sieht nach einer Nettigkeit aus, die unangemessen ist, solange ich nicht um ihre Freundschaft werben, sie vögeln oder einen Kaufvertrag abschließen will. Es liegt mir nichts daran, dass sie das Eis bekommt. Aber ich selbst ekle mich davor, und Lebensmittel wegwerfen kann ich nicht. Clara ist der einzige Mensch in der Stadt, dem ich nachts um eins ein Eis bringen kann. Jedenfalls mittwochs und sonntags. Ich setze mich also in Bewegung. Jacques Chirac, auf seinen langen Beinen schwebend, neben mir. Er wird lebhafter und läuft ein paar Schritte voraus, als wir die orangefarbenen Lichtkegel der Straßenbeleuchtung verlassen und in den Park eindringen. Die alten Bäume ragen hoch auf und sehen in ihrer Schwärze aus wie die dicken Beine einer Elephantenherde, deren Bauchunterseiten den Nachthimmel bilden. Es ist Grillengezirpe zu hören und das Gemurmel der Studenten, die mit Weinflaschen auf der Wiese liegen.
Die Luft ist warm. Ich werde mit einer Handvoll weißer Matsche dastehen, wenn ich den Sender erreiche.
Der Einbruch der Dunkelheit bedeutet immer eine große Erleichterung. Die Straßen leeren sich, der Verkehrslärm verebbt, ich kann ziellos, untätig, ohne den geringsten Nutzen herumschlendern. Auch die anderen haben um diese Zeit nichts Besseres zu tun. Sie sehen fern, ich erkenne den blauen Widerschein ihrer Geräte hinter allen Fenstern, an den Zimmerdecken ihrer Wohnungen. Anhand der Farbgebung und Geschwindigkeit der Bilderwechsel kann ich raten, ob sie Nachrichten gucken, einen Action-Film oder eine Reportage. Auf diese Art stört mich die Anwesenheit der anderen nicht, jetzt ist sie genauso sinnlos wie meine. Von mir aus müsste es nie wieder Tag werden. Die Erde könnte ihre Umlaufbahn verlassen und wegfliegen in die ewige Nacht des Universums, von allen Seiten in die Sterne schauend. Vielleicht nehmen wir den Mond mit, er steht blass und schmal wie ein abgeschnittener Daumennagel am Himmel. Es geht mir besser. Vielleicht weil Mittwoch ist. Mittwoch und Sonntag sind die einzigen Tage, die ich erkenne. Etwas wie ein Fleck im Gesicht unterscheidet sie von den anderen, vollkommen gleich aussehenden Tagen. Der Fleck ist Claras Sendung. Vielleicht tritt auch endlich eine Verbesserung des biochemischen Zustands meines Gehirns ein. Vielleicht eine Ankündigung, dass ich bald den Drogenkonsum wieder aufnehmen kann.
Heerscharen von Motten schaffen es, in das geschlossene Gehäuse der Laternen einzudringen, dort zu verrecken und klumpige schwarze Muster an der Innenseite des Glases zu bilden. Ein Marder, geformt wie eine Salami auf Beinen, quert meinen Weg und verschwindet zwischen den parkenden Autos. Ich schlenkere meinen Frischhaltebeutel. In einer Nacht wie dieser hätte ich Jessie beim Nachhausekommen in der Wohnung gesucht, sie wahrscheinlich am Küchentisch gefunden vor dem offenen Fenster, die Beine um den Stuhl geschlungen und mit dem Finger den Zeilen eines ihrer Briefe mit österreichischer Marke folgend, die immer ohne Absender kamen und deren Asche ich manchmal im Becken der Spüle fand. Ich hätte ohnehin niemals versucht, einen dieser Briefe zu lesen, ich war sicher, dass sie von ihrem Bruder Ross kamen und dass sie nicht darauf antwortete.
Ich hätte ihr einen nächtlichen Spaziergang vorgeschlagen, und sie wäre sofort aufgesprungen mit einem Strahlen im Gesicht und dem unordentlich abstehenden gelben Haarkranz außen herum, der sie wie eine kleine Sonne aussehen ließ. Sie wäre nach ihren Turnschuhen gelaufen und hätte im Vorbeifliegen Jacques Chirac in die Rippen getreten, um ihn auf die Beine zu bringen. Draußen auf der Straße, umgeben von der staubigen Stadt, eingetaucht in laue, orangefarbene Luft, hätte sie meine Hand gegriffen und den Fingerkampf mit mir gespielt, bis sie meinen Mittel- und Ringfinger zu fassen bekommen und die Faust darum geschlossen hätte. Jeden anderen Griff schüttelte sie ab. Wir wären Hand in Hand gegangen und irgendwann an einer Tankstelle vorbeigekommen und sie hätte mich um ein Eis angebettelt und ich hätte es ihr gekauft. Magnum Weiß. Ich fasse in den Frischhaltebeutel. Es ist immer noch fest.
Jessie übte sich darin, ein Eis möglichst langsam zu essen. Sie biss nicht ab, sondern fuhr nur immer mit der Zunge darüber. Diese Technik machte mich wahnsinnig, ich konnte es nicht mit ansehen. Es ist völlig wirkungslos, an einem Eis mit geschlossener Schokoladenhülle nur vorsichtig herumzulecken. Irgendwann tropft unten in Stielnähe die Vanillesauce heraus, große glatte Schokoladenschollen brechen ab und fallen zu Boden. Wenn Jessie das Eis endlich erledigt hatte, klebte ihr ganzes Gesicht, die Hände erst recht, und auf den klebrigen Flächen blieb Straßenstaub hängen, auch herumfliegende Pollenschirmchen und manchmal eine Mücke. Sie war glücklich, jedenfalls sah es für mich so aus.
Ich bleibe stehen und fasse mir an den Hals. Für einen Moment bekomme ich keine Luft, ich kenne das, ein Stechen dicht über dem Kehlkopf, dann ein enormer Hustenreiz, aber kein Atem zum Husten. Ich zwinge mich zur Ruhe und versuche, meinen Hals zu entspannen. Es gelingt. Beim anschließenden Husten beuge ich mich vornüber, stütze beide Hände auf die Knie und glaube, meine Lungen auszustülpen wie ein Paar Socken, die eingerollt und knotig aus der Waschmaschine gekommen sind. Jacques Chirac steht neben mir und sieht mich unbewegt an. Ich fingere eine Zigarette aus der hinteren Tasche meiner Hose und stecke sie an. Der Schmerz in den Lungen, als der Rauch über die gereizten Flächen streicht, tut mir gut. Er bringt mich in die Gegenwart zurück und weg von Eis und Glück. Zurück in diese Nacht, in der es darum geht, ein Speiseeis loszuwerden, das ich aus Dummheit eingekauft habe, in der ich auf meinen Weg achten muss, wenn ich Claras Sender finden will.
Ich versuche, an Clara zu denken, daran, dass sie bestimmt abends Getreidekörner zum Einweichen fürs Frühstück ins Wasser legt, dass sie sonntagmorgens um zehn zu Technoparties geht und niemals Weichspüler benutzt für eine Waschmaschinenladung mit Jeans. Aber ich kann mich kaum an ihr Gesicht erinnern. Ich habe ein paar Tage lang schwitzend und stöhnend dem Straßenverkehr zugehört und jede Stunde davon war wie eine Woche.
Ich klettere die Böschung zu den Bahnschienen hinunter. Ein Trampelpfad führt durch hüfthohes, gelbgetrocknetes Gras, zwischen Schierlingspflanzen, deren Blütenstände hoch über meinem Kopf schwanken. Mindestens zehn Schienenstränge laufen parallel, die meisten grasüberwachsen, einige frei. Im Gebüsch neben den Gleisen liegen gelbe oder blaue halb verrottete Müllsäcke, gefüllt mit namenlosem Unrat, einmal erfasst mich eine Wolke fauligen Fleischgestanks. Ich lasse Jacques Chirac nah bei mir gehen. Unter den Bögen zweier Fernwärmerohre beschleunige ich meinen Schritt in der Angst, sie könnten sich herabfallen lassen, meinen Körper zerdrücken und verschlingen. Als das dicke Schienenbündel zu zwei sauberen Spuren zusammenläuft, verlasse ich das Gelände und kehre auf die Straße zurück.
Der Platz vor dem Hauptgebäude des Senders ist groß und leer, zwei Autos parken in frei gewähltem Abstand darauf, eins von beiden ist auffällig grün wie ein Plastikfrosch, eine Farbe, die garantiert nicht serienmäßig aufgespritzt wird. Am Ende des Platzes sehe ich im erleuchteten Eingangsbereich hinter den Glaswänden den Pförtner sitzen. Ich nähere mich dem grünen Auto, ein klappriger Ascona, und schon von weitem fällt mir auf, dass das Nummernschild außer Schwarz und Weiß auch ein wenig Rot enthält. Ich will es trotzdem nicht glauben, gehe näher heran und beuge mich zum Kennzeichen hinunter. Es stimmt. Der Wagen ist in Wien zugelassen. Warum auch nicht. Trotzdem bleibt eine Unruhe zurück, die sich in Wut zu kehren beginnt, in eine unerklärbare, sinnlose und eigentlich nicht besonders starke Wut.
Der Pförtner schaut misstrauisch. Es ist zwei Uhr, und ich erwarte gar nicht, sie noch anzutreffen. In die geschlitzte Sprechanlage sage ich ihren Namen, dann meinen. Er telephoniert kurz, die Tür summt. Er lächelt sogar Jacques Chirac zu, als wir vorbeigehen. Er öffnet sein Häuschen und ruft uns »Zweiter Stock« hinterher.
Im Fahrstuhl betrachte ich mein Bild in der Spiegelwand. Meine Gesichtsfarbe wäre vermutlich auch schon ohne die Neonbeleuchtung nicht besonders schön. Immer schon habe ich von Spiegeln in öffentlichen Räumen geglaubt, sie seien von der Rückseite her durchsichtig und irgendjemand nehme dort die Blicke derer entgegen, die sich in die eigenen Augen schauen.
Die Tür öffnet sich jetzt, sagt eine digitale Frauenstimme vom Band, zweiter Stock.
Als die Aufzugtür sich hinter mir geschlossen hat, ist alles dunkel. Absolut kein Geräusch. Ich bleibe stehen, halte Jacques Chirac am Halsband und warte darauf, dass meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen, dass sich irgendeine Art von Orientierung einstellt. Schließlich sehe ich einen Lichtschimmer linker Hand und gehe darauf zu. Ich betrete einen Raum und stoße krachend an einen Gegenstand; es ist ein Mischpult. Ich erkenne eine weitere offene Tür, aus der das grünliche Licht fällt. Es kommt von einem Computermonitor. Clara sitzt davor mit dem Rücken zu mir, eine dunkle Silhouette. Ein Fenster steht offen. Motten, Nachtfalter, Fliegen in allen Größen kriechen über den Bildschirm wie zum Leben erwachte Satzzeichen. Ich bleibe stehen und lehne mich gegen den Türrahmen.
Hey, sagt sie.
Sie dreht sich nicht um. Es gibt eigentlich nichts zu sagen. Ich zünde eine Zigarette an. Es ist still bis auf das Klappern der Tastatur. Sie schreibt schnell wie eine Sekretärin. Ich bemühe mich nicht, den Text zu lesen, es genügt zu beobachten, wie sich die Zeilen vorwärts schieben, ein Wurm, der aus sich selbst herausgestülpt wird, dann abbricht und einen halben Zentimeter tiefer ganz links wieder beginnt, seinen Anfang aus einem einzigen Buchstaben entwickelnd wie aus einem kleinen schwarzen Ei. Es hat etwas Hypnotisierendes.
Der Raum ist eng und vollgestellt mit Geräten, deren Nutzen ich nicht kenne. Alles, inklusive Claras Rücken und mir, sieht unwirklich aus im Schein des Monitors; das glühende Ende meiner Zigarette scheint der einzige natürliche, organische Punkt im Raum zu sein. Ich kenne dieses Mädchen nicht. Sie war zweimal in meiner Wohnung. Jacques Chirac ist vor der Tür geblieben und atmet leiser als sonst. Ich raschele mit dem silbernen Frischhaltebeutel.
Ich habe dir was mitgebracht, sage ich.
Die Luft geht mir aus, bevor der kurze Satz zu Ende ist. Es klingt noch alberner, als ich befürchtet habe.
Was ist es, sagt sie.
Auf meiner Stirn bilden sich Schweißperlen, das bloße Existieren in diesem Raum verbraucht dreifache Energie. Ich blicke in meine Tüte und schaue, was es ist.
Ein Eis, sage ich.
Es klingt nicht nur albern, es klingt verzweifelt. Vielleicht bin ich am Ende, jetzt wirklich am Ende. Ich fasse den Beutel unten, trete zwei Schritte vor und schüttele das Eis neben sie auf den Computertisch. Sie bewegt sich immer noch nicht, aber sie unterbricht den Schreibvorgang, der Wurm friert ein in der Mitte des Monitors, Claras Hände verharren angespannt wie auf Beute lauernde Spinnen über den Tasten.
Das Einzige, was ich von dir will, sagt sie leise, ist deine Geschichte. Was anderes interessiert mich nicht.
Ein paar Sekunden halten wir beide absolut still. Nur die Insekten krabbeln ungestört weiter. Wenn sie sich bewegte, sich umdrehte, mir ihr Gesicht zeigte; wenn ihre Stimme auch nur ein Quentchen Leben oder Wärme enthielte, würde es mir möglicherweise gelingen, die Lage zu meistern. Ich könnte loslachen oder brüllen, ich könnte sie büßen lassen für die Insekten, das grüne Auto, für Straßenverkehr und Kindergeschrei und das schlechte Licht im Fahrstuhl. Es bräuchte nur einen winzig kleinen Anstoß. Aber sie hält still, absolut still, sie dreht sich nicht um, sie atmet nicht einmal.
Mit einem gurgelnden Geräusch im Hals greife ich plötzlich nach dem Eis – es fühlt sich weich an zwischen den Fingern, eine Beule von Sauce in einem Stanniolpapier, und es gehört Jessie – und springe aus dem Raum. Den Hund reiße ich am Halsband mit, erst widerstrebt er, anscheinend will er bleiben, seine Pfoten rutschen ein paar Zentimeter über den glatten Boden, dann trabt er los, klickend neben mir, und wir verirren uns im dunklen Korridor, finden das kleine rötliche Licht der Fahrstuhltaste nicht, entdecken dafür über unseren Köpfen eine grüne Leuchte für das Treppenhaus. Ich glaube, Clara hat Jacques Chirac überhaupt nicht bemerkt.