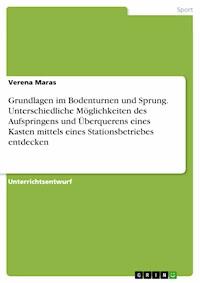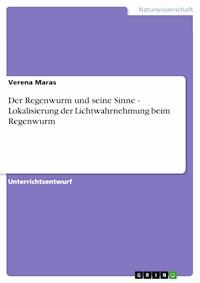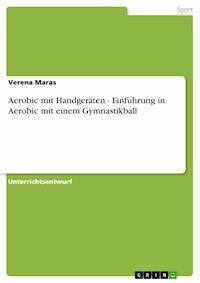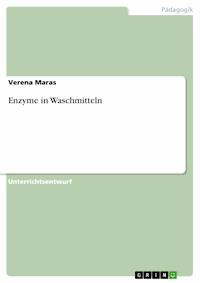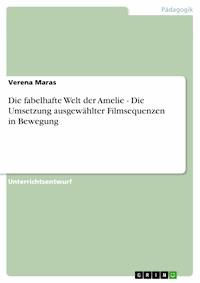36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Didaktik - Sport, Sportpädagogik, Note: 1, , Veranstaltung: Zweites Staatsexamen, Sprache: Deutsch, Abstract: Aerobic ist heute durch ganz unterschiedliche Ausprägungsformen gekennzeichnet, die sich aber im Wesentlichen nur durch unterschiedliche Geräte, Trainingsschwerpunkte, Figurtrends und Einflüsse aus anderen Sportarten und Musikrichtungen unterscheiden. Die besondere Rolle von Aerobic in der Fitnesswelt ist unumstritten. Aber auch im Schulsport stellt Aerobic eine enorme Bereicherung dar, weil Jugendliche durch die Musik, ein positives Gruppenerlebnis und Freude an der eigenen Bewegung animiert und motiviert werden können. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich zeigen, dass es sowohl möglich als auch sinnvoll ist den anhaltenden Trend Aerobic in den Sportunterricht der Schulen zu holen und mit bekannten Handgeräten der rhythmischen Sportgymnastik zu verbinden. Durch die Verknüpfung von rhythmisch-tänzerischer Gymnastik (mit Handgeräten) mit der funktionellen Aerobic sollen die Schülerinnen animiert werden ihre Bewegungen in Einklang mit dem Handgerät und der Musik zu bringen. Darin sehe ich eine Chance, die aus der Mode geratenen klassischen Handgeräte für die Schülerinnen wieder attraktiv zu machen und auch gleichzeitig den kreativen Gestaltungsaspekt sowie die gesundheitsförderliche Fitnesskomponente mit einzubeziehen. Über die Fitness- und Gesundheitsperspektive lässt sich für die Heranwachsenden eine Sinngebung erfahren, die eine intrinsische Motivation bewirken und sie zu lebenslangem Sport treiben animieren kann. Des Weiteren bietet die Einheit Aerobic mit Handgeräten die Möglichkeit die Kooperationsfähigkeit sowie die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen der Schülerinnen zu fördern. Zusammenfassend lassen sich die zentralen Fragestellungen der Arbeit folgendermaßen formulieren: Wie schafft man erfahrungsoffene Lehr-Lernsituationen mit dem Ziel die Selbstständigkeit, die Kooperation und das Selbstvertrauen der Schülerinnen zu fördern? Und wie wird man dem hohen Maß an Selbstständigkeit und Sozialkompetenz der Lerngruppe bei gleichzeitiger Heterogenität der Leistungsvoraussetzungen gerecht? Wie lässt sich eine sinnvolle und effektive Verzahnung von Theorie und Praxis erreichen, die über die Vermittlung spezifischer Kenntnisse die Schülerinnen zur Handlungskompetenz befähigt und zugleich den Aspekt der Bewegungsaktivität berücksichtigt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2004
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Anhangsverzeichnis
1 Einleitung
2 Darstellung der Unterrichtssituation
2.1 Rahmenbedingungen
2.2 Analyse der pädagogischen Situation
3 Didaktisch – methodische Überlegungen zur Unterrichtsreihe
3.1 Begründung der Themenauswahl
3.2 Aerobic – ein anhaltender Trend
3.3 Überlegungen zur Koordination und zu den Handgeräten
3.3.1 Der Aspekt der Koordination
3.3.2 Die Handgeräte
3.4 Bedeutung und Einsatz von Musik
3.5 Modell / Raster: Didaktisch-methodische Konzeption zur Planung und Durchführung der Reihe
3.5.1 Relevantes zum Lehrplan
3.5.2 Zentrale Perspektiven der Reihe
3.5.3 Verknüpfung von Theorie und Praxis
3.5.4 Die Rolle der Lehrerin im Rahmen von erfahrungsoffenen und handlungsorientierten Lehr-Lernprozessen
3.6 Leistungsbewertung und Lernerfolgskontrolle
4 Dokumentation der Unterrichtsreihe
4.1 Tabellarische Übersicht über den Verlauf der Reihe
4.2 Erläuterungen zum Aufbau und zur Dokumentation der Reihe
4.3 Dokumentation der zweiten Doppelstunde
4.3.1 Didaktisch-methodische Überlegungen zur Stunde
4.3.2 Tatsächlicher Verlauf der Stunde
4.3.3 Reflexion
4.4 Dokumentation der fünften Doppelstunde
4.4.1 Didaktisch-methodische Überlegungen zur Stunde
4.4.2 Tatsächlicher Verlauf der Stunde
4.4.3 Reflexion
4.5 Dokumentation der sechsten Doppelstunde
4.5.1 Didaktisch-methodische Überlegungen zur Stunde
4.5.2 Tatsächlicher Verlauf der Stunde
4.5.3 Reflexion
5 Gesamtreflexion und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Anhangsverzeichnis
Anhang A: Fragebogen
Anhang B: „Ausprägungsformen der Aerobic“ und „neue Handgeräte“
Anhang C: Arbeitsblätter „Auf- und Abwärmen“
Anhang D: Stretching-Übungen / Artikel: „Stretching zum Aufwärmen?“
Anhang E: Plakat zu einer Schrittkombination („Superman“)
Anhang F: Bilder 1-3
Anhang G: Informationsblatt zur Aerobic
Anhang H: Arbeitsblatt zur „Musiktheorie“
Anhang I: Bilder 4-12
Anhang J: Aerobic-Lernzirkel
Anhang K: „Aerobic Sign Language“ (Die Zeichensprache im Aerobic)
Anhang L: Bilder 13-19
Anhang M: Aufgabenplakat zur 3. Std. der Reihe
Anhang N: Paper Atem- und Entspannungsübungen
Anhang O: Bilder 20-24
Anhang P: Paper zu den motorischen Grundeigenschaften
Anhang Q: Paper zur „Ausdauer in der Aerobic“
Anhang R: Paper zur Dauer- und Intervallmethode
Anhang S: Chi-Yoga-Dancing
Anhang T: Bilder 25-27
Anhang U: Planungsbogen für die 5. Std. der Reihe
Anhang V: Aufgabenstellung und Beobachtungskriterien der 6. Std.
Anhang W: Einige Yogaübungen für den Unterricht
Anhang X: Bilder 29-33
Anhang Y: Paper zu den koordinativen Fähigkeiten
Anhang Z: Bewertungsbogen und Evaluation der Reihe
1 Einleitung
Aerobic ist heute durch ganz unterschiedliche Ausprägungsformen gekennzeichnet, die sich aber im Wesentlichen nur durch unterschiedliche Geräte, Trainingsschwerpunkte, Figurtrends und Einflüsse aus anderen Sportarten und Musikrichtungen unterscheiden. Die besondere Rolle von Aerobic in der Fitnesswelt ist unumstritten. Aber auch im Schulsport stellt Aerobic eine enorme Bereicherung dar, weil Jugendliche durch die Musik, ein positives Gruppenerlebnis und Freude an der eigenen Bewegung animiert und motiviert werden können. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich zeigen, dass es sowohl möglich als auch sinnvoll ist den anhaltenden Trend Aerobic in den Sportunterricht der Schulen zu holen und mit bekannten Handgeräten der rhythmischen Sportgymnastik zu verbinden. Durch die Verknüpfung von rhythmisch-tänzerischer Gymnastik (mit Handgeräten) mit der funktionellen Aerobic sollen die Schülerinnen[1] animiert werden ihre Bewegungen in Einklang mit dem Handgerät und der Musik zu bringen. Darin sehe ich eine Chance, die aus der Mode geratenen klassischen Handgeräte für die Schülerinnen wieder attraktiv zu machen und auch gleichzeitig den kreativen Gestaltungsaspekt sowie die gesundheitsförderliche Fitnesskomponente mit einzubeziehen. Über die Fitness- und Gesundheitsperspektive lässt sich für die Heranwachsenden eine Sinngebung erfahren, die eine intrinsische Motivation bewirken und sie zu lebenslangem Sport treiben animieren kann (vgl. Hkm 2002, 2). Des Weiteren bietet die Einheit Aerobic mit Handgeräten die Möglichkeit die Kooperationsfähigkeit sowie die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen der Schülerinnen zu fördern.
Im neuen Lehrplan Sport für die gymnasiale Oberstufe des Landes Hessen, der ab dem Schuljahr 2003/04 verbindlich in Kraft getreten ist, werden sowohl die Aerobic, die Fitnessgymnastik als auch die rhythmische Gymnastik mit Handgeräten explizit berücksichtigt. Dabei lässt sich das Thema Aerobic mit Handgeräten nicht nur dem Bewegungsfeld „Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestalten“, sondern auch dem Feld „den Körper trainieren, die Fitness verbessern“ zuordnen. (vgl. Hkm 2002, 8). Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt damit sowohl auf dem rhythmisch-gymnastischen Gestaltungsbereich als auch auf dem gesundheitsförderlichen Fitnessbereich.
Der Lehrplan setzt u.a. an dem fachdidaktischen Konzept der Mehrperspektivität an und möchte darüber den Schülerinnen verschiedene Zuwendungsmotive zur Bewegungsaktivität vermitteln (vgl. Hkm 2002, 3-4). Die Gestaltung, Körpererfahrung, Kooperation und Gesundheit sind solche Motive bzw. Perspektiven, die in der Reihe Aerobic mit Handgeräten eine Rolle spielen, und zur individuellen Sinngebung der Schülerinnen beitragen können. Mehrperspektivisch unterrichten bedeutet den Sport von verschiedenen Perspektiven aus zu beleuchten. Dadurch, dass in der Reihe unterschiedliche Perspektiven miteinander verknüpft werden, bekommen die Schülerinnen die Gelegenheit die Sportart Aerobic mit Handgeräten ganzheitlicher zu erfassen und in ihr ganzheitlicher zu handeln (vgl. Paul/Sölken 1998, 481).
Der Lehrplan fordert auch eine stärkere Verzahnung von Theorie und Praxis, wobei der Sportunterricht grundsätzlich auf Bewegungsaktivität ausgerichtet sein und die Theorievermittlung praxisbegleitend stattfinden soll (vgl. Hkm 2002, 11). In der Einheit wird aufgezeigt, wie man eine ausgewogene Mischung aus kognitiven und konditionell-koordinativ dominierenden Phasen erzielen kann, um sowohl die Sportkompetenz der Schülerinnen zu fördern als auch die Komplexität der Sportart Aerobic transparenter zu machen. Der Theorieanteil wird über kurze Schülerreferate, L.-S.-Gespräche sowie Hausaufgaben in die Sportstunden integriert und wenn möglich in der anschließenden Praxis umgesetzt.
Eine weitere Forderung des Lehrplans ist die Vermittlung von Methoden und Formen selbstständigen Arbeitens, deren Umsetzung vorzugsweise im offenen Unterricht gelingt (vgl. Hkm 2002, 12). Da die Lerngruppe sehr selbstständig arbeitet und über eine gute Sozial- und Problemlösekompetenz verfügt (vgl. Kap. 2.2), können relativ innovative Lehr-Lernformen gewählt werden, die vielfältige Öffnungen zulassen. Durch die erfahrungsoffenen Lernsituationen wird das individuelle Lerntempo der Schülerinnen mit berücksichtigt und bewusstes Lernen sowie kreatives Bewegungsverhalten möglich. Dadurch sind gleichzeitig eine Schüler- und Handlungsorientierung gewährleistet.
Durch die Öffnung des Unterrichts ergibt sich eine Rollenverschiebung für die Lehrkraft. Sie nimmt zunehmend die Position einer Moderatorin, Beraterin oder Helferin ein, die Erfahrungsspielräume schafft, Einigungs- und Übungsprozesse der Schülerinnen unterstützt und begleitet, d.h. beispielsweise Alternativen vorschlägt oder für bestimmte Probleme Lösungsanregungen gibt (vgl. Klingen 2002, 307).
Zusammenfassend lassen sich die zentralen Fragestellungen der Arbeit folgendermaßen formulieren: Wie schafft man erfahrungsoffene Lehr-Lernsituationen mit dem Ziel die Selbstständigkeit, die Kooperation und das Selbstvertrauen der Schülerinnen zu fördern? Und wie wird man dem hohen Maß an Selbstständigkeit und Sozialkompetenz der Lerngruppe bei gleichzeitiger Heterogenität der Leistungsvoraussetzungen (vgl. Kap. 2.2) gerecht? Wie lässt sich eine sinnvolle und effektive Verzahnung von Theorie und Praxis erreichen, die über die Vermittlung spezifischer Kenntnisse die Schülerinnen zur Handlungskompetenz befähigt und zugleich den Aspekt der Bewegungsaktivität berücksichtigt?
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Im zweiten Kapitel erfolgt die Darstellung der Unterrichtssituation, in der die Rahmenbedingungen aufgezeigt werden und die Lerngruppe, nach der sich die Gestaltung der Einheit im Wesentlichen ausrichtet, beschrieben wird.
Im Anschluss werden im dritten Kapitel die didaktisch-methodischen Überlegungen zur Unterrichtsreihe dargestellt. Ich habe ein Modell/Raster zur Konzeption der Unterrichtsreihe entworfen (siehe Seite 14), das den Inhalt dieses Kapitels in Kurzfassung widerspiegelt. Außerdem werden die Begründung der Themenwahl sowie aerobicspezifische Informationen erörtert.
Im vierten Kapitel wird schließlich der tatsächliche Reihenverlauf beschrieben. Dieses Kapitel beinhaltet eine tabellarische Übersicht über den Gesamtverlauf sowie die detaillierte Beschreibung ausgesuchter Stunden, deren Planungen und Reflexionen wichtige Ergebnisse für die abschließende Gesamtbetrachtung im fünften Kapitel liefern.
Zur derzeitigen Literaturlage (Kapitel 6) in Bezug auf die Thematik Aerobic mit Handgeräten in der Schule ist Folgendes zu sagen: Die Auswahl an Literatur zur Aerobic ist recht umfangreich. Auch die derzeit auf dem Markt vorhandene Tanz- und Gymnastikliteratur ist zahlreich, wenn auch wenig aktuell und innovativ, wie ich finde. Dem Thema Aerobic mit Handgeräten in der Schule wurde bislang in der Literatur keine Aufmerksamkeit geschenkt. Es wird weder auf die Methodik noch auf die Probleme der Vermittlung eingegangen und schulsportspezifische Hinweise sucht man vergeblich. Daher beziehen sich die didaktischen und methodischen Ausführungen, soweit nicht anders gekennzeichnet, auf meine persönlichen Erfahrungen aus Praxis und Fortbildung[2].
2 Darstellung der Unterrichtssituation
2.1 Rahmenbedingungen
Seit Beginn des Schuljahres 2003/04 unterrichte ich den zweistündigen Sportkurs der Jahrgangsstufe 12 in den Bewegungsfeldern „Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestalten“ und „den Körper trainieren, die Fitness verbessern“ (siehe Hkm 2002, 8). Der Unterricht findet freitags in der 8. und 9. Stunde in der Halle A der Herderschule statt. Dem Kurs steht die gesamte Halle zur Verfügung. Ich lasse meistens einen der beiden Vorhänge herunter, sodass der Unterricht in zwei Dritteln der Halle stattfindet. Dadurch habe ich bei Gruppenarbeiten einen besseren Überblick und die Kommunikation zwischen den Schülerinnen untereinander sowie den Schülerinnen und mir ist effektiver und angenehmer. Außerdem muss ich die Musikanlage nicht so laut „aufdrehen“.
Fitnessspezifische Geräte wie z.B. kleine Hanteln, Thera-Bänder, Tubes, Physio-Bälle oder Rope-Skippings etc. gehören nicht zur Ausstattung der Schule – aber „klassische Handgeräte“ der Gymnastik wie Bälle, Stäbe, Keulen, Reifen, Seile und Bänder sind in ausreichender Zahl vorhanden.
Die Musik wird über eine kleine Anlage eingespielt, deren Beschallungskraft für die Zwecke dieses Kurses ausreicht. Auch eine Fernbedienung ist vorhanden, so dass ich für Ansagen, Bewegungsaufforderungen und Korrekturen nicht immer zwischen der Gruppe und der Musikanlage hin und her laufen muss.
Ein Head-Set[3] würde den Unterricht an manchen Stellen noch vereinfachen, denn man muss beim Ansagen der Schritte häufig sehr laut reden um gegen die Musik anzukommen oder aber die Musik so leise drehen, dass viele Schülerinnen den Rhythmus nicht mehr mitbekommen und die Motivation abnimmt. Allerdings sollte hierbei bedacht werden, dass die Schülerinnen durch die Instruktionen, die sie über ein Head-Set bekommen, schnell in eine Konsumhaltung verfallen, die nicht im Sinne der Reihenkonzeption ist. Im Rahmen der Unterrichtsreihe hat es sich, auch in Abgrenzung zu der Vorgehensweise in einem Fitnessstudio, als sinnvoll erwiesen, Plakate mit den einzelnen Schrittkombinationen zu verwenden[4], vorher Absprachen über die Schrittfolgen zu treffen oder Handzeichen für die unterschiedlichen Schritte auszumachen.
Für das Floorwork[5] und die Entspannungsphasen (mehr dazu in Kap. 4.1) können Turnmatten genutzt werden.
Gemäß den Kursstrukturplänen für die gymnasiale Oberstufe (Hkm 2002) stehen den Schülerinnen des 12. Jahrgangs in diesem Schuljahr mehrere Kurse mit unterschiedlichen Bewegungsfeldern zur Auswahl. Die Nachfrage für die von mir angebotenen Bewegungsfeldern war sehr groß, sodass viele weitere interessierte Schülerinnen Kursen mit anderen Bewegungsfeldern zugeteilt werden mussten. Die Bereitschaft sich mit Inhalten aus den tänzerischen und fitnessorientierten Bereichen auseinander zu setzen ist sehr hoch. Hier sehen auch die Schülerinnen, die z.B. in den Ballspielen oder in koedukativen Gruppen negative sportliche Vorerfahrungen gemacht haben eine neue Chance sich zu entwickeln. Da die Schülerinnen den Kurs freiwillig gewählt haben, besteht bei allen ein gesteigertes Interesse für den Bereich Fitness und Gymnastik/Tanz, was den Lernprozess, die Zusammenarbeit und das Verfolgen eines gemeinsamen Ziels erleichtert.
2.2 Analyse der pädagogischen Situation
Der Kurs besteht aus 21 Schülerinnen. Davon sind mir fünf Schülerinnen bereits aus dem vergangenen Schuljahr bekannt[6] und zwei Schülerinnen fehlen krankheits-/verletzungsbedingt schon seit Beginn des Kurses.
Die Schülerinnen sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie befinden sich in ihrer Entwicklung zwischen der Adoleszenz und dem Erwachsenenalter (vgl. Meinel/Schnabel 1998, 240). Diese Entwicklungsphase ist durch eine allgemeine Stabilisierung der Bewegungsausführung, eine Zunahme der Ausdauerleistungsfähigkeit und eine gute motorische Lernfähigkeit gekennzeichnet. In dieser Altersstufe besitzen die Schülerinnen bereits eine recht genaue Beobachtungsfähigkeit, d.h. Bewegungsabläufe werden gut erfasst und analytische Aufgaben können zunehmend besser bewältigt werden. Des Weiteren kommt es zu einer Verbesserung der motorischen Steuerungs-, Anpassungs-, Umstellungs- und Kombinationsfähigkeit. Dadurch wird die Aneignung technisch anspruchsvoller und komplexer Bewegungsabläufe vereinfacht. (vgl. Weineck 1997, 226, 559, 603). In der Aerobic mit Handgeräten ist dies von besonderer Bedeutung, da man sich komplexe Bewegungsabfolgen von Armen und Beinen über mehrere Takte merken und umsetzen muss (Näheres zur Koordination in Kap. 3.3).
Um mir einen Eindruck über die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten der Lerngruppe zu verschaffen, den Schülerinnen die Möglichkeit zur Selbsteinschätzung zu geben und um eine Diskussionsgrundlage für die theoretische Klärung des Fitnessbegriffs zu haben wurde zu Beginn des Kurses der Münchner Fitnesstest (MFT)[7] durchgeführt. Dieser soll am Ende des Schuljahres wiederholt werden, um zu überprüfen, ob sich die „Fitness“ der Teilnehmerinnen im Verlauf des Kurses verändert hat. Die Schülerinnen zeigten z.T. sehr geringe sportmotorische Fähigkeiten, die es im Verlauf des Kurses zu berücksichtigen und zu verbessern gilt.
Mit Hilfe von Fragebögen[8] und Gesprächen mit den Schülerinnen zu Beginn des Kurses konnte ich mir einen Überblick bezüglich der außerschulischen Sportaktivitäten sowie der Vorerfahrungen in den Bereichen Fitness, Gymnastik und Tanz verschaffen. Zudem wurde ich über die Lernvoraussetzungen und Erwartungshaltungen der Schülerinnen in Bezug auf diesen Sportkurs informiert. Außerdem erfuhr ich, ob sie bereits mit bestimmten Entspannungsverfahren, die im Verlauf des Kurses eine wichtige Rolle spielen, Erfahrungen gesammelt haben. Dies erleichterte mir eine an die Schülerinnen angepasste Planung und Durchführung der Reihe.