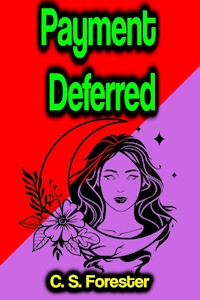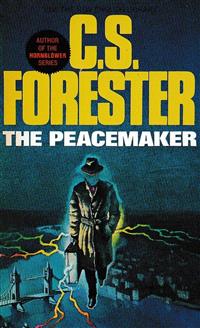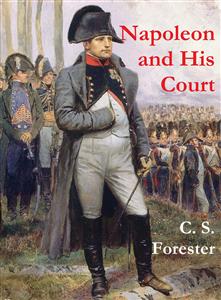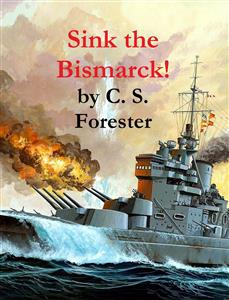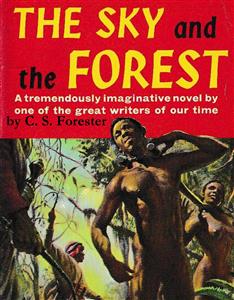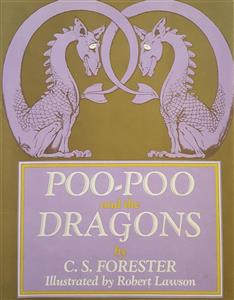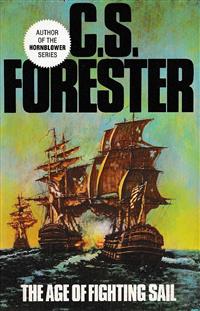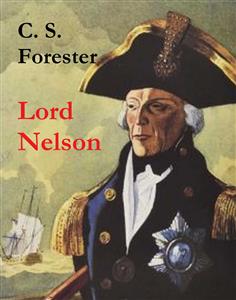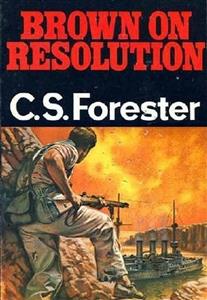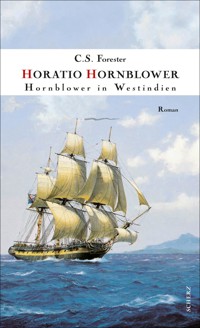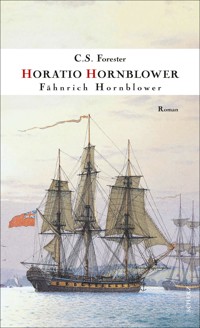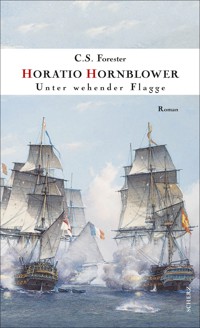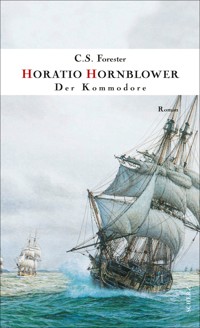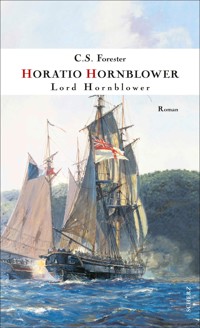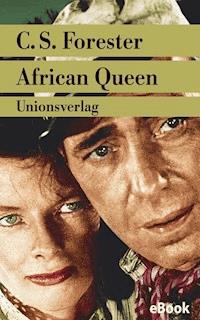
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Erste Weltkrieg auch in den Dschungel Afrikas vordringt, finden sich Charlie Allnut, ein Mechaniker aus Londons Unterschicht mit zweifelhaftem Ruf, und Rose Sayer, die gestrenge, unverheiratete Missionarin, in einer unverhofften Schicksalsgemeinschaft wieder. Sie sind einander zutiefst fremd, und doch bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit dem maroden Dampfboot African Queen den Fluchtweg den gefährlichen Ulanga-Fluss hinunter anzutreten, wobei ihnen neben Malaria, Gewehrschüssen und Stromschnellen auch allerlei gegenseitige Spannungen zu schaffen machen. Und doch entwickelt Rose eine überraschende Zuneigung zu ihrem lästigen Weggefährten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Als der Erste Weltkrieg auch in den Dschungel Afrikas vordringt, finden sich Charlie Allnut, ein Mechaniker aus Londons Unterschicht mit zweifelhaftem Ruf, und Rose Sayer, die gestrenge, unverheiratete Missionarin, in einer unverhofften Schicksalsgemeinschaft wieder. Die Flucht mit dem maroden Dampfboot African Queen verändert beider Leben von Grund auf.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
C. S. Forester (1899–1966) brach das Medizinstudium ab, um eine Laufbahn als Schriftsteller einzuschlagen. John Hustons Verfilmung von The African Queen mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn gilt als Meilenstein der Filmgeschichte.
Zur Webseite von C. S. Forester.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
C. S. Forester
African Queen
Roman
Aus dem Englischen von Doris Kornau
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 1935 unter dem Titel The African Queen.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1985 im Ullstein Verlag.
Originaltitel: The African Queen (1935)
© by C. S. Forester 1935
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30243-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.05.2024, 15:02h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
AFRICAN QUEEN
1 – Obwohl Rose Sayer sich selbst so elend fühlte …2 – Allnutt fühlte sich immer noch nicht ganz wohl …3 – Rose brachte es tatsächlich fertig, den größten Teil …4 – Eines Abends war Allnutt schweigsam und in sich …5 – Vielleicht hätte ein Mann mit stärkerer Willenskraft oder …6 – Die Flüsse Afrikas sind fast alle über Strecken …7 – Am nächsten Morgen schien es fast, als sei …8 – Wahrscheinlich war dies alles unvermeidlich gewesen. Alle Begleitumstände …9 – Irgendwo auf ihrem Weg kamen sie an diesem …10 – Der friedlichen Stille der Nacht folgte die Gluthitze …11 – In dieser Nacht war es nicht nötig …12 – Am Morgen mussten sie nur noch einen schmalen …13 – Die Mündung des Bora, auf die sie hinauskamen …14 – Als der Anfall am späten Nachmittag vorüber war …15 – Am Morgen sahen sie, wie sich die Königin …16 – Der Vorsitzende des Gerichts betrachtete den Gefangenen voller …17 – Der Posten eines kommandierenden Marineoffiziers in Port Albert …18 – Als die Königin Luise am nächsten Tag in …19 – Jeder Sieg bringt ein Hochgefühl mit sich …Mehr über dieses Buch
Über C. S. Forester
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Afrika
Zum Thema Abenteuer
Zum Thema Schmöker
Zum Thema Liebe
1
Obwohl Rose Sayer sich selbst so elend fühlte, dass sie sich ins Bett gelegt hätte, wäre sie eine weniger willensstarke Person gewesen, war ihr klar, dass es ihrem Bruder, Hochwürden Samuel Sayer, noch viel schlechter ging. Er war zum Erbarmen schwach, und als er zum Abendgebet niederkniete, ähnelte dieser Akt mehr einem plötzlichen Zusammenbruch als einer bewusst ausgeführten Bewegung. Seine zum Gebet erhobenen Hände zitterten heftig. Für einen kurzen Moment, bevor sie andächtig die Augen schloss, sah Rose, wie mager und durchsichtig diese Hände waren und wie sich die Knochen an den Handgelenken skelettartig abzeichneten.
Die dumpfe Hitze des afrikanischen Urwalds schien sich mit dem Einbruch der Dunkelheit während ihres Gebets noch zu verstärken. Roses gefaltete Hände waren nass, als hätte sie sie in Wasser getaucht, und während sie kniend betete, spürte sie, wie ihr der Schweiß unter dem Kleid in Strömen über den Körper lief und sich in ihren Kniekehlen sammelte. Dieses Empfinden war es vor allem, das ihr half, ihr Gewissen mit der Tatsache zu versöhnen, dass sie, fast schon eine Frau in den mittleren Jahren, kein Korsett trug. Immerhin war ihr ein Leben lang eingeimpft worden, dass es sich für eine Frau von vierzehn Jahren an aufwärts nicht schickte, sich in der Öffentlichkeit ohne dieses Utensil zu zeigen. Tatsächlich war ein Korsett in Ostafrika eine Absurdität, und Rose hatte sich gelegentlich sogar schon bei dem Wunsch ertappt, überhaupt keine Unterwäsche unter ihrem weißen Drillichkleid zu tragen, ein Gedanke, den sie freilich als Versuchung des Teufels sofort energisch von sich wies.
Gepeinigt von der feuchten Hitze, wurde Rose sogar jetzt, während dieser feierlichen Gebetsstunde, von solchen Vorstellungen heimgesucht. Sie schob sie jedoch augenblicklich beiseite, um sich wieder voller Inbrunst dem Gebet zu widmen, das Samuel mit leiser Stimme und schleppenden Worten an Gott richtete. Samuel bat um himmlische Führung für ihren Erdenweg und um Vergebung ihrer Sünden. Dann folgte seine übliche Bitte um Gottes Segen für die Mission, und dabei wurde seine Stimme immer brüchiger. Die Mission, der sie ihr Leben gewidmet hatten, existierte praktisch nicht mehr, seit von Hanneken mit seinen Truppen den Ort geplündert und alle Dorfbewohner, Bekehrte wie Heiden, fortgetrieben hatte, um sie zu Soldaten oder Trägern in einem deutsch-ostafrikanischen Corps zu machen, das er gerade aufstellte. Die plündernden Truppen hatten alles mitgenommen, den gesamten Vieh- und Geflügelbestand, sämtlichen Hausrat und alle Nahrungsmittel, selbst vor der tragbaren Kapelle hatten sie nicht haltgemacht; verschont blieb lediglich der Bungalow der Mission am Rand der verlassenen Lichtung. Die Schwäche in Samuels Stimme verschwand, als er um ein Ende des Krieges bat, der über die Welt gekommen war, und um ein Ende der Zerstörung und des Blutvergießens und dass die Menschen sich besannen, dem Krieg zu entsagen und weltweiten Frieden zu schaffen. Und als er dies gesagt hatte, erhob Samuel noch einmal seine Stimme und bat, der Allmächtige möge Englands Waffen segnen und das Land sicher durch diese schwerste aller Prüfungen geleiten und seine Anstrengungen mit einem Sieg über die gottlosen Militaristen krönen, die an diesem Elend schuld waren. In Samuels Stimme schwang bei diesen Worten ein Anflug von Kampfgeist mit, und seine Ausdrucksweise erinnerte an das Alte Testament, an einen anderen Samuel, der einst den Sieg über die Amalekiter herbeigefleht hatte.
»Amen! Amen! Amen!«, schluchzte Rose, den Kopf über die gefalteten Hände gebeugt.
Sie verharrten noch einige Sekunden schweigend auf den Knien und erhoben sich dann. Rose konnte in dem schwindenden Licht gerade noch Samuels weiß gekleidete, schwankende Gestalt und sein blasses Gesicht erkennen. Sie machte keine Anstalten, die Lampe anzuzünden. Nun, da sich Deutsch-Ostafrika im Krieg gegen England befand, konnte niemand vorhersagen, wie lange es dauern würde, bis sie wieder einmal Öl oder Streichhölzer bekommen würden. Sie waren völlig von der Außenwelt abgeschnitten, die einzig mögliche Verbindung führte durch feindliches Territorium.
»Ich denke, ich ziehe mich jetzt zurück, Schwester«, sagte Samuel mit matter Stimme.
Rose war ihm nicht beim Auskleiden behilflich. Sie waren Bruder und Schwester und streng erzogen, und ihm dabei zu helfen, wäre für sie undenkbar und höchstens durch Samuels völlige Hilflosigkeit zu rechtfertigen gewesen. Doch als er im Bett lag, stahl sie sich im Dunkeln zu ihm, um dafür zu sorgen, dass seine Moskitovorhänge auch richtig zugezogen waren.
»Gute Nacht, Schwester«, sagte Samuel. Selbst in dieser mörderischen Hitze schlugen klappernd seine Zähne aufeinander.
Rose begab sich in ihr Zimmer und lag dann schweißgebadet auf ihrer Pritsche, obwohl sie nur ihr dünnes Nachthemd trug. Von draußen drangen die Geräusche der afrikanischen Nacht an ihr Ohr, das Gekreisch der Affen, der schrille Schrei eines Raubtiers und das Brüllen der Krokodile unten am Fluss. Begleitet wurde all dies von dem ständigen hohen Summton, der von der Moskitowolke hinter ihren Vorhängen kam, ihr so vertraut, dass sie es gar nicht mehr wahrnahm.
Erst gegen Mitternacht fiel sie in einen unruhigen Schlaf, und es dämmerte eben erst, als sie schon wieder erwachte. Samuel musste nach ihr gerufen haben. Barfuß eilte sie durch den Wohnraum in sein Zimmer. Doch falls er tatsächlich nach ihr gerufen haben sollte, schien er dazu jetzt kaum noch in der Lage. Fast alles, was er sagte, war völlig wirr. Einen Augenblick lang hatte sie den Eindruck, als versuche er, das Scheitern seines Lebenswerkes vor jenem Tribunal zu rechtfertigen, vor das er schon bald treten sollte.
»Die arme Mission«, sagte er, und: »Die Deutschen waren es, die Deutschen.«
Danach ging es sehr schnell mit ihm zu Ende, während Rose weinend an seinem Bett saß. Als der erste große Kummer verebbt war, richtete sie sich langsam auf. Die Morgensonne lastete heiß auf dem Wald und tauchte die einsame Lichtung in blendendes Licht, und Rose war ganz allein.
Die Angst, die ihren Kummer ablöste, hielt jedoch nicht lange an. Rose Sayer war nicht dreiunddreißig Jahre alt geworden, hatte nicht zehn Jahre im zentralafrikanischen Urwald gelebt, ohne zu dem einfachen Glauben an ihre Religion auch ein gesundes Selbstvertrauen zu erwerben. Sie stand nicht lange in dem stillen Bungalow mit dem toten Mann, da erfasste sie eine wilde Wut gegen Deutschland und die Deutschen. Ohne sie, sagte sie sich, ohne das Entsetzen über von Hannekens Requirierungen wäre Samuel nicht gestorben. Zu erleben, wie die mühevolle Arbeit von zehn Jahren innerhalb einer Stunde zu nichts wurde, das war es, was ihn getötet hatte.
Was die Deutschen auf ihr Gewissen geladen hatten, wog schlimmer als Samuels Tod, dachte Rose. Sie hatten Gottes Werk zerstört; Rose gab sich keinerlei Illusionen darüber hin, wie viel Christentum noch in den Bekehrten sein würde nach einem Urwaldfeldzug in den Reihen einer Truppe von Einheimischen, in der neunundneunzig von hundert Männern Heiden waren.
Rose kannte den Urwald. Sie konnte sich vage vorstellen, was dort, auf einer Fläche von hunderttausend Quadratmeilen, Krieg bedeutete. Auch wenn einige ihrer Bekehrten überleben sollten, würden sie doch nie zur Mission zurückkehren – und selbst wenn sie es täten, war Samuel ja tot.
Rose versuchte sich einzureden, dass der Angriff auf die heilige Sache eine größere Sünde war als der dadurch verursachte Tod, aber es gelang ihr nicht. Von Kindheit an war sie dazu angehalten worden, ihren Bruder zu lieben und zu bewundern. Als sie noch ein kleines Mädchen war, war ihm bereits die wundervolle, fast mystische Auszeichnung zuteilgeworden, ein geistliches Amt zu bekleiden, und schon damals besaß er in ihren Augen in höchstem Maße sämtliche charakterlichen Vorzüge, die zur Erfüllung einer solchen Aufgabe notwendig waren. Ihre eigenen Eltern, strenge, gottesfürchtige Christen, die bei der Erziehung ihrer Kinder oft von der Rute Gebrauch machten, beugten sich von da an seinem Urteil und lauschten respektvoll seinen Worten. Ihm allein war es zu verdanken, dass sie in der gesellschaftlichen Rangordnung ein riesiges Stück aufrückte, von der kleinen Ladenbesitzerstochter zur Schwester eines Geistlichen wurde. Zwölf Jahre lang war sie ihm Haushälterin, eifrigste und ergebenste Anhängerin und vertrauenswürdigste Gehilfin, und so war es kaum verwunderlich, dass sie ganz unchristliche Hassgefühle gegenüber der Nation hegte, die seinen Tod herbeigeführt hatte.
Selbstverständlich war es ihr auch unmöglich, sich in die Lage des Gegners zu versetzen. Unterstützt von nicht mehr als fünfhundert weißen Männern in einer von einer Million Schwarzen bevölkerten Kolonie, von denen nur ein paar Tausend überhaupt wussten, dass sie Untertanen der deutschen Flagge waren, sah sich von Hanneken vor die Aufgabe gestellt, Deutsch-Ostafrika gegen die Angriffe einer überwältigenden Zahl von feindlichen Truppen zu verteidigen – Truppen, die jeden Augenblick losschlagen konnten. Es war seine Pflicht, bis zum bitteren Ende zu kämpfen, möglichst viel feindliches Territorium so lange wie möglich besetzt zu halten und, wenn es sein musste, im letzten Schützengraben zu sterben, während die wirkliche Entscheidung unterdessen in Frankreich ausgefochten wurde. Dank der britischen Vorherrschaft auf den Weltmeeren konnte er mit keinerlei Hilfe von außen rechnen; er musste sich ausschließlich auf seine eigenen Mittel verlassen, während der Verstärkung der feindlichen Truppen keine Grenzen gesetzt waren. Folglich war es nur natürlich, dass er – mit deutscher Gründlichkeit – jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Reichweite als Träger oder Soldaten verpflichtete und jede noch so kleine Menge an Lebensmitteln oder Material, das er aufstöbern konnte, beschlagnahmte.
Rose ließ nicht die geringste Entschuldigung für ihn gelten. Sie erinnerte sich, dass sie die Deutschen noch nie gemocht hatte. Bei ihrer Ankunft in der Kolonie hatten deutsche Beamte damals sie und ihren Bruder peinlichen Kreuzverhören und Überprüfungen ausgesetzt, hatten sie höhnisch und verächtlich behandelt und ihnen Misstrauen entgegengebracht, was für deutsche Beamte beim Eindringen eines britischen Missionars in eine deutsche Kolonie eigentlich ganz natürlich war. Sie entdeckte, dass sie ihre Manieren, ihre Moralvorstellungen, ihre Gesetze und ihre Ideale verabscheute – fraglos ließ sich Rose von der Welle internationalen Hasses mitreißen, von der die ganze übrige Welt im August 1914 ergriffen war.
Hatte ihr als Märtyrer gestorbener Bruder nicht für den Erfolg der britischen Truppen und die Niederlage der Deutschen gebetet? Beim Anblick des toten Mannes schoss ihr bruchstückhaft eine Flut von Textstellen aus dem Alten Testament durch den Kopf, die er dem Anlass entsprechend gewählt haben würde. Sie dürstete danach, für England zu kämpfen und die Amalekiter, Philister, Midianiter zu vernichten. Doch noch während diese leidenschaftliche Gefühlsaufwallung von ihr Besitz ergriff, richtete sie sich jäh auf, voll Zorn, sich Tagträumen hingegeben zu haben. Sie war hier, mutterseelenallein im ostafrikanischen Urwald, allein mit einem Toten. Sie hatte nicht die geringste Chance, irgendetwas zu erreichen.
Bei diesen Gedanken blickte Rose über die Veranda des Bungalows nach draußen, und da sah sie ihn, sah »ihre Chance«, die vorsichtig vom Rand der Lichtung zu ihr herblickte. Allerdings erkannte sie ihn nicht als »Chance«; sie ahnte nicht, dass der Mann, der dort aufgetaucht war, das Werkzeug war, dessen sie sich bei ihrem Kampf für England bedienen würde. Was sie dagegen erkannte, war Allnutt, den Cockney-Londoner, Mechaniker bei der belgischen Goldbergwerksgesellschaft zweihundert Meilen flussaufwärts – ein Mann, dessen Gesicht ihrem Bruder nicht gefiel, denn er hielt ihn für einen unchristlichen Menschen.
Aber es war ein englisches Gesicht und außerdem ein ihr wohlgesinntes, und als sie es jetzt sah, begriff sie erst, was es bedeuten konnte, allein zu sein im Urwald. Sie eilte auf die Veranda und winkte Allnutt einen Willkommensgruß zu.
2
Allnutt fühlte sich immer noch nicht ganz wohl in seiner Haut. Er sah sich vorsichtig um, als er durch die Gärten der Einheimischen auf sie zukam.
»Wo stecken denn alle, Miss?«, fragte er, als er sie erreicht hatte.
»Sie sind alle fort«, sagte Rose.
»Wo ist der Reverend – Ihr Bruder?«
»Er ist drinnen … Er ist tot«, sagte Rose.
Ihre Lippen begannen ein wenig zu zittern, als sie da zusammen im grellen Sonnenlicht standen, doch verbot sie sich jedes Zeichen von Schwäche. Ihr Mund schloss sich wie eine Falle und bot wieder das übliche Bild eines harten, geraden Strichs.
»Tot, sagen Sie? Das ist schlimm, Miss«, sagte Allnutt, doch war klar zu erkennen, dass sein Mitgefühl im Moment rein mechanischer Natur war. Allnutts Auffassungsgabe war so beschaffen, dass er sich jeweils nur mit einem Thema beschäftigen konnte. Er musste noch weitere Fragen stellen.
»Sind die Deutschen hier gewesen, Miss?«, erkundigte er sich. »Ja«, sagte Rose. »Sehen Sie nur.«
Ihre Handbewegung umschloss den kahlen, runden Platz, der das Dorfzentrum darstellte. Ohne von Hannekens Überfall wäre auf diesem Dorfplatz jetzt ein lärmender, geschäftiger Markt im Gange gewesen, voll von lächelnden, schwatzenden Einheimischen, mit Hühnern und Eiern und Hunderten von anderen Dingen zum Tauschen. Nackte, dickbäuchige Kinder wären umhergeflitzt, ein paar Kühe wären zu sehen gewesen, Frauen bei der Gartenarbeit und vielleicht eine Gruppe von Männern, die, mit Fischen beladen, vom Fluss heraufkamen. Nun aber war da nichts mehr, nur der kahle Boden und die im Kreis angeordneten, verlassenen Hütten und dahinter der schweigende Urwald.
»Die reinste Hölle, Miss«, sagte Allnutt. »Oben beim Bergwerk sahs genauso aus, als ich von Limbasi zurückkam. Alles weg. Was die mit den Belgiern gemacht haben, weiß Gott allein. Soll er ihnen jetzt auch helfen. Möchte im Urwald nicht Gefangener dieses langen Burschen mit dem Glasauge sein – Hanneken heißt er, nicht, Miss? Nichts rührte sich oben beim Bergwerk, bis so ein Neger, der den Deutschen durch die Lappen gegangen war, auftauchte. Meine Neger an Bord verkrümelten sich sofort auf Nimmerwiedersehen im Wald, als sie die Neuigkeit erfuhren. Keine Ahnung, ob sie vor mir oder den Deutschen Angst hatten. Hauten einfach nachts ab und ließen mich mit der Barkasse sitzen.«
»Der Barkasse?«, sagte Rose aufhorchend.
»Ganz richtig, Miss. Die African Queen. War mit der Barkasse flussaufwärts in Limbasi, um Vorräte zu holen. Die dort oben hatten zwar schon vom Krieg gehört, glaubten aber nicht, dass von Hanneken kämpfen würde. Haben mir einfach das Zeug übergeben und ließen mich wieder abschippern. Hab mir die ganze Zeit gedacht, so leicht, wie die sich das vorstellen, wirds ihnen nicht gemacht. Wetten, dass es ihnen jetzt leidtut? Wetten, dass von Hanneken mit denen dasselbe gemacht hat wie mit den Leuten von der Mine? Aber die Barkasse hat er nicht bekommen und schon gar nicht das, was drin ist. Hätte sich bestimmt darüber gefreut.«
»Und was ist das?«, wollte Rose wissen.
»Sprenggelatine, Miss. Acht Kisten voll. Und Dosenfraß. Außerdem noch Sauerstoff- und Wasserstoffflaschen, für die Schweißarbeiten an der Steinfräse. Ein Haufen Zeug. Von Hanneken könnte das alles gut gebrauchen – das steht fest.«
Sie waren jetzt im Bungalow, und Allnutt nahm seinen schäbigen Sonnenhut ab, als ihm einfiel, dass er sich in Gegenwart eines Toten befand. Er senkte den Kopf und murmelte einige unverständliche Worte. So wortreich er vom Krieg oder von seinen persönlichen Erlebnissen erzählen konnte, so schwer wollte es ihm fallen, in aller Form zu kondolieren. Doch eine Sache musste er zur Sprache bringen.
»’tschuldigung, Miss, aber wie lange ist er schon tot?«
»Er starb heute Morgen«, sagte Rose, der der gleiche Gedanke kam, der hinter Allnutts Frage stand. In den Tropen muss ein Toter innerhalb von sechs Stunden beerdigt werden. Aber Allnutt war außerdem noch von dem Wunsch besessen, so rasch wie möglich fortzukommen, sich wieder in seinen Schlupfwinkel in einem der Seitenarme des Flusses zurückzuziehen, weit weg von den Augen der Deutschen.
»Ich werd ihn begraben, Miss«, sagte Allnutt. »Keine Sorge, Miss. Ich machs schon richtig. Kenn mich ein bisschen mit den Gebeten aus. Hab sie ja oft genug mit angehört.«
»Ich habe mein Gebetbuch hier. Ich kann das Gebet lesen«, sagte sie, ein Zittern in ihrer Stimme unterdrückend.
Allnutt trat wieder hinaus auf die Veranda. Sein Blick suchte zunächst den Waldrand nach Deutschen ab, bevor er ihn auf die Lichtung richtete, um eine passende Stelle für das Grab zu finden.
»Dort drüben dürfte genau der richtige Platz sein«, sagte Allnutt. »Die Erde ist dort sicher locker, und er würde bestimmt gern im Schatten liegen, nehm ich an. Wo gibt es hier einen Spaten, Miss?«
Die nahen Gefahren beschäftigten derart Allnutts Gedanken, dass er nicht umhinkonnte, noch während seines traurigen Tuns zu bemerken: »Wir sollten uns beeilen, Miss, falls die Deutschen noch mal zurückkommen.«
Und als alles vorüber war und Rose bekümmert am Grab mit dem notdürftig aufgestellten Kreuz stand, machte Allnutt neben ihr einen äußerst unruhigen Eindruck.
»Kommen Sie mit runter zum Fluss, Miss«, drängte er. »Nichts wie weg von hier!«
Quer durch den Wald gelangte man auf einem abfallenden Weg hinunter zum Ufer, und dort, wo der Weg auf die sumpfige Niederung stieß, verkümmerte er zusehends und war bald nicht einmal mehr ein Trampelpfad. Bisweilen wateten sie knietief im Morast. Taumelnd und immer wieder ausrutschend, kämpften sie sich vorwärts, schweißüberströmt unter der Last von Roses spärlicher Habe. Ab und zu fanden ihre Füße für einen kurzen Moment sicheren Halt auf einer Baumwurzel, und bei jedem Schritt wurde der für den Fluss typische durchdringende Geruch nach Ringelblumen intensiver und stach ihnen in die Nase. Schließlich hatten sie die dichte Vegetation hinter sich und standen wieder im gleißenden Licht der Sonne. Die Barkasse lag nahe am Ufer vor Anker und tanzte hin und her, den Bug stromaufwärts gerichtet. Das wild dahinschießende braune Wasser schlug geräuschvolle Wellen um Ankerkette und Backbordseite.
»Vorsichtig jetzt, Miss«, sagte Allnutt. »Stellen Sie Ihren Fuß auf den Baumstumpf dort. Gut so!«
Rose saß in der Barkasse, die so bedeutsam für sie werden sollte, und sah sich um. Die Barkasse verdiente schwerlich den hochtrabenden Namen African Queen. Sie war gedrungen, knapp zehn Meter lang und hatte einen flachen Boden. Ihr Anstrich war abgeblättert, und sie roch nach Verfall. Ein zerfetztes Sonnensegel überdachte eine etwa zwei Meter tiefe Fläche vor dem Heck; mittschiffs stand die Dampfmaschine mit dem gedrungenen Schornstein, der das Sonnendach nur wenig überragte. Auf ihrem Sitzplatz spürte Rose die Hitze, die das Ding ausstrahlte, wie zusätzliche Sonnenglut.
»’tschuldigen Sie, Miss«, sagte Allnutt. Er kniete auf dem Schiffsboden und befasste sich mit der Maschine, holte einen Kasten voll heißer Asche heraus und schüttete sie in den Fluss, wo es ein ungeheures Gezische und Gespritze gab. Dann schob er neues Holz von dem neben ihm liegenden Stapel in die Feuerung, und bald erschien Rauch über dem Schornstein, und Rose hörte das Rauschen der Flammen. Die Maschine begann, zu ächzen und zu zischen – Rose sollte später die Reihenfolge der auftretenden Geräusche noch zur Genüge kennenlernen –, und fing dann an, graue Dampfwölkchen auszustoßen. Tatsächlich waren das Bemerkenswerteste an der ganzen Maschine diese anscheinend aus allen Ritzen quellenden Dampfwölkchen. Allnutt spähte auf seine Messinstrumente, warf noch etwas Holz ins Feuer und hechtete dann um die Maschine herum nach vorn. Grunzlaute ausstoßend und kräftig an der kleinen Winde zerrend, machte er sich daran, den Anker einzuholen, während ihm der Schweiß in Strömen über den Körper lief. Als der Anker sich gelöst hatte und die reißende Strömung das Boot ans Ufer zu drücken drohte, stürzte er wieder zurück zur Maschine. Ein rasselndes Geräusch ertönte, und Rose spürte, wie die Schraubenwelle unter ihr zu rotieren begann. Allnutt stieß das Boot mit einer langen Stange kräftig vom schlammigen Ufer ab, zog die Stange hastig wieder an Bord und stürzte dann nach hinten zum Ruder.
»’tschuldigen Sie, Miss«, sagte er noch einmal. Er schob sie unsanft beiseite und konnte das Ruder gerade noch rechtzeitig herumreißen, bevor das Boot ans Ufer geprallt wäre. Stampfend und rasselnd steuerten sie raus in das reißende braune Wasser. »Denke mir, Miss«, sagte Allnutt, »wir sollten irgendwo hinter einer Insel ein ruhiges Plätzchen auftreiben, wo man uns nicht sehen kann. Dort könnten wir dann beratschlagen, was wir tun sollen.«
»Das wäre sicher das Beste«, sagte Rose.
Das Flussbett des Ulanga ist an diesem Punkt seines Verlaufs schwer zu bestimmen. Der Fluss schlängelt und windet sich, seine Ufer sind schlammig, und er ist übersät mit Inseln, die so dicht aneinanderliegen, dass er auf manchen Streckenabschnitten eher wie ein Bündel von Seitenarmen aussieht, die sich durch Haufen dichter Vegetation hindurchquälen. Die African Queen schob sich langsam gegen die Strömung quer über den breiten Flussarm, in dem sie ihre Reise begonnen hatten. Eine halbe Meile flussaufwärts bot sich am anderen Ufer ein halbes Dutzend schmalerer Arme zur Auswahl an; Allnutt richtete den Bug auf die in der Mitte liegenden.
»Wären Sie so nett, das Ruder zu übernehmen, Miss, und es genau so zu halten, wie es jetzt ist?«, fragte Allnutt.
Rose ergriff schweigend die Eisenstange; sie war so heiß, dass sie ihre Hand zu versengen drohte. Doch Rose hielt sie forsch umschlossen und spürte beinahe mit Entzücken, wie die African Queen gehorsam etwas von ihrem Kurs abwich, wenn sie das Ruder nur ein klein wenig bewegte. Allnutt strotzte schon wieder vor Aktivität. Er hatte die Klappe der Feuerung geöffnet und warf nun noch einige Holzscheite hinein, dann kletterte er mühsam nach vorn zum Vorschiff, stellte sich, um Gleichgewicht kämpfend, auf die Schiffsladung und suchte den Flussarm nach Baumstämmen und Sandbänken ab.
»’ne Spur nach Backbord, Miss«, rief er ihr zu. »Ich meine, ziehen Sie das Ruder etwas auf die Seite dort. Gut so! Ruhig Blut!«
Das Boot tuckerte langsam in einen engen Tunnel aus Blattwerk, das sich von den Ufern her über ihnen geschlossen hatte. Mit einem Hechtsprung über die Ladung setzend, kam Allnutt wieder zurück und stellte die Maschine ab, sodass die Schraubenwelle aufhörte zu rotieren. Dann stürzte er noch einmal ins Vorschiff, und gerade als die Bäume auf Roses Seite sich scheinbar wieder vorwärtszubewegen begannen, weil die Strömung nun stärker war als die Fahrt, die das Boot jetzt machte, ließ er den Anker unter gewaltigem Gerassel und Geklirr hinunter, und die African Queen kam fast ohne Ruck in dem in grünes Dämmerlicht getauchten Flussarm zum Stehen. Als der Lärm der Ankerkette verstummt war, umfing sie eine große Stille, die Stille eines tropischen Flusses um die Mittagszeit. Nur das Rauschen und Gurgeln des dahinschießenden Wassers und das Ächzen und Zischen der Maschine waren noch zu hören. Die grüne Kühle hatte etwas Paradiesisches. Und dann plötzlich kamen die Insekten aus dem Dickicht auf den Inseln. Sie kamen in Wolken und fielen erbarmungslos über sie her.
Allnutt kam wieder nach hinten zu den Achtersitzen. Von seiner Oberlippe baumelte eine Zigarette; Rose hatte nicht die leiseste Ahnung, wann er sie angesteckt hatte, doch vervollständigte diese baumelnde Zigarette erst Allnutts Erscheinung. Ohne sie wirkte er unvollkommen. In den folgenden Jahren gelang es Rose nie, sich Allnutts Bild ohne eine – im Allgemeinen ausgegangene – Zigarette zu vergegenwärtigen, die zwischen Mundmitte und linkem Mundwinkel an seiner Oberlippe klebte. Ein spärlicher, borstiger Bart, eigentlich nur ein paar Dutzend schwarzer Haare, begann, auf seinen eingefallenen Wangen zu sprießen. Er wirkte immer noch rastlos und nervös, wie er da gegen die Fliegen ankämpfte, doch gelang es ihm nun, da sie nicht mehr auf dem Festland waren, besser, seine Unruhe zu beherrschen oder sie zumindest hinter einer scheinbaren Heiterkeit zu verbergen.
»Nun, da wären wir, Miss«, sagte er. »Sicher. Und gesund, könnte man wohl sagen. Die Frage ist, wie gehts jetzt weiter?« Rose fielen Entscheidungen nicht leicht, und sie war ein ziemlich wortkarger Typ. Sie schwieg deshalb, wohingegen sich Allnutts Nervosität in einer immer größer werdenden Redseligkeit offenbarte.
»Wir haben jede Menge zu futtern hier, Miss, sind also gut dran, was das angeht. Zweitausend Glimmstängel. Zwei Kisten Gin. Könnten hier monatelang bleiben, wenn wir wollten. Die Frage ist nur, wollen wir das? Wie lange, glauben Sie, wird dieser Krieg noch dauern, Miss?«
Rose konnte ihn nur schweigend anschauen. Was er mit seiner Rede andeuten wollte, war offensichtlich – er schlug vor, in diesem schlammigen Seitenarm zu bleiben, bis der Krieg zu Ende war und sie gefahrlos wiederauftauchen konnten. Und genauso offensichtlich war es, dass er das für die bei Weitem beste Idee hielt, vorausgesetzt, ihre Vorräte reichten aus. Er dachte nicht im Entferntesten daran, England zu helfen. Rose war zu erstaunt, um zu antworten, was Allnutts Geschwätzigkeit wieder neue Nahrung gab.
»Das Dumme ist nur«, bemerkte Allnutt, »dass wir nicht wissen, von woher wir Hilfe zu erwarten haben. Ich denke, es wird zum Kampf kommen. Der gute von Hanneken scheint jedenfalls ziemlich fest damit zu rechnen, finden Sie nicht auch? Falls unsere Leute vom Meer herkommen, werden sie sich wahrscheinlich entlang der Eisenbahnlinie nach Limbasi vorkämpfen. Aber das würde uns hier nicht viel nützen. Wenn sie es aber doch tun, könnten wir ja hier bleiben und einfach hoch nach Limbasi fahren, wenn es so weit ist. Wenn ich mirs recht überlege, wäre das wohl das Beste. Natürlich könnten sie auch von oben, von Britisch-Ost kommen. So hätten sie eine bessere Chance, von Hanneken zu schnappen, obwohl es bestimmt kein Kinderspiel sein wird, ihn im Urwald aufzustöbern. Nur, wenn sie das tun, haben wir ihn die ganze Zeit zwischen ihnen und uns. Und genauso ist es, wenn sie von Rhodesien oder Portugiesisch-Ost herkommen. Wir stecken ziemlich tief im Schlamassel, von welcher Seite mans auch betrachtet, Miss.«
Allnutts angeborene Cockney-Schläue, verbunden mit seinen Kenntnissen über das Land, erlaubten ihm, sich beredt über die strategische Lage auszulassen. Und in ebendiesem Augenblick zerbrachen sich schwitzende Generäle den Kopf über ganz ähnliche – wenn auch anders formulierte – Erkenntnisse, die ihre Stäbe erarbeitet hatten. Die Invasion Deutsch-Ostafrikas, angesichts eines unter guter Führung stehenden Feindes, war ein Unternehmen, das nicht leichtherzig angegangen werden konnte.
»Eins ist jedenfalls sicher, Miss. Von der Kongo-Seite her werden sie nicht kommen. Nicht mal, wenn die Belgier das wünschten. Es gibt nämlich nur einen Weg von dort, und der führt über den See. Und über den See kommt nichts rüber, solang die Louisa dort ist.«
Die KÖNIGIN LUISE, deren Namen Allnutt charakteristischerweise zu Louisa anglisierte, war der Polizeidampfer, den die deutsche Verwaltung auf dem See eingesetzt hatte. Rose konnte sich noch daran erinnern, wie das Schiff vor acht Jahren in Einzelteilen von der Küste auf dem Landweg heraufgebracht worden war. Wie heute war damals das Land auf der Suche nach Trägern und Arbeitern leer gefegt worden, denn es waren Trassen durch den Urwald zu schlagen und riesige Lasten zu schleppen. Der Kessel der Königin Luise musste unzerlegt transportiert werden, und allein während dieses Unternehmens hatte fast jede Achtelmeile ein Mann im Urwald sein Leben lassen müssen. Doch nachdem das Schiff schließlich montiert und vom Stapel gelassen worden war, hatte es den See in kürzester Zeit von den Kanupiraten gesäubert, die ihn seit undenklichen Zeiten beherrschten. Mit einer Geschwindigkeit von zehn Knoten erwischte es jede Kanuflotte, und mit seiner Sechspfünderkanone räumte es in den Piratendörfern auf. Bald entwickelte sich ein reger Handelsverkehr auf dem See, und in den sumpffreien Ufergebieten breitete sich Landwirtschaft aus. Die Königin Luise verwandelte ihr Schwert in eine Pflugschar und sorgte für einen so reibungslosen Post- und Passagierdienst, dass der größere Teil Deutsch-Ostafrikas nun von der Atlantikküste aus über Belgisch-Kongo zugänglicher war als vom Indischen Ozean her.
Und jetzt gab die Königin Luise eine interessante Lektion in Sachen Seemacht, wenn die bloße Erwähnung ihres Namens genügte, um zwei so gute Kenner des Landes wie Rose und Allnutt zu der Schlussfolgerung zu veranlassen, dass Deutsch-Ostafrika von der Kongoseite her nicht beizukommen war. Keine wie immer geartete Invasion konnte über den See vorgetragen werden wegen eines Hundert-Tonnen-Dampfers mit einem Sechspfünder drauf. Deutschland beherrschte den See so unbestritten wie England die Straße von Dover, und der Vorteil, den die Deutschen aus dieser lokalen Vorherrschaft ziehen konnten, war den beiden in der Barkasse augenblicklich klar.
»Wenn die Louisa nicht wäre«, sagte Allnutt, »hätten wir hier keine Probleme. Der gute von Hanneken könnte sich keinen Monat halten, wenn sie über den See an ihn herankämen. Doch wie die Dinge liegen …«
Allnutts Geste deutete an, dass von Hanneken, nach den drei anderen Seiten abgeschirmt durch den Urwald, seinen Widerstand unbegrenzt fortsetzen könnte. Allnutt klopfte leicht auf seine Zigarette, sodass Asche auf seine schmutzige weiße Jacke fiel. Auf diese Weise ersparte er sich die Mühe, die Zigarette aus dem Mund zu nehmen.
»Aber das alles bringt uns kein bisschen schneller nach Hause, was, Miss? Bloß ich weiß w-wahrhaftig nicht, was wir tun könnten.«
»Wir müssen etwas für England tun«, sagte Rose. Sie würde gesagt haben: »Wir müssen das Unsere tun«, hätte sie diese Kriegsfloskel gekannt, die zu dieser Zeit gerade in England aufkam. Doch was sie sagte, bedeutete dasselbe und klang auch nicht melodramatisch im afrikanischen Urwald.
»Donnerwetter!«, sagte Allnutt.
Seiner Vorstellung nach war es ratsam, den größtmöglichen Abstand zwischen sich und dem Kriegsschauplatz herzustellen; er hielt es für eine Selbstverständlichkeit, dass dieser Krieg, wie andere Kriege auch, von Leuten geführt wurde, die für diesen Zweck bezahlt und ausgebildet worden waren. Unberührt von der patriotischen Propaganda der Presse, hatte er nicht im Entferntesten daran gedacht, sich einzumischen. Selbst seine gezwungenermaßen ausgedehnte Abwesenheit von England hatte seinem Patriotismus nichts hinzugefügt, das über das Schwenken einer billigen Union-Jack-Flagge, wie während seiner Schulzeit am Empire-Tag, hinausgegangen wäre; ja, möglicherweise war sie seinem Patriotismus sogar abträglich gewesen – es wäre taktlos zu fragen, auf welchem Wege und aus welchem Grund ein Engländer dazu kam, in einer deutschen Kolonie auf einer belgischen Bergwerkskonzession als Allroundmechaniker zu arbeiten; solche Fragen stellte man einfach nicht, nicht einmal Missionare oder deren Schwestern taten das.
»Donnerwetter!«, sagte Allnutt noch einmal. Etwas Ansteckendes, Beflügelndes ging von dem Gedanken aus, »etwas für England zu tun«.
Für einen Augenblick erregte ihn diese verlockende Vorstellung, dann wischte er sie beiseite. Er war ein Mensch der Maschinenwelt, ein Tatsachenmensch, kein Träumer. Solche Gedanken mochten ein Kind begeistern; sah man näher hin, hatten sie weder Hand noch Fuß. Doch beschloss er mit Rücksicht auf Roses vor Eifer glühendes Gesicht, erst einmal abzuwarten, einfach, um sie bei guter Laune zu halten.
»Jawohl, Miss«, sagte er, »wenn wir was tun könnten, wär ich der Erste, der sagen würde, tun wirs. Was schwebt Ihnen denn so vor?«
Er stellte diese Frage ganz arglos, in dem festen Glauben, dass es nichts gab, was sie vorschlagen könnte – jedenfalls nichts, was vernünftigen Argumenten standhielt. Und er schien recht zu behalten. Rose nahm ihr kräftiges Kinn in ihre Hand und zog daran. Zwei steile Falten erschienen zwischen ihren buschigen Augenbrauen, während sie krampfhaft nachdachte. Es war absurd, dass zwei Menschen mit einem Boot voll hochexplosiven Sprengstoffs sich nicht in der Lage sahen, gegen einen Feind, in dessen Gebiet sie sich aufhielten, etwas zu unternehmen, und doch schien es so zu sein. Rose versuchte, sich an das wenige zu erinnern, was sie über Kriegführung wusste.
Alles, woran sie sich vom Russisch-Japanischen Krieg her erinnern konnte, war, dass die Japaner sehr tapfere Männer waren, die »Banzai!« zu schreien pflegten. Der Burenkrieg war etwas anderes – sie war damals zwanzig gewesen, Samuel war gerade zum Priester geweiht worden, und sie erinnerte sich, dass Kaki eine kleidsame Farbe war, dass die Leute Plaketten mit den Porträts von Generälen trugen und dass die Königin den Männern an der Front Pakete mit Schokolade schickte. Damals hatte sie auch gelegentlich Zeitung gelesen – was für ein Mädchen von zwanzig während einer nationalen Krise entschuldbar war.
Später, nach der »Schwarzen Woche« und nachdem Roberts die unvermeidlichen Siege davongetragen hatte, in Prätoria einmarschiert und im Triumphzug heimgekehrt war, wurde noch jahrelang weitergekämpft. Ein gewisser de Wet war da, »aalglatt« – niemand erwähnte ihn je, ohne dieses Adjektiv zu gebrauchen. Er pflegte Eisenbahnanlagen anzugreifen und in die Luft zu jagen.
Rose richtete sich jäh auf, weil sie einen Augenblick lang geglaubt hatte, des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Doch gleich darauf schwand ihre Hoffnung. Es existierte zwar eine Eisenbahnlinie, doch verlief diese von einem Meer, das unter Englands Vorherrschaft stand, zum Hauptschifffahrtsgebiet auf dem Ulanga bei Limbasi. Die Linie würde den Deutschen jetzt wenig nützen, und um zu einer der Brücken an der Eisenbahnlinie zu gelangen, müssten sie und Allnutt flussaufwärts nach Limbasi fahren, das vielleicht immer noch in deutscher Hand war, und dann zu Fuß weiter, beladen mit all dem Sprengstoff und jeden Augenblick darauf gefasst, geschnappt zu werden. Rose hatte genügend Märsche durch den Urwald mitgemacht, um erkennen zu können, wie unmöglich diese Aufgabe war, und ihr Sinn für Ökonomie wehrte sich gegen den Gedanken, ein so hohes Risiko bei so zweifelhaftem Nutzen einzugehen. Allnutt konnte ihr die zwiespältigen Gefühle vom Gesicht ablesen.
»Ganz schön harte Nuss, was, Miss?«, bemerkte er.
In diesem Augenblick kam Rose die Erleuchtung. »Allnutt«, sagte sie, »dieser Fluss hier, der Ulanga, mündet doch in den See, nicht?«
Die Frage beunruhigte ihn.
»Nun ja, Miss, das stimmt. Doch falls Sie mit dem Gedanken spielen, mit dieser Barkasse hier zum See runterzufahren – dann vergessen Sie ihn mal gleich wieder. Das geht nämlich nicht, ganz einfach.«
»Warum nicht?«
»Stromschnellen, Miss. Felsen und Stromschnellen und enge Felsschluchten. Sie sind noch nicht dort gewesen, Miss. Ich aber. Über eine Strecke von hundert Meilen gibt es dort nichts als Stromschnellen. Warum wohl hat der Fluss dort unten, wo er in den See mündet, einen anderen Namen als hier oben? Dort heißt er Bora. Daran können Sies sehen. Kein Mensch wusste, dass das ein und derselbe Fluss ist, bis dieser Spengler …«
»Er kam den Fluss herunter. Daran erinnere ich mich.«
»Ja, Miss. In einem Kanu. Hatte ein halbes Dutzend Suahelis zum Paddeln bei sich. Hat Karten angelegt. Da sind Stellen, wo dieser Fluss hier nicht breiter als zwanzig Meter ist und wo das Wasser runterschießt wie – wie aus dem Wasserhahn, Miss. Ein Kanu kommt dort vielleicht klar, aber diesen alten Kahn kriegen wir nie durch.«
»Wie ist dann die Barkasse überhaupt hierhergekommen?«
»Mit der Eisenbahn, Miss, nehm ich an, wie das ganze andere schwere Zeug. Denke, man hat sie stückweise von der Küste nach Limbasi raufgeschickt und am Ufer zusammengebaut. Sie haben ja sogar die Louisa zum See getragen, Miss.«
»Ja, daran erinnere ich mich.«
Wegen des heftigen Protests, den Samuel, um der Einheimischen willen, bei dieser Gelegenheit vorgebracht hatte, war er fast aus der Kolonie ausgewiesen worden. Nun war ihr Bruder tot, und er war der beste Mensch auf Erden gewesen.
Rose war ihr ganzes Leben lang der Führung eines anderen gefolgt – ihrem Vater, ihrer Mutter oder ihrem Bruder. Tapfer hatte sie ihrem Bruder während der endlosen Streitigkeiten mit den deutschen Behörden zur Seite gestanden. Und sie war seine dankbarste, wenn auch nicht kompetenteste Zuhörerin, wenn er in Stimmung war und mit ihr die christliche Lehre diskutierte. Ihm zuliebe hatte sie sich – ziemlich erfolglos – abgemüht, Suaheli und Deutsch und die anderen Sprachen zu lernen, auf diese Weise ihren Anteil an der Strafe abbüßend, welche die Menschheit (wie ihr Samuel versicherte) für die Sünde zu Babel zu erdulden hatte. Sie wäre entsetzt gewesen, hätte ihr jemand gesagt, dass sie sich genauso verhalten hätte, wenn ihr Bruder es vorgezogen hätte, Papist oder Ungläubiger zu sein, doch es wäre die Wahrheit gewesen. Rose entstammte einer gesellschaftlichen Schicht und einer Zeit, in der die Frauen stets der Meinung ihrer Mannsleute waren. Und jetzt dachte sie ganz für sich über etwas nach, das erste Mal in ihrem Leben, wenn man von Haushaltsproblemen absieht.