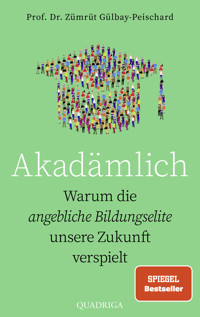
19,99 €
Mehr erfahren.
Kaum ein Satz ohne Rechtschreibfehler, aber am liebsten morgen schon einen gut bezahlten Job in der freien Wirtschaft. Zu jedem Thema eine Meinung, aber Kritik an sich selbst als Majestätsbeleidigung verstehen. Junge Menschen aus wohlstandsverwöhnten Generationen erwarten, dass ihnen alles auf dem Silbertablett serviert wird: von Leistungs- und Leidensbereitschaft haben sie nie etwas gehört. Deshalb haben sie sogar das Lernen verlernt oder gar nicht erst gelernt. Zümrüt Gülbay-Peischard entlarvt die Ursachen der Bildungsmisere an deutschen Hochschulen und zeigt ihre Folgen: Hochschulen sind immer weniger in der Lage, die dringend benötigten Topkräfte für den Arbeitsmarkt auszubilden. Die Autorin geht mit der Generation Z hart ins Gericht, die Ignoranz und Lethargie der Studierenden empfindet sie als geradezu unanständig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. Kapitel
Was Studierende alles nicht machen
Was Studierende alles wollen
Besser als der Ruf
Ich weiß, was kommen wird
2. Kapitel
Ist jede Form von Arbeit inhuman?
Wie es anfing
Hallo Deutschland
Durch das Abitur zum Jurastudium
Was macht eine Professorin?
3. Kapitel
Was manchmal so in Vorlesungen passiert
Die Organisationsprobleme
Die Prüfungsvorbereitung
Wer durchfällt
Wie viel Arbeit steckt in einem Studium?
Das Nachverhandeln von Prüfungsergebnissen
Wie arbeitet man richtig?
Das Studium und das liebe Geld
4. Kapitel
Lernbulimie
Ich möchte diese Klausuren nicht korrigieren
Weil ihnen die Sprache fehlt
Auch Lesen muss man können
Die Rechtschreibung ist ein Trümmerfeld
Wer so alles an die Hochschulen kommt
Zu viele studieren irgendwie
5. Kapitel
Ich will nicht mitmachen
Bitte keine unzivilisierten E-Mails mehr
Wie sie miteinander reden
Und wenn wir persönlich miteinander reden
Der Anspruch an Dienstleistungen
Dauernde Erreichbarkeit
Smartphone-Verbot in der Vorlesung
Das ewige Thema der mündlichen Mitarbeit
Wenn manchmal Konflikte unvermeidlich sind
Höflichkeit als unnötiger Ballast
Muss man heute noch pünktlich sein?
6. Kapitel
Was geht ab?
Politik ist uninteressant
Soziale Medien
Einige dann doch
Die großen Lücken
Freiheit muss sein
7. Kapitel
Die Konfrontation
Leben in zwei Welten
Bildungsinländer und -ausländer
Abgrenzung und Ablehnung
Instrumentalisierung des Vorwurfs
Es gibt Erlebnisse, die vergisst man nicht
Als ich damals studierte
Lernen voneinander
8. Kapitel
Arbeiten in der Pandemie
Kamera an oder aus
Und irgendwie war es dann vorbei
9. Kapitel
Erziehung mit zu viel Liebe
Ohne Kritik erziehen
Kompetenzen akzeptieren
Erziehung im World Wide Web
Anspruchshaltung der Kinder und der Eltern
Empörung in der Kommunikationskultur
Drei Konsequenzen für die Gesellschaft
10. Kapitel
Meine laktosefreie Milch ist weg
Bitte die Vorlesung für mich verlegen
So, wie ich es will
Die singende Studentin
Der Betrug musste sein
11. Kapitel
Die Bedeutung von Arbeit
Arbeit ist anstrengend
Die Arbeit soll zum Leben passen
Wenn der Ruf nach Pflichterfüllung Widerstand weckt
Leistungsförderung und Leistungswille
Vor dem Erfolg steht die Arbeit
Zu krank zum Arbeiten
Die fehlende Resilienz
Und am Ende soll immer jemand helfen
12. Kapitel
Das Privileg der geistigen Freiheit
Studienabschluss nebenbei
Respekt vor dem Lehrenden
Was kostet ein Studium
Studieren in der Dauerschleife
Selbst an den Hochschulen: die Eltern
Und wenn es dann geklappt hat, irgendwie?
Der Arbeitsmarkt sagt die Wahrheit
13. Kapitel
Warum versagen unsere Schüler?
Ein anderes Lehrerbild
Der Umgang miteinander in den Schulen
Was die Schule alles können soll
Ehrliche Leistungsbewertung
Ist wirklich jedes zweite Kind für ein Studium geeignet?
Was Chancengleichheit bedeuten sollte
Mehr Anerkennung für die Ausbildungsberufe
14. Kapitel
Der Zugang zur Hochschule
Verpflichtendes Orientierungsstudium
Oder soziales Jahr
Intensivere Betreuung
Prüfungen als Orientierung
Langzeitstudiengebühren
Mit dem Bachelorabschluss sich einen Zugang zum Masterstudium verdienen
Der Finanzierungsschlüssel der Hochschulen
Das Problem beginnt und endet mit dem Föderalismus
15. Kapitel
Kenne dein Studium und deine Hochschule!
Habe Prüfungsziele!
Sei schnell!
Sei ehrlich zu dir!
Mach einfach mal mehr!
Der Professor, dein Freund und Helfer
Liebe Eltern
Danke
Fußnoten
Über das Buch
Kaum ein Satz ohne Rechtschreibfehler, aber am liebsten morgen schon einen gut bezahlten Job in der freien Wirtschaft. Zu jedem Thema eine Meinung, aber Kritik an sich selbst als Majestätsbeleidung verstehen. Junge Menschen aus wohlstandsverwöhnten Generationen erwarten, dass ihnen alles auf dem Silbertablett serviert wird: von Leistungs- und Leidensbereitschaft haben sie nie etwas gehört. Deshalb haben sie sogar das Lernen verlernt oder gar nicht erst gelernt. Zümrüt Gülbay-Peischard entlarvt die Ursachen der Bildungsmisere an deutschen Hochschulen und zeigt ihre Folgen: Hochschulen sind immer weniger in der Lage, die dringend benötigten Topkräfte für den Arbeitsmarkt auszubilden. Die Autorin geht mit der Generation Z hart ins Gericht, die Ignoranz und Lethargie der Studierenden empfindet sie als geradezu unanständig.
Über die Autorin
Zümrüt Gülbay-Peischard kam mit zwei Jahren als Tochter türkischer Gastarbeiter nach Westberlin. Sie wuchs im Wedding auf, der in Medien oft als »Problembezirk« bezeichnet wird. Sie legte ihr Abitur als Jahrgangsbeste ab, studierte Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft, promovierte mit 25 zum europäischen Wettbewerbsrecht, arbeitete als Rechtsanwältin, später in den USA und Asien sowie als Dozentin an unterschiedlichen Hochschulen. Sie war Mitglied der Islamkonferenz und im Beraterkreis von Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Mit Altkanzlerin Angela Merkel sprach sie über Frauen in Führungspositionen.
Prof. Dr. Zümrüt Gülbay-Peischard
Akadämlich
Warum dieangebliche Bildungseliteunsere Zukunftverspielt
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Anne Büntig
Covergestaltung: Kristin Pang unter Verwendung eines Motivs von © shutterstock.com: Sudarsan Thobias
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7517-7436-9
Sie finden uns im Internet unter luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: lesejury.de
1. Kapitel
Wir haben ein Problem – lassen Sie uns darüber reden
Deutschlands Studierende sind faul, lethargisch, handysüchtig, arrogant, überschätzen sich und haben keine Ahnung davon, was der Arbeitsmarkt von ihnen will. Ihre Selbsteinschätzung steht immer wieder in scharfem Kontrast zu ihren fachlichen und persönlichen Möglichkeiten. Sie beherrschen nicht einmal die Rechtschreibung, wollen aber den Vorstandsvorsitz eines Dax-Konzerns, und zwar hier und jetzt.
Mein Urteil ist hart, und ich habe viele Gründe, es in vollem Umfang zu vertreten. Ein sehr gutes, weitgehend serviceorientiertes und fast vollständig kostenloses Bildungssystem wird von jungen Menschen ausgenutzt und ausgebeutet, und das mit größtem Selbstverständnis und absoluter Selbstverständlichkeit.
Was Studierende alles nicht machen
Studierende sind nicht bereit, sich persönlich zu entwickeln und in einen fachlichen Diskurs zu gehen. Wissen wird nicht dauerhaft erworben, nicht hinterfragt, nicht kritisch beleuchtet, sondern wenn überhaupt – und das ist ein großes »Wenn« – in einer Form von Lernbulimie zur Prüfung gelernt und danach wieder vergessen.
In beinahe jeder Vorlesung können Professoren[1] wieder von vorn anfangen und Grundlagen legen, die eigentlich schon lange vorhanden sein sollten.
Diese jungen Menschen haben ein seltsames Verhältnis zum Lernen. Statt Wissen aufzubauen, wird eine KI wie Chat GPT genutzt und dieser auch vollends vertraut. Die eigene Fähigkeit, das durch die KI Angebotene auch bewerten zu können, wird gar nicht als notwendig erachtet und deshalb nicht erworben. Der Blick über den eigentlichen Lernhorizont hinaus durch vertieftes Wissen wird so praktisch unmöglich. Jeglicher innovativen Arbeit und Entwicklung fehlt damit die Grundlage.
Ursache und Wirkung von Karriere und Erfolg sind für diese Studierenden nicht die Arbeit. Studierende sehen in dem Erfolg von Menschen selten die Arbeit und den Fleiß, die damit verbunden sind. Erfolg scheint etwas zu sein, was einem einfach zufliegt. Es ist eine oberflächliche Betrachtung. Sie sehen die Hülle und nicht den Inhalt. Sie wollen die Hülle, sind aber nicht bereit, für den Inhalt zu arbeiten. Eltern, die es versäumt haben, ihre Kinder zu erziehen, wollen den akademischen Abschluss und den beruflichen Erfolg des geliebten Kindes. Nur haben sie nicht vermittelt, dass vor dem Erfolg die Arbeit steht und dass das geliebte Kind, so wie es ist, eben nicht perfekt ist, sondern etwas tun muss.
Studierenden wird in der Kindheit durch alle Institutionen von der Kita zur Grundschule und zur weiterführenden Schule eine von zu Hause geprägte Anspruchshaltung anerzogen. Fordern statt Tun, Erwarten statt Gestalten, Inanspruchnahme statt Arbeit. Die anderen sollen etwas tun, und man selbst darf und kann etwas wollen. Das führt zu einer fehlenden Selbstreflexion und zu einer Selbstüberschätzung. Das ist eine gefährliche Mischung, die aus Studierenden keine guten Führungskräfte macht. Diese Absolventen haben als Führungskräfte keine Weitsicht und Empathie im Umgang mit ihren Mitarbeitenden und sind mehr am Status als an der Qualität ihrer Arbeit interessiert.
Schlecht erzogene Studierende kennen keine Umgangs- und Kommunikationsformen mehr. Sie sind ärgerliche Gesprächspartner, sowohl schriftlich wie auch im persönlichen Gespräch. Ein konzentrierter, freundlicher und respektvoller Umgang mit den Hochschulmitarbeitenden aller Ebenen, aber auch untereinander besteht kaum noch.
Was Studierende alles wollen
Gegenüber der Hochschule wird eine Anspruchshaltung formuliert wie gegenüber einem Reiseveranstalter. Eigentlich sollte die Hochschule zu jeder Zeit auch für das angemessene Wetter sorgen, damit ein Studieren möglich ist. E-Mails, Telefonate und Gespräche in Sprechstunden sind Kaskaden von sprachlichen Entgleisungen und desaströsen Formulierungen. Man weiß bisweilen nicht, ob man lachen oder weinen soll.
Engagierte Studierende, die gestalten wollen, Verantwortung übernehmen und auch mal mehr machen als das absolute Minimum, sind kleine kostbare Raritäten und wertvolle Sammlerobjekte – so selten, wie sie zu finden sind. Mit viel Glück sind es in einem Jahrgang von 100 Studierenden ein bis zwei. Die Hochschule als Gemeinschaft und Raum für den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Exkurs besteht für die Mehrheit der Studierenden nicht, und sie haben daran auch kein Interesse.
Hochschulen stehen in einem dauernden Wettbewerb um Studierendenzahlen, denn ihre Daseinsberechtigung und die Größe ihres finanziellen Haushalts sind weitgehend abhängig davon, wie viele Studierende sich an dieser Hochschule immatrikulieren, also einschreiben und bleiben. Im Ergebnis werden dann auch Studierende aufgenommen, die nicht an die Hochschule gehören und dann denen, die gefördert und ausgebildet werden sollten, weil sie gut sind, Kapazitäten wegnehmen. Zu viele Abiturienten und Anfänger mit anderen Hochschulzugangsberechtigungen, die mittel bis wenig geeignet und fähig sind, nivellieren Vorlesungen und im Ergebnis dann auch die Prüfungen.
Die Hochschulen sind zunehmend weniger in der Lage, die geforderten Topkräfte für den Markt auszubilden. Die Ursache liegt nicht bei den Hochschulen. Das System würde die Entdeckung und Förderung von guten Studierenden immer ermöglichen, es gibt keine systemimmanente Unterdrückung oder Verdrängung. Es gibt einfach zu wenige sehr gute bis gute Studierende. Und die, die durchschnittlich geeignet sind, sind leider häufig unterdurchschnittlich motiviert, etwas zu tun und sich zu entwickeln.
Der Anspruch auf akademische Bildung oder eher der Anspruch auf einen entsprechenden Abschluss, wird als individuelles Recht verstanden, das fast keiner Gegenleistung bedarf. So etwas wie Dankbarkeit und Bewusstsein gegenüber der Gesellschaft ist nicht vorhanden. Dieses Selbstverständnis besteht auch gegenüber den gesellschaftlichen Freiheiten einer Demokratie, und deshalb wird dafür genauso wenig gemacht wie für die eigene geistige Weiterbildung.
Politische Informiertheit und Wissen über aktuelle Entwicklungen sind rudimentär und werden selten durch digitale oder analoge Nachrichten erlangt. Was die eigene kleine Welt der sozialen Medien nicht zeigt, existiert nicht, und was gezeigt wird, existiert nur in der einfachen Wahrheit der sozialen Medien. Und diesen Horizont hätten Studierende gerne auch in der Wissensvermittlung. Kurz, prägnant und leicht zu konsumieren. Die Vorlesung als TikTok-Video. Das Lesen und das sich Erarbeiten von schweren Inhalten wird gemieden, und das ist bei Weitem kein rein deutsches Phänomen. Die Autorin Rose Horowitch schreibt in ihrem Beitrag »The elite college students who can’t read books« von den Erfahrungen einiger meiner amerikanischen Kollegen zum Beispiel an der renommierten Columbia University, deren Studierende sogar zugeben, noch nie ein Buch gelesen zu haben.[2]
Bedauerlicherweise akzeptieren auch manche Professoren diesen Zustand und finden einen Weg, sich mit dieser Situation zu arrangieren. Schlechteren Leistungen und geringer Leistungsbereitschaft wird mit niedrigen Anforderungen in den Prüfungen entsprochen, schlechtes Benehmen wird ignoriert. Der so verständnisvolle Professor ist der freundliche und nette, der sich vielfach gute Evaluationsergebnisse sichern kann, während derjenige, der Leistung verlangt und keine Noten verschenkt, sich für seinen Arbeitsanspruch immer wieder rechtfertigen muss.
Die Lehre an deutschen Hochschulen hat sich verändert und musste sich vielen Anforderungen stellen. Weniger Geld, eine komplexere Hochschullandschaft, schwierige Studierende und Konkurrenz durch private Hochschulen, die jedem einen Abschluss versprechen, sind nur einige dieser Anforderungen. Es gibt Lehrende, die sich diesen Herausforderungen mit Engagement stellen.
Die Arbeit wird nicht einfacher durch Studierende, die dieses Engagement entweder als Selbstverständlichkeit oder als Störfaktor auf dem Weg zur Abwicklung des Studiums mit dem nur nötigsten Arbeitsaufwand wahrnehmen, auch aus einer Haltung heraus, dass der Lehrende schließlich Geld bekommt und dafür zu Diensten sein soll. Dafür soll er etwas tun, aber bitte nicht stören und keine Leistung verlangen. Aber weil die deutsche Hochschullandschaft durch öffentliche Gelder finanziert ist, um aus jungen Menschen Akademiker zu machen, sollte eine akademische Ausbildung fordernd sein, immer wieder auch mit klaren Ansagen und Äußerungen. Wer das nicht aushält, wird es später schwer haben im Leben und hat an der Hochschule nichts zu suchen.
Natürlich können zahlreiche Fälle angeführt werden, wie schwierig und entbehrungsreich, wie anstrengend und belastend die Erlangung akademischer Grade für einen Menschen war, aber das soll es auch sein. Dieser Abschluss soll die Zugehörigkeit zu einer Leistungs- und Bildungselite zeigen und nicht Ausdruck dafür sein, wer sich am besten durch das Studium laviert oder sich ein- und durchgeklagt hat.
Die Ignoranz und die Lethargie der Studierenden sind nervig und geradezu unanständig. Und hierbei handelt es sich nicht um das allgemeine Wehklagen einer älteren Generation gegenüber der jüngeren. Es geht nicht um das übliche Generationen-Bashing. Mir sind die Bezeichnungen, ob X, Z oder Alpha, und die Frage, ob überhaupt in diesen Generationenbegriffen gedacht werden sollte, herzlich gleichgültig. Ich sehe eine Entwicklung, die in einer Bildungsmisere enden wird und der Wirtschaft noch weniger gute Arbeitskräfte anbieten kann als bisher.
Auch gute Studierende und auch jüngere Professoren und Professorinnen sind von den Ansprüchen und der Motivationslosigkeit der Studierenden abgeschreckt. Es gibt einige Studierende, die sich die Frage stellen, warum bestimmte andere Kommilitonen überhaupt an der Hochschule sind, wie zum Beispiel Geena Gamradt in ihrem Beitrag »Warum studieren so viele Leute, die eigentlich keinen Bock auf Uni haben?« für die Stern-Community.[3] Sie spüren und merken, wann es nicht weitergeht und es eigentlich weitergehen sollte, weil Rücksicht genommen wird auf die eigentlich zu schwachen in der Gruppe. Ich beobachte jüngere Kolleginnen und Kollegen, die nach einigen Jahren an der Hochschule bereits zynisch und abgebrannt sind und sich weitere Betätigungsfelder außerhalb der Hochschule gesucht haben. Der Job bringt dann das Geld, aber nicht die inhaltliche und menschliche Bestätigung.
Besser als der Ruf
Das Bildungssystem in Deutschland ist in nahezu allen Bereichen besser, als es besprochen wird. Es gibt einen guten strukturellen Bestand. Ohne Frage gibt es die Notwendigkeit von infrastrukturellen Maßnahmen, aber das deutsche Bildungswesen hat Qualität. Natürlich sehe ich auch die Fehler und Risse im System. Eine öffentliche Hochschule in Deutschland lässt sich nicht vollständig mit akademischen Ausbildungen in anderen Ländern vergleichen. In den meisten Ländern dieser Welt ist ein solch umfassendes Angebot zur akademischen Ausbildung ohne eine wesentliche eigene Kostenbeteiligung gar nicht möglich. Um es ganz deutlich zu sagen: Eine Ausbildung bis zur Promotion ist in Deutschland kostenfrei möglich und wird vielfach finanziell gefördert. Das gilt auch für einen zweiten und dritte Bildungsweg bis zum akademischen Titel.
Auf allen Ebenen gibt es in Deutschland gut ausgebildete und engagierte Lehrende. Deutschland verfügt über ein sehr gutes Lehrpersonal und Lehrumfeld. Die Professoren bieten zu einem großen Teil engagierte und inhaltlich anspruchsvolle Vorlesungen an und scheitern dann an dem Niveau der Studierenden. Die Studierenden betrachten gut ausgestattete Lehrräume, Bibliotheken und jederzeit zur Verfügung stehende teure Datenbanken wie auch Soft- und Hardware, Labore und weitere Arbeitsbereiche als völlig selbstverständlich. Diese Ausbildung wird ihnen von der Gemeinschaft der Menschen, die Steuern zahlen, finanziert und damit haben sie – die Studierenden – dieser Gesellschaft ein Versprechen auf das Solidarsystem der Zukunft gegeben. Dieses Verständnis vom eigenen Beitrag zum Solidarsystem ist vergessen oder war niemals vorhanden.
Gerne werden von den Kritikern des deutschen Bildungssystems die sinkenden Zahlen der sozialen Mobilität angeführt, um zu zeigen, wie wenig wir funktionieren. Die soziale Mobilität wird seit vielen Jahren in Deutschland empirisch erfasst und wissenschaftlich erforscht. Ein Beispiel hierfür sind die Forschungen zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Mit der sozialen Mobilität wird beschrieben, wie Menschen durch einen Bildungs- und Ausbildungsabschluss einen sozialen Aufstieg erlangen. Diese Zahlen sind rückläufig, aber meines Erachtens nicht allein zu begründen mit einem Verweis auf ein vermeintlich nicht funktionierendes Ausbildungssystem. Es ist nicht so, dass nur gesellschaftliche Schranken und Hindernisse den Zugang zur Bildung verwehren. Manche wollen einfach nicht an den Möglichkeiten des Bildungsangebotes teilhaben. Deutschlands Bildungssystem hat keine Klassengesellschaft, die bestimmten sozialen Schichten einen Zugang verwehrt. Deutschland hat aber in allen sozialen Schichten Jugendliche, die lieber Influencer und Youtuber werden wollen, als zur Schule zu gehen.
Dieses Buch basiert nicht auf einem singulären Eindruck aus einer Hochschule. Nach mehr als 30 Jahren Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten wie auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften im In- und Ausland sind meine Erfahrungen nicht nur einem Hochschultyp zuzuordnen und weder spezifische Ost- noch Westerfahrung. Der von mir beschriebene Studierende ist an allen Hochschulen zu finden.
Ich liebe meine Arbeit und stehe den Studierenden unablässig mit großer Sympathie und Engagement gegenüber. Junge Menschen sind spannend, eine Professur ist abwechslungsreich und herausfordernd, und der Inhaber einer solchen Stelle ist privilegiert und geschützt. Ich schreibe nicht als frustrierte Mittfünfzigerin mit Sendungsbewusstsein. Die Entwicklung, die ich beobachte, macht mir Sorgen.
Fehlende Leistungs- und Leidensbereitschaft der Studierenden, denen das Bewusstsein für das Privileg einer höheren Bildung fehlt, sind wesentliche Gründe für die Bildungsmisere in Deutschland. Statt der geforderten Topkräfte bilden wir immer mehr Durchschnittsakademiker mit Durchschnittsfähigkeiten aus. Die akademische Ausbildung als Regelausbildung wird Deutschland nicht voranbringen. Dabei entstehen nicht die zukünftigen Topkräfte, die der Arbeitsmarkt braucht und die unseren Wohlstand sichern.
Ich weiß, was kommen wird
Ich erwarte eine öffentliche Kritik an meiner Person und an meiner Arbeit als Reaktion auf dieses Buch. Schließlich kritisiere ich etwas, woran ich selbst beteiligt bin. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dieses Buch wirklich schreiben soll. Meine Eltern haben mich gelegentlich ermahnt mit dem Satz: »Herşeye maydanoz olma!« Wörtlich übersetzt heißt es, sei keine Petersilie zu allem, gemeint ist, nicht zu allem eine Meinung zu haben und zu äußern. Zum Zustand der aktuellen Bildungslandschaft aber habe ich eine Meinung und will die Petersilie sein.
Dieses Buch soll in Deutschland eine Debatte anstoßen über unsere gemeinsame Verantwortung. Lassen Sie uns reden.
2. Kapitel
Wie ich eine Professorin wurde
Als ich die Zusage des Verlages für dieses Buch erhielt, musste ich kurz innehalten. Das Arbeiterkind aus dem Berliner Wedding würde sich also mit einem Buch zur Bildung an Deutschland wenden. Wer hätte das gedacht? Es war nicht unbedingt absehbar, dass ich diese Karriere mache. Meine Ausgangsbedingungen waren nicht optimal. Ich habe mit viel Arbeit und einiger Unterstützung meinen Platz in der Bildungslandschaft gefunden und ich glaube fest daran, dass das auch vielen anderen gelingen kann, wenn sie bereit sind, sich einzubringen und sich auf das Abenteuer Bildung einzulassen.
Ist jede Form von Arbeit inhuman?
Manchmal schaffe ich es tatsächlich, eine ganze Gruppe im Vorlesungssaal zu motivieren, sich an einer Diskussion zu beteiligen. In einer Vorlesung zum Arbeitsrecht ging es um Arbeitszeiten und den hierzu bestehenden gesetzlichen Schutztatbeständen. Die Begrenzung von Überstunden brachte uns zu der Frage, wie viel ein Mensch denn arbeiten kann. Es fiel der Satz, dass zu viel Arbeit inhuman sei.
»Ein interessantes Argument, meine Damen und Herren, lassen Sie uns darüber reden«, war mein Vorschlag, und ich fragte nach einer Definition für »inhuman«. Wir trugen also zusammen, dass von inhuman geredet werden kann, wenn Regulierungen und Forderungen menschliche Gesichtspunkte völlig außer Acht lassen. Daraufhin sagte eine Studentin: »Dann ist doch aber jede Form von Arbeit inhuman, oder?« »Also sollten Menschen gar nicht arbeiten in einer humanen Gesellschaft?«, war meine Gegenfrage. »Ja, ich denke schon. Arbeit liegt doch keinem Menschen.« Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen.
Ist Arbeit wirklich etwas so Furchtbares, dass daraus das Gegenteil von menschlich wird? Ähm, eigentlich nein, also versuchte ich einen neuen Ansatz. Zunächst einmal verwies ich auf Untersuchungen der OECD, wonach eine Gesundheitsgefährdung erst ab einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 50 Stunden festzustellen ist. Dann erzählte ich von einer Zeit in meinem Leben, in der ich fast drei Jahre lang, vor dem Ersten Staatsexamen und bis zum Abschluss meiner Promotion, jeden Tag gearbeitet habe und nicht einen Tag frei hatte oder ausgegangen bin. Es war hart und anstrengend und widerspricht auch bestimmt meiner gemütlichen Grundnatur, aber ich habe diese Zeit dennoch genossen und gewusst, dass ich mich auf einem erfolgreichen Weg befinde. Diese Situation war mir persönlich nie inhuman vorgekommen.
Ein Student meinte daraufhin mit einem leicht süffisanten Lächeln: »Und dann sind Sie bei all der Arbeit nur Professorin geworden?« Er hatte die Lacher auf seiner Seite. Ein inhumanes Leben mit viel Arbeit und keinem ausreichend erfolgreichen Status. Ich wurde auch schon mal charmanter beschrieben. Mir zeigte seine scherzhafte Anmerkung jedoch eine versteckte zweite Ebene. Wer so viel wie ich gearbeitet hat und nur ein Professorengehalt verdient, hat etwas falsch gemacht im Leben. Arbeit und vor allem viel Arbeit muss mit einem größeren messbaren finanziellen Erfolg und dem entsprechenden Status einhergehen. So sehe ich das nicht.
Wie es anfing
Ich bin im Alter von 28 Jahren Professorin für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Anhalt in Sachsen-Anhalt geworden, wo ich heute noch hauptamtlich arbeite. Mein Alter, meine Herkunft und mein Werdegang haben damals viele Medien und Menschen in verschiedenen Positionen interessiert. Ich bin für einige Projekte angefragt worden und habe interessante Sachen gemacht. Ich war Mitglied der Islamkonferenz des damaligen Bundesinnenministers Dr. Wolfgang Schäuble, ich war im Beraterkreis des Bundesfinanzministers Peer Steinbrück, und ich habe mich auch in verschiedenen Veranstaltungen bei den Grünen und in der Frauenunion der CDU engagiert.
Als eine junge Frau mit einem türkischen Migrationshintergrund war ich der Beweis für ein erfolgreiches Bildungssystem in Deutschland. Ich wurde auch angefragt, ob ich ein Buch zur Bildung in Deutschland schreiben möchte, das habe ich damals abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich für eine solche Aufgabe nicht bereit. Ich hätte es als anmaßend empfunden, denn mir hatte das Bildungssystem in Deutschland einen sozialen Aufstieg ermöglicht, und ich war eine Nutznießerin dieses Systems des freien Zugangs zur Bildung. Für einen kritischen Blick darauf fehlten mir seinerzeit die notwendigen umfassenden Erfahrungen als Gestaltende und Mitwirkende in diesem System. Das ist jetzt anders.
Hallo Deutschland
Ich bin ein Gastarbeiterkind. Aufgewachsen im Berliner Wedding. Wenn ich morgens um halb acht zur Schule gegangen bin, waren die zwei Kneipen in unserer Straße schon auf, und das Bier wurde ausgeschenkt. Meine Eltern haben in Fabriken gearbeitet. Mein Vater im wöchentlichen Drei-Schicht-Betrieb in einer Schokoladenfabrik in Berlin Neukölln und meine Mutter am Akkordfließband bei Siemens. Sie haben zunächst keinen Gedanken daran verschwendet, wie sie sich in Deutschland integrieren können. Sie gehörten zur ersten Generation, die eigentlich nach ein paar Jahren in Deutschland auch wieder zurückkehren wollten. Mit den Jahren ist meinen Eltern bewusst geworden, dass eine Heimkehr und Rückkehr als Familie nicht geschehen würde, denn ihre vier Mädchen waren hier in Deutschland zu Hause. Erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt in ihrem Leben ging es für sie allein wenigstens teilweise zurück in die Heimat.
Für meine Eltern muss es unglaublich schwierig gewesen sein, darüber geredet haben wir leider nicht. Ihr Spagat zwischen der eigenen Kultur, mit der sie aufgewachsen waren und die für sie Maßstab und Orientierung war, und den vier Mädchen, die aus der Schule mit vielen anderen Ideen und Lebensmodellen nach Hause kamen. Es war ein immer schwelender und nicht lösbarer Konflikt zwischen dem, was wir Mädchen wollten, und dem, was meine Eltern akzeptieren konnten.
Bis ich zur Schule gegangen bin, konnten weder meine Eltern noch ich richtig deutsch sprechen. Nachdem ich mit drei Jahren mit meiner Schwester, die zwei Jahre alt war, und meinem Vater meiner Mutter, die schon über ein Jahr in Deutschland war, nachgereist bin, haben wir weitgehend ohne einen Kontakt zu den Deutschen in einer rein türkischen Parallelgesellschaft gelebt. Erst als ich in der Schule anfing Deutsch zu lernen, lernten es meine Eltern auch. Meine Eltern stammen beide aus Familien, in denen eine höhere Bildung für sie nicht möglich war. Beide haben früh angefangen zu arbeiten und die Familie zu unterstützen. Auch in Deutschland haben sie über eine eigene berufliche Weiterbildung nicht nachgedacht. Dafür waren sie auch nicht geholt worden. Ihre vier Töchter, mit mir als der ältesten, sollten jedoch alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wir sollten Abitur machen, was drei von uns vieren auch gelungen ist.
Die körperlich harte Arbeit hat meinen Eltern nicht viel Kraft und Zeit gelassen, sich mit uns vier Mädchen zu beschäftigen und uns zu fördern. Wir mussten funktionieren, und die Schule durfte zu Hause keine Probleme machen. Sie hatten am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, keine Ausbildung zu haben. Also trieben sie uns an. Uns wurde immer wieder eingeschärft, etwas aus unserem Leben zu machen, die Schule zu nutzen und erfolgreich zu sein. Meine Eltern haben Fleiß, Disziplin und Engagement verlangt und auch bekommen. Etwas anderes blieb uns gar nicht übrig.
Im Nachhinein ist mir bewusst, wie anders meine Eltern im Vergleich zu vielen anderen Eltern aus Gastarbeiterfamilien waren. Weil die Rückkehr in die Heimat zunächst das Ziel von allen war, war die deutsche Schulbildung der Kinder zunächst nicht wichtig. Auch weil sie selbst vielfach eine sehr geringe Schulbildung hatten, haben sie sich nicht um die Bildung ihrer Kinder bemüht und wurden auch nicht darin durch irgendwen oder irgendwie bestärkt oder unterstützt. Eine echte Integrationspolitik gab es damals nicht.
Zu der Zeit habe ich nur gesehen, unter welchem Druck ich stand. Ich musste verstehen und lernen, dass es wenig Unterstützung durch meine Eltern gab, aber eine ständige Forderung nach Erfolg. Hilfe bei den Hausaufgaben, meine Eltern als Elternvertreter oder anderweitig engagiert in der Schule war nicht machbar. Wir vier haben nur dann Reaktionen bekommen, wenn die Noten schlecht waren oder wir etwas angestellt hatten. Auch dann gab es keine langen Gespräche, wertschätzenden Hilfestellungen oder Diskussionen. Im Zweifel wurde man bestraft und musste die Sache ausbügeln.
Meine Rettung war damals das Lesen. Ich habe alles gelesen, was die Jerusalem Bibliothek im Wedding hergab. Meine Eltern wussten zwar selten, was ich las, waren aber glücklich, wenn sie mich mit einem Buch irgendwo entdeckten.
Ich hatte meistens kein Frühstück zu Hause, weil wir uns selbst darum kümmern mussten, uns für die Schule fertig zu machen. Meine Mutter ist um halb sechs aus dem Haus gegangen, und mein Vater war entweder aus der Nachtschicht noch nicht zu Hause oder ebenfalls schon unterwegs zur Arbeit. Wie viele andere Kinder damals auch habe ich in der Toilette am Wasserhahn meinen Durst gelöscht und nach der Schule zu Hause das erste Mal am Tag etwas gegessen.
Ich konnte aber sehen und beobachten, wie gut es andere, vor allem deutsche Kinder hatten. Ich habe diese Kinder heiß und innig beneidet, deren Mütter und Väter nachmittags bei den Hausaufgaben dabei waren und denen die vergessenen Schulbücher oder Hausaufgaben in die Schule nachgebracht wurden. Vorbereitete Pausenbrote und Snacks nach einem reichhaltigen Frühstück haben diese Kinder durch den anstrengenden Schultag gebracht. So was gab es bei uns nicht. Eine Mitschülerin wurde von ihrer Mutter jeden Morgen bis zur Schule gebracht, obwohl sie nur zwei Straßen weiter wohnte. Auf dem Weg ging es für sie zum Bäcker, und sie durfte sich jeden verdammten Morgen aussuchen, was sie gerne in der Schule essen wollte. Es ist schon erstaunlich, welche Erinnerungen sich festsetzen. Dann war sie auch noch im Rollschuhverein, und einmal zeigte sie in einem echten Glitzerkostüm ihre Kür im Sportunterricht. Mein Neid auf sie kannte keine Grenzen.
Viele Jahre später bei einem Klassentreffen der Grundschule konnte ich ein Gefühl von Genugtuung nicht unterdrücken. Ich bin auch nur ein Mensch und habe auch dunkle Seiten. Sie war nach einem gescheiterten Abitur Fachverkäuferin für Wurst- und Fleischwaren geworden. Ein ehrenwerter Beruf, keine Frage, und viele leere Theken in Supermärkten zeigen, wie dringend diese Fachkräfte gebraucht werden. Dennoch fühlte ich mich ehrlicherweise sehr gut. Viele dieser besonders geförderten und gepamperten Kinder aus meiner Jugend haben das Engagement ihrer Eltern nicht mit ruhmreichen Karrieren zurückgezahlt.
Für mich bedeuteten die prekären finanziellen Verhältnisse zu Hause, dass ich mit 16 neben der Schule gearbeitet habe. Einmal in der Woche nachmittags und jeden Samstag habe ich in einem Jeansladen verkauft und vor der Ladenöffnung ab fünf Uhr morgens Ware ausgeladen und einsortiert. Nach Ladenschluss habe ich alle Spiegel im Geschäft geputzt und bin dann nach 14 Stunden Arbeit nach Hause gefahren. Das mit dem Arbeitsschutz war damals für Aushilfen nicht wirklich ein Thema.
Durch das Abitur zum Jurastudium
Trotzdem konnte ich ein gutes Abitur machen und habe dann angefangen, Jura und BWL zu studieren. Nach sieben Semestern war ich im Ersten Staatsexamen, habe gleich danach mit meiner Dissertation begonnen und war nach insgesamt sechs Jahren, nachdem ich das erste Mal einen Hörsaal der Freien Universität in Berlin betreten hatte, fertig promovierte Juristin mit beiden Staatsexamen.
Ich habe das vielen glücklichen Momenten und der Unterstützung von tollen Menschen zu verdanken, aber eben auch meinem Fleiß und Ehrgeiz. Bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe, können Psychologen meinen Anspruch, den ich an Studierende habe, bestimmt mit einer sehr klugen und berechtigten Erklärung in Verbindung bringen. Ich kann nur meine Erfahrungen nehmen und versuchen, diese angemessen als Anforderungen an die heutige junge Generation zu übertragen. Bildung ist machbar und kann vieles ermöglichen. Ich glaube fest daran.
Zu Beginn meiner Studierendenzeit bin ich zu Hause ausgezogen, auch weil ich einen deutschen Freund hatte und die dauerhafte Auseinandersetzung mit meinen Eltern nicht mehr ertrug. Finanzielle Unterstützung von meiner Familie habe ich nie erhalten, ich musste mich allein finanzieren. Im Ergebnis bedeutete das eine dauerhafte Suche nach gut bezahlten Jobs. Ich erlebte als Studierende die Wiedervereinigung und die Weiterbildungsgesellschaften, die dann im ehemaligen Ostberlin wie Pilze aus dem Boden schossen und viele Dozenten für Recht brauchten. So kam ich an meine ersten Lehrjobs und habe praktisch mein gesamtes Erstes Staatsexamen mit Umschulungsmaßnahmen finanziert.
Mit meinem Ersten Staatsexamen in der Tasche habe ich durch eine Empfehlung im März 1994 eine Probevorlesung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin halten dürfen, und der damalige Rektor hat mir eine Chance gegeben und mir einen Lehrauftrag über eine Rechtsvorlesung in einer Abendveranstaltung angeboten. Meine erste Vorlesung an einer Hochschule mit 24 Jahren.
Die Studierenden dieser Lehrveranstaltung waren zumeist in festen Arbeitsverhältnissen und haben von Montag bis Freitag von 18 bis 21 Uhr Vorlesungen besucht, um neben der Arbeit einen akademischen Abschluss zu erlangen. Mit meinem Ersten Staatsexamen und frisch von der Uni war ich in einer völlig anderen Lebenssituation und daher auch als Dozentin fast die Jüngste unter insgesamt 44 Studierenden. Der Kurs hat mich nicht abgeschreckt und mir einiges beigebracht. Die Teilnehmenden waren ehrgeizig und hartnäckig und haben viel aufgewandt, um einen akademischen Abschluss zu schaffen. Auch ihre Einstellungen haben ein Stück weit meinen Anspruch an Studierende geprägt. Mittlerweile habe ich über 60 Semester an Hochschulen gearbeitet und bin seit über 26 Jahren hauptamtliche Professorin.
Was macht eine Professorin?
Professoren haben in Deutschland zwei Tätigkeitsbereiche. Sie sollen lehren und forschen oder forschen und lehren. Die Reihenfolge folgt der individuellen Schwerpunktsetzung, und bereits das ist ein Privileg. Forschende Kollegen haben Freiheiten und Unterstützung in der Forschung, und lehrende Kollegen haben die Freiheit und Unterstützung in der Lehre. Beide Bereiche der Tätigkeit sind verfassungsrechtlich geschützt, und die meisten Kollegen sind sich ihrer Aufgabe in der Gesellschaft bewusst.
Das Klischee des Professors, der nur wenige Tage an der Hochschule anzutreffen ist und sich kaum in der Lehre engagiert, kann ich nur in sehr wenigen Kollegen wiederfinden. Die meisten Kollegen haben sich sehr bewusst unter Ausschluss besser bezahlter Jobs in der freien Wirtschaft für eine Arbeit an der Hochschule entschieden. Sie wollen mit jungen Menschen arbeiten, forschen und die Hochschule weiterentwickeln. Natürlich gibt es sie – die, die den Status genießen, ein professorales Umfeld wollen, zu wenig tun und zu viel reden, und wie eben auch die Studierenden die sind, die unsere Hochschullandschaft nivellieren. Sie sind aber nicht die Mehrheit der Kollegen, zum Glück.





























