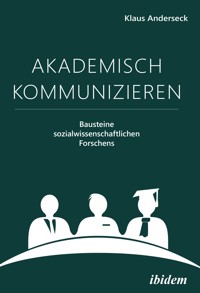
14,99 €
Mehr erfahren.
Die vorliegende Einführung vermittelt wesentliche Eigenheiten der akademischen Kommunikation am Beispiel der Wirtschaftswissenschaften und angrenzender Wissenschaften. Der Aufbau des Buches ist dabei vom Leitziel wissenschaftlichen Lernens bestimmt: Nach einer Einführung in den Umgang mit Begriffen, Definitionen und Theorien führt der Weg vom Schema der wissenschaftlichen Erklärung über Ziel-Mittel-Systeme bis hin zum Werturteilsstreit in den Sozialwissenschaften. Der zweite Teil greift diese Inhalte auf und vermittelt Anleitungen zum wissenschaftlichen Arbeiten. Er zeigt die einzelnen Schritte einer wissenschaftlichen Untersuchung von der Themensuche über die Durcharbeitung bis zum abschließenden Bericht auf. Im dritten Teil folgt eine kurze wissenschaftsphilosophische Ergänzung mit einer Einführung in das moderne Wissenschaftsverständnis und mit einem Exkurs über das zwar ungelöste, im wissenschaftlichen Argumentieren aber immer noch durchscheinende Universalienproblem. Ergänzend finden sich noch wertvolle Hinweise zum Aufbau einer akademischen Arbeit, zur Vermeidung von Fehlern und zum korrekten Zitieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
1 Einleitung und Lehrziele des Kurses
1.1 Regelsysteme des wissenschaftlichen Arbeitens
1.2 Welche Handlungsstrategien vermittelt das Buch?
1.3 Anmerkungen
2 Grundlagen der Forschung
2.1 Was heißt „forschen“?
2.2 Wissenschaftliche Vorgehensweisen
2.2.1 Das Ursache-Wirkungs-Schema: Erklärung, Prognose, Technologie
2.2.2 Das Ziel-Mittel-Schema
2.2.3 Wissenschaftliche Aussageebenen
2.2.4 Definitionsverfahren
2.3 Der Forschungsprozess
2.3.1 Problemfindung und Problemformulierung
2.3.2 Aufstellung des Forschungsplanes
2.4 Exkurs: Strukturierung einer Untersuchung
2.4.1 Checkliste zur Vorgehensweise
2.4.2 Korrektes Zitieren
2.4.3 Häufige Fehler in der Konzeption
3 Wissenschaftsphilosophische Grundfragen
3.1 Das Spannungsverhältnis von Theorie und Realität
3.2 Das Universalienproblem
4. Ergänzungen
4.1 Musterlösungen (Lösungsvorschläge)
4.2 Literaturverzeichnis
4.2.1 Zitierte Literatur
4.2.2 Ergänzende und weiterführende Literatur
1 Einleitung und Lehrziele des Kurses
1.1 Regelsysteme des wissenschaftlichen Arbeitens
Sehr geehrte Leserinnen und Leser! Mit Ihrer Einschreibung in eine Universität begeben Sie sich in eine Institution, deren bestimmendes Merkmal die Wissenschaftlichkeit der von ihr vorrangig zu erledigenden Aufgaben ist. Die Einhaltung dieser Grundverfassung ist durch zwei ineinandergreifende Regelsysteme bestimmt, von denen das eine administrativ und das andere kommunikativ verfasst ist. Administrativ unterliegen staatliche Universitäten den Hochschulgesetzen des jeweiligen Bundeslandes. Diese Gesetze geben Rahmenbedingungen vor, deren Ausgestaltung in die Selbstverwaltung der Universitäten gelegt ist. Dazu gehören zuvörderst die Aufgaben der Universitäten. Hierzu heißt es z. B. in § 3 des Hochschulgesetzes NRW (HG-NRW):1
„(1) Die Universitäten dienen der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre, Studium, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Wissenstransfer (insbesondere wissenschaftliche Weiterbildung, Technologietransfer).(…) Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten im In- und Ausland vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern. Sie gewährleisten eine gute wissenschaftliche Praxis“.
Der § 4 HG stellt unter Bezugnahme auf Artikel 5 des Grundgesetzes die Freiheit in Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium sicher, die ihre gesetzliche Grenze in der Treue zur Verfassung findet. Insbesondere haben nach § 4 HG die Wissenschaftler „die Freiheit, wissenschaftliche Meinungen zu verbreiten und auszutauschen“. Die Wissenschaftsfreiheit ist ein sehr starkes Privileg, nach dem grundsätzlich jeder Wissenschaftler die in seiner Tätigkeit gewonnenen Ansichten und Erkenntnisse unzensiert vertreten darf, auch wenn sie sich als „irrig oder fehlerhaft erweisen“. Sie müssen allerdings wissenschaftlich sein, „darunter fällt alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung von Wahrheit anzusehen ist“.2 Damit hier keine Beliebigkeit und kein Wildwuchs entstehen und man sich untereinander verständigen kann, greift das kommunikative Regelsystem. Dessen Repräsentant ist die Gemeinschaft der Wissenschaftler eines Faches und darüber hinaus im Wissenschaftsbereich allgemein, genannt: die Scientific Community.
„Innigste Gemeinschaft aller Kenntnisse, scientifische Republik, ist der hohe Zweck der Gelehrten.“(Novalis 1798)
Die Betonung der gesetzlichen Vorgaben liegt auf wissenschaftlich. Dass hat seinen Grund darin, dass die Wissenschaften als der Ort der effizientesten Produktion von neuem und vor allem von gesichertem Wissen gelten. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden als glaubwürdig und damit als verlässliche Basis für das Erfassen eines Sachverhaltes aber auch für Entscheidungen und Handlungen eingeschätzt.
Warum aber wird der wissenschaftlichen Erkenntnis ein so hoher Rang an Glaubwürdigkeit eingeräumt? Auf jeden Fall nicht deshalb, weil die Wissenschaftler, vor allem die Professoren, etwa mit einer besonderen Fähigkeit zur Welterkenntnis ausgestattet wären, sondern weil sie sich verpflichten, bei ihrer Tätigkeit strengen methodischen Prinzipien zu folgen. Diese Prinzipien sind Gemeingut der Scientific Community einer wissenschaftlichen Disziplin. Sie haben sich in der Forschungspraxis der Disziplin herausgebildet und beruhen, wie der Schweizer Philosoph Jean PIAGÉT es ausdrückt, auf einem „gentlemen agreement“.6 Sie sind, in den Worten der Philosophin Elisabeth STRÖKER „durch die reglementierte Forschungspraxis sanktioniert (..), so daß etwa derjenige, der sie verletzt, Gefahr läuft, von seinen Kollegen nicht ernst genommen, übergangen oder in eine Außenseiterrolle gedrängt zu werden“.7 Das kann durchaus auch zu einem Konflikt mit der grundgesetzlich gesicherten Freiheit der Wissenschaft führen.8
Die Entscheidung, sich einem Gegenstand wissenschaftlich zu nähern, hat also die Konsequenz, dass sich die Forschungstätigkeit an den in der Scientific Community einer Disziplin geltenden Konventionen ausrichten muss, z. B. über die Definition und den Gebrauch von Begriffen, über die Zulässigkeit verschiedener Formen von Aussagen und Theorien und über die Anwendungsmodalitäten wissenschaftlicher Methoden.
Wie wird man nun zum Angehörigen der Scientific Community? Da sie keine formale Organisation ist, gibt es auch kein formales Aufnahmeverfahren, sondern die Zugehörigkeit definiert sich über die Ausübung einer Forschungstätigkeit und über die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. Beides sind zwar notwendige aber noch keine hinreichenden Bedingungen. Hinzukommen muss noch die Akzeptanz der Tätigkeit als Forschung und die Akzeptanz der damit gewonnenen Erkenntnisse als wissenschaftlich gültig und vertrauenswürdig. Darüber entscheidet die Scientific Community im Rahmen der Selbstkontrolle in disziplinöffentlichen Diskussionen und in Bewertungen der Forschungsergebnisse, die vor allem in Zeitschriften und auf Tagungen und Symposien stattfinden. Der Wissenschaftler muss sich der Kritik der Kollegen und Kolleginnen in seiner Disziplin stellen, und die kann manchmal recht heftig sein.9 Diesem kommunikativen Verfahren liegt kein rechtlich fixierter Kriterienkatalog zugrunde, sondern in den einzelnen Disziplinen ist es im Laufe der Zeit zu einer Übereinkunft darüber gekommen, welches Vorgehen in einer Disziplin als wissenschaftlich gilt und welche Forschungsbereiche zu einer Disziplin gehören. Dieser Konsens funktioniert als Bewertungsinstrument erstaunlich gut,10 und er wird auch von einer Wissenschaftlergeneration zur anderen weitergegeben.
Damit sind wir beim zentralen Anliegen dieses Buches angelangt. Sie, die Leserinnen und Leser, sollen einige der grundlegenden wissenschaftlichen Vorgehensweisen kennenlernen. Die Beispiele stammen aus den Wirtschaftswissenschaften, sie sind aber nicht auf diesen Bereich begrenzt, denn da die Wirtschaftswissenschaften zu den Sozialwissenschaften gezählt werden, lassen sich alle Darlegungen auf diesen Bereich ausweiten und umgekehrt. Wo es passt, werden auch Ausführungen zu allgemeinen Wissenschaftsfragen eingebunden. Darüber hinaus soll der Inhalt auch ein Stück Allgemeinbildung für Sie sein und Ihnen, es wäre zu wünschen, ein intellektuelles Vergnügen bereiten.
1.2 Welche Handlungsstrategien vermittelt das Buch?
Der Aufbau des Buches wird von dem Leitgedanken des forschenden Lernens bestimmt. Dessen Grundidee ist es, die Fähigkeit der Studierenden zu fördern, sich Kenntnisse und Methoden eines Wissensgebietes eigenständig verfügbar machen und weiter entwickeln zu können, didaktisch formuliert: selbstbestimmtes Lernen zu stimulieren und die Kommunikationsfähigkeit wissenschaftssprachlich zu fundieren. Dem folgend liegen der Abhandlung zwei übergreifende Lehrziele zugrunde.
Das erste Lehrziel beinhaltet die Beschäftigung mit grundlegenden Formen des wissenschaftlichen Denkens und Handelns, d. h. Wie funktioniert Forschung? Damit sind gleich mehrere Absichten verbunden. Zunächst sollen Ihnen die erworbenen methodischen Kenntnisse das Verständnis der Inhalte der fachwissenschaftlichen Literatur erleichtern und sie sind ein Instrumentarium, das Sie als Positionsrahmen für Ihre eigenen wissenschaftlichen Arbeiten verwenden können. Außerdem stellt dieses Wissen ein Denksystem bereit, das häufig auch für alltägliche Problemlösungen herangezogen werden kann.
Das zweite Lehrziel betrifft das Handwerkszeug des wissenschaftlichen Arbeitens. Sie werden in die Anlage eines Forschungsprojektes eingeführt und mit den einzelnen Schritten vertraut gemacht werden. Die Abhandlung bietet darüber hinaus Hinweise zum Aufbau einer Arbeit und zum korrekten Zitieren, damit Sie nicht in die Falle eines Plagiats tappen.
Detailliertere Ausführungen zum Nutzen der besprochenen Elemente finden Sie im Zusammenhang mit der Darstellung der Elemente und zusammengefasst noch einmal am Schluss des Buches.
1.3 Anmerkungen
Sie werden feststellen, dass dieses Buch ein relativ umfangreiches Literaturverzeichnis aufweist. Diese Literaturfülle ist zum einen dadurch bedingt, dass auf Publikationen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen zurückgegriffen wurde. Zum anderen bietet es einen Einstieg in grundlegende Literaturbeiträge. Ein Teil der Literatur ist schon älteren Datums. Das entspringt der Absicht, solche Werke zu zitieren, in denen neue Gedanken erstmals entweder in die Diskussion eingebracht oder vorhandene einer Kritik unterzogen wurden (sog. Primärquellen).
Das Lernen ist natürlich eng an Ihre aktive Mitarbeit gekoppelt. In die einzelnen Kapitel sind deshalb Fragen und Aufgaben eingestreut, die unterschiedliche Aktivitäten verlangen. Sie reichen von der Anregung, sich mit einem Thema genauer zu beschäftigen bis zur Aufforderung, einen kleinen Essay anzufertigen. Diese Übungen gehen von dem Gedanken des entdeckenden Lernens aus. Aus Untersuchungen zu dieser Lernform ist bekannt, dass die aktive Wissensaneignung über Fragen, auf die man eine Antwort sucht, eine höhere Effizienz im Hinblick auf das Behalten von Wissen und vor allem auf das Verfügen über Wissen hat als das rezeptive Lernen, bei dem ein Inhalt lediglich „online” angeeignet wird.
Deshalb die Empfehlung: Nehmen Sie die Aufgaben ernst, auch wenn Ihnen die eine oder andere als zu einfach erscheint!
Im Text finden sich häufig Begriffe wie „der Teilnehmer“ oder „der Mitarbeiter“, die wie geschlechtsspezifische Ausdrücke aussehen. Dabei handelt es sich jedoch um abstrakte Merkmalskategorien für wissenschaftliche Aussagen (genera) und nicht um empirische Begriffe. Dort wo es vom Aussagencharakter her geboten ist, wird entsprechend geschlechtsspezifisch differenziert, z. B. in „Mitarbeiter“ und „Mitarbeiterin“. Auf Bezeichnungen wie „I“ (z. B. MitarbeiterInnen) oder „*“ (z. B. Mitarbeiter*innen“) wird grundsätzlich verzichtet. Sie haben in einer wissenschaftlichen Diskussion keine Funktion.
1 Hochschulgesetz NRW vom 12. Juli 2019. Die Hochschulgesetze anderer Bundesländer enthalten ähnliche Formulierungen.
2Detmer 1994, S.10.
3 Pietschmann 1983, S. 89.
4 Vgl. Wikipedia-1: http://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_of_London.
5 Seit 1956 mit dem Untertitel „Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“.
6 Piagét1975, Bd. 1, S. 15.
7 Ströker, 21977, S. 110.
8 So stellt Doyn Farmer, der Begründer der Ökonophysik, fest, dass in den Wirtschaftswissenschaften „extremer Konformitätsdruck herrscht. Es werden sehr strenge Kriterien angelegt, wie ein Aufsatz zu schreiben ist, im Hinblick auf Stil und Präsentation und den Theorietyp, ob er mit den Mainstreamüberzeugungen, wie eine Theorie aussehen sollte, übereinstimmt.“ Hossenfelder 42018, S. 292.
9 Siehe Karikatur, entnommen aus: Lützeler 1976, S.49,
10 vgl. Pietschmann 1983, S. 89. Formale Funktionen erhält der Konsens insbesondere bei der Berufung von Professoren an eine Universität. Hier bewerten die Mitglieder der Berufungskommissionen die Wissenschaftlichkeit der in den Veröffentlichungen dokumentierten Leistungen der Bewerber um eine Professur. Zum Problem vgl. Fußnote 8.
2 Grundlagen der Forschung
2.1 Was heißt „forschen“?
In seinem Werk Der Staat entwirft der griechische Philosoph PLATON ein Gleichnis, das seine Aktualität bis heute nicht verloren hat: Man stelle sich Menschen vor, die in einer Höhle leben, an „Schenkeln und Hälsen“ gefesselt, so dass sie nur nach vorn auf eine Felswand schauen können. Hinter ihnen brennt ein Feuer. Zwischen dem Feuer und den Gefesselten tragen Leute allerhand Gegenstände umher, darunter auch Statuen von Menschen und anderen Lebewesen, und lassen auch ihre Stimmen hören. Die Gefesselten haben nun in ihrem ganzen Leben nichts anderes gesehen, als die Schatten der Gegenstände, die das Feuer auf die Felswand wirft. Sie halten einzig diese Schattenbilder für die Wirklichkeit. Wenn nun aber einem von ihnen die Fesseln abgenommen werden und er genötigt wird, sich umzudrehen, wird er die Realität sehen und langsam begreifen, dass das, was er bisher gesehen hat, nur Schattenspiele waren. Diese Erkenntnis wird für ihn schmerzhaft sein, so dass er sich lieber wieder der Schattenwelt zuwendet. Wird dieser Mensch nun gezwungen, aus der Höhle aufzusteigen, so wird sich dieser Prozess des Erkennens der Zweiteilung von wahrgenommener Wirklichkeit und bestehender Realität auf einer weiteren Stufe wiederholen und auf einer vierten zum Zustand der reinen Erkenntnis führen.1
Dieses Gleichnis ist deswegen so aktuell, weil sich mit ihm auch einige grundlegende Probleme in der Kommunikation sowohl in der Wissenschaft als auch in der heutigen Gesellschaft veranschaulichen lassen, die auf dem Verhältnis von wahrgenommener bzw. geglaubter (Schattenphänomene) und „objektiver“ Realität (Feuer und Schattenspieler) beruhen. Der Wiener Physiker Herbert PIETSCHMANN unterscheidet hier zwischen Wirklichkeit und Realität. Diese Unterscheidung mag zunächst verblüffen. „Wirklichkeit“ und „Realität“ sind doch lt. Duden synonyme Begriffe. Richtig! Aber sind sie auch eindeutig? Denken Sie an einen Verkehrsunfall. Dabei kommt es fast nie zu gleichlautenden Beschreibungen des Unfalls durch die daran Beteiligten. Jeder erlebt ihn auf seine ihm eigentümliche Weise, er wird zu seiner subjektiven Wirklichkeit (wie die Schatten bei Platon). Die stimmt allerdings nicht immer mit dem vom Unfallsachverständigen rekonstruierten Ablauf des Unfalls, also mit der Realität, exakt überein.2
Wie bereits dargelegt wurde, sind die für den Beruf eines Wissenschaftlers zentralen Tätigkeiten das Forschen und das Dokumentieren der Forschungsergebnisse. Was heißt nun „forschen“? Eine einfache Antwort lautet: „Der Zweck von Forschung ist es, durch die Anwendung wissenschaftlicher Verfahren sinnvolle Antworten auf sinnvolle Fragen zu finden“,3 z. B. „Werden die Immobilienpreise in einem Wohnviertel sinken, das zunehmend von Migranten bewohnt wird?“ Forschen ist also gleichbedeutend mit Suchen, und zwar mit methodisch geleitetem Suchen.
Der Philosoph Wolfgang STEGMÜLLER beschreibt das Anliegen wissenschaftlichen Tuns so: „Unsere wissenschaftliche Welterkenntnis (…findet) ihren Niederschlag in der Suche nach Erklärungen und in der Suche nach Gründen",4 wobei die Erklärung ein spezieller Fall der Suche nach Gründen dafür sei, warum eine Behauptung wahr oder warum sie falsch ist.
Wenn die Person aus PLATONs Gleichnis nach der Abnahme der Fesseln nicht zur Erkenntnis genötigt werden müsste, sondern wenn sie aus Neugier wissen wollte, was es mit den Schattenfiguren auf sich hat, wo sie herkommen, nach welchen Mustern sie sich bewegen, warum sie bisher nur Schattenfiguren gesehen hat usw., dann würde sie nach entsprechenden Erklärungen suchen, d. h. zu forschen beginnen. Neugier ist also eine Grundvoraussetzung jeglicher Forschungstätigkeit.
Nach STEGMÜLLER können wir Erklärungen als Antworten auf Warum-Fragen auffassen.5 Doch bevor wir eine Warum-Frage stellen, muss zuerst geklärt sein, worauf sie sich bezieht, d. h. was der Fall ist. Das kann ein Ereignis, eine Tatsache (getane Sache), ein Problem sein. Wissenschaftliche Erklärungen geben Gründe dafür an, warum ein Ereignis eingetreten ist, eine Tatsache vorliegt oder ein Problem besteht. Sie unterscheiden sich von alltäglichen oder spontanen Erklärungen oder von bloßen Beschreibungen dadurch, dass sie das Auftreten eines Ereignisses auf der Basis einer wissenschaftlich gesicherten, allgemeinen Grundlage interpretieren.6 Als Bezugsgröße dienen Aussagen, in Form von „Hypothesen“, „Behauptungen“ oder „Annahmen“, welche gesetzmäßige Beziehungen (Wenn ich A tue, dann wird B eintreten) enthalten. Wenn sie komplex oder abstrakt sind, werden sie als „Theorien“ bezeichnet. Dazu später mehr.7
Wie verfährt nun die Forschung bei der Suche nach Erklärungen? Hier können wir zwischen theoretischen und empirischen Vorgehensweisen unterscheiden. Theoretisches Vorgehen hat zum Ziel, auf der Grundlage vorhandener Forschungsergebnisse einen Erklärungszusammenhang für die zu untersuchende Warum-Frage zu konstruieren. Was ist bereits an Erkenntnissen vorhanden? Welcher Art sind die Aussagen? Gibt es Widersprüche? Wie sind die Wissenschaftler zu den Erkenntnissen gelangt, welche Methoden haben sie verwendet? Sind die Erkenntnisse vertrauenswürdig?
Sollte eine Beantwortung der Forschungsfrage auf der Basis der vorhandenen Literatur nicht zufriedenstellend gelingen, kann über empirische Vorgehensweisen nach passenden Antworten gesucht werden. Die empirische Forschung greift dabei auf Daten in Form vorhandener, oder auf der Basis von Datensammlungen (Interviews, Experimente usw.) selbst erstellter Statistiken zurück. Damit wird die Realität vom Forscher gezielt „beobachtet“. Die Beobachtungen, bez. Forschungsergebnisse werden dokumentiert und dazu ist die Verwendung präziser sprachlicher Einheiten unerlässlich.8
Stets geforscht und stets gegründet,nie geschlossen, oft geründet,Ältestes bewahrt mit Treue,freundlich aufgefaßtes Neue,heitern Sinn und reine Zwecke:Nun, man kommt wohl eine Strecke!(GOETHE 1826)
In der empirischen Forschung wird manchmal die Meinung vertreten, man solle bei der Datensammlung unvoreingenommen an die Sache herangehen und sich nicht durch bereits vorhandene Vorstellungen oder Daten beeinflussen lassen. Dieser Sichtweise ist eindrucksvoll widersprochen worden (vgl. Text 1).
Text 1: Albert EINSTEIN zur TheoriebildungSelbst der geniale Wissenschaftler Heisenberg vertrat die Meinung, „daß nur beobachtbare Daten zur Bildung einer Theorie herangezogen werden dürften. Einstein, der früher selbst diese Ansicht vertreten hatte, war bereits über sie hinausgegangen und soll geantwortet haben: ‚Es ist durchaus falsch, zu versuchen, eine Theorie nur auf beobachtbaren Größen aufzubauen. In Wirklichkeit tritt gerade das Gegenteil ein. Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können‘“.13
POPPER hat die Auffassung der ungezielten Datensammlung als „Kübeltheorie des Bewußtseins“ kritisiert. Die Daten würden als Rohstoff quasi von außen einem theoretischen Kübel zugeführt, in dem sie eine Art automatischer Verarbeitung oder Verdauungsprozess durchliefen und dann als reiner Wein der Erkenntnis dem Kübel wieder entnommen werden könnten. Er setzt der Kübeltheorie sein Modell einer „Scheinwerfertheorie“ der Erkenntnis entgegen (vgl. Text 2).
Text 2: Scheinwerfertheorie der Wissenschaft versus Kübeltheorie des Bewusstseins14





























