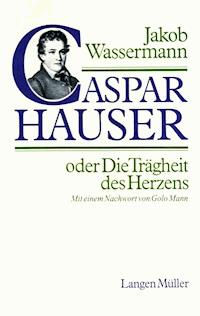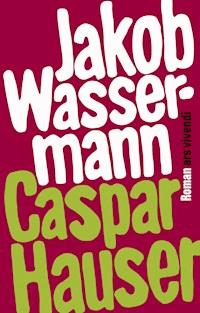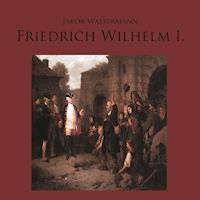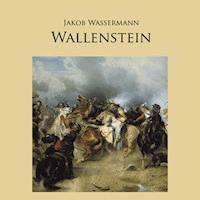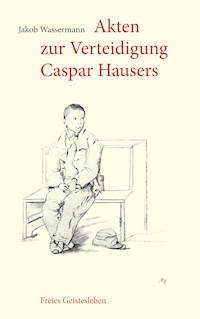
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Leben Jakob Wassermanns (1873–1934) ist der 1908 erschienene Roman ›Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens‹ ein Schlüsselwerk. Mit keinem anderen Stoff hat er sich so eingehend und anhaltend beschäftigt, weit über die Vollendung des Romans hinaus. Im »heimatlichen Mythos« des geheimnisvollen Außenseiters, dem Unverständnis und Misstrauen entgegenschlägt und der schließlich eines gewaltsamen Todes stirbt, fand der unter dem Antisemitismus seiner Umwelt leidende deutsche Jude ein Bild der eigenen Existenz. Und er war fest überzeugt davon, dass Kaspar Hauser tatsächlich der badische Erbprinz war. All dies belegen eindrücklich die hier versammelten Studien und Selbstzeugnisse sowie der Briefwechsel mit Hermann Pies (1888–1983), der durch Wassermanns Roman zu seinen bahnbrechenden Kaspar-Hauser-Forschungen angeregt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kaspar Hauser im Jahr 1828Kopfstudie von Heinrich Adam (1787–1862)
Jakob Wassermann
Akten zur VerteidigungCaspar Hausers
Zeugnisse eines Engagements
Inhalt
AKTEN ZUR VERTEIDIGUNG CASPAR HAUSERS
Der Schatten Caspar Hausers
Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Caspar-Hauser-Roman
DER KRIMINALIST FEUERBACH
AUS: MEIN WEG ALS DEUTSCHER UND JUDE
BRIEFWECHSEL MIT HERMANN PIES
Claudius Weise
DER GLEICHE GRUNDAKKORD
Anmerkungen
Quellennachweise
AKTEN ZUR VERTEIDIGUNG CASPAR HAUSERS
Der Schatten Caspar Hausers
Es lebte in einer Stadt des westlichen Deutschland vor mehr als vier Jahrzehnten ein Professor, dessen Namen wir aus wohlüberlegten Gründen verschweigen müssen. Es genüge, wenn wir sagen: der Professor. Vielleicht mögen einige bewanderte oder divinatorisch begabte Leser hinter dieser von unserer Diskretion und einem gewissen Mitgefühl errichteten Schranke eine bestimmte Persönlichkeit, wenn auch in verfließenden Zügen, erkennen, das ist dann ein Vorteil, dessen sie ohne Zutun und Verschulden des Autors teilhaftig werden.
Besagter Professor nun war seit Jahr und Tag mit unermüdlichem Eifer und einer Hingebung, deren nur ein deutscher Mann der Wissenschaft fähig ist, mit der Abfassung eines äußerst umfänglichen Werkes beschäftigt. Er hatte sich nämlich zur Aufgabe gesetzt, die beinahe sagenhaft gewordene, dessenungeachtet aber im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, öffentlicher Streitigkeiten, unabsehbaren Zeitungshaders, endloser Beschuldigungen und Verteidigungen stehende Figur des Findlings Caspar Hauser einer gewissenhaften Prüfung zu unterziehen, ihre Antezedenzien festzustellen, ihre Würdigkeit, ihre Erlebnisse, ihre protokollierten Aussagen, mit einem Wort, ihr Leben und ihr Sterben. Er bediente sich hierbei gleichsam eines unsichtbaren Mikroskops; seine geistigen Augen waren von einer Schärfe, der nichts entging, kein Stäubchen auf der Ehre seines Objekts, keine Regung seiner Seele, keine Wandlung seiner Gesinnung, kein Motiv seines Handelns. So bildete er sich wenigstens ein; es war auch die Meinung seiner Bewunderer, und deren gab es nicht wenige, wie leicht zu glauben, denn jeder Professor hat seine Eingeschworenen und Trabanten hinter sich wie ein römischer Imperator, namentlich dann, wenn er sich im Stande der Negation befindet und etwas Seiendes bekämpft.
Er schuf an seinem Buche Tag und Nacht. Er hatte im Laufe der Zeit so viel Dokumente angesammelt, dass seine Schreibtischfächer nicht mehr ausreichten, sie zu fassen. Es waren Zeugnisse aus aller Welt, Belege von unwidersprechlicher Art, Indizien von eiserner Kraft, Nachweise von verblüffender Zielsicherheit. Es waren Stammtafeln, behördliche Manifeste, ärztliche Legitimationen, Tauf-, Geburts-, Wohnscheine, Krankenatteste, Obduktionsatteste, Laufzettel, Kriminalakten, Schulhefte, Zensuren, Journalartikel, Biographien, Schädelaufnahmen, Gedichte, Nekrologe und vieles andere mehr. Er konnte darin wühlen wie in einer Kiste voll Juwelen. Er konnte besichtigen, vergleichen, zusammenstellen, richtigstellen, alles mit philologischer Gründlichkeit und Prägnanz. Er konnte es nicht nur, sondern er tat es auch. Außerdem hatte er ein viele hundert Seiten starkes Manuskript vor sich liegen, mit dessen Hilfe er überzeugt war, sich in den Himmel der Unsterblichkeit zu schreiben, jedenfalls aber das Problem, dem er sein Leben weihte, vollkommen zu lösen und für alle Zeiten über das Wirrsal der banalen Meinungsverschiedenheiten emporzuheben.
In einer Dezembernacht geschah es, dass er, ein wenig ermüdet von der Arbeit, die Feder weglegte, sich in seinem Sessel zurücklehnte und die Augen hinter der goldgeränderten Brille träumerisch durch das Halbdunkel seiner faustischen Studierstube schweifen ließ. Da gewahrte er in der Ecke, neben dem großen Globus, weit außerhalb des Lampenkreises, eine im Grau der Dämmerung beinahe verrinnende Gestalt. Der Professor zog die Stirne in Falten und wunderte sich, ohne mehr zu erschrecken als es einem aufgeklärten Forscher ziemt. Mit unterdrückter, rauher Stimme rief er: «Hallo, wer da?»
Die Gestalt zuckte sichtlich zusammen, gewann aber bei dem Anruf bestimmtere Formen und näherte sich der Mitte des Raumes.
»Ich bin der Schatten», sagte sie kaum vernehmlich.
»Was für ein Schatten?» erkundigte sich der Professor streng, als habe er einen Schüler vor sich, der sein Pensum nicht gelernt hat.
»Nun, der Schatten von dem da, von dem Caspar Hauser da», flüsterte die Gestalt und wies mit schimmernder Hand auf das dickleibige Manuskript auf dem Schreibtisch.
»Wie soll ich das verstehen?» fragte der Professor mit unmutig verzogener Stirn und schob die Brille etwas höher hinauf; «was heißt das: der Schatten? Es gibt keine Schatten. Will sagen: keinen Schatten im Sinne leiblichen Residuums. Entweder du bist es selbst oder du bist eine Imagination. Bist du eine Imagination, so bist du natürlich meine eigene Imagination. Folglich kann und werde ich zu dir sprechen: Hebe dich hinweg. Es könnte ja sein, dass mein überanstrengtes Hirn zur Phantombildung neigt. Derlei liegt mir freilich nicht. Ich glaube nicht an Phantome. Ich glaube nicht an dich, ich glaube nicht, dass du da bist. Verschwinde, elender Geist!»
«Wenn du es auch nicht glaubst, Herr Professor, ich bin doch der Schatten, ich bin dennoch Caspar Hauser», sagte sanft die Gestalt, und ihre Umrisse wurden allmählich deutlicher.
Der Professor verschränkte die Arme über der Brust. So entschlossen er auch aussah, konnte er sich gleichwohl eines leichten Schauers nicht erwehren, und mit einer Beklommenheit, die ihn ärgerte, so dass seine Stimme etwas Dumpf-Grollendes hatte, fragte er: «Was willst du? Zu welchem Ende behelligst du mich?»
Die Gestalt schwieg und senkte den Kopf, doch näherte sie sich dem Schreibtisch noch mehr und blieb erst stehen, als sie mit der schimmernden Hand, die eigentümlich wie ein Lebewesen für sich wirkte, den Bord des Tisches berührte.
«Wenn ich schon die Hypothese zulasse, dass du hier bist und ein Etwas außerhalb meiner selbst bist«, sagte der Professor in demselben böse grollenden Ton, «so habe ich vor allem das Recht, zu erfahren, welcher Zweck mit dieser zudringlichen Störung verfolgt wird. Den Fall gesetzt also, ich nähme deine Existenz oder scheinbare Existenz zu meiner Kenntnis: Cui bono?»
Der Schatten deutete abermals auf das handschriftliche Konvolut und sagte: «Du schreibst da ein dickes Buch, Herr Professor –»
«Ich bin nicht gewohnt, dass man mich duzt», fuhr der Professor zornig auf; «die Tatsache deiner nächtlichen Gespensterhaftigkeit befugt dich noch nicht zu so unverschämt vertraulichem Übergriff.»
Der Schatten duckte sich ein wenig und wich schüchtern einen halben Schritt zurück. «Da unten sagen wir alle du zueinander», entschuldigte er sich; «ich habe das andere verlernt. Ich kann es nicht mehr. Da unten sind wir Brüder. Du musst mich du sagen lassen, Herr Professor. Meine Hochachtung vor dir bleibt deswegen dieselbe. Es ist nicht nur Hochachtung, es ist auch Angst. Ich habe große Angst vor dir, obgleich ich ein Geist bin und du nicht.»
«Ha!» rief der Professor.
«Und ich wollte dich fragen, warum du in deinem Buch da immerfort behauptest, dass ich ein Schwindler und Betrüger bin. Das tut mir weh. Auch wir in der Unterwelt empfinden Schmerz.»
Der Professor erlangte nach und nach seine ganze Zuversicht zurück. Die bängliche Haltung des Schattens flößte ihm um so größeren Mut ein, als er sie der Wirkung seiner persönlichen Gewalt zuschrieb. «Das wundert dich noch?» fragte er voll Hohn; «beschwerst du dich vielleicht gar? Fünfzig Jahre sind seit deinem Tode vergangen, und noch immer halten deine Schnurrpfeifereien die leichtgläubige Welt in Atem. Wir müssen die Materie, will sagen den Lügenkomplex, in zwei Teile scheiden, a und b. Teil a bezieht sich auf das Erscheinungsmäßige, Teil b auf das Gefasel von der fürstlichen Abkunft.»
»Ich verstehe das nicht», flüsterte der Schatten mit traurigem Kopfschütteln; «ich habe eure schwere Sprache beinahe schon vergessen.»
»Ja, du warst immer ein miserabler Schüler», bemerkte der Professor geringschätzig. «Ich will also versuchen, dir die Sache mundgerecht zu machen, und wiederhole: Einerseits haben wir da das unsinnige Märchen von jahrelanger Einsperrung und Dunkelhaft bei Wasser und Brot, von plötzlicher Entführung, Nichtgehenkönnen, Nichtsprechenkönnen; das Auftauchen in der guten, leider nur etwas albernen Stadt Nürnberg, das Blendwerk mit dem kindlichen Geist und der unberührten Seele, das Geschwätz und Geschrei halbgelehrter Narren und einfältiger Schwärmer über den Augen- und Sinnentrug, den sie sich von dir haben vormachen lassen, die fingierten Mordanfälle bis zu jenem letzten in Ansbach, bei dem du dich ungewollter- oder ungeschickterweise etwas zu tief ins Herz getroffen hast; andrerseits lastet auf dir und deinen genasführten Anhängern die gotteslästerliche Fabel von deiner hochfürstlichen Geburt, diese verbrecherische Erfindung respektverlassener Demagogen, die zu beseitigen und zu zerstören ein Mann wie ich und viele andere noch, die mir allerdings nicht recht gewachsen sind (was du zugeben musst, wenn du einmal mein Buch wirst lesen können), das Licht ihres Geistes verschwenden müssen.»
Dieser scharfsinnig aufgebaute, obschon etwas verschnörkelte und gotisch düstere Satz flößte dem Schatten sichtlich tiefen Schrecken ein. «Ich kann aber nichts dafür», sagte er und faltete die Hände; «es ist alles so, wie es ist. Es war alles so, wie es war.»
Der Professor stieß eine imposante Lache aus. «Das könnte ja beinahe eine philosophische These sein», spottete er. «Es war, wie es war. Natürlich. Wie war es denn aber? Hast du geschwindelt oder hast du nicht geschwindelt? Darauf kommt es an. Und bis zu welchem Punkte ging deine Freiwilligkeit, und von welchem Punkte an warst du das Opfer deiner sogenannten Freunde? Darauf kommt es an. Sprich. Erleichtere dich. Mach reinen Tisch mit der Lüge, die schon zum Himmel stinkt und als perverser Mythos die Erde verpestet.»
Es konnte beinahe scheinen, als lächelte der Schatten; jedenfalls war es ein trübes und melancholisches Lächeln, das um seine beinahe durchsichtigen Lippen spielte, als er antwortete: «Es ist wirklich sonderbar mit den Menschen. Wenn etwas einfach ist, mögen sie es nicht glauben. Alles, was verwickelt und schwer ist, das glauben sie. Alle sind darauf aus, ihr Gehirn anzustrengen und das Herz möglichst in Ruhe zu lassen. Woher kommt das, Herr Professor? Du bist doch ein so gescheiter Mann; du musst mir das doch erklären können.»
»Unsinn», brummte der Professor, «anmaßender Unsinn. Zur Sache, zur Sache.»
»Meine Sache ist gut aufgehoben bei denen, die die Augen innen haben, und schlecht aufgehoben bei denen, die sie außen haben», sagte der Schatten, tief in sich gekehrt. «Wenn ich zu dir sprechen würde: Ja, ich habe gelogen, dann würdest du jubeln und würdest sagen: Caspar Hauser ist ein anständiger Kerl. Du würdest dich freuen und würdest mich loben; warum? Weil dir soviel an der Wahrheit liegt? oder nicht nur deswegen, weil du es dann besser weißt als die Anderen? Wie kann ich aber sagen, etwas ist Lüge, was ich bin? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich mein wirkliches Leben nicht gelebt haben soll, und nur das andere, das du dir einbildest, weil es dir wunderbar vorkommt, während es doch das Einfache und Natürliche ist. Wenn ich beweisen könnte, dass es gewesen ist, wie es gewesen ist, dann wäre es ja schon anders gewesen. Begreifst du das nicht? Begreifst du nicht, dass das Dunkle mein Leben ist und das Geheimnis mein Wesen? Ach, ich habe keinen höheren Wunsch, als dass der Schleier endlich fällt. Freilich, dann bin ich nicht mehr, dann wandle ich nicht mehr, dann ist auch mein Schatten nicht mehr da und mein Bild nicht mehr da. Das ist aber alles besser als mit solcher Last im Geisterreich zu schweben, mit solcher Last wie Ahasver. Ich kann nichts dazu tun, um euch zufriedenzustellen, euch, die ihr mein Grab aufwühlt, weil ihr mich für einen Lügner haltet.»
Der Professor war keines Wortes mächtig. Er befand sich durchaus in der Situation eines Examinators, den der Examinand bereden will, dass alles, was er gelehrt, was er erforscht, was er seit seiner Kathederbesteigung verkündet hat, falsch und unhaltbar sei. Wir dürfen deshalb nicht zu streng mit ihm ins Gericht gehen; wir müssen seine besondere Art zu erfassen suchen, seine Umpanzerung gegen das fließende Leben, seine beleidigte Würde, und wenn wir ihn so sitzen sehen zwischen einem unglaubwürdigen Schatten und einer sehr glaubwürdigen Handschrift, sozusagen zwischen dem Grauen des Metaphysischen und der Realität der Tinte, mischt sich vielleicht in unsere heimliche Genugtuung (eine Genugtuung, die wir sogar empfinden, wenn ein starker Baum aus seinen Wurzeln gehoben wird) ein wenig Mitleid. Der Autor jedenfalls muss sich zu diesem Gefühl bekennen.
Indessen fuhr die Schattenstimme fort, und trotz ihrer sanften Schüchternheit war es, als fülle sie den ganzen Raum: «Wüsst ich nur, was ihr meine Lüge nennt, da ihr doch alle, die für meine Wahrheit zeugen, auch Lügner heißt. Erst war mein Kerker das Unterirdische; dann war mein Kerker das Oberirdische, eure unbegreifliche Welt; jetzt habt ihr einen neuen Kerker gezimmert für meine Seele. Wie soll ich mich retten? Wie soll ich euch überzeugen? Ihr wisst um meine Träume und nennt sie Lügen; ihr wisst um meine Leiden und nennt sie Lügen; ihr wisst um meinen grausamen Tod und nennt ihn Lüge; ihr habt mir das Herz aus dem Leib gerissen, und dann habt ihr triumphierend gesagt: Seht, er hat kein Herz! Verbrechen sind an mir geschehen, und statt dass ihr die sucht und richtet, die sie begangen haben, verlangt ihr von mir, dass ich sie auf mich nehmen und tragen soll. Ihr sucht die Wahrheit am falschen Ort, und weil ihr sie nicht finden könnt, sagt ihr: Er hat gelogen. Ihr habt nicht den Mut, die zu fragen, die alles wissen, darum sagt ihr: Wir wissen schon längst alles, und was wir nicht wissen, ist des Wissens nicht wert. Große Herren haben für mich geredet; ihr hört es nicht. Und große Herren haben für mich geschwiegen, ihr achtet es nicht. Ihr glaubt nicht einmal den wahren Schuldigen, wenn sie sich selber anklagen – aus lauter Ehrfurcht vor ihnen. Wenn man euch den rechten Weg gezeigt hat, seid ihr ärgerlich geworden, und wenn man euch ein Licht angezündet hat, habt ihr geschrien, man soll es auslöschen, weil es euch die schöne Finsternis stört. Hättet ihr mein Bild, so hättet ihr meine Wahrheit, aber ihr habt bloß euer Wort, und an dem beißt ihr euch wund. Wann wird dies alles enden und wann wird die gerechte Sonne euch erleuchten? Ich sollte vielleicht meine Bruderschatten heraufbeschwören, die schuldigen, und sie anflehen, sich endlich zu offenbaren. Aber das darf nicht sein, denn Leben und Tod der Menschen sind dem gleichen Schicksalsgebot unterworfen, und die Schatten müssen tun und leiden, was den Lebendigen auferlegt war. Einmal wird es sein. Einmal wird Wahrheit sein. Aber wenn ich dann zu dir komme, Herr Professor, und zu dir spreche: Gib mir die Ehre wieder, auch du, so wirst du sagen: Ich bin es nicht. Du wirst so erbittert darüber