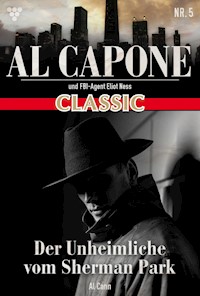12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Al Capone
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
FBI-Agent Eliot Ness, der große Gegenspieler von Al Capone Aufregende Action-Krimis aus Chicago um Bandenkriege und Frauenmörder, erzählt von einem Schriftsteller, der sich wie kein anderer in der großen, alten Gangster-Metropole auskennt: Al Cann weiß alles über den unbestechlichen FBI-Agenten Eliot Ness und den berüchtigtsten aller Gangster, den Italo-Amerikaner Al Capone, der nicht nur Chicago, sondern das ganze Land in Atem hielt. Die beiden großen Gegenspieler Eliot Ness und Alfonso Capone haben wirklich gelebt! Authentische Kriminalfälle halten unsere Leser in Atem, fesselnd, fast magisch beschrieben, daß es unter die Haut geht. Diese Krimiserie wird alle Krimifans begeistern und nachhaltig binden. Den fintenreichen und spannungsgeladenen Romanen mit wahrem Hintergrund kann niemand widerstehen. Das Duell zwischen Eliot Ness und Al Capone schreitet unaufhaltsam seinem Höhepunkt entgegen... E-Book 5: Der Unheimliche vom Sherman Park E-Book 6: Drei von der Keaton-Gang E-Book 1: Der Unheimliche vom Sherman Park E-Book 2: Drei von der Keaton-Gang
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Der Unheimliche vom Sherman Park
Drei von der Keaton-Gang
Al Capone – Doppelband 3 –
Al Capone
Al Cann
Der Unheimliche vom Sherman Park
Roman von Cann, Al
Es war Abend. Über dem Weltstadtgiganten Chicago breitete sich ein sternenbedeckter Himmel aus. Mit raschen Schritten ging Geraldine Page den Loomis Boulevard hinunter, hatte den Sherman-Park erreicht und deutete mit der Linken auf den italienischen Kastanienverkäufer, der mit melodischer Stimme seine heißen Maronis anbot.
Der kleine sechsjährige Joe Griffith, den sie an der Hand hatte, lachte über sein ganzes pausbäckiges Gesicht.
»O ja, Miß Page, kaufen Sie mir Maronis!«
Die beiden traten an den Stand heran. Der hohlwangige Mann mit den Kohlenaugen warf einen raschen Blick auf das Mädchen und blickte dann den Jungen an. Mit seinem fremdländischen Akzent fragte er:
»Na, möchtest du sie denn besonders heiß, Jimmy?«
»Ich heiße Joe«, erklärte der Kleine.
»Na gut, Joe. Dann werde ich dir ein paar besonders schöne heraussuchen.«
Als Miß Page mit dem Jungen den Weg fortsetzte, blickte der italienische Auswanderer Cesar Isella hinter den beiden her. Mit einer müden Bewegung fuhr er sich durch sein faltenzerschnittenes Gesicht und beugte sich wieder über die kleine Zigarrenkiste, in der die wenigen Cents lagen, die er heute abend eingenommen hatte.
Miß Page hatte jetzt mit dem Jungen das Haus an der Ecke 52nd Street und Loomis Boulevard erreicht. Mit raschen Schritten lief der Junge ihr voran in das elfgeschossige Haus und drückte unten links auf die Klingel.
»Dr. Griffith« stand auf dem großen Messingschild.
Der weißbekittelte Arzt kam selbst an die Tür. Er nahm den Jungen auf die Arme und blickte in seine hellen Augen.
»Na, Joe«, forschte der überanstrengt aussehende Mann, während er dem Kleinen über die Wangen strich, »worauf kaust du denn da herum?«
Inzwischen hatte Miß Page die Haustür auch erreicht und meinte entschuldigend:
»Wir haben ein paar Maronis gekauft.«
Der Arzt ließ das Kind auf den Boden hinunter. In diesem Augenblick wurde am anderen Ende des großen Korridors die Tür geöffnet, und eine große, sehr gut aussehende, etwas üppige Frau blickte mit vorwurfsvollem Gesicht auf das Kind.
»Joe, du sollst doch nicht vor dem Essen Süßigkeiten knabbern.«
»Es sind keine Süßigkeiten, Mama«, antwortete der Junge, während er an der Frau vorbei aufs Kinderzimmer zulief.
Es war sechs Uhr und neunzehn Minuten.
Graue Wolken schoben sich über die Stadt und verdunkelten das Licht der Sterne. Aber das Lichtermeer Chicago nahm davon keine Notiz.
Als Geraldine Page vier Minuten später vom Speisezimmer her die Tür des nebenan liegenden Kinderzimmers öffnete, fand sie das Zimmer leer.
»Joe…?«
Keine Antwort.
Das Mädchen öffnete die Tür zum Korridor. Auch hier war der Junge nicht. Sie sah im Bad nach, in der Küche, in der Toilette – und ging schließlich in die Küche zurück. Die korpulente Negerköchin Sara stand am Herd und hantierte mit ihren dampfenden Töpfen herum.
»Haben Sie Joe gesehen, Miß Sara?«
»Little Joe? Nein, nicht gesehen.«
Das Mädchen trat wieder in den Korridor hinaus und blickte sich unschlüssig um.
Es war achtzehn Uhr siebenundzwanzig, als Geraldine im Salon nachsah. Auch da war niemand. Nanu, sollte Mrs. Griffith noch mit dem Kind vor die Tür gegangen sein?
Geraldine trat ans Fenster, zog die Vorhänge zurück und blickte auf den Loomis Boulevard hinaus. Draußen strömten die Menschen vorüber, die von einer Spätschicht aus einem der gegenüberliegenden Hochhäuser kamen.
Die Wohnungstür wurde geöffnet.
Geraldine lief hinaus und sah die Frau des Arztes ohne Hut und Mantel hereinkommen.
»Das Essen ist bereit, Mrs. Griffith.«
»Ja, es ist gut. Bringen Sie Joe hinein.«
»Joe?« stammelte das Mädchen. »Aber er ist nicht da.«
»Was soll das heißen?« sagte die Frau stirnrunzelnd.
»Ich kann ihn nirgends finden.«
»Sind Sie verrückt?« kam es unbeherrscht von den Lippen der schönen Frau.
Vera Griffith war vierunddreißig, hatte grüne, etwas schrägstehende, langbewimperte Augen und rotes, elegant frisiertes Haar. Sie trug ein smaragdfarbenes Kleid, das ihre etwas vollreife Figur eng umschloß. Jetzt stand zwischen ihren sauber gezupften Brauen eine winzige Falte. Mit raschen Schritten kam sie auf ihren hohen Pumps auf die Mitte des großen chinesischen Teppichs und blickte das erschrockene Mädchen vorwurfsvoll an.
»Aber was soll denn das heißen?«
Geraldine hob mit einer hilflosen Geste die Arme.
»Ich weiß es auch nicht. Ich hatte ihn doch ins Kinderzimmer gebracht.«
»Wann?«
»Als ich mit ihm nach Hause kam.«
Vera Griffith fuhr sich mit einer fahrigen Geste über die Stirn, als sie fragte:
»Ist mein Mann noch da?«
»Ich glaube nicht. Das heißt, es könnte sein. Aber ich glaube, es sind keine Patienten mehr da.«
Mit raschen Schritten ging Vera Griffith auf das Wartezimmer zu, stieß die Tür auf und sah einen älteren Mann, der drüben am Fenster saß und in eine Sportzeitung vertieft war.
Ohne den Mann eines Grußes zu würdigen, schloß die Frau des Arztes hinter sich die Tür, durchquerte das Wartezimmer und öffnete die Zwischentür zum Sprechzimmer.
Sie mußte durch einen kurzen Korridor, der links und rechts von Aktenschränken flankiert war, und klopfte kurz an die Sprechzimmertür. Sie wußte, daß ihr Mann es nicht liebte, wenn er während der Behandlung gestört wurde. Schon der Patienten wegen. Als sie geöffnet hatte, sah sie das Behandlungszimmer leer vor sich. Die grün abgeschirmte Lampe auf dem Tisch brannte noch.
Aber das wollte nichts besagen. Griffith löschte die Lampe eigentlich nie; es war eine Gewohnheit von ihm, sie brennen zu lassen. Als seine Frau ihn einmal daraufhin angesprochen hatte, meinte er, daß es vielleicht beruhigend für die Patienten sei, wenn sie spät in der Nacht seine Praxis aufsuchen müßten und noch Licht brennen sähen. Schon Oswald Griffiths Vater war Arzt gewesen, zwar nicht hier im Zentrum Chicagos, sondern weiter draußen in einem Vorort. Auch er hatte es so gehalten mit der »ewigen Lampe«.
Kopfschüttelnd verließ Vera Griffith das Sprechzimmer ihres Mannes, durchquerte den Bestrahlungsraum und gelangte von hier in den Korridor, von wo eine Zwischentür zum übrigen Teil der Wohnung führte. Dr. Griffith hatte es von Anfang an so eingerichtet, daß seine Privaträume von der Praxis getrennt waren. Die Patienten wurden bis achtzehn Uhr von Miß Tunney an der Tür, die zum Loomis Boulevard hinausführte, empfangen und auch dort wieder hinausgelassen. Miß Tunney selbst verließ jeden Abend pünktlich um achtzehn Uhr die Praxis.
Vera Griffith ging in den Korridor zurück, blieb einen Moment sinnend auf der Schwelle zum Salon stehen und sah dann wieder in die erschrockenen Augen des Kindermädchens.
»Was stehen Sie denn hier herum? Los, gehen Sie raus, und sehen Sie zu, ob Sie den Jungen finden! Er kann ja nur kurz hinausgegangen sein.«
Geraldine folgte dieser Anweisung, verließ die Wohnung, trat auf die Straße und schob sich durch das Menschengewühl auf dem Gehsteig vorwärts. Drüben an der anderen Ecke beim Park konnte sie den Lichtschein der bunten Laterne des Maroniverkäufers erkennen.
Sollte Joe etwa noch einmal dorthin zurückgelaufen sein?
Geraldine ging über den Fahrdamm auf die Parkecke zu, schob sich an den Menschen vorbei, die hier an der Haltestelle auf den Bus wartete, und blieb enttäuscht stehen.
Der Maronistand war leer. Die Holzklappe war zugeschoben, und die Lampe, die dahinter hing, hatte nur noch ein winziges Flämmchen, das nach wenigen Minuten erloschen sein würde.
Miß Page lief zurück ins Haus, und als sie den Schlüssel in die Wohnungstür schob, wurde sie von einem seltsamen Angstgefühl beschlichen.
Vera Griffith stand im Eßzimmer hinter ihrem Stuhl.
»Was ist nun?« drang dem Kindermädchen ihre ungeduldige Stimme entgegen.
»Ich kann ihn – nicht finden, Mrs. Griffith.«
»Was soll das heißen?« Die Frau schob die Hände zusammen, und wieder stand die kleine Falte zwischen ihren Brauen. »Der Junge kann doch nicht verschwunden sein!«
»Vielleicht«, stammelte das verschüchterte Kindermädchen, »ist er mit – ist er mit Ihrem Mann weggegangen.«
»Mit meinem Mann? Was wären denn das für neue Sitten?«
Vera Griffith ging sofort wieder hinüber in die Praxisräume und warf einen Blick auf den kleinen goldgerahmten Tageskalender. Links stand die Reihe der vielen Patienten, die sich für den Vormittag angemeldet hatten. Am Nachmittag waren weniger Namen verzeichnet. Darunter war der große Strich, hinter dem die Abendbesuche aufgeführt waren.
Mit der eiligen Handschrift des Arztes waren da noch fünf Namen aufgeschrieben. Obenan Mrs. Abendroth.
Vera Griffith stieß einen unwilligen Laut aus und sagte dann, so daß Geraldine Page, die in der Tür stand, es hören konnte:
»Denise Abendroth. Schnell, suchen Sie die Telefonnummer heraus.«
Miß Page griff nach dem Telefonverzeichnis und hatte die Nummer rasch gefunden. Als Vera Griffith gewählt hatte, meldete sich niemand.
»Ach, sie hat natürlich wieder abgeschaltet, weil sie sich vor Anrufen nach Einbruch der Dunkelheit fürchtet.«
Der nächste Name war Miller.
»Miller, wer ist denn das? Kennen Sie einen Patienten namens Miller?«
»Ja, mehrere, Mrs. Griffith.«
Unter Miller stand Cavella.
Das Gesicht der Frau des Arztes verdunkelte sich für einen Moment.
»Julia Cavella«, murmelte sie vor sich hin. »Was hat die denn schon wieder?« Mit einem raschen Griff nahm sie das Telefonverzeichnis an sich und suchte den Namen der Patientin vergeblich darin.
»Suchen Sie sofort die Nummer von Miß Cavella aus dem Telefonbuch, Miß Page!«
Auch hier erhielt sie keine Antwort.
»Gewohnheiten haben die Leute! Ich möchte bloß wissen, wozu sie überhaupt Telefon haben.«
Bernstein war der nächste Name.
James Bernstein meldete sich. »Ja, ich warte noch auf den Doktor. Er müßte eigentlich bald kommen. Meiner Frau geht’s gar nicht sehr gut, Mrs. Griffith.«
»Ja, er wird bald kommen. Ich habe ihm nur etwas ausrichten wollen. Nein, nein, es ist nicht sehr wichtig. Aber Sie könnten ihm vielleicht sagen, daß er einmal anruft, wenn er bei Ihnen ist.«
Es dauerte dreiundzwanzig Minuten, bis das Telefon schrillte.
Vera Griffith nahm den Hörer auf.
»Oswald, bist du es?«
»Ja.«
»Hast du Joe mitgenommen?«
Es war einen Moment still in der Leitung.
»Joe?« kam dann die belegte Stimme des Arztes zurück. »Was soll das heißen?«
»Er ist nicht da.«
Wieder herrschte einen Moment Stille in der Leitung. Dann kam wieder die Stimme des Mannes.
»Aber das ist doch nicht dein Ernst, Vera?«
»Er ist nicht da, wenn ich es dir doch sage!«
»Habt ihr denn schon überall nachgesehen? Vielleicht ist er unten im Keller?«
»Was soll er denn im Keller? Da ist doch alles abgeschlossen. – Miß Page, sehen Sie gleich mal nach, ob das Kind vielleicht im Keller ist!«
»Ruf sofort bei Brabanes an«, forderte der Arzt seine Frau auf.
Dr. Jeffrey Brabanes war mit Dr. Griffith befreundet. Er wohnte ein paar Häuser weiter, und sein kleiner Sohn Ted spielte zuweilen mit Joe.
»Ist gut«, sagte die Frau und hängte ein.
Brabanes konnte die Frage nach dem kleinen Joe nur verneinen.
»Nein. Seit wann ist er denn weg, Vera?«
»Wir vermissen ihn seit der Abendbrotzeit. Das heißt, er ist mit unserem Kindermädchen aus dem Kindergarten gekommen, und plötzlich war er dann verschwunden.«
»Aber das gibt es doch nicht. Ich will mal mit Ted sprechen.«
Aber der kleine Ted hatte seinen Freund auch nicht gesehen.
Kurz nach acht rief Dr. Griffith nach dreimaligem Anruf in seiner Wohnung die Polizei an.
*
Der kleine Joe Griffith war verschwunden. Als er auch um zehn Uhr noch nicht zurück war, wandte sich die Polizeibehörde vom 9. Bezirk an das Präsidium.
Die Antwort: sofortige Benachrichtigung des FBI.
Zwar war es noch längst nicht erwiesen, daß der kleine Joe etwa entführt worden war, aber die Vorschriften der Stadt-Polizei gingen dahin, daß das Federal Bureau of Investigation sofort zu benachrichtigen war. Es hatte sich herausgestellt, daß es immer gut war, wenn das FBI, das für Kindesraub seit etlichen Jahren zuständig war, so frühzeitig wie möglich eingeschaltet wurde, denn die G-men waren auf Kidnapping spezialisiert, verfügten über große Erfahrung in der Verfolgung solcher Verbrechen – und vor allem über den entsprechenden Apparat zu deren Bekämpfung.
Die Nachricht erreichte die Spezialabteilung am Oakwoods Cemetery in der 71st Straße East schon nach wenigen Sekunden. Sie wurde sofort zum Zimmer des Chef-Inspektors durchgegeben.
Aber der große Eliot Ness, der seit einer Reihe von Monaten der Spezialabteilung hier am Oakwoods Cemetery vorstand, war nicht anwesend. Zusammen mit seinem Stellvertreter, Pinkas Cassedy, war Ness am frühen Vormittag nach Indianapolis geflogen, um da die Fährte eines Gangsters aufzunehmen, der in Chicago eine Frau ermordet hatte. Es handelte sich um den zweiunddreißigjährigen Bulgaren Jordan Belgareff.
Da die Vorschriften des FBI verlangten, daß in Abwesenheit des Chef-Inspektors und auch seines Stellvertreters ein Sonderinspektor die Angelegenheiten des Bureaus wahrzunehmen hatte, war am frühen Morgen mit einer Kuriermaschine von Detroit der dreiundvierzigjährige Inspektor Durbridge herübergeflogen. Es war das erste Mal, daß Inspektor Durbridge den berühmten Eliot Ness zu vertreten hatte. Er war ein ehrgeiziger, hagerer, ungeliebter Mann, der mehrfach vom Amt A 1 in Washington, den Auftrag erhalten hatte, in Cincinnati, Cleveland, Rochester, Pittsburgh und Columbus die dort abwesenden leitenden Inspektoren zu vertreten. Offensichtlich war man oben in Washington der Ansicht, daß dieser Mann nicht nur ehrgeizig, sondern auch tüchtig war.
Eine halbe Stunde nach Erhalt der Meldung traf Durbridge mit Ted
O’Keefe, Daniel O’Connor und Joseph Lock am Sherman-Park ein. Mit dem ihm eigenen Eifer und einer etwas zu arroganten Manier – wie Joseph Lock fand – setzte Durbridge die Untersuchungen in Gang.
Zunächst wurden die im dortigen Distrikt bekannten Verbrecher festgesetzt. Es handelte sich da gleich um sieben Leute, die schon einmal etwas mit Kidnapping zu tun gehabt hatten. Des weiteren ließ Durbridge sofort nach Geraldine Pages Bericht den Maroniverkäufer Cesar Isella suchen und zwecks Vernehmung zum Amt bringen.
O’Connor mußte eine vollkommene Liste der Hausbewohner anfertigen. Dabei stellte sich heraus, daß nur drei Geschosse als Wohnungen vermietet waren, die übrigen acht als Büroräume. In den drei Wohnetagen stand eine Wohnung leer, und zwar die über der von Dr. Griffith gelegene. Bis vor einem Monat hatte dort ein Dr. Croci gewohnt, der für ein Geldinstitut arbeitete, aber kürzlich nach Tennessee verzogen war. Gegenüber der Familie Griffith wohnte die achtundsechzigjährige Mrs. Diana Midland, eine alleinstehende Frau, die seit sieben Jahren verwitwet war und mit ihrem Dackel allein in der großen Wohnung lebte. Über ihr wohnte Walt Cramer, ein deutschstämmiger Handelsvertreter von sechsundvierzig Jahren mit seiner vierunddreißigjährigen Frau Joana und seiner sechzehnjährigen Tochter Carol. Über den Cramers lebte die neunundvierzigjährige Mrs. Pullinger mit ihrem dreiundzwanzigjährigen Sohn Roy.
Auf der anderen Seite wohnten unten die Griffiths, darüber die Wohnung stand wie gesagt leer, und im dritten Geschoß lebte ein Ausländer namens Storgoff, ein einundfünfzigjähriger Mann, der sich als Privatier hatte eintragen lassen. Oben im siebten Geschoß lebte in drei Zimmern noch eine Mrs. Duncer, eine sechsundsechzigjährige Frau, mit ihrem siebenundzwanzigjährigen Neffen Edward. Mrs. Duncer hatte von der Versicherungsgesellschaft, die die acht übrigen Geschosse belegte, den Portiersposten bekommen.
Inspektor Durbridge, der sich schon lange einen solchen Fall gewünscht hatte, nahm sämtliche Hausbewohner unter die scharfe Lupe. Er ließ sich sogar die Listen sämtlicher Angestellten kommen, die in den acht Etagen der Versicherung beschäftigt waren; obgleich diese Leute kaum in Frage kamen, da sie an diesem Nachmittag bereits um vier Uhr das Haus verlassen hatten.
Durbridge griff mit großer Energie in den Fall ein. Er verhörte bis in den grauenden Morgen hinein die Hausbewohner und ließ sich außerdem eine Aufstellung ihrer sämtlichen Verwandten und abschließend auch von allen Bekannten beschaffen.
Um elf Uhr sechzehn am nächsten Vormittag schritt Inspektor Durbridge zur Verhaftung des dreiundzwanzigjährigen Edward Duncer. Er hatte herausgebracht, daß Duncer vor fünf Jahren zu einer Bande gehört hatte, die am Westrand von Chicago Autos geknackt und sich einmal auch an der Verschleppung eines Negerjungen beteiligt hatte. Wenige Minuten vor ein Uhr erschien Durbridge in der ersten Etage und verhaftete zum Schrecken von Walt und
Joana Cramer auch deren Tochter Carol.
»Was hat denn das zu bedeuten?« fragte der Handelsvertreter entsetzt. »Sie bringen doch nicht allen Ernstes meine Tochter mit dem Verschwinden des kleinen Joe in Verbindung, nur weil sie ein paarmal mit ihm gesprochen hat?«
»Hat sie nur mit ihm gesprochen, Mr. Cramer?« forschte Durbridge scharf.
»Nun ja, sie hat auch sicher mal mit ihm gespielt.«
»Hat sie ihm nicht auch Bonbons gegeben?«
»Das kann schon sein.«
»Ist das nicht schon mehrfach geschehen?«
»Weshalb nicht? Der kleine Junge war drollig, und wenn ich ein Mädchen von sechzehn Jahren wäre, so könnte es mir wohl auch in den Sinn kommen, einem kleinen, netten, pausbäckigen Jungen einmal ein paar Bonbons zu schenken. Was ist denn schon dabei?«
»Mr. Cramer, hindern Sie mich nicht an der Ausführung meiner Arbeit…«
Carol Cramer saß mit leichenblassem Gesicht oben in dem grauen, finsteren Bau am Oakwoods Cemetery im Vorzimmer des Chef-Inspektors und blickte auf die flinken, leichten Finger der Sekretärin, die einen endlosen Bericht abzuschreiben hatte.
Hin und wieder wurde die Tür zum Chefzimmer geöffnet, und Durbridges hageres Gesicht blickte herein.
»Ich werde Sie gleich zur weiteren Vernehmung rufen, Miß Cramer.«
Aber Durbridge ließ sich offenbar sehr viel Zeit. Es war schon fast drei Uhr am Nachmittag, als die Tür zum Korridor geöffnet wurde und ein hochgewachsener Mann eintrat, der mit einem raschen Blick das Mädchen betrachtete, das verschüchtert in einer Ecke saß.
»Wen haben wir denn da?« forschte er mit einer dunklen Stimme.
Die hübsche schwarzhaarige Ruth Everett fuhr von der Maschine auf, wurde etwas rot und sagte mit offensichtlicher Freude: »Hallo, Mr. Ness! Sie sind schon zurück?«
Carol Cramer zuckte zusammen. Das war also der berühmte Eliot Ness. Der Mann, der den fürchterlichen Nebelmörder zur Strecke gebracht hatte, der den grauenhaften Aufschlitzer gestellt und eine Reihe anderer Gangster gegriffen hatte. Im »Chicago News« hatte der Redakteur Matherley für ihn den Namen MR. CHICAGO geprägt. Bloß hatte es damals so ausgesehen, als hätte der große Matherley Eliot Ness mit diesem Namen verspotten wollen. Wenn es so war, dann war das ein Schlag ins Wasser gewesen, denn die Unterwelt Chicagos akzeptierte den Namen durchaus; für sie war dieser FBI-Mann wirklich der Feind Nummer eins.
Ja, es war Eliot Ness. Er blieb neben dem Schreibtisch seiner Sekretärin stehen, nahm den Hut ab und fuhr sich durch sein kurzgeschnittenes helles Haar. Sein Gesicht war scharfkantig, und die blauen Augen hatten etwas Zwingendes an sich.
Er sieht gut aus, dachte Carol trotz der scheußlichen Situation, in der sie sich befand.
»Das ist Miß Carol Cramer«, sagte Ruth Everett und berichtete in sachlicher Kürze, was sich ereignet hatte. Der Chef-Inspektor nickte nur, grüßte Carol kurz mit dem Kopf und ging dann weiter auf sein Zimmer zu.
Inspektor Durbridge saß hinterm Schreibtisch, hatte die nächsten Mitarbeiter von Eliot Ness alle um sich versammelt und hielt Kriegsrat. Das geschah zwar in einer so weitschweifigen Art, daß Joseph Lock gerade ärgerlich zu O’Connor gemeint hatte:
»Vielleicht sollten wir, um uns die Sache richtig klarzumachen, zunächst einmal bei Kain und Abel anfangen.«
»Hören Sie, Mr. Lock«, wies ihn Durbridge zurecht. »Wenn Sie glauben, hier an meinen Entscheidungen etwas auszusetzen zu haben, so tun Sie sich nur keinen Zwang an. Allerdings möchte ich Sie dann bitten, dies schriftlich zu tun und Ihre Eingabe an das Amt A I zu richten. Hier jedenfalls herrscht jetzt absolute Ruhe.«
»Eine Frage nur, Inspektor«, meinte Lock, »haben Sie allen Ernstes vor, das Girl wegen der Bonbons einzulochen?«
»Sie müssen es mir schon überlassen, ob ich Miß Cramer, die Sie hier als Girl bezeichnen, inhaftieren lassen werde oder nicht. Schließlich sind ausreichende Verdachtsmomente vorhanden…«
»Finden Sie?«
Durbridges Ton verschärfte sich.
»Hören Sie, Lock, ich weise Sie jetzt letztmalig darauf hin, daß…«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür. In ihrem Rahmen stand die hünenhafte Gestalt des Chef-Inspektors. Durbridge federte sofort von seinem Platz hoch und konnte nicht verhindern, daß ein Schatten über sein Gesicht flog. Nur zu deutlich spürte er das Aufatmen um sich her.
»Machen Sie nur weiter, Mr. Durbridge.«
Ein schales Lächeln zuckte um die Winkel des schmallippigen Mundes von Durbridge.
»Tja, ich bin da bei der Aufklärung eines Kapitalverbrechens, Mr. Ness. Ein Kind ist entführt worden. Drüben am Sherman-Park. Ein sechsjähriger Junge, Sohn eines Arztes. Habe bereits einen verdächtigen Mann inhaftiert, einen sogenannten Maroniverkäufer, einen Italo-Amerikaner. Heißt Isella, Cesar mit Vornamen, ist dreiundfünfzig, mehrfach wegen Landstreicherei festgenommen worden…«
»Ein harmloser Mann«, unterbrach ihn Joseph Lock furchtlos. »Er ist jedesmal wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ein Bursche, der etwas dumm dreinschaut und deshalb jedem kleinen Polizisten auffällt.«
»Mr. Lock!« zischte Durbridge erregt.
»Aber, meine Herren!« Eliot Ness hob die linke Hand um den Schreibtisch herum und vertrieb dadurch Durbridge von seinem Platz. »Mr. O’Connor, holen Sie bitte gleich Inspektor Cassedy herüber. Er wird sich freuen, heute noch Arbeit zu bekommen.«
Cassedy, der gleich nach der Rückkehr vom Flughafen in sein Zimmer gegangen war, tauchte sofort nach dem Anruf im Zimmer des Chef-Inspektors auf. Er war ein untersetzter Mann mit einem gutmütigen Gesicht, einem kahlen Schädel und grauem Haarkranz. Er hatte eine siebzehnjährige Praxis hinter sich, war ein bewährter FBI-Inspektor und hatte, als man ihm den verhältnismäßig jungen Eliot Ness hierher setzte, erst Bedenken, war aber nun seit einem halben Jahr davon überzeugt, daß dieser Eliot Ness nicht nur ein hochbegabter Mann sei, sondern auch ein Genie als Kriminalist. Und damit irrte sich der dicke Pinkas Cassedy nicht, denn dieser Eliot Ness sollte der bedeutendste Polizei-Offizier Amerikas werden.
Noch am gleichen Tag wurde Carol Cramer nach Hause geschickt. Auch der junge Edward Duncer und der Maroniverkäufer konnten wieder gehen. Eliot Ness verstand es so einzurichten, daß Durbridge keineswegs Grund hatte, darüber beleidigt zu sein. Im Gegenteil, er schickte ihn nicht gleich zurück nach Detroit, sondern nahm ihn mit auf seine nächsten Wege. Durbridge hätte dabei Gelegenheit gehabt, das Können eines wirklich bedeutenden Kriminalisten zu bewundern und einiges von ihm zu lernen – wenn er eben nicht der Mann gewesen wäre, der er war: ein egozentrischer, dünkelhafter Mensch. Solche Beamte wie er waren keine Hilfe bei der Verbrecherjagd, sie bereiteten den Gangsterbanden in Chicago den Boden ihres kriminellen Tuns. Ein Al Capone konnte sein Netzwerk ungestört organisieren und hemmungslos ausweiten. Inspektor Durbridge nahm das Treiben des gerissenen Syndikatchefs gar nicht wahr. Bis auf Eliot Ness brauchte der berüchtigte Al Capone keinen Verfolger zu fürchten. Er war zum König der Unterwelt geworden, noch ehe es seine Feinde überhaupt begriffen hatten.
*
Im Haus an der Ecke Loomis Boulevard und 52nd Straße herrschte tiefste Niedergeschlagenheit. Der Arzt ging beklommen seiner Arbeit nach, und seine schöne Frau saß zusammengebrochen in ihrem Zimmer. Geraldine Page arbeitete mit verweinten Augen in der Küche, und eigentlich war es nur die Negerin, die obenauf blieb.
Eliot Ness hatte sich die Protokolle gründlich durchgesehen, bevor er sich auf den Weg zum Sherman-Park machte. Es war kurz vor sechs Uhr am Abend. Zur Verwunderung von Durbridge und auch Cassedy, die den Inspektor begleiteten, läutete er jedoch nicht an der Wohnung der Familie Griffith, sondern gegenüber bei Mrs. Midland.
Es dauerte eine Weile, bis das Gekläff eines alten Hundes hörbar wurde; dann war der schlurfende Schritt eines Menschen zu vernehmen.
Die Tür wurde geöffnet. Mit plinkenden Augen blickte die gebeugte weißhaarige Frau den Inspektor an.
»Was gibt’s?«
»Mein Name ist Ness, Mrs. Midland. Darf ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen?«
»Was wollen Sie?«
»Ich bin vom FBI und…«
»FBI?« Sie furchte die Stirn und deutete auf Durbridge. »Ja, genügt es denn nicht, daß mich der Mann da schon belästigt hat? Ich habe keine Zeit.«
»Es tut mir leid, Madam, aber ich muß mit Ihnen sprechen.«
»Was soll das heißen? Ich will doch nicht hoffen, Mister, daß Sie mich mit dieser Sache in Verbindung bringen. Ich habe mit dem Jungen nicht das mindeste zu tun. Überhaupt mag ich Kinder…«
»Ich weiß, daß Sie keine Kinder mögen, Mrs. Midland«, entgegnete der Inspektor kühl.
»Was soll das heißen?« giftete die Frau.
»Ich denke da an den kleinen Ferry Codyna, den Sie damals, vor vierzehn Jahren, oben in Cicero mit einem Schirm geschlagen haben…«
»Ach«, machte Mrs. Midland und fuhr einen Schritt zurück.
»So, diese alte Geschichte haben Sie ausgegraben. Typisch für die Polizei. Na ja, der Bengel hat mir allerhand Streiche gespielt. Sie wollen doch wohl nicht wegen dieser lächerlichen Bagatelle jetzt behaupten, daß ich etwas mit dem Verschwinden dieses Jungen zu tun haben könnte?«
»Ob es eine lächerliche Bagatelle war, Madam, kann ich nicht beurteilen. Fest steht jedoch, daß es keine einmalige Sache war.«
»Was wollen Sie damit sagen? Das ist doch wohl eine Unverschämtheit! Ich werde mich über Sie beschweren. Wie ist doch gleich Ihr Name?«
»Ness«, entgegnete der Inspektor ruhig.
»Ich möchte Sie bei dieser Gelegenheit an die kleine Pouline Martens erinnern und den kleinen Jonas Hanegger. Sie hatten mit den Eltern der beiden Kinder ebenfalls ziemlichen Ärger, wenn ich recht unterrichtet bin.«
Eine fahle Blässe flog jetzt über das Gesicht der alten Frau.
»So, das haben Sie also auch ausgekramt.«
»Sie dürfen es uns nicht übelnehmen, Mrs. Midland. Es sind Dinge, die nun einmal geschehen sind.«
»Ja und? Sind Sie gekommen, um mir diese alten Kamellen vorzuhalten?«
»Keineswegs. Ich sagte ja, daß ich mit Ihnen sprechen muß.«
»Ich möchte bloß wissen, was es da zu sprechen gibt. Na gut, kommen Sie herein.«
Die drei Beamten traten in den dunklen Korridor, aus dem ihnen ein unangenehmer Hundegeruch entgegenschlug. Die Frau zündete einen Armleuchter an der Wand an, blieb dann stehen und machte nicht die geringsten Anstalten, die G-men in den Wohnraum zu führen.
»Was also?« knurrte sie barsch.
»Sie kannten den Jungen, Mrs. Midland.«
»Was heißt, ich kannte ihn? Ich habe ihn im Treppenhaus gesehen, wie ihn jeder andere hier im Haus auch gesehen hat. Das war alles. Und mir reichte sein Gekläff, das er immer im Hausflur machte. Außerdem ließ er drüben die Tür immer so hart ins Schloß fallen, daß man zusammenzuckte wie unter einem Schlag.«
Das Gekläff kam jetzt von dem alten Dackel, dem es offensichtlich nicht gefiel, daß Mr. Cassedy zu nahe bei seinem Korb stand.
»Haben Sie den Jungen gestern abend gesehen, Mrs. Midland?«
»Der Bengel interessiert mich überhaupt nicht. Was kümmern mich solche Bälger…«
Der Inspektor hatte sich zur Seite gewandt, ging zur Tür, blieb da noch einmal stehen und meinte:
»Mrs. Midland, ich muß Sie bitten, das Haus und vor allem die Stadt nicht zu verlassen, ohne sich mit uns in Verbindung gesetzt zu haben.«
Die Frau schluckte und blickte mit zusammengepreßten Lippen hinter den drei Männern her.
Bevor der Inspektor drüben den Finger auf den Klingelknopf neben dem Schild »Dr. Griffith« setzte, tauschte er einen Blick mit Cassedy. Der zog seine massigen Schultern hoch und ließ sie wieder fallen.
»Sie wollen noch mit den Griffiths sprechen?« fragte Durbridge rasch.
»Ich hatte es vor«, versetzte Ness.
»Ich meine, die Leute sind furchtbar genug betroffen von dem Unglück, Mr. Ness. Vielleicht sollte man ihnen etwas Ruhe gönnen. Ich habe sie sehr lange verhört.«
»Tut mir leid, Mr. Durbridge«, entgegnete Eliot Ness und drückte auf den Klingelknopf.
Die Tür wurde schon nach wenigen Sekunden geöffnet. Geraldine Page stand mit blassem Gesicht und verweinten Augen da und blickte die Männer fragend an. Dann erkannte sie Inspektor Durbridge.
Der sagte sofort: »Das ist Miß Page…«
Im Hintergrund des Korridors wurde im gleichen Moment die Tür zum Wohnzimmer geöffnet. Vera Griffith trat heraus.
»Inspektor, da sind Sie ja«, sagte sie und kam mit raschen Schritten auf Durbridge zu.
Der schluckte und deutete mit einer Handbewegung auf Eliot Ness.
»Das ist Mr. Ness, Mrs. Griffith…«
Da tauchte der Arzt in der Zwischentür zu den Praxisräumen auf. Er war ein großer, schlanker Mensch mit tiefliegenden Augen und einem ernsten, etwas hohlwangigen Gesicht. Er trug seinen weißen, bis zum Hals geschlossenen Arztkittel und kam mit raschen Schritten heran.
»Eliot Ness?« fragte er sofort.
Da hielt Vera Griffith ihrem Mann einen Zettel hin.
»Da, das habe ich eben bekommen!« stieß sie hervor.
Dr. Griffith warf einen kurzen Blick darauf und reichte das Blatt dann sofort dem Polizei-Offizier.
Es war ein halb durchgetrennter Papierbogen, auf den ausgeschnittene Druckbuchstaben geklebt waren.
50 000 in kleinen Scheinen bereitmachen.
Die Polizei aus dem Spiel lassen.
Weitere Nachricht folgt.‹
Der Inspektor reichte den Zettel an Pinkas Cassedy weiter.
»Haben Sie auch den Umschlag?« forschte er.
Die Frau nickte. »Ja, er liegt drinnen auf dem Wohnzimmertisch. Miß Page, holen Sie ihn.«
Auch den Umschlag nahm Pinkas Cassedy an sich.
»Wann ist denn das gekommen?« wollte Ness wissen.
»Eben, vor ein paar Minuten«, sagte die Frau.
»Wieso, jetzt kommt doch gar keine Post.«
»Der Brief lag vorn an der Tür. Ich habe ihn zufällig gesehen, als ich aus dem Badezimmer kam.«
Die Frau sank auf einen kleinen englischen Sessel und stützte den Kopf in beide Hände.
Ein Weinkrampf erschütterte ihren Körper.
»Bitte, versuchen Sie doch, sich zu beruhigen, Mrs. Griffith«, sagte Durbridge, der zu ihr herangetreten war. »Es wird sich alles aufklären, wir haben den Fall ja schon fest in Händen. Doktor, Sie sollten Ihrer Frau ein Beruhigungsmittel geben.«
Als die drei Männer vom FBI wieder auf der Straße waren, meinte Durbridge:
»Also ein echter Fall von Kidnapping. Fünfzigtausend Dollar, ein ganz schöner Batzen Geld! Der Kerl weiß, wo er es zu holen hat.«
»Er scheint es mir im Gegenteil gar nicht zu wissen«, entgegnete Eliot Ness, während er auf seinen alten Ford zuging und die Tür öffnete.
»Wie kommen Sie denn darauf?« krächzte Durbridge, der sich auf den hinteren Sitz quetschte, da Pinkas Cassedy selbstverständlich den Beifahrersitz einnahm.
Der Chef-Inspektor warf den Motor an und startete, während er antwortete:
»Weil Dr. Griffith keineswegs ein so reicher Mann ist, daß er eine solche Summe ohne weiteres zahlen könnte. Doch weshalb haben Sie keinen Mann in der Nähe der Wohnung postiert, Mr. Durbridge?«
»Wozu sollte ich das?« knurrte Durbridge aufsässig. »Was könnte uns das für einen Nutzen bringen?«
»Immerhin den«, brummte Cassedy, »daß wir jetzt den Mann hätten, der den Brief gebracht hat.«
Durbridge nagte ärgerlich an der Unterlippe. Da hatte dieser Eliot Ness sich also keineswegs so unvorbereitet hierher begeben, nicht nur die Verfehlungen von Mrs. Midland hatte er inzwischen herausgebracht, sondern auch bereits festgestellt, daß Dr. Griffith keineswegs ein reicher Mann war. Man hätte sich das denken können; schließlich war der MR. CHICAGO ja bereits bekannt dafür, immer mehr zu wissen als andere.
*
Wieder war es dunkel geworden. Der Himmel hatte sich mit Wolken bezogen, und fadendünn fiel der Regen. Die Autos surrten zischend über den spiegelglatten Asphalt. An der Ecke der 54. Straße zum Loomis Boulevard trat ein Mann aus einem Hausgang. Er trug einen dunklen Regenmantel, einen Hut und hatte den Kragen hochgeschlagen. Beim Gehen zog er den rechten Fuß etwas nach.
Es war nicht sehr weit bis hinüber zur Garfield-Straße, von wo der Mann rechts in die Racine Avenue abbog. Er machte vor dem dritten Anwesen auf der rechten Seite halt. Es war Gommeds Großgarage.
Der Hinkende tauchte im Dunkel des Hofes unter und stahl sich an den Garagentoren vorbei auf den Eingang neben dem Büro zu. Es war der Hauseingang. Hier blieb er lauschend stehen.
Von oben klang das Lachen eines Kindes herunter. Der Mann ging weiter die Treppe hinauf bis zum ersten Stock, wo ein Teil der Wohnung der Familie Gommed lag.
Die Wohnungstür war verschlossen.
Der Hinker ging bis zum nächsten Treppenabsatz und blieb da stehen.
Fast zwanzig Minuten verharrte er reglos auf der Stelle, dann wurde die Wohnungstür geöffnet, und ein kleines, etwa fünfjähriges Mädchen kam heraus und lief die Treppe hinunter.
»Gaby!« rief eine Frauenstimme. »Wirst du wohl sofort heraufkommen! Es geht jetzt ins Bett!«
Das Mädchen hielt inne und kam dann langsam zurück.
»Ja, ist gut…«
Das Licht im Treppenhaus flammte auf. Der Hinker hatte die Tür geöffnet, die sich hinter ihm befand; es war der Eingang zur Toilette, die hier, wie es in alten Häusern üblich war, auf dem Halbgeschoß untergebracht war.
Mit tapsigen Schritten kam das kleine Mädchen ein paar Treppenstufen herauf, legte dann die Arme über das Geländer und rief:
»Komm, Mutti, ich will sehen, wer zuerst oben ist.«
»Ich komme auch gleich«, rief da die Stimme eines Mannes aus der Wohnung.
»O ja, Papi!«
Der Hinker verharrte bewegungslos hinter der nur angelehnten Tür. Plötzlich machte das kleine Mädchen mehrere Schritte vorwärts, bis zu dem Treppenabsatz. In dem Moment, in dem es an der Toilettentür vorbei wollte, flog diese auf, der Mann kam heraus, packte das Kind, preßte ihm die Linke auf den Mund und zerrte es mit der Rechten in die Toilette.
Nicht ganz dreißig Sekunden später kam unten die neunundzwanzigjährige Elizabeth Gommed aus der Wohnungstür und stieg die Treppe hinauf. Als sie oben die Tür zu den Schlafräumen verschlossen fand, schüttelte sie ärgerlich den Kopf.
»Gaby, mach sofort auf!«
Sie erhielt keine Antwort, klopfte heftig gegen das Ornamentglas, das in die Tür eingelassen war und rief:
»Du machst jetzt sofort auf, Gaby, sonst kannst du was erleben.«
Aber die kleine Gabriela Gommed konnte die Tür nicht öffnen, denn sie hatte den oberen Teil der Wohnung der Familie Gommed gar nicht betreten. Sie war nicht mehr dazu gekommen.
Der Hinker hatte sie in die Toilette gezogen und war von dort aus durch das Fenster auf die Brandleiter gestiegen. Unbemerkt hatte er das Anwesen verlassen können, noch ehe die Familie Gommed ahnte, was sich da ereignet hatte.
Wieder war ein Kind entführt worden. Und niemand ahnte, wer der Mann war, der da im Dunkel der beginnenden Nacht zuschlug wie ein Raubtier.
In der Frühe des nächsten Morgens fand der Garagenbesitzer Jean Gommed unter seiner Bürotür einen Brief, in dem er aufgefordert wurde, 50 000 Dollar in kleinen Scheinen bereitzuhalten, die Polizei aus »der Sache« zu lassen und weitere Nachricht abzuwarten.
Ein würgendes Gefühl stieg dem beleibten Garagenhalter in die Kehle, als er nach dieser furchtbaren Nacht im Morgengrauen unten im Büro den Zettel fand.
Sofort griff er zum Telefon, um die Nummer des FBI zu wählen. Bis zwei Uhr war Eliot Ness hier im Haus gewesen und hatte ihm dann seine Nummer zurückgelassen, mit dem Ersuchen, ihn sofort anzurufen, wenn sich irgend etwas ereignen sollte.
Aber Jean Gommed ließ den Hörer in der Gabel, nahm die Hand zurück, als könnte er sich an dem schwarzen Griff des Apparates verbrennen. Langsam ging er in den anschließenden Raum und öffnete den Tresor, der hinter seinem Hochzeitsbild in die Wand eingelassen war. Es war nur ein kleiner Tresor, in dem er seine Wertpapiere aufhob.
Sobald die Banken geöffnet hatten, war er am Schalter. Mit 20 000 Dollar in kleinen Scheinen verließ er das Bankhaus.
Wenige Minuten nach halb zehn tauchte Eliot Ness auf dem Garagenhof auf.
Gommed war eben erst von der Bank zurückgekehrt und hatte die Tasche mit dem Geld drinnen auf seinem Schreibtisch liegen.
»Irgend etwas Neues?« Der Blick des FBI-Mannes flog forschend über das Gesicht des Garagenhalters.
»Nein – nein, nichts, Inspektor.«
»Gut, wenn etwas ist, dann geben Sie mir bitte Bescheid.«
»Hören Sie, Inspektor«, rief Gommed da dem Davonschreitenden nach, »wird der Hof eigentlich bewacht?«
»Ja, natürlich.«
Damned, wie war es dem Verbrecher bloß gelungen, in den Hof zu kommen und den Brief unter die Bürotür zu schieben?
Erst nach längerem Überlegen kam Gommed darauf, daß der Kidnapper den Brief, gleich nachdem er mit dem Kind das Haus verlassen hatte, unter die Bürotür geschoben haben mußte. Wie sicher mußte der Mann sich seiner Sache gewesen sein!
»Da war vor ein paar Tagen ein Mann hier, der Postkarten verkaufte«, hatte die Mutter des entführten Kindes dem Inspektor erklärt, nachdem sie sich von dem Nervenschock, den sie erlitten hatte, etwas erholt zu haben schien. Aber sie konnte sich an den Mann nicht näher erinnern und ihn auch nicht beschreiben.
»Kam er abends?« forschte der G-man?
»Ja, ich glaube, es war abends.«
*
Es war am Abend dieses Tages. Wieder fiel feiner Sprühregen aus grauen, pulvrigen Wolken auf die Dächer und den Asphalt der Weltstadt nieder.
Am Rand eines Parkweges stand hinter einem Gebüsch ein hochgewachsener Mann und blickte auf den spiegelglatten Asphalt der Straße hinaus. Die Autos zogen zischend vorüber, und die Gehsteige waren fast leer. Schon seit anderthalb Stunden stand Eliot Ness hier und beobachtete die Racine Street. Er konnte die breite Hofeinfahrt von Gommeds Garage genau übersehen.
Immer wieder tauchten Menschen auf, die jedoch das Anwesen der Gommeds passierten und wieder im Dunkel der Nacht verschwanden.
Dann kam eine Frau. Sie blieb an einem Papierkorb vorn am Straßenrand stehen, kramte darin herum und ging weiter, bis sie Gommeds Hof erreicht hatte. Sie blickte die Straße hinunter, lauschte in den Hof und war gleich darauf im Dunkel vor den Garagentoren verschwunden.
Nur etwa fünfundzwanzig Sekunden später war Eliot Nesse ebenfalls im Dunkel des Garagenhofes.
Eine Ölbüchse fiel scheppernd auf den Zement des Hofes. Das Geräusch brach sich scharf an den kahlen Wänden. Gleich darauf war ein leiser Fluch zu hören.
Angespannt blickte der Inspektor zu der Gestalt hinüber, die jetzt mit raschen Schritten den Eingang zur Straße zu erreichen suchte. Es war die Frau. Sie blickte sich nach allen Seiten um und nahm dann das Bündel, das sie neben sich hinter dem Hoftor abgestellt hatte, auf, um zu verschwinden.
In diesem Augenblick legte sich ihr eine Hand auf die Schulter.
Entgeistert fuhr sie herum.
»Polizei. Kommen Sie mit.«
Willenlos trottete die Frau vor dem Inspektor her in den Hof auf die großen Fässer zu.
»Was haben Sie hier gesucht?«
»Ich – lieber Himmel, jetzt ist’s also wieder soweit. Erst dreiundzwanzig Tage bin ich aus dem Knast, und jetzt soll ich schon wieder rein?«
»Was hatten Sie zu suchen?«
»Was schon, natürlich Werkzeug.«
»Werkzeug?«
»Ja.«
»Wieso denn hier im Abfall?«
»Manchmal wirft einer der Monteure Werkzeug mit den Büchsen weg.«
Das war doch wohl mehr als unwahrscheinlich. Eliot Ness brauchte zehn Minuten, bis er die Wahrheit aus der Frau heraus hatte: Einer der Angestellten stahl tagsüber irgendwelche Werkzeugstücke und brachte sie drüben bei den Tonnen unter den Abfall. Die Alte, die seine Schwester war, holte das Zeug dann nach Einbruch der Dunkelheit dort ab.
»Wie heißt der Mann?«
»Victor Vicennes.«
Es handelte sich um den Sohn eines französischen Auswanderers, der seit achtundzwanzig Jahren mit seiner alkoholsüchtigen Schwester in den Staaten lebte und schon mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft war. Der gutmütige Garagenhalter hatte ihn trotz schlechter Zeugnisse aufgenommen, da er Mangel an Arbeitskräften hatte.
Eliot Ness verlor durch diesen Zwischenfall kostbare Zeit. Als er an seinen Platz am Ende des Parkweges zurückkam, war es fast elf Uhr. Der Regen war stärker geworden und rann ihm am Hals vorbei durch den Kragen auf den Körper.