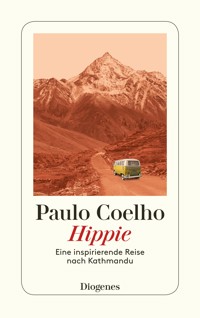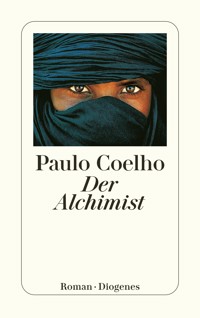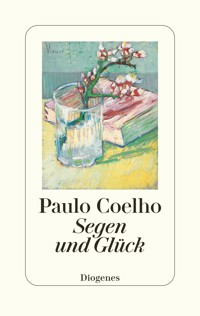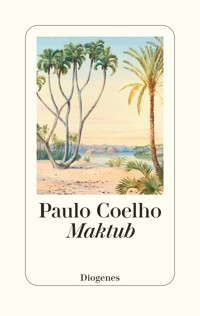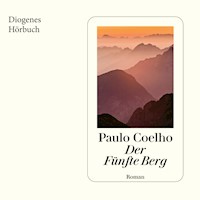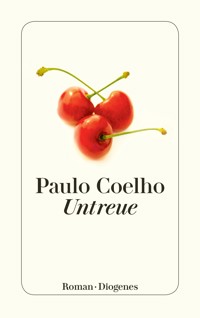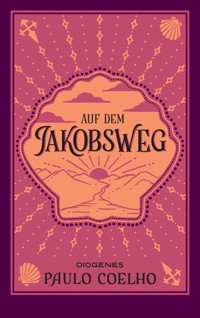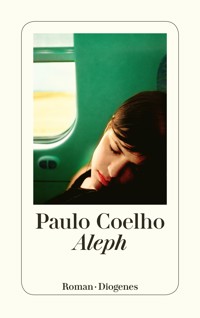
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Transsibirischen Eisenbahn begegnet ein Schriftsteller einer jungen Stargeigerin – und gleichzeitig einer dunklen Seite seines früheren Lebens. Er gerät in ein Paralleluniversum, in dem Zeit und Raum zusammenfallen – das ›Aleph‹. Und er erkennt seine Chance, eine alte Schuld zu bewältigen und sein Leben noch einmal neu zu beginnen. Kann man seine Vergangenheit zurücklassen wie einen Bahnhof, aus dem man gerade hinausfährt? Kann man sich selbst neu entdecken wie ein fremdes, neues Land?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Paulo Coelho
Aleph
RomanAus dem Brasilianischen vonMaralde Meyer-Minnemann
Titel der 2010 bei
Editora Sextante, Rio de Janeiro,
erschienenen Originalausgabe: ›O Aleph‹
Copyright © 2010 by Paulo Coelho
Mit freundlicher Genehmigung von
Sant Jordi Asociados, Barcelona, Spanien
Alle Rechte vorbehalten
Paulo Coelho: www.paulocoelho.com
Die deutsche Erstausgabe erschien 2012 im Diogenes Verlag.
Das Motto von Jorge Luís Borges
ist folgender Ausgabe entnommen:
Jorge Luís Borges, Gesammelte Werke in
zwölf Bänden. Band 5: Der Erzählungen erster Teil
Universalgeschichte der Niedertracht. Fiktion. Das Aleph
Herausgegeben von Gisbert Haefs und Fritz Arnold
Aus dem Spanischen von Karl August Horst,
Wolfgang Luchting und Gisbert Haefs
Copyright © 2000 Carl Hanser Verlag GmbH & Co KG, München
Mit freundlicher Genehmigung
Covermotiv: Foto von age fotostock
Copyright © age fotostock/LOOK-foto
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2022
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24242 3
ISBN E-Book 978 3 257 60253 1
[5] Für J., der dafür sorgt, dass ich nicht stehen bleibe.
Für S. J., die mich weiterhin beschützt.
Für Hilal, weil sie mir in der Kirche in Nowosibirsk vergeben hat.
Heilige Maria, ohne Sünden empfangen, bete für uns, die wir uns an dich wenden. Amen.
[6] Im Durchmesser mochte das Aleph zwei oder drei Zentimeter groß sein, aber der kosmische Raum war darin, ohne Minderung seines Umfangs. Jedes Ding […] war eine Unendlichkeit von Dingen, weil ich sie aus allen Ecken des Universums deutlich sah.
Jorge Luís Borges,Das Aleph
Du weißt alles; ich kann nicht sehen.
ich hoffe, nicht vergeblich zu leben,
ich weiß, dass wir uns wiedersehen
[9] König meines eigenen Reiches
Nein! Bloß kein neues Ritual! Nicht schon wieder eine rituelle Anrufung! Bloß nicht wieder unsichtbare Kräfte bitten, dass sie sich in der sichtbaren Welt manifestieren! Was hat das mit der Welt zu tun, in der wir heute leben? Junge Leute schließen ihr Studium ab und finden keine Arbeit. Die Alten gehen in Rente, und das Geld reicht hinten und vorn nicht. Und diejenigen, die arbeiten, haben keine Zeit zum Träumen – sie rackern sich von früh bis spät ab, um ihre Familie zu ernähren, die Ausbildung der Kinder zu bezahlen, im ständigen Kampf mit der sogenannten »harten Realität«.
Noch nie war die Welt so in Aufruhr wie heute: religiöse Kriege, Völkermord, fehlende Achtung vor unserem Planeten, Wirtschaftskrisen, Depression, Armut. Und für all diese Probleme – und für die eigenen – erwarten alle schnelle Lösungen. Wenn es darum geht, wenigstens ein paar der Probleme, die die Welt oder das eigene Leben betreffen, zu lösen, wollen alle gleich Ergebnisse sehen. Aber die Zukunft sieht immer düsterer aus.
Und ausgerechnet jetzt soll ich mich mit einer spirituellen Tradition auseinandersetzen, deren Ursprung in einer fernen Vergangenheit, weit weg von den Herausforderungen unserer Zeit zu finden ist?
[10] Mit J., den ich meinen Meister nenne, obwohl ich an diesem Status langsam zu zweifeln beginne, gehe ich auf die heilige Eiche zu, die seit mehr als fünfhundert Jahren unbeeindruckt Zeuge der menschlichen Leiden ist; einzig bestrebt, im Herbst ihre Blätter abzuwerfen und sie im Frühjahr wieder wachsen zu lassen.
Ich mag nicht länger über mein Verhältnis zu J. schreiben, der mich in jene spirituelle Tradition eingeführt hat. Ich besitze zig Tagebücher voller Notizen zu unseren Gesprächen, die ich nie wieder lesen werde. Seit ich ihm 1982 in Amsterdam zum ersten Mal begegnet bin, habe ich etliche hundert Male verlernt zu leben und es wieder neu erlernt. Wenn mich J. etwas Neues lehrt, glaube ich jedes Mal, dass dies möglicherweise der letzte Schritt ist, um den Gipfel des Berges zu erreichen, die Note, die der Schlüssel zu einer ganzen Symphonie ist, das Wort, das ein ganzes Buch zusammenfasst. Die daraus folgende Euphorie klingt jedoch nach und nach ab. Einiges bleibt für immer, doch die meisten Übungen, Rituale, Lehren verschwinden irgendwann in einem schwarzen Loch. Jedenfalls kommt es mir so vor.
* * *
Der Boden ist nass, meine Turnschuhe, erst vor zwei Tagen gründlich gereinigt, werden gleich wieder voller Schlamm sein, egal, wie sehr ich mich in Acht nehme. Meine Suche nach Wissen, innerem Frieden und der Bewusstheit für die Wirklichkeit – die sichtbare wie unsichtbare – ist bereits zur Routine geworden und bringt mich nicht mehr weiter. Im Alter von zweiundzwanzig Jahren habe ich mich der [11] Magie verschrieben; es waren wichtige Jahre für mich, in denen ich viele Wege eingeschlagen habe. Zeitweise bewegte ich mich am Rande des Abgrunds, strauchelte, stürzte, war nahe daran aufzugeben und fing wieder von vorn an. Mit neunundfünfzig Jahren, so hatte ich mir immer vorgestellt, würde ich längst dem Paradies und jenem inneren Frieden nahe sein, wie ich ihn im Lächeln buddhistischer Mönche zu erkennen glaubte.
Tatsächlich scheine ich davon weiter entfernt zu sein denn je. Ich bin mit mir nicht im Reinen. Immer wieder hadere ich mit inneren Konflikten, manchmal über Monate hinweg. Wenn ich es schaffe, in eine magische Realität einzutauchen, dann gerade lange genug, um zu spüren, dass diese andere Welt existiert, und um frustriert zu sein, weil es mir nicht gelingt, alles in mir aufzunehmen, was ich dort erfahre.
Wir sind beim Baum angekommen.
Wenn das Ritual beendet ist, werde ich ernsthaft mit J. reden. Wir legen beide unsere Hände an den Stamm der heiligen Eiche.
* * *
J. spricht ein Sufi-Gebet:
»Allmächtiger Gott, wenn ich den Stimmen der Tiere, dem Rascheln des Laubs, dem Murmeln des Wassers, dem Zwitschern der Vögel, dem Brausen des Windes oder dem Grollen des Donners lausche, dann höre ich Dich in allem; ich spüre, dass Du die höchste Macht, die Allwissenheit, die höchste Weisheit, die höchste Gerechtigkeit bist.
[12] Allmächtiger Gott, ich erkenne Dich in den Prüfungen, die ich durchstehe. Möge Deine Freude auch meine Freude sein. Gestatte, dass Deine Zufriedenheit auch meine Zufriedenheit sei. Lass mich Deine Freude sein, jene Freude, die ein Vater an seinem Kind hat. Und lass mich auch dann ruhig und entschlossen Deiner gedenken, wenn es mir schwerfällt, zu sagen, dass ich Dich liebe.
Normalerweise würde ich in einem solchen Moment sekundenlang jene Präsenz spüren, die Sonne und Erde bewegt und die Sterne an ihrem Platz hält. Aber heute möchte ich nicht mit dem Universum sprechen; heute möchte ich nur, dass der Mann an meiner Seite mir die Antworten gibt, die ich brauche.
* * *
J. nimmt die Hände vom Stamm der Eiche, und ich tue es auch. Er lächelt mich an, und ich erwidere sein Lächeln. Wir gehen schweigend und ohne Hast zu meinem Haus, setzen uns auf die Veranda und trinken einen Kaffee, immer noch schweigend.
Ich betrachte den riesigen Baum in der Mitte meines Gartens, um dessen Stamm ich aufgrund eines Traums ein Band gewunden habe. Wir befinden uns im Dorf Saint-Martin in den französischen Pyrenäen in einem Haus, dessen Kauf ich inzwischen bereue; da nicht ich das Haus, sondern das Haus mich besitzt. Es fordert meine Anwesenheit, wann immer möglich, denn damit es seine Energie bewahrt, muss sich jemand darum kümmern.
»Es gelingt mir nicht mehr, mich weiterzuentwickeln«, [13] sage ich zu J. und bin damit wie immer in die Falle getappt, stets als Erster das Wort ergreifen zu müssen. »Ich glaube, ich bin an meine Grenzen gelangt.«
»Seltsam. Ich habe mein Leben lang versucht herauszufinden, wo meine Grenzen sind, und habe sie bis heute nicht erreicht. Und dabei erweitert sich mein Horizont auch noch ständig und ist mir ganz und gar nicht dabei behilflich, mein persönliches Universum ganz kennenzulernen«, provoziert mich J.
Das war ironisch gemeint, aber ich fahre unbeeindruckt fort.
»Warum bist du heute hier? Du versuchst mich wie immer davon zu überzeugen, dass ich mich irre. Du kannst sagen, was du willst, aber Worte werden daran nichts ändern: Ich bin nicht glücklich.«
»Genau deswegen bin ich gekommen. Ich spüre das schon eine ganze Weile. Aber man muss den richtigen Augenblick zum Handeln abwarten«, sagt J., nimmt eine Birne vom Tisch und betrachtet sie von allen Seiten. »Hätten wir eher miteinander geredet, wärest du noch nicht reif dafür gewesen. Würden wir später reden, wärest du inzwischen verdorben.«
Er beißt in die Frucht. »Genau der richtige Zeitpunkt«, sagt er genießerisch.
Ich lasse nicht locker: »Ich habe viele Zweifel. Besonders an meinem Glauben.«
»Großartig. Der Zweifel treibt den Menschen an.«
Wie immer die passenden Antworten, die passenden Bilder, aber heute verfehlen sie ihre Wirkung.
»Ich werde dir sagen, was du fühlst«, fährt J. fort. »Dass [14] alles, was du gelernt hast, keine Wurzeln geschlagen hat, dass du zwar imstande bist, in das magische Universum einzutauchen, es dir aber nicht gelingt, dort zu verweilen. Dass dies alles möglicherweise nichts weiter als eine einzige Illusion ist, geschaffen vom Menschen, um sich der Angst vor dem Tode zu erwehren.«
Doch es ist schlimmer als das: Ich zweifle an meinem Glauben. Alles, was ich sicher weiß, ist, dass es ein paralleles spirituelles Universum gibt, das an die Welt, in der wir leben, anschließt. Der ganze Rest – heilige Bücher, spirituelle Führer, Handbücher, Zeremonien –, all das kommt mir absurd vor. Und, was noch schlimmer ist, sie scheinen keine bleibende Wirkung zu haben.
»Ich werde dir erzählen, wie es mir ergangen ist«, fährt J. fort. »Als junger Mann war ich von all den Dingen, die das Leben zu bieten hatte, vollkommen geblendet und habe gedacht, ich müsste nur danach greifen. Nach meiner Hochzeit musste ich mich für einen einzigen Weg entscheiden, um meine Frau, die ich liebe, und meine Kinder zu versorgen. Mit fünfundvierzig war ich ein sehr erfolgreicher Manager, die Kinder erwachsen und aus dem Haus, und ich hatte das Gefühl, als würde von nun an alles nur noch eine Wiederholung dessen sein, was ich bereits erlebt hatte.
Da begann meine spirituelle Suche. Ich bin ein disziplinierter Mensch und habe all meine Kraft darauf verwendet. Es gab Zeiten, da war ich voller Begeisterung, und Zeiten, in denen mich der Glaube verließ, und irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich mich so fühlte wie du heute.«
»Ja, trotz all meiner Bemühungen kann ich nicht [15] behaupten, dass ich Gott und mir selber näher gekommen wäre«, sage ich mit kaum verhohlener Bitterkeit.
»Das kommt daher, dass du wie alle anderen Menschen auf diesem Planeten glaubst, die Zeit würde dich lehren, wie du dich Gott nähern kannst. Aber die Zeit lehrt nichts; sie bewirkt nur, dass wir uns erschöpft und alt fühlen.«
Die Eiche scheint mich jetzt anzusehen. Sie steht bestimmt seit mehr als fünfhundert Jahren dort, und das Einzige, was sie in dieser Zeit gelernt hat, ist, an einem Ort zu verharren.
»Warum haben wir an der Eiche ein Ritual abgehalten? Wie soll uns das helfen, zu besseren Menschen zu werden?«
»Ebendeshalb, weil die Menschen heute keine Rituale mehr an Eichen durchführen. Und weil durch scheinbar absurde Rituale etwas tief in der eigenen Seele berührt wird, im ältesten Teil deines Selbst, der dem Ursprung von allem am nächsten ist.«
Ich muss ihm recht geben. Ich habe eine Frage gestellt, auf die ich die Antwort bereits kenne. Ich sollte sinnvoller von J.s Gesellschaft Gebrauch machen.
»Zeit, von hier aufzubrechen«, sagt J. unvermittelt.
Ich schaue auf die Uhr und antworte ihm, dass der Flughafen ganz in der Nähe liegt und wir uns ruhig noch weiter unterhalten könnten.
»Das meine ich nicht. Als ich damals in deiner Situation war, habe ich die Lösung in etwas gefunden, das vor meiner Geburt geschehen war. Ich schlage vor, du versuchst das auch.«
Reinkarnation? Er hatte mir immer von Besuchen in meinen vergangenen Leben abgeraten.
»Ich war bereits in der Vergangenheit. Noch bevor ich [16] dich getroffen habe, habe ich gelernt, wie das geht. Ich habe dir von den zwei Inkarnationen erzählt: einer als französischer Schriftsteller im 19.Jahrhundert und einer –«
»Ja, ich weiß.«
»Ich habe Fehler gemacht, die ich jetzt nicht wiedergutmachen kann. Und du hast mir gesagt, dass ich von weiteren Reisen in die Vergangenheit absehen solle, weil ich mich nur noch schuldiger fühlen würde. In vergangene Leben zu reisen sei wie ein Loch in den Fußboden zu machen und zuzulassen, dass das Feuer im darunterliegenden Stockwerk auf das darüberliegende übergreift, die Vergangenheit auf die Gegenwart.«
J. überlässt die Überreste der Birne den Vögeln im Garten und sieht mich irritiert an.
»Wenn du nicht aufhörst, solchen Unsinn zu reden, glaube ich noch, dass du recht hast und in den vierundzwanzig Jahren, die wir uns kennen, nichts gelernt hast.«
Ich weiß, worauf er hinauswill. In der Magie – und im Leben – gibt es nur den Augenblick, das JETZT. Die Zeit lässt sich nicht wie die Entfernung zwischen zwei Punkten messen. »Zeit« vergeht nicht. Wir Menschen haben Mühe, uns auf die Gegenwart zu konzentrieren; wir denken ständig an das, was wir getan haben, daran, was wir hätten besser machen können, an die Folgen unseres Handelns. Oder aber wir beschäftigen uns mit der Zukunft, mit dem, was wir morgen tun werden, wie wir uns gegen die Gefahren wappnen können, die uns hinter der nächsten Ecke erwarten, wie wir verhindern, was wir nicht wollen, und das erreichen, wovon wir immer geträumt haben.
J. fährt fort:
[17] »Hier und jetzt beginnst du dich zu fragen: Läuft da wirklich etwas verkehrt? Doch wenn du an diesem Punkt angelangt bist, begreifst du auch, dass du deine Zukunft ändern kannst, indem du die Vergangenheit in die Gegenwart bringst. Vergangenheit und Zukunft existieren nur in unserem Kopf.
Der Augenblick jedoch steht außerhalb der Zeit: Er ist die Ewigkeit. Die Inder benutzen dafür in Ermangelung eines besseren Begriffs das Wort ›Karma‹. Doch was Zeit wirklich bedeutet, kann kaum jemand erklären: Nicht, was du in der Vergangenheit getan hast, wird die Gegenwart beeinflussen. Was du in der Gegenwart tust, wird deine Handlungen in der Vergangenheit aufwiegen und im Gegenzug auch die Zukunft verändern.«
»Und das heißt…?«
J. hält inne. Der Ärger darüber, dass ich einfach nicht begreife, was er mir erklärt, ist ihm immer deutlicher anzusehen.
»Es bringt nichts, einfach nur hier zu sitzen und zu reden. Tu etwas. Probier dich aus. Es ist Zeit, dass du von hier aufbrichst. Du musst dein Reich, in dem jetzt Routine herrscht, zurückerobern. Hör auf damit, ständig dieselbe Lektion zu wiederholen, dabei wirst du ohnehin nichts Neues lernen.«
»Routine ist nicht das Problem. Ich bin unglücklich.«
»Genau das meine ich mit Routine. Du spürst dich nur noch, wenn du unglücklich bist. Andere Menschen scheinen geradezu für ihre Probleme zu leben und reden von nichts anderem: Probleme mit den Kindern, dem Ehepartner, mit der Schule, mit der Arbeit, mit Freunden. Sie halten nie inne, [18] um sich klarzumachen: Ich lebe hier und jetzt. Ich bin das Ergebnis von allem, was geschehen ist oder geschehen wird, aber ich lebe hier und jetzt. Wenn ich etwas Falsches getan habe, kann ich es wiedergutmachen oder wenigstens um Vergebung bitten. Wenn es das Richtige war, werde ich dadurch glücklicher und bin fester mit dem Jetzt verbunden.«
J. atmet tief durch, bevor er weiterspricht:
»Du lebst schon lange nicht mehr im Hier und Jetzt. Es ist Zeit, aufzubrechen und wieder in die Gegenwart zurückzukommen.«
* * *
Genau das hatte ich befürchtet. Schon seit einer Weile hatte J. mir zu verstehen gegeben, dass es Zeit sei, mich auf den dritten heiligen Weg zu machen. Aber mein Leben hatte sich seit dem fernen Jahr 1986 verändert. Damals hatte die Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela mich dazu gebracht, mich meinem Schicksal und dem, was Gott mit mir vorhatte, zu stellen.
Drei Jahre danach war ich in der Region, in der wir uns im Augenblick befanden, den sogenannten »Römischen Weg« gegangen: siebzig schmerzvolle, ermüdende Tage, während denen ich all die absurden Dinge in die Tat umsetzen musste, die ich in der vorangegangenen Nacht geträumt hatte. (Dazu gehörte auch, vier Stunden an einer Bushaltestellte zu warten, ohne dass irgendetwas Nennenswertes geschah.)
Seither hatte ich mich ganz meiner Arbeit gewidmet. Es war das, was ich wollte, und es war gut so. Außerdem fing [19] ich an, wie ein Wahnsinniger zu reisen. Und lernte dabei die wichtigsten Lektionen meines Lebens.
Im Grunde genommen bin ich schon immer wie ein Wahnsinniger gereist, seit meiner Jugend. Aber in letzter Zeit scheine ich nur noch auf Flughäfen und in Hotels zu leben – und das Gefühl, Abenteuer zu erleben, ist schnell einem gewissen Überdruss gewichen. Wenn ich mich darüber beschwere, dass ich nie länger an einem Ort bleiben kann, wundern sich die Leute: ›Aber reisen ist doch so schön! Schade, dass ich nicht das Geld dafür habe!‹
Doch Reisen ist niemals eine Frage des Geldes, sondern des Mutes. Wie viel Geld hatte ich schon als junger Hippie? Gerade genug, um das Ticket zu bezahlen, dennoch waren es die besten Jahre meiner Jugend – ich aß schlecht, übernachtete auf Bahnhöfen, konnte mich oft nicht einmal verständigen, weil ich der Sprache nicht mächtig war. Allein um eine Unterkunft für die Nacht zu finden, musste ich mich von anderen abhängig machen.
Wenn man lange unterwegs ist, eine Sprache im Ohr hat, die man nicht versteht, Geld in den Händen, dessen Wert man nicht kennt, unterwegs auf unbekannten Straßen, durch die man noch nie gekommen ist, dann entdeckt man, dass das alte Ich mit all seinen Erfahrungen angesichts dieser neuen Herausforderungen vollkommen nutzlos ist. Man erkennt, dass es tief in uns jemanden sehr viel Interessanteren, Abenteuerlustigeren gibt, der offen für die Welt und neue Erfahrungen ist.
Irgendwann aber kommt der Tag, an dem man genug vom Reisen hat, an dem auch das Reisen zur langweiligen Routine geworden ist.
[20] »Nein, es ist niemals genug. Es wird niemals genug sein«, widerspricht mir J. »Unser Leben ist eine einzige Reise, von der Geburt bis zum Tod. Die Landschaft verändert sich, die Menschen verändern sich, unsere Bedürfnisse wandeln sich, aber der Zug fährt immer weiter. Das Leben ist dieser Zug, nicht der Bahnhof. Und was du im Moment tust, hat nichts mit Reisen zu tun. Du wechselst lediglich die Landschaft, und das ist etwas vollkommen anderes.«
Ich schüttele den Kopf.
»Nein, das hilft mir nicht weiter. Wenn ich einen Fehler aus einem früheren Leben wiedergutmachen will, und ich weiß genau, um welchen Fehler es geht, kann ich das genauso gut hier tun. Ich fühle mich wie in einem Gefängnis, in dem ich jemandes Anordnungen gehorche, der Gottes Willen kennt: dir. Außerdem habe ich inzwischen mindestens vier Menschen um Vergebung gebeten.«
»Aber du hast nicht herausgefunden, mit welchem Fluch du belegt worden bist.«
»Du wurdest doch auch verflucht. Und hast du denn etwas herausgefunden?«
»Ja, das habe ich. Und ich kann dir versichern, der Fluch war schlimmer als deiner. Du warst einmal feige, während ich viele Male ungerecht war. Doch als ich das erkannt hatte, war ich frei.«
»Wenn ich eine Zeitreise machen soll, warum muss ich dann von hier weggehen?«
J. lacht.
»Weil es für uns alle eine Möglichkeit der Erlösung gibt, aber dafür müssen wir die Menschen finden, denen wir weh getan haben, und sie um Vergebung bitten.«
[21] »Und wohin soll ich gehen? Nach Jerusalem?«
»Ich weiß es nicht. Wohin auch immer du musst. Finde heraus, was du unvollendet gelassen hast, und beende es. Gott wird dich führen, denn im Hier und Jetzt ist alles enthalten, was du erfahren hast und erfahren wirst. Die Welt wird in diesem Augenblick zugleich geschaffen und zerstört. Wen auch immer du getroffen hast, wird wieder auftauchen, wen auch immer du verloren hast, wird zurückkommen. Erweise dich der Gnade würdig, die dir zuteilwurde. Erkenne, was in dir vorgeht, und du wirst wissen, was in allen anderen vorgeht. Nur glaube nicht, dass ich gekommen bin, um dir Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, um dir ein Schwert zu reichen.«
[22] Es regnet, ich zittere vor Kälte, und mein erster Gedanke ist: »Ich werde mich erkälten.« Aber dann tröste ich mich mit dem Gedanken, dass mir bisher jeder Arzt versichert hat, Erkältungen würden von einem Virus hervorgerufen, nicht von Wassertropfen.
Es gelingt mir nicht, im Hier und Jetzt zu sein; in meinem Kopf dreht sich alles: Wohin soll ich gehen? Und was ist, wenn ich die Menschen aus meiner Vergangenheit auf meinem Weg nicht erkenne? Es wäre nicht das erste und sicher auch nicht das letzte Mal. Das ist schon ein paar Mal passiert und wird wieder passieren – sonst hätte meine Seele schon ihren Frieden.
Nach neunundfünfzig Jahren kenne ich mich mittlerweile ganz gut. Als ich J. das erste Mal traf, schien seinen Worten ein Leuchten anzuhaften, viel strahlender, als es seine Person war. Ich akzeptierte alles, was er tat und sagte, ohne es zu hinterfragen, ging Schritt um Schritt ohne Angst und bereute es niemals. Doch die Zeit verging, und mit zunehmender Vertrautheit kam die Routine. Obwohl J. mich nie enttäuscht hat, konnte ich ihn einfach nicht mehr mit den gleichen Augen sehen wie zu Anfang. Obwohl ich seinen Worten noch immer Glauben schenke, tue ich es jetzt nicht mehr (wie noch 1992, zehn Jahre nach unserer [23] Begegnung) mit Freuden, sondern aus Pflichtgefühl und längst nicht mehr mit der gleichen Überzeugung.
Doch das ist meine Schuld. Schließlich war es meine Entscheidung, mich dieser magischen Tradition zu verschreiben. Welchen Sinn hat es also, sie jetzt in Frage zu stellen? Es steht mir jederzeit frei, all das aufzugeben, aber irgendetwas treibt mich voran. J. hat zweifellos recht, aber ich habe mich nun mal an das Leben, das ich führe, gewöhnt und brauche keine weiteren Herausforderungen. Nur Frieden.
Eigentlich sollte ich glücklich sein: Ich bin erfolgreich in einem sehr unsicheren Beruf, in dem ein hoher Konkurrenzdruck herrscht; bin seit siebenundzwanzig Jahren mit der Frau, die ich liebe, verheiratet; erfreue mich bester Gesundheit; bin von Menschen umgeben, denen ich vertrauen kann, und werde von meinen Lesern freudig begrüßt, wenn ich ihnen auf der Straße begegne. Es gab Zeiten, in denen mir das genügte, aber in den letzten zwei Jahren genügte es mir immer weniger.
Ob das nur eine vorübergehende Krise ist? Reicht es nicht, die gewohnten Gebete zu sprechen, die Natur als Gottes Werk zu achten und all die Schönheit um mich herum in mir aufzunehmen? Warum also soll ich mich weiter bemühen, wenn ich doch überzeugt bin, an meine Grenzen gelangt zu sein?
WARUM KANN ICH NICHT SEIN WIE MEINE FREUNDE?
Es regnet immer stärker, und ich höre nur noch das Rauschen des Wassers. Ich bin vollkommen durchnässt, aber unfähig, mich von der Stelle zu bewegen. Ich will nicht von hier weg, weil ich nicht weiß, wohin. J. hat recht. Ich bin verloren. Wenn ich tatsächlich an meine Grenzen gelangt [24] wäre, gäbe es dieses Gefühl von Schuld und Frustration nicht mehr. Aber ich fühle weiterhin beides. Furcht und Zittern. Doch unzufrieden lässt Gott uns nur aus einem einzigen Grunde sein: Alles muss sich ändern, man muss sich wieder auf den Weg machen.
Ähnliches habe ich früher schon erlebt. Immer wenn ich mich weigerte, meinem Schicksal zu folgen, passierte in meinem Leben etwas Schlimmes. Und genau davor fürchte ich mich in diesem Augenblick: vor einem Unglück. Ein Unglück löst in unserem Leben radikale Veränderungen aus, Veränderungen, die alle eines gemeinsam haben: Verlust. Wenn wir einen Verlust erleiden, bringt es nichts, uns das Verlorene zurückzuwünschen, es ist besser, den großen, frei gewordenen Raum zu nutzen und ihn mit etwas Neuem zu füllen. In der Theorie hat jeder Verlust auch etwas Gutes; aber in der Praxis lässt er uns an Gottes Existenz zweifeln und uns fragen: Wie habe ich das verdient?
Herr, bewahre mich vor dem Unglück, und ich werde Deinen Ratschlüssen folgen.
Kaum habe ich das gedacht, kracht ein Donnerschlag, und schon wird der Himmel von einem Blitz erleuchtet.
Wieder Furcht und Zittern. Ein Zeichen. Da versuche ich, mir einzureden, dass ich immer mein Bestes gebe, doch die Natur belehrt mich des Gegenteils: Wer wirklich lebt, bleibt niemals stehen. Himmel und Erde treffen in diesem Augenblick in einem Gewittersturm aufeinander. Ist er erst einmal vorbei, wird die Luft reiner sein und die Felder fruchtbarer. Aber bis dahin wird der Sturm Häuser zerstören, jahrhundertealte Bäume entwurzeln, paradiesische Flecken überschwemmen.
[25] Eine gelbe Gestalt nähert sich.
Ich überlasse mich dem Regen. Weitere Blitze gehen nieder, aber das Gefühl der Hilflosigkeit wandelt sich allmählich in etwas Positives – als würde das Regenwasser meine Seele rein waschen.
›Segne, und du wirst gesegnet werden.‹
Die Worte kommen mir ganz selbstverständlich in den Sinn, eine Weisheit, die nicht meine ist, aber hin und wieder auftaucht. In diesen Momenten kann ich aufhören, alles in Frage zu stellen, was ich über die Jahre gelernt habe.
Das Problem ist nur: Sobald diese Momente vorbei sind, beginne ich wieder zu zweifeln.
Die gelbe Gestalt steht jetzt direkt vor mir. Es ist meine Frau, die einen dieser grellgelben Umhänge anhat, die wir auf unseren Gebirgswanderungen tragen. Wenn wir uns verlaufen würden, wären wir leicht zu finden.
»Hast du vergessen, dass wir heute Abend zum Essen eingeladen sind?«
Nein, ich habe es nicht vergessen. Ich verlasse die Welt der Metaphysik, in der Donner die Stimme der Götter ist, und kehre in die Realität einer kleinen französischen Provinzstadt zurück, zu gutem Wein, Lammbraten und angeregter Unterhaltung mit guten Freunden, die uns von ihrer abenteuerlichen Harley-Davidson-Reise erzählen wollen. Zurück im Haus, wo ich mich umziehe, fasse ich das Gespräch mit J. in ein paar Sätzen zusammen.
»Hat er gesagt, wohin du gehen sollst?«, fragt meine Frau.
»Er hat gesagt, ich muss mich einlassen.«
»Und ist das so schwer? Sei doch nicht so störrisch. Du benimmst dich wie ein alter Mann.«
[26] Hervé und Véronique haben noch ein französisches Ehepaar mittleren Alters dazu geladen. Der Mann wird mir als »Seher« vorgestellt, den sie in Marokko kennengelernt haben.
Er wirkt weder besonders sympathisch noch unsympathisch, sondern einfach nur abwesend. Doch plötzlich, während des Abendessens, wendet er sich wie in Trance an Véronique:
»Seien Sie vorsichtig beim Autofahren. Sie werden einen Unfall haben.«
Ich finde die Bemerkung mehr als unangebracht. Falls Véronique die Prophezeiung ernst nimmt, wird ihre Angst negative Energie erzeugen, und es könnte ihr tatsächlich etwas zustoßen.
»Sehr interessant!«, sage ich, bevor jemand anders reagieren kann. »Dann haben Sie also die Fähigkeit, sich in der Zeit zu bewegen, zurück in die Vergangenheit oder vorwärts in die Zukunft. Ich habe gerade erst heute Nachmittag mit einem Freund darüber gesprochen.«
»Wenn Gott es erlaubt, habe ich seherische Fähigkeiten. Ich weiß, wer jeder, der hier am Tisch sitzt, war, ist und sein wird. Ich weiß nicht, wie es kommt, dass ich diese Gabe habe, aber ich habe vor langer Zeit gelernt, sie zu akzeptieren.«
[27] Eigentlich hatten die Gastgeber ja von ihrer Sizilienreise erzählen wollen, auf der sie mit Freunden ihre Leidenschaft für klassische Harley-Davidsons ausgelebt haben, aber auf einmal nimmt das Gespräch eine Wendung, die mir unangenehm ist. Wie sich die Dinge halt manchmal fügen.
Alle sind gespannt, was ich darauf antworten werde.
»Dann wissen Sie auch, dass Gott uns solche Dinge nur dann sehen lässt, wenn er eine Veränderung wünscht.«
Und zu Véronique gewandt, füge ich hinzu:
»Sei einfach vorsichtig. Wenn etwas aus der astralen Ebene auf diese Ebene verschoben wird, verliert es einen großen Teil seiner Kraft. Was ich sagen will: Ich bin mir fast sicher, dass es keinen Unfall geben wird.«
Véronique schenkt Wein nach. Sie glaubt, der Seher aus Marokko und ich würden auf einen Streit zusteuern. Doch das stimmt nicht. Er erschreckt mich nur, weil er tatsächlich »sehen« kann. Ich nehme mir vor, später Hervé darauf anzusprechen.
Der Mann schaut mich kaum an – er wirkt immer noch abwesend, wie jemand, der unwillentlich in eine andere Dimension eingetreten ist, und sich nun verpflichtet fühlt, seine Erfahrungen zu teilen. Er will mir etwas sagen, zieht es aber vor, sich an meine Frau zu wenden:
»Die Seele der Türkei wird Ihrem Mann all ihre Liebe schenken. Aber sie wird sein Blut vergießen, bevor sie enthüllt, was er sucht.«
Ein weiterer Beweis, dass es der falsche Moment für mich wäre zu reisen, denke ich, wohl wissend, dass wir die Dinge immer unseren Wünschen entsprechend interpretieren und nicht so, wie sie wirklich sind.
[28] Der chinesische Bambus
Es ist ein Segen, in diesem Zug zu sitzen, auf dem Weg von Paris zur Buchmesse nach London. Jedes Mal, wenn ich nach England komme, erinnere ich mich an das Jahr 1977, als ich meinen Job bei einer internationalen Schallplattenfirma in Brasilien aufgegeben und beschlossen hatte, den Rest meines Lebens vom Schreiben zu leben. Ich mietete eine Wohnung in der Basset Road in London, hatte viele Freunde, studierte Vampirologie, erkundete die Stadt zu Fuß, war verliebt, ging in jeden Film, der gezeigt wurde, und bevor ich mich’s versah, war ein Jahr vergangen und ich zurück in Rio de Janeiro, ohne auch nur eine einzige Zeile geschrieben zu haben.
Diesmal würde ich nur drei Tage in London bleiben. Eine Signierstunde, Abendessen in indischen und libanesischen Restaurants, Gespräche über Bücher, Verlage und andere Autoren in der Hotellobby. Wenigstens bis zum Jahresende werde ich nicht in mein Haus in Saint-Martin zurückkehren. Von London aus werde ich nach Rio de Janeiro fliegen, wo ich endlich wieder einmal meine Muttersprache auf den Straßen hören, jeden Abend Açaí-Saft trinken und von meinem Fenster aus stundenlang die schönste Aussicht der Welt genießen kann: den Blick auf den Strand von Copacabana.
[29] Kurz vor der Ankunft in London betritt ein junger Mann mit einem Strauß Rosen den Waggon und schaut sich um. Eigenartig, denke ich, im Eurostar habe ich noch nie Blumenverkäufer gesehen.
»Ich brauche zwölf Freiwillige«, ruft er. »Die Frau meines Lebens wartet auf mich. Ich möchte ihr einen Heiratsantrag machen. Jeder von Ihnen soll ihr bei der Ankunft eine Rose übergeben.«
Auch ich melde mich, neben einigen anderen, werde aber nicht ausgewählt. Als der Zug hält, folge ich der Gruppe dennoch. Der junge Mann zeigt auf ein Mädchen auf dem Bahnsteig. Die Fahrgäste überreichen ihr, einer nach dem anderen, eine Rose. Am Ende gesteht er ihr seine Liebe, alle applaudieren, und das junge Mädchen wird vor Verlegenheit ganz rot. Sie küssen sich und gehen Arm in Arm davon.
Ein Zugbegleiter meint:
»Das ist das Romantischste, was ich in meinem ganzen Arbeitsleben gesehen habe.«
* * *
Das Signieren hat fast fünf Stunden gedauert, mich aber trotzdem mit positiver Energie aufgeladen, und ich frage mich, warum ich in den letzten Monaten so durcheinander war. Selbst wenn ich in meiner spirituellen Entwicklung im Moment blockiert bin, sollte ich vielleicht einfach etwas Geduld haben. Schließlich war es mir vergönnt gewesen, Dinge zu sehen und zu erleben, die nur wenigen anderen Menschen zuteilwurden.
Bevor ich nach London fuhr, war ich in eine kleine [30] Kapelle in Barbazan-Debat gegangen. Dort habe ich die Heilige Jungfrau gebeten, mir mit ihrer Liebe den Weg zu weisen und mir zu helfen, die Zeichen zu erkennen, die mich zu mir selber zurückführen. Ich weiß, dass ich ein Teil der Menschen bin, die mich umgeben, und dass sie ein Teil von mir sind.
Gemeinsam schreiben wir am Buch des Lebens, zusammengeführt nur durch das Schicksal, aber vereint im Glauben, die Welt verändern zu können. Jeder trägt mit einem Wort, einem Satz, einer Idee dazu bei, aber am Ende ergibt alles ein Ganzes: Das Glück jedes Einzelnen wird zum Glück aller.
Unsere Fragen werden immer dieselben sein. Wir werden demütig hinnehmen müssen, dass nur unser Herz den Grund für unser Dasein kennt. Ja, es ist schwierig, zu seinem Herzen zu sprechen, aber vielleicht ist das nicht einmal notwendig. Es reicht, Vertrauen zu haben, den Zeichen zu folgen, seinen Traum zu leben, und früher oder später erkennen wir, dass wir an etwas Umfassenderem teilhaben, auch wenn wir dieses Etwas mit unserer Vernunft nicht erfassen können. Man sagt, dass jeder in der Sekunde vor seinem Tod den wahren Grund für seine Existenz erfährt. Und dieser Augenblick entscheidet zwischen Hölle oder Paradies.
Die Hölle wird es sein, wenn wir in diesem Bruchteil einer Sekunde erkennen, dass wir die Gelegenheit versäumt haben, das Wunder des Lebens zu würdigen. Das Paradies jedoch, wenn wir dann sagen können: ›Ich habe wohl Fehler gemacht, aber ich war kein Feigling. Ich habe mein Leben gelebt und mein Bestes gegeben.‹
Wie auch immer, es gibt keinen Grund, meine persönliche [31] Hölle vorwegzunehmen und mir wieder und wieder den Kopf darüber zu zerbrechen, dass ich bei meiner spirituellen Suche nicht weiterkomme. Ich darf einfach nicht aufgeben. Selbst jenen, die nicht ihr Bestes versucht haben, wurde bereits vergeben. Das Leben selbst war ihre Strafe, wenn sie unglücklich waren, wo sie doch in Frieden und im Einklang mit sich selbst hätten leben können. Wir sind alle erlöst, frei, dem Weg zu folgen, der nirgendwo seinen Anfang genommen hat und kein Ende haben wird.
* * *
Ich habe kein Buch dabei. Während ich darauf warte, mich mit meinen russischen Verlegern zum Abendessen zu treffen, blättere ich in einem dieser Magazine, die immer in Hotelzimmern ausliegen. Ich lese ohne übermäßiges Interesse einen Artikel über den chinesischen Bambus. Nachdem der Samen gepflanzt wurde, steht dort, sieht man knapp fünf Jahre lang nichts bis auf einen winzigen Spross. Unter der Erde jedoch entsteht in dieser Zeit eine komplexe, sich vertikal und horizontal ausbreitende Wurzelstruktur. Doch am Ende des fünften Jahrs schießt der chinesische Bambus in kürzester Zeit bis zu einer Höhe von 25Metern auf.
Ich hätte als Zeitvertreib keine langweiligere Lektüre finden können. Ich beschließe, hinunterzugehen und das Kommen und Gehen in der Lobby zu beobachten.
* * *
[32] Während ich warte, trinke ich einen Kaffee. Mônica, meine Agentin und meine beste Freundin, leistet mir Gesellschaft. Wir sprechen über dies und das. Ich sehe, dass sie müde ist, nachdem sie den ganzen Tag mit Leuten aus der Verlagsbranche verhandelt und schließlich noch meine englische Verlegerin am Telefon über die Signierstunde auf dem Laufenden gehalten hat.
Unsere Zusammenarbeit begann, als Mônica gerade erst zwanzig war. Sie war eine begeisterte Leserin meiner Bücher und überzeugt davon, dass ein brasilianischer Autor auch außerhalb seines Landes übersetzt und erfolgreich veröffentlicht werden könnte. Sie gab ihr Chemieingenieurstudium in Rio de Janeiro auf, zog mit ihrem Freund nach Spanien, wo sie an Verlagstüren klopfte und engagierte Briefe schrieb mit dem Ziel, spanische Verleger für meine Bücher zu begeistern.
Als jedoch all ihre Bemühungen keinen Erfolg zeitigten, bin ich in die kleine Stadt in Katalonien gefahren, in der sie lebte, habe sie zu einem Kaffee eingeladen und ihr geraten, das Handtuch zu werfen und sich ihrem eigenen Leben und ihrer Zukunft zu widmen. Sie weigerte sich und sagte, sie könne nicht mit einer Niederlage nach Brasilien zurückkehren. Ich versuchte, sie davon zu überzeugen, dass sie keineswegs gescheitert sei, immerhin hatte sie gezeigt, dass sie überleben konnte (indem sie Flyer verteilte und als Kellnerin arbeitete), und außerdem die einzigartige Erfahrung gemacht, im Ausland zu leben. Mônica blieb stur. Ich verließ das Café mit dem sicheren Gefühl, dass sie ihr Leben wegwarf, ich sie aber nie würde umstimmen können, dickköpfig, wie sie war. Sechs Monate später sollte alles [33] vollkommen anders sein, und nach weiteren sechs Monaten hatte sie genug Geld, um sich eine Wohnung zu kaufen.
Sie hatte an das Unmögliche geglaubt und so eine Schlacht gewonnen, die alle – mich eingeschlossen – verloren gegeben hatten. Das ist es, wodurch sich ein Krieger auszeichnet: Er erkennt, dass Wille und Mut nicht ein und dasselbe sind. Mut kann Angst machen und Bewunderung auslösen, aber einen starken Willen zu haben verlangt Geduld und Engagement. Männer und Frauen mit großer Willenskraft sind häufig Einzelgänger und strahlen eine gewisse Reserviertheit aus. Viele empfinden Mônica als kühl, aber sie täuschen sich sehr: In ihrem Herzen brennt ein verborgenes Feuer, noch heute so intensiv wie damals in jenem katalonischen Café. Trotz allem, was sie erreicht hat, hat ihre Begeisterung um nichts nachgelassen.
Gerade als ich ihr von meinem kürzlich mit J. geführten Gespräch erzählen will, betreten meine beiden bulgarischen Verlegerinnen die Lobby, die im selben Hotel untergebracht sind – nicht ungewöhnlich während der Buchmesse. Wir machen Small Talk, dann stellt mir eine der beiden die stets wiederkehrende Frage:
»Wann besuchen Sie unser Land?«
»Nächste Woche, wenn Sie das organisieren können. Meine einzige Bedingung ist eine Party nach der Signierstunde.«
Die beiden starren mich ungläubig an.
Der chinesische Bambus!
Auch Mônica ist entgeistert:
»Dazu muss ich erst einmal in den Terminkalender schauen.«
[34] »Aber ich bin sicher, dass ich nächste Woche in Sofia sein kann«, unterbreche ich Mônica.
Und auf Portugiesisch füge ich hinzu:
»Ich erkläre es dir später.«
Mônica merkt, dass ich es ernst meine, doch die Verlegerinnen sind sich noch nicht so sicher. Sie fragen, ob ich nicht noch warten möchte, damit sie entsprechende Werbung machen können.
»Nächste Woche«, wiederhole ich. »Oder aber wir müssen es auf unbestimmte Zeit verschieben.«
Erst jetzt verstehen sie, dass ich keinen Witz gemacht habe. Sie schauen Mônica an und warten auf ihre Reaktion. Genau in diesem Augenblick kommt mein spanischer Verleger an den Tisch. Wir unterbrechen unser Gespräch, ich stelle alle einander vor, und schon heißt es wieder:
»Und wann kommen Sie wieder nach Spanien?«
»Gleich im Anschluss an meinen Besuch in Bulgarien.«
»Und wann wird das sein?«
»In zwei Wochen. Wir können eine Signierstunde in Santiago de Compostela und eine weitere im Baskenland planen. Mit anschließenden Partys, zu denen wir auch ein paar Leser einladen werden.«
Die bulgarischen Verlegerinnen trauen der ganzen Sache immer noch nicht, und Mônica lächelt schief.
»Lass dich ein«, hatte J. gesagt.
Die Bar füllt sich allmählich. Bei den meisten großen Messen, egal in welcher Branche, logieren die Fachbesucher in zwei oder drei Hotels, und ein großer Teil der Geschäfte wird in der Lobby oder bei Abendessen wie jenem abgeschlossen, das an diesem Abend stattfinden soll. Ich begrüße [35] alle meine Verleger und nehme jede Einladung in ihr jeweiliges Land dankend an. Damit Mônica mich nicht fragen kann, was in mich gefahren sei, versuche ich, die Gespräche so lange wie möglich am Laufen zu halten. Ihr bleibt nur noch, alle Termine, die ich abmache, in ihren Kalender einzutragen.
Irgendwann unterbreche ich das Gespräch mit dem arabischen Verleger, um zu hören, wie viele Besuche ich inzwischen zugesagt habe.
»Du bringst mich in eine unmögliche Lage«, antwortet Mônica ärgerlich auf Portugiesisch. »Sechs Länder, fünf Wochen. Du weißt doch, dass diese Messe eine für Verleger und keine für Schriftsteller ist! Du brauchst überhaupt keine Einladung anzunehmen, ich übernehme das!«
Der portugiesische Verleger tritt auf uns zu, und wir können nicht auf bewährte Weise weiterreden. Als er außer den üblichen Begrüßungsfloskeln nichts mehr sagt, ergreife ich die Initiative:
»Wollen Sie mich nicht nach Portugal einladen?«
Er gesteht, dass er in der Nähe gestanden und unfreiwillig das Gespräch zwischen mir und Mônica mitbekommen hat.
»Es ist mir Ernst. Ich würde gern in Guimarães und in Fátima Bücher signieren.«
»Solange Sie nicht in letzter Minute absagen…«
»Ich werde nicht absagen. Versprochen.«
Er ist einverstanden, und Mônica schreibt »Portugal« in den Kalender: weitere fünf Tage. Schließlich gesellen sich meine russischen Verleger – ein Ehepaar – zu uns und begrüßen uns. Mônica ist erleichtert, denn jetzt kann sie mich endlich von hier weglotsen und ins Restaurant bringen.
[36] Während wir auf das Taxi warten, zieht sie mich zur Seite.
»Bist du verrückt geworden?«
»Das bin ich doch schon vor vielen Jahren«, sage ich lachend. Und dann erzähle ich ihr die Geschichte vom chinesischen Bambus.
»Und was hat das mit dem zu tun, was du hier gerade abgezogen hast?«
»Vor einem Monat hatte ich ein Gespräch mit J., ich werde dir später ausführlich darüber berichten. Im Moment ist nur wichtig, dass es mir genauso ging wie dem Bambus: Ich hatte Arbeit, Zeit und Mühe investiert; hatte mit Liebe und Hingabe versucht, innerlich zu wachsen, und nichts passierte. Jahrelang ist nichts passiert.«
»Was soll das heißen, es ist nichts passiert? Hast du vergessen, wer du bist?«
Das Taxi kommt. Der russische Verleger hält Mônica die Tür auf.
»Es geht um meine spirituelle Seite. Ich glaube, ich bin wie dieser chinesische Bambus und dass gerade mein fünftes Jahr begonnen hat. Der Zeitpunkt, wieder zu wachsen. Du hast mich gefragt, ob ich verrückt geworden sei, und ich habe dir flapsig darauf geantwortet. Die Wahrheit aber ist, dass ich tatsächlich dabei war, verrückt zu werden. Ich begann zu glauben, dass alles, was ich gelernt hatte, keine Wurzeln schlug.«
Für den Bruchteil einer Sekunde hatte ich vorhin im Hotel J.s Anwesenheit gespürt, und auf einmal verstand ich seine Worte – auch wenn es erst klick gemacht hatte, als ich gelangweilt ein Gartenmagazin durchblätterte. Mein [37] selbstauferlegtes Exil in meinem Haus in Frankreich hatte mir zwar auf der einen Seite viele wichtige Dinge über mich selbst offenbart, aber es gab auch ernsthafte Nebenwirkungen: das Laster der Einsamkeit. Mein Universum hatte sich auf wenige Freunde in der Nachbarschaft reduziert, auf die Beantwortung von Briefen und E-Mails und auf die Illusion, dass der Rest meiner Zeit mir allein gehörte. Kurz gesagt, lebte ich ein Leben ohne die ganz normalen Probleme, die aus dem Kontakt und dem Zusammenleben mit anderen Menschen entstehen.
Aber war es das, was ich suche? Ein Leben ohne Herausforderungen? Und worin besteht der Reiz, Gott außerhalb der Menschen zu suchen?