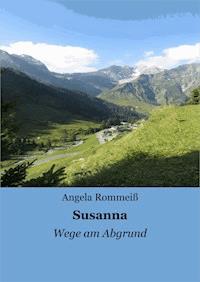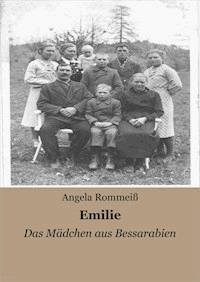Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein spannender Roman/Krimi mit interessanten Ausflügen in die Vergangenheit in die Zeit der DDR und des 2. Weltkrieges. Die Thüringer Mundart und die Eigenheiten der Menschen werden amüsant beschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Angela Rommeiß
Alex und Alexandra
Das Haus in Thüringen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Impressum neobooks
Kapitel 1
Alle handelnden Personen in diesem Buch sind frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit wirklichen Personen
ist zufällig und nicht beabsichtigt.
1
Die alte Frau lag im Sterben.
Sie wusste es, und ihre Tochter, die neben dem Klinikbett auf einem Stuhl saß, wusste es auch.
Die Frau hielt die Hand ihrer Mutter und blickte ihr in das blasse, zerfurchte Gesicht. Dieses Gesicht, das sie so sehr liebte und das ihr von klein auf vertraut war wie ihre eigene Hand. So vertraut waren ihr diese feinen Gesichtszüge, dass ihr entgangen war, wie sie sich im Laufe der Jahre verändert hatten, mehr und mehr Falten bekamen und alt wurden.
Als kleines Mädchen hatte ihr ein Blick in dieses Gesicht genügt, und die Welt verlor ihren Schrecken. Sei es, dass sie sich verlaufen hatte im Getümmel des Marktes, oder schaute sie nach ihr aus, wenn sie bei einer Schulaufführung in den Zuschauerraum blickte - alles war gut, wenn sie Muttis Gesicht in der Menge entdeckte.
Die Tochter erinnerte sich an die Nächte ihrer Kindheit, in denen sie, von Albträumen geplagt, ins Bett ihrer Mutter kroch, um sich trösten zu lassen. Dicht an ihren Körper gedrückt, sodass sie ihren Herzschlag spürte, fühlte sie sich sicher vor Räubern und Gespenstern. Von unerklärlichen Ängsten geplagt hatte sie die Mutter gefragt: „Gell, Mutti, du stirbst nicht?“
Und die Mutter hatte leise geantwortet: „Doch, ich sterbe auch mal. Aber das ist noch lange hin.“
Mit schwerem Herzen hatte das Kind gefragt: „Wie lange denn?“
Die Mutter hatte ihr die Wange gestreichelt und mit dunkler, ruhiger Stimme geflüstert: „Ganz lange, ein ganzes Leben. Mach dir keine Sorgen, schlaf jetzt.“
Aber wie sollte man sich denn keine Sorgen machen, wenn man wusste, dass die Mutti einmal sterben würde? Wie sollte man denn da schlafen?
Die Tochter erinnerte sich noch genau an dieses Gefühl längst vergangener Kindertage. Seltsamerweise hatte sie sich nie um den eigenen Tod Sorgen gemacht, aber der drohende Verlust der Mutter erschien ihr unerträglich.
Die Jahre und die Kinderängste vergingen, und nun war es also doch soweit. Das ganze Leben, von dem ihre Mutter gesprochen hatte, war vorüber.
Die Frau seufzte. „Ach, Mutti“, dachte sie. „Ich hätte mich in den letzten Jahren mehr um dich kümmern sollen. Du hast doch nur mich. Aber ich habe dich viel zu selten besucht, dich nicht oft genug angerufen. Vielleicht hätte ich eher bemerkt, dass da etwas nicht stimmt, dass ein Krebsgeschwür in dir wuchert. Ich habe doch als Altenpflegerin einen Blick für so etwas, ich hätte es bestimmt gemerkt, wenn ich nur öfter zu dir gekommen wäre!
Aber hätte ich das wirklich? Wahrscheinlich nicht. Fremde Leute schaut man anders an als die eigene Mutter, die man noch lange nicht als alte Frau empfindet. Du wusstest es ja, hast es nur niemandem gesagt. Dabei bist du doch noch nicht alt. Heutzutage ist sechzig nicht alt, die Leute werden fünfundachtzig und älter. Ach, Mutti.“
Auf einmal vermisste sie das Blinken und Surren der Geräte auf der Intensivstation, obwohl sie anfangs doch froh gewesen war, dass sie endlich Ruhe hatten. Aber die geschäftige Geräuschkulisse und das emsige Tun des Pflegepersonals hatten den Eindruck vermittelt, dass man noch etwas tun konnte, dass es nicht endgültig war...
Ein sanfter Druck der alten Hand, die sie umklammert hatte, ließ die Frau aufschauen. Schnell zwinkerte sie die Tränen weg, die ihr immer wieder den Blick verschleierten. Mit wachen Augen schaute die Mutter ihre Tochter an.
Die Augen waren immer das Schönste an ihr gewesen, diese großen, dunkelbraunen Augen. Sie waren auch fast das einzige, was sie ihrer Tochter vererbt hatte. Jedenfalls das einzige Äußerliche, denn im Charakter ähnelten sie sich sehr. Während aber die Mutter eine große, kräftige Frau war, war ihre Tochter eher zierlich und von kleinem Wuchs. Sie war sich neben ihrer Mutter immer winzig vorgekommen.
„Meine kleine Elfe“, hatte die Mutter sie oft genannt, oder „meine kleine Anna“. Dabei hieß sie gar nicht Anna, sondern Alexandra. Aber Anna war ihr Kosename gewesen, seit sie denken konnte, und nur ihre Mutter nannte sie so.
Wie sie da so klein und zusammengesunken im Krankenbett lag, sah die Mutter sich selbst gar nicht mehr ähnlich. Der Krebs hatte die Kraft und die Stärke aus dieser einst so lebensfrohen, resoluten Frau gesogen, sie sah aus wie eine leere Hülle ihres früheren Körpers.
„Alexandra, versprich mir etwas!“, flüsterte sie mühsam, ihre Stimme krächzte. Schnell griff die Tochter nach dem Wasserglas und hielt es ihrer Mutter an die spröden Lippen. Die alte Frau schluckte und seufzte. Dann sprach sie klarer.
„Ich möchte, dass du dich um das Haus kümmerst. Meine Schwester hat es dir damals vermacht. Seitdem steht es leer. Ein Haus sollte nicht leer stehen, es stirbt dann.“
Alexandra war verblüfft. Wovon sprach ihre Mutter da? Sicherlich war sie verwirrt und phantasierte. Die Tochter streichelte die Hand der Kranken und antwortete sanft: „Ich habe doch kein Haus geerbt, Mutti. Und du… du hast doch gar keine Schwester.“
Die Mutter seufzte schwer. „Doch doch, ich hatte eine Schwester. Ich habe dir nie von ihr erzählt, weil... aber das ist jetzt auch egal. Sie ist ja gestorben, die Anna. War noch so jung!“
Eine Träne rann aus ihrem Auge und tropfte auf das weiße Krankenhausnachthemd. Alexandra tätschelte die Hand ihrer Mutter und dachte: „Sie phantasiert. Ganz sicher tut sie das.“
Aber die Kranke sprach weiter, und es klang nicht so, als phantasiere sie.
„Es ist mein Elternhaus. Nein, ich wollte nicht dort wohnen, das stimmt schon, und verkauft habe ich es auch nicht. Ich hätte mich darum kümmern sollen, aber ich konnte irgendwie nicht. Eigentlich hast auch du es geerbt und nicht ich. Vielleicht nicht offiziell, aber... Anna hat es mir oft gesagt: Alexandra soll alles bekommen, was ich habe. Und dann soll sie selber sehen ...“ Die Mutter richtete sich plötzlich auf und bat eindringlich: „Verkauf es nicht, Anna! Du musst es behalten, bitte!“
„Ja, ja natürlich, Mutti!“ antwortete Alexandra hilflos. Wie sollte sie ihrer Mutter denn auf dem Sterbebett ein Versprechen verweigern, sei es auch noch so irrwitzig? Dieses Gespräch strengte die Kranke zu sehr an, sie sollte sich ausruhen.
Als sie das Versprechen hatte, beruhigte sich die Mutter wieder ein wenig. Nach einer Weile sagte sie leise: „Es ist so viel Zeit vergangen seit damals. So viel Zeit… Man sagt ja, Zeit heilt alle Wunden. Aber nicht alle. Nicht alle, nein…“ Sie sprach langsam und leise, mit langen Pausen zwischen den Sätzen. Ihre Tochter ließ sie reden und hielt ihre Hand.
„Da gibt es noch etwas, das du wissen solltest...“
Alexandra horchte auf. Da war es wieder, dieses unausgesprochene Geheimnis. Sie wusste nicht, wann es begonnen hatte, aber schon seit sie in die Pubertät gekommen war, hatte ihre Mutter immer mal wieder solche Andeutungen gemacht. Sie hatte es ihr am Gesicht angesehen, dass es etwas Wichtiges war, aber immer hatte die Mutter einen Rückzieher gemacht und ihr nichts gesagt. Alexandra war sich einigermaßen sicher, dass es darum ging, wer ihr Vater war. Sie hatte ihn nie kennengelernt, niemand hatte das. Und wen man nicht kennt, den vermisst man auch nicht. Alexandra zumindest hatte ihn nie vermisst, ihr hatte die Mutter genügt. Sie hatte nur sie, keine sonstigen Verwandten. Keine Onkel und Tanten, keine Großeltern, keine Geschwister. Dass sie vielleicht doch eine Tante gehabt hatte, musste sie erst einmal verdauen. Das war also der Grund dafür gewesen, dass ihre Mutter sie immer Anna genannt hatte! Anscheinend hatte Alexandra ihre Mutter an ihre Schwester erinnern, vielleicht sah sie ihr sogar ähnlich. Sie beugte sich vor, um die schwache Stimme ihrer Mutter besser zu hören.
„Es ist... es ist schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll.“ Die Kranke stöhnte gequält.
Alexandra streichelte ihrer Mutter die Wange, so wie sie selbst so oft von ihr getröstet worden war. „Sag es einfach, Mutti. Es wird dich erleichtern, und ich halte es schon aus. Ich halte ‘ne Menge aus, das weißt du doch. Ich bin wie du!“
Die Mutter schaute ihre Tochter an, als sähe sie sie das erste Mal. Dann lächelte sie und nickte. Sie schien sich innerlich zu straffen und wirkte auf einmal sehr zufrieden.
„Ja. Ja, du hast Recht. Du bist wie ich, und deshalb ist es auch nicht wichtig. Es ist ganz egal!“
„Was ist egal?“, fragt Alexandra verwirrt, aber ihre Mutter hatte schon die Augen geschlossen und schien wieder einzuschlummern. Sie stand unter starken Schmerzmitteln. Leicht frustriert lehnte sich die Frau wieder zurück. Dieses Geheimnis sollte wohl ein Geheimnis bleiben.
Draußen begann der Tag zu dämmern. Ein Vogel fing an, sein Morgenlied zu trällern, ein zweiter fiel ein. Krankenschwestern gingen auf leisen Sohlen draußen auf dem Gang an ihrem Zimmer vorbei, schnaufend öffneten und schlossen sich die großen Glastüren am Ende des Ganges. Nebenan rauschte eine Toilettenspülung.
Die durchwachten Nächte machten sich bemerkbar, Alexandra fielen die Augen zu, ihr Kopf sank zur Seite. Die Unwirklichkeit der Situation verschwamm in ihrem Kopf: Sie schlief in ihrem Bett, der Wecker hatte geklingelt, gleich würde sie aufstehen müssen! Nur noch ein paar Minuten...
Alexandra schreckte auf. Ein Traum! Es war nur ein böser Traum gewesen! Die Sekunde der Erleichterung verflog so schnell, wie sie gekommen war. Nein, es war kein Traum – ihre Mutter würde heute sterben. Warum konnte es denn kein böser Traum gewesen sein? Wieder spürte Alexandra, wie sich ihre Kehle zuschnürte, wie ihr die Tränen heiß in die Augen stiegen.
Nach einem besorgten Blick auf ihre Mutter stand sie auf und ging zum Fenster. Draußen erwachte die Großstadt zum Leben. Eigentlich schlief sie nie, immer gab es Lichter, fuhren Autos und Busse, zuckten Blaulichter, hasteten Menschen durch die Straßen. Berlin war eine lebendige Stadt. Unten auf der Straße bewegten sich die ersten Besucher. Was wohl die Leute so früh hier wollten? Waren es Väter, die ihre Neugeborenen das erste Mal sehen wollten? Kamen besorgte Eltern, um ein krankes Kind zu besuchen und zu trösten? Kamen Leute mit Beschwerden hier in die Charité und sicherten sich einen Platz in den überfüllten Warteräumen? Vielleicht waren es auch Angestellte – Krankenschwestern, Ärzte, Putzfrauen – die zu ihrer Schicht erschienen? Egal – sie alle würden dieses Krankenhaus früher oder später wieder verlassen, so wie sie selbst auch.
Aber ihre Mutter nicht.
Sie nicht.
Alexandra war noch nicht bereit, ihre Mutter zu verlieren. Sie war ihr fester Halt im Leben, ihre Vergangenheit. Wer sollte die Erinnerungen ihrer Kindheit mit ihr teilen, mit wem sollte sie über Episoden ihres Lebens reden, mit wem über lustige Begebenheiten lachen? Niemand kannte sie so gut wie ihre Mutter, niemand würde sie je so gut verstehen. Die Probleme, die sie mit Stefan hatte, die Sorgen mit der pubertierenden Tochter – immer verstand die Mutter ohne lange Erklärungen sofort ihre Sorgen, beruhigt sie, relativierte die Probleme und gab ihr mit ein paar wenigen, guten Ratschlägen ihr Selbstbewusstsein und innere Ruhe wieder. Wie sollte sie darauf verzichten? Mit wem konnte sie nun reden?
Alexandra wurde von einer Welle des Selbstmitleids übermannt, für das sie sich selbst verachtete. Aber es half nichts, die Tränen strömten jetzt ungehemmt. Schluchzend sank sie auf ihrem Stuhl zusammen.
Kurze Zeit später erwachte die Mutter erneut. Wieder war sie völlig klar und sprach leise, aber deutlich.
„Alexandra, mein Schatz! Nein, weine nicht. Jeder hat seine Zeit, und meine ist um. Es ist nicht schlimm, ich bin müde. Ich hatte ein gutes Leben, und das verdanke ich dir. Du hast mein Leben reich gemacht. Wenn ich dich nicht gehabt hätte... Es ist so schön, dass ich dich haben durfte. Sie wollten es erst nicht erlauben, aber ich durfte dich haben...“
Alexandra konnte sich keinen Reim darauf machen, was ihre Mutter da redete. Aber sie sagte nichts, sondern hörte nur zu.
Die alte Frau sprach weiter, jetzt eindringlicher: „Kind, das Leben ist kostbar. Es vergeht viel zu schnell, deshalb vergeude es nicht. Gib dich nicht mit Dingen ab, die dich unglücklich machen, fühle dich nicht verantwortlich für jedermann. Man muss Dinge, die einem schaden, einfach hinter sich lassen und nicht mehr daran denken. Manchmal auch Menschen. Kümmere dich um dich selbst und um dein Kind, das ist das einzige, was zählt. Hörst du, vergeude keinen Tag!“ Ihr fest die Hand drückend, beschwor die alte Frau ihre Tochter nachdrücklich mit heiserer, vom nahenden Tod gezeichneten Stimme: „Vergeude keinen Tag deines Lebens, mein Schatz! Hörst du, keinen einzigen Tag!“
Alexandra konnte nur nicken, sie hatte eine Gänsehaut bekommen.
Der Kopf der Mutter sank wieder in die Kissen, ihre Augen schlossen sich erneut, und dieses Mal öffnete sie sie nicht wieder. Sie schlief ein, und während draußen die Vögel die ersten Frühlingslieder sangen, tat das Herz von Adele Sebach seinen letzten Schlag.
2
„Aber ist das nicht seltsam? Sie hat gesagt, dassichdas Haus geerbt hätte. Nicht offiziell, aber meine Tante hätte es ihr ausdrücklich so gesagt: Alexandra soll alles bekommen, was ich habe. Und dass ich eine Tante hatte... ist das nicht verrückt?“
Stefan ließ genervt die Zeitung sinken. „Wer weiß, ob das stimmt. Sie war ja schon ziemlich durch den Wind am Ende, das hast du selbst gesagt. Und ist das nicht scheißegal, wer den alten Kasten geerbt hat? Immerhin erbst du sowieso alles von deiner Mutter, also...“ Er senkte den Blick wieder auf die Zeitung und demonstrierte damit, dass das Gesprächsthema damit für ihn beendet war.
Alexandra war ärgerlich. Sie mochte es gar nicht, wenn ihr Mann Kraftausdrücke vor ihrer Tochter gebrauchte. Alex brachte selbst schon genug davon aus der Schule mit, sie sollte nicht denken, dass es normal war, so zu reden. Außerdem frustriert es sie, dass Stefan so wenig Anteil nahm. Sicher, er war im schwarzen Anzug bei der Beerdigung gewesen, er hatte die weinende Tochter und die schluchzende Ehefrau umarmt, hatte die Blumen bezahlt und die wenigen Trauergäste in die Gaststätte geführt, wo die Trauerfeier ihr Ende nahm. Und das war es dann auch für ihn: Das Ende. Die Schwiegermutter war tot und begraben und damit Schluss. Sie hatten die kleine Wohnung aufgelöst, alle Formalitäten erledigt und nun war die Sache ausgestanden. Jedenfalls für ihn.
Alexandra aber hätte jetzt gerne jemanden zum Reden gehabt. Die unglaublichen Dinge, die sie auf dem Sterbebett von ihrer Mutter erfahren hatte, musste sie dringend mit jemandem besprechen. Aber es war lange her, dass sie sich mit Stefan über andere Dinge austauschen konnte als die alltäglichen Notwendigkeiten wie: „Das Klopapier ist alle“, oder: „Wo sind meine dunkelblauen Jeans?“
Früher konnten sie stundenlang quatschen, sie diskutierten Filme oder politische Themen, redeten über ihre Probleme und was sie in der letzten Nacht geträumt hatten. Alexandra wusste gar nicht genau, wann das eigentlich aufgehört hatte und sich die Langeweile in ihre Ehe eingeschlichen hatte. Vielleicht, seitdem Stefan damals den angestrebten Chefposten in seiner Firma nicht bekommen hatte (man warf ihm Korruption vor, aber er war der festen Überzeugung, dass man ihn gemobbt hatte) und seither dem Alkohol mehr zusprach, als gut für ihn war. Um den Vorwürfen seiner Frau zu entgehen, denen er nichts entgegenzusetzen wusste, kam er oft gar nicht erst nach Hause und ging lieber mit ein paar Kumpels in die Kneipe. Seitdem redeten sie nicht mehr.
Allerdings konnte Alexandra auch ganz gut mit ihrer Tochter quatschen. Das Mädchen war für sie immer eine Freundin gewesen. Freilich war sie seit etwa einem Jahr schwierig geworden. Die Pubertät, da konnte man nichts machen. Sie selbst wäre da auch so gewesen, hatte ihre Mutter gesagt, und sie solle eben abwarten und geduldig sein, irgendwann gehe diese Phase vorbei. Das war leichter gesagt als getan, zudem Alexandra Stefans wegen manchmal sehr dünnhäutig war. Manchmal war Alex wie früher, anschmiegsam und verständnisvoll, aber kurz darauf konnte sie patzig und überempfindlich sein und ihrer Mutter mit beleidigenden Worten zusetzen. Und so grübelte Alexandra eben alleine über die letzten Sätze ihrer Mutter nach, die ihr nicht aus dem Kopf gingen.
Was hatte das nur zu bedeuten: Anna hätte oft gesagt, dass sie, Alexandra, das Haus bekommen sollte und auch sonst alles, was ihr gehörte. Das musste doch bedeuten, dass sie von Alexandra gewusst, sie vielleicht persönlich gekannt hatte, als sie noch klein gewesen war. Sehr klein, sonst müsste sie sich noch erinnern. Hatten die Schwestern später noch Kontakt zueinander gehabt? Warum hatte ihre Mutter ihr die Tante verschwiegen?
Und die Worte: „Dann soll sie selber sehen.“ Was sollte sie denn selber sehen?
Sie hatte sich beim Notar erkundigt: Das Haus war ein altes, heruntergekommenes Bauernhaus in einem Thüringer Dörfchen, welches nur knapp dreihundert Einwohner zählte. Allein in ihrem Wohnblock wohnten mehr Menschen als dort. Alexandra wusste zwar, dass ihre Mutter aus Thüringen stammte, man merkte es auch an ihrem Dialekt, aber sie selbst war nie dort gewesen.
Was hatte ihre Mutter damit gemeint, als sie sagte, es sei so schön, dass sie sie haben durfte? Hatte man sie zur Abtreibung gedrängt? Wer konnte nur ihr Vater sein? Sicher ein Bursche aus dem Dorf, von dem sie ungewollt schwanger geworden war. Adele hatte ihrem Heimatdorf den Rücken gekehrt, hatte den Kontakt zu Eltern, Schwester und Jugendfreunden abgebrochen und war mit ihrem Kind in die Welt hinausgezogen. Dort hatte sie als alleinerziehende Mutter in vielen Großstädten gelebt, zum Schluss waren sie in Berlin gelandet.
Alexandra war als Einzelkind aufgewachsen, ohne feste Bindung an einen Ort und an bestimmte Menschen. Wichtig war immer nur die Mutter gewesen, denn wo sie war, da war ihr Zuhause. Es hatte auch nur wenige Männer im Leben ihrer Mutter gegeben. Gelegentliche Affären, kurze Beziehungen, nichts Festes. Die Mutter suchte keine Bindung.
Was mochte nur vorgefallen sein, dass eine liebevolle, warmherzige Frau wie Adele Sebach völlig mit ihrer gesamten Familie gebrochen und sogar ihrer Tochter deren Existenz verschwiegen hatte?
Als Alexandra damals Stefan kennenlernte, stand ihre Mutter dem jungen Mann freundlich, aber distanziert gegenüber. Die beiden hatten keine Probleme miteinander gehabt, denn Stefan hielt es genauso. Als die Kleine geboren wurde, war ihre Großmutter sehr glücklich und entwickelte eine innige Beziehung zu dem Kind. Manchmal verwöhnte sie die Kleine zu sehr, aber auf die Einwände ihrer Tochter hin erwiderte die Oma nur, Großmütter hätten das Recht, ihre Enkelkinder zu verwöhnen und damit basta.
Alexandra war ihr Leben bis vor kurzem als relativ unkompliziert und leicht überschaubar vorgekommen, aber aus irgendeinem Grund hatte sie dieses Gefühl seit dem Tod ihrer Mutter nicht mehr.
„Ich geh nochmal raus!“, verkündete Alex, warf den DS, mit dem sie sich bis dahin beschäftigt hatte, auf den Tisch und verschwand. Alexandra blickte der Dreizehnjährigen besorgt hinterher und verkniff sich, hinter ihr herzurufen: „Zieh eine Jacke an!“. Oder: „Komm vor zehn nach Hause!“. Oder: „Pass auf dich auf, lass dich nicht mit Zuhältern und Drogenhändlern ein, geh mit keinem Jungen mit nach Hause, egal was er dir verspricht, lass dich nicht überfahren, vergewaltigen, entführen...“
Alexandra seufzte. Dieses Großstadtleben mochte etwas für Erwachsene sein, für Heranwachsende war es sicher nichts. Zumindest nichts für die Nerven ihrer Eltern.
Stefan legte die Zeitung hin und stand ebenfalls auf. „Du hast doch nichts dagegen, wenn ich noch ein paar Stunden ins Fitnessstudio gehe?“, meinte er leichthin und hatte dabei diesen beiläufigen Tonfall, dass bei Alexandra sofort alle Alarmglocken schrillten. Im vorigen Jahr, als er diese Affäre mit der blonden Studentin gehabt hatte, waren es Überstunden gewesen, und auch die hatte er seiner Frau mit demselben Tonfall mitgeteilt, den er anscheinend für sehr unauffällig hielt.
„Fitnessstudio?“, fragte sie lahm. „Ich dachte, wir schauen uns heute diesen Film an, den historischen, du weißt schon. Wolltest du den nicht sehen?“
Stefan schüttelte den Kopf. „Ach, guck du mal alleine. Kannst mir ja hinterher alles erzählen.“ Er tätschelte ihr freundlich die Schulter und ging ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Sie hörte ihn ein Liedchen pfeifen.
„Duwirst mir bestimmt nicht alles hinterher erzählen!“, dachte Alexandra frustriert und gekränkt. „Zumindest nicht, was du wirklich gemacht hast.“
Stefan war Bauingenieur und arbeitete seit seinem unehrenhaften Rauswurf aus seinem alten Baubetrieb in einer kleineren Firma. Die Kollegen verstanden sich gut, so gut, dass sie sich auch abends gern auf ein Bier trafen. Es blieb bald nicht mehr beim Bier. Die erste Affäre hatte Stefan mit einer Kollegin gehabt. Seine Frau vertraute ihm, glaubte an seine erfundenen Dienstreisen und Überstunden. Doch eine ihrer Bekannten hatte Stefan und seine Freundin in der Stadt beim Verlassen eines Hotels gesehen, zu einem Zeitpunkt, zu dem er eigentlich zu Vermessungsarbeiten in Köln hätte sein sollen. Bei einer Aussprache kam alles heraus, Stefan machte mit der Kollegin Schluss, alles war wieder gut. Doch leider war er auf den Geschmack gekommen, seine Affären wurden immer jünger und häufiger, der Alkoholkonsum stieg. Und die Überstunden fingen wieder an. Schon oft hatte Alexandra unter Tränen mit Scheidung gedroht, wenn er wieder einmal sturzbetrunken und nach fremdem Parfüm riechend in den Morgenstunden nach Hause gekommen war. Sie machte ihm eine Szene, er schlief auf der Couch im Wohnzimmer - wie immer.
Eine Weile herrschte dicke Luft und Alexandra war entschlossen, ihn zu verlassen. Ein paar Tage später fing er an zu schmeicheln und zu betteln, schwor ihr ewige Liebe und Besserung. Wenn Alexandra immer noch hart blieb, kamen die Selbstmorddrohungen und dieses „Ich-bin-ja-sowieso-nichts-wert“- Gestammel, das Alexandra verabscheute. Wenn auch das nichts half, wies er sie dezent darauf hin, dass sie finanziell von ihm abhängig war und sie ohne ihn kaum in der Lage wäre, mit ihrem schlecht bezahlten Job im Altenheim ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und auch den von Alex nicht. Das Wohlergehen ihrer Tochter gab dann den Ausschlag, dass sie um des lieben Friedens willen einlenkte und ihm eine weitere Chance gab.
Die er mit einer Regelmäßigkeit vergeigte, die wohl das einzig Zuverlässige an ihm war.
Aber das Schlimmste, das Allerschlimmste an der ganzen Sache war, dass sie ihn immer noch liebte.
Alexandra blieb starr und resigniert im Wohnzimmer vor dem schwarzen Fernseher auf dem Sofa sitzen. Als Stefan gegangen war, lauschte sie noch eine Weile dem Schall der zugefallenen Wohnungstür nach, dann begann sie zu weinen.
Am nächsten Morgen, als Stefan zur Arbeit und Alex in die Schule gegangen waren, machte sich Alexandra über die Kartons her, die sie aus der Wohnung ihrer Mutter geholt hatte.
Sie hatte heute Spätdienst, und das Sortieren der Hinterlassenschaften schien ihr am besten geeignet, sich von ihren Grübeleien über Stefans spätes Heimkommen am vergangenen Abend abzulenken. War da eine neue Affäre oder war da nichts? Stefan verstand es, sie mit Worten in Sicherheit zu wiegen, aber das schaffte er nur, weil sie ihm so gern glauben wollte. Warum konnte nicht einfach alles in Ordnung sein?
Seufzend öffnete Alexandra einen der Pappkartons. Das meiste – Geschirr, Kleider, Möbel – war von einem Räumdienst abgeholt worden, Alexandra hatte die Sachen einem gemeinnützigen Verein geschenkt. Was sie an hübschen Kleinigkeiten und Erinnerungsstücken behalten wollte, passte in eine Kiste. Eine weitere enthielt Bücher, Papiere, Urkunden, Zeugnisse, Briefe, Kinderzeichnungen von ihr selbst, Muttertags- und Geburtstagskarten. Diesen Karton ging Alexandra nun durch. Sie hoffte, einige Hinweise auf ihre unbekannte Tante und ihre Großeltern zu erhalten.
Warum hatte sie die Mutter nur nie gefragt? Sie hätte sie drängen müssen, ihr von ihren Vorfahren zu erzählen, jeder Mensch hat doch ein Recht darauf, so etwas zu wissen! Aber Alexandra hatte nie gefragt. Zu selbstverständlich war es für sie gewesen, dass es nur sie und ihre Mutter gab, sonst niemanden. Und nun war es für Fragen zu spät.
Eifrig sichtete sie nun Papiere. Da war ein alter Führerschein ihrer Mutter aus DDR-Zeiten, ein Heftchen eher. Genau wie der alte Personalausweis, auch ein Heftchen, säuberlich in eine Hülle gesteckt. In einer Mappe die Geburtsurkunde: Adele Maria Sebach, geboren am 25. Juni 1949 in Erfurt. Eltern: Karl Sebach und Wilma Sebach, geborene Kurzhals.
Alexandra schmunzelte. Sie musste es Alex erzählen, die würde es lustig finden, eine Uroma zu haben, die als Kind Wilma Kurzhals geheißen hat!
Als Alexandra eine große, braune Ledermappe öffnete, fielen ihr etliche Briefe entgegen. Aufgeregt überprüfte sie die Absender, aber sie hatte Pech: Kein einziger Brief war von einer Anna oder sonst irgendeinem Sebach. Briefe von Horst Schmidt waren es, einem verflossenen Liebhaber ihrer Mutter, mit dem sie vier Jahre zusammen gewesen war und den sie bei einer Kur kennengelernt hatte. Onkel Horst hatte Alexandra ihn genannt. Sie wusste gar nicht, warum es mit den beiden nicht geklappt hatte und wie es auseinandergegangen war. Vielleicht würde sie es herausfinden, wenn sie die Briefe las, aber dazu hatte Alexandra keine Lust. Sie brannte darauf, etwas über ihre unbekannte Tante zu erfahren.
Als sie gerade ein paar Notizbücher durchblätterte, klingelte das Telefon. Sie blieb sitzen und wartete, bis der Anrufbeantworter ansprang und Stefans Stimme ertönte: „Hallo Schatz. Ich komme heute später. Ihr braucht mit dem Abendbrot nicht auf mich zu warten. Tschau!“
Wie betäubt hockte Alexandra zwischen dem Haufen Papiere. Ihre Kehle schnürte sich zu und die Kränkung saß ihr wie ein Klumpen im Magen.
„Es ist wie in einem schlechten Film“, dachte sie verbittert. „Genau diese Worte, die Ehemänner benutzen, wenn sie fremdgehen. Hält der mich eigentlich für bescheuert? Er muss doch wissen, dass ich es weiß. Und ich weiß, dass er weiß, dass ich es weiß. Und warum kann er sich das erlauben? Nur, weil ich so blöde bin, es ihm immer wieder durchgehen zu lassen.“ Alexandra warf das Buch, was sie gerade in der Hand hielt, in die Kiste zurück.
„Scheiße, scheiße, scheiße!“
Sie warf sich aufs Sofa und wollte nur noch heulen. Aber es ging nicht, sie war zu wütend. Alexandra überlegte, eine ihrer Freundinnen anzurufen, aber die einzige, mit der sie über Stefan reden könnte, war Birgit, und die war im Urlaub auf den Kanaren. Schöner Mist. Die anderen Freudinnen schienen Alexandra nicht geeignet, um Eheprobleme mit ihnen durchzugehen. Simone schwatzte nur ununterbrochen über ihre Zwillinge: Erste Zähnchen, was denn besser sei, Brei aus dem Glas oder selbstgekocht und über biologisch abbaubare Windeln. Seit sie die Babys hatte, war sie kaum noch aus ihrer Wohnung zu kriegen. Alexandra gönnte ihr ja das Mutterglück, aber die Freundschaft ging doch so langsam auseinander. Simone traf sich jetzt lieber mit anderen Müttern, die sie in der Krabbelgruppe kennengelernt hatte. Im vorigen Jahr, als Simone schwanger gewesen war, hatte Alexandra auch eine Zeitlang darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn sie noch ein Baby bekämen. Ihr hatte der Gedanke gefallen, dass ihr Mann mit seinem kleinen Sohn Legotürme baute und Rennautos fahren ließ. Aber Stefan war komplett dagegen gewesen, er wollte kein weiteres Kind. Alexandra war darüber zwar etwas gekränkt, hatte aber schnell eingesehen, dass eine Ehe nicht mit einem Kind gekittet werden konnte.
Ihre andere Freundin, Diana, war frisch verliebt und schwärmte unablässig von ihrem ‚Süßen‘, wie sie ihn nur nannte. Dass sie sich einmal in der Woche in der Stadt verabredeten und dann so taten, als würden sie sich zufällig treffen, damit sie sich immer neu kennenlernen konnten. „Das müsst ihr auch mal machen, das ist wundervoll!“, riet sie ihren Freundinnen. Und dann erzählte sie ständig von den kleinen Dingen, die ihr Süßer ihr in der Wohnung hinterließ, damit sie merkte, dass er an sie dachte: Kleine Zettelchen mit Liebesgrüßen am Kühlschrank, ein Lippenstiftherzchen am Spiegel oder eine Praline auf dem Kopfkissen.
Alexandra fand es zum Kotzen. Sie dachte an die „Liebesgrüße“, die ihr Mann ihr in der Wohnung hinterließ: Zigarettenasche auf dem Teppich und eingetrocknete Kackstreifen im Klo. Diana hatte ihr gesagt, dass sie selber schuld sei, dass ihr Mann sich seine Bestätigung anderswo suchte, schließlich nörgele sie nur noch an ihm herum. „Einen Mann muss man anhimmeln und bewundern“, sagte sie. „Er muss immer das Gefühl haben, dass er der Größte ist, im Bett, im Job, überall. Dann tut er für dich auch alles, was du willst, glaub mir!“
Alexandra stellte sich eine gleichberechtigte Partnerschaft anders vor. Allerdings schien es ihr, als habe Diana den Nagel auf den Kopf getroffen: Stefan, der leider ein etwas überzogenes Selbstwertgefühl hatte, brauchte ständig Bewunderung und Bestätigung. Die gab ihm Alexandra nicht mehr. Und sie war nicht bereit, sich zu verstellen und ihren Mann wie ein verwöhntes Kind zu behandeln, nur damit er sie nicht betrog.
Wann hatte Stefan sie eigentlich das letzte Mal gefragt, wie es ihr ginge und was sie für Probleme hatte? Es war ihm egal. Sie war ihm egal. Das zu spüren, tat weh.
Aber wie sollte es dann weitergehen?
Was hatte ihre Mutter gesagt? „Kind, das Leben ist kostbar, vergeude es nicht. Gib dich nicht mit Dingen ab, die dich unglücklich machen. Man muss Dinge, die einem schaden, einfach hinter sich lassen und nicht mehr daran denken. Manchmal auch Menschen. Kümmere dich um dich selbst und um dein Kind, das ist das einzige, was zählt. Hörst du, vergeude keinen Tag!“
Das waren ihre Worte gewesen.
Sie hatte keines davon vergessen.
Aber die eigentliche Bedeutung dieser Worte sickerte erst allmählich in ihr Bewusstsein, erst allmählich verstand sie, was ihre Mutter ihr als letzten Rat gegeben hatte. Und das Verstehen erschreckte sie. Denn das bedeutete, dass sie in ihrem Leben etwas verändern musste und dass es Einschnitte geben würde.
Schmerzhafte Einschnitte.
3
„Das ist ungerecht! Nie werdeichgefragt, wasichwill! Immer muss ich jeden Scheiß machen, denduwillst!“ Mit einem geräuschvollen Rumms fiel die Tür ins Schloss, dass die Scheiben im Wohnzimmerschrank klirrten.
Alexandra seufzte. Genau diese Reaktion ihrer Tochter hatte sie vorausgesehen. Wie sollte eine Dreizehnjährige auch sonst reagieren, wenn sie erfuhr, dass sie umziehen, ihre Schule wechseln und ihren Freunden Lebewohl sagen musste? Dass sich ihre Eltern trennen wollten, hatte Alex lange nicht so mitgenommen, wie Alexandra gedacht hatte. Selbst die Reaktion ihres Mannes war verhalten gewesen. Aber das musste nichts bedeuten, da konnte durchaus noch was kommen.
Alexandra seufzte erneut und räumte das Geschirr vom Abendbrottisch. Gespielte Normalität. Keiner von ihnen hatte einen Bissen gegessen, nachdem sie die Bombe hatte platzen lassen. Einfache Worte hatte sie gewählt, die sie sich sorgsam zurechtgelegt hatte: „Ich muss euch etwas mitteilen. Ich habe beschlossen, nach Finkendorf zu ziehen. Allein. Also, allein mit Alex.“ Sie hatte tief Luft geholt: „Ich glaube, es ist das Beste für uns alle, wenn wir uns trennen, Stefan! Ich habe keine Lust mehr auf diesen ganzen Mist. Du kriegst das mit dem Alkohol und mit den...“, ein vorsichtiger Blick zu Alex, „... und mit den Weibergeschichten doch nicht auf die Reihe, und ich bin nicht deine Therapeutin. Ich habe vor, mich wieder mehr um mich selbst zu kümmern. Das ist mein gutes Recht, ich habe schließlich auch nur das eine Leben.“
Stefan hatte zerknirscht genickt. Er reagierte immer überaus reumütig, wenn er auf seine Verfehlungen angesprochen wurde. Am Ende würde sie ja doch wieder einlenken, so wie immer. Er würde ihr sagen, dass er sie über alles liebte und ohne sie nicht leben konnte. Eher würde er sich umbringen, als ohne sie zu leben. Er wusste, dass ihr das Familienleben wichtig war. Er würde die Sache mit Jacqueline langsamer angehen lassen, nicht mehr so oft zu ihr gehen, bis sich die Lage zu Hause beruhigt hatte und Alexandra nicht mehr von Trennung redete. Er hasste es, wenn sie das tat. Immerhin war sie seine Frau und gehörte ihm. Sie führten ein ruhiges und bequemes Familienleben und wie sähe das denn aus, wenn seine Frau ihm den Laufpass gäbe? Die Kollegen würden sich kaputtlachen. Und überhaupt – wo wollte sie hin? Nach Finkendorf, in die Thüringer Provinz? Nie und nimmer zog sie das durch. Da war sich Stefan ganz sicher.
Aber dieses Mal war es anders. Stefan wusste es noch nicht, aber Alexandra hatte Nägel mit Köpfen gemacht. Sie hatte mit dem Finkendorfer Bürgermeister Kontakt aufgenommen, sich beim Landratsamt umgemeldet, die Schulummeldung ihrer Tochter in die Wege geleitet, ihren Job im Altenheim gekündigt und mit einem Scheidungsanwalt gesprochen. Ihrer Freundin Diana, die mit ihrem neuen Freund zusammengezogen war, kaufte sie deren altes Auto ab, einen Honda Civic, der schon gut und gerne zwölf Jahre auf dem Buckel hatte, und meldete ihn auf ihren Namen um. Erst dann folgte das Gespräch am Abendbrottisch.
Sollte doch Stefan mit Selbstmord drohen, sie ließ sich nicht mehr erpressen! Die Worte ihrer Mutter klangen ihr immer noch wie ein Echo im Ohr: „Vergeude keinen einzigen Tag!“
Stefan war auf ein Bier in seine Kneipe gegangen. Ohne ein Wort hatte sie ihn ziehen lassen.
Alexandra klopfte vorsichtig an Alex‘ Tür. Als sie keine Antwort bekam, trat sie leise ein.
Alex lag auf ihrem Bett, das Gesicht ins Kissen gedrückt. Alexandra streichelte ihr über das braune, glänzende Haar, das ihrem eigenen so ähnlich war. Überhaupt glich ihr die Tochter sehr, sie teilten sich nicht nur den gleichen Vornamen, sondern auch den größten Teil ihrer Gene. Außer den Ohren und der Nase und einem unglückseligen Hang zur Unordnung hatte Alex nicht viel von ihrem Vater mitbekommen. Nun ja, eine gewisse Sprachbegabung und die Liebe zum Zeichnen hatte sie auch von ihm, das musste Alexandra sich eingestehen.
„Es tut mir so leid!“, sagte sie zu dem Hinterkopf ihrer Tochter.
„Ihr lasst euch wirklich scheiden? Jetzt endgültig?“, fragte das Mädchen.
„Ja, jetzt endgültig. Es geht einfach nicht mehr.“
Eine Weile war Ruhe.
Alexandra betrachtete den Körper ihrer Tochter, der fast nichts Kindliches mehr an sich hatte. Beinahe war sie schon so groß wie ihre Mutter, nur schlanker. Es war nicht zu glauben, wie schnell aus einem zarten kleinen Mädchen ein Teenager wurde, der jetzt statt rosa Kleidchen lieber schwarze, enge Sachen mit Totenköpfen drauf trug.
„Das war doch nicht dein Ernst, oder?“, kam die gedämpfte Stimme von Alex aus dem Kissen. „Ich meine, dass wir in dieses Kuhkaff ziehen? Das hast du doch nur so gesagt, stimmt‘s?“
Alexandra seufzte. „Nein, ich fürchte, dieses Mal ist es mir ernst. Ich verlasse Papa und ziehe mit dir nach Finkendorf. Es ist schön da, du wirst sehen. Du wirst neue Freunde finden und auch...“
„Woher willst du wissen, dass es da schön ist? Du bist ja noch gar nicht dort gewesen!“
Alexandra versuchte, zuversichtlich zu klingen: „Oma hat es mir erzählt. Es ist idyllisch und ruhig dort. Es wird sein wie Ferien auf dem Bauernhof, die nie aufhören!“
„Ferien auf dem Bauernhof ist was für Kleinkinder! Kann ich nicht einfach hierbleiben? Ich kann doch bei Papa bleiben“, rief Alex.
Alexandra versetzte es einen Stich, aber sie antwortete, so ruhig sie konnte: „Schatz, ich verlasse deinen Vater, weil er Alkoholiker ist. Nein, du kannst nicht bei ihm bleiben! Aber du kannst ihn besuchen, so oft du willst, an den Wochenenden und in den Ferien.“
Alex wandte ihrer Mutter die tränennassen Augen zu. „Das ist egoistisch, Mama! Sonst ist es doch auch immer gegangen - mit Papa, meine ich. Kannst du es nicht noch ein paar Jahre aushalten? Wenigstens, bis ich sechzehn bin?“
Langsam fiel es Alexandra schwer, ruhig zu bleiben.
„Ich soll noch drei Jahre meines Lebens mit einem alkoholkranken Weiberhelden von Mann zusammenleben, der mich nicht liebt und nur ausnutzt, nur damit du nicht die Schule wechseln musst? Erzähle mir bitte nichts von Egoismus, meine Liebe! Das Leben ist kostbar, weißt du, sogar meins! Und ich habe nicht vor, auch nur noch einen Tag davon zu verschwenden! Das habe ich meiner Mutter auf dem Sterbebett versprochen - undichliebe meine Mutter!“
Alexandra wollte sich abwenden, aber da fiel ihr Alex um den Hals. „Ich hab dich doch auch lieb, Mama. Und ich will ja auch nicht, dass du unglücklich bist. Sag mir nur noch, ob wir eine schöne Wohnung da haben und ob ich mein eigenes Zimmer bekomme. Hoffentlich gibt es einen Internetanschluss.“
Alexandra lächelte. „Ein eigenes Zimmer? Du bekommst ein ganzes Haus voller Zimmer. Aber ob es einen Internetanschluss hat, weiß ich nicht.“
„Aber...“
„Kein Aber. Ab übernächste Woche sind Osterferien, aber ich will versuchen, dass du eher freigestellt werden kannst. Am Wochenende fahren wir nach Finkendorf. Nach den Ferien gehst du in die neue Schule. Also pack deine Sachen.“
Ohne auf Alex‘ entsetztes Stöhnen zu achten, stand sie auf und machte sich an die Arbeit.
4
Es war ein warmer, sonniger Tag Mitte März.
Sie stiegen aus dem Auto und standen vor ihrem neuen Zuhause, welches im hellen Sonnenlicht noch schäbiger aussah, als es vielleicht im Regen ausgesehen hätte. Würde es regnen, fiele es vielleicht nicht so auf, dass keine einzige Fensterscheibe das Licht reflektierte, dass die Fassade grau und das eingesunkene Dach bemoost und zugewachsen war.
Die Landschaft, von Feldern und kleinen Wäldchen geprägt, war idyllisch und etwas langweilig, so wie das Dorf selbst. Das Dörfchen war im Großen und Ganzen eine Ansammlung netter Bauernhäuser, die eng aneinandergeklebt entlang einer schmalen Straße standen, die um eine kleine Kirche herumführte. Ein Anger und ein kleiner Spielplatz, der nur aus einer Sandkiste und einer Schaukel bestand, bildeten den Dorfmittelpunkt. Ein paar Straßen zweigten ab und führten jeweils zu einem Friedhof, zu einer verwaist wirkenden Gärtnerei, zu einem alten, verlassenen Industriegelände oder einfach nur aufs Feld. Sie waren allen Wegen gefolgt und wieder umgekehrt. Hinter den Gardinen tauchten gelegentlich neugierige Gesichter auf, aber niemand kam heraus.
Bisher waren sie zwei Katzen, einem Hund, drei Hühnern und nur zwei Leuten auf der Straße begegnet, einem Kind und einem Mann. Den Mann fragten sie nach der Nummer sechsundsechzig, nach dem Sebach-Haus. Der Zeitungsausträger gab bereitwillig Auskunft und blieb hinterher stehen, um ihnen nachzublicken.
Das alte, zweistöckige Fachwerkhaus ihrer Tante stand am Ende einer schmalen Straße, die leicht hangaufwärts zum Walde hin verlief und sich in einem Feldweg verlor. Es war größer, als Alexandra angenommen hatte und machte den Eindruck, dass es einmal sehr stattlich gewesen sein mochte, bevor der Zahn der Zeit ihm zugesetzt hatte. Es stand etwas zurückgesetzt in einem großen Garten. Eine Reihe ähnlicher Gebäude flankierten die Straße. Einige hatte man saniert und mit bunten Fassaden versehen, aber man sah trotzdem, dass es alte Häuser waren. Statt einer Garage mit Zufahrt wie bei den anderen stand ein Schuppen neben ihrem Haus, der auch schon bessere Tage gesehen hatte. Der Vorgarten hinter dem wackeligen Holzzaun war völlig von vergilbtem Gras, Unkraut und Dornenranken überwuchert, sodass man den Weg kaum sah. Ein großer Walnussbaum stand links, eine Lärche rechts neben dem Haus und streckte ihre Äste über das Dach. Eine Rankenpflanze, die wie wilder Wein aussah, hatte die gesamte rechte Seite des Hauses überwuchert und schien Willens, sich auch der linken zu bemächtigen. Sogar auf dem Dach und auf den Schornsteinen wucherte sie emsig. Neben dem Haus war jeweils ein etwa vier Meter breiter Streifen bis zu den Nachbargrundstücken frei. Nun ja, so frei, wie es das Gestrüpp zuließ, welches überall üppig wucherte. Hinter dem Haus ragten große Bäume mit den Ästen über das Dach. Sicherlich würden sie schön aussehen, wenn sie begannen, sich mit zartem Grün zu schmücken. Weiter hinten sah man die hohen Tannen des Wäldchens, das zum Dorf gehörte. Wer in den Wald wollte, musste an ihrem Haus vorbei, denn die Straße ging ein paar hundert Meter weiter in einen unbefestigten Weg über, der direkt in den Wald hinein führte.
Stumm stand Alex am Auto und starrte das Haus an. Sie protestierte nicht, denn über diesen Punkt war sie schon hinaus. In den letzten Tagen und selbst noch während der fünfstündigen Autofahrt war sie mit allen ihren Argumenten bei ihrer Mutter vor Mauern gelaufen, hatte geweint, gebettelt und gebockt - nichts hatte geholfen.
Zwei Wochen vor den Ferien hatte Alex ihre Sachen packen müssen. Sie heulte dabei und war unglücklicher denn je. Von ihren Freundinnen Vivien und Julia hatte sie sich tränenreich verabschiedet, die Klasse hatte ihr ein großes Bild geschenkt mit allen Unterschriften drauf, die sie in die farbigen Abdrücke ihrer Hände geschrieben hatten. „Viel Glück in der neuen Schule“, stand groß darüber, und da weinte Alex das erste Mal vor der ganzen Klasse.
Klar war sie alt genug, um zu begreifen, dass sich ihre Eltern getrennt hatten und auch warum sie sich getrennt hatten - etliche ihrer Freundinnen lebten auch in geschiedenen Familien - aber sie verstand einfach nicht, dass sie deswegen gleich nach Sibirien auswandern mussten. Wieso gaben sie das bequeme Leben in der Stadt auf? Warum mussten sie in dieses öde, langweilige Kuhkaff ziehen? Hier gab es gar nichts, nicht mal einen Laden, wo man einkaufen konnte. Wegen jedem Stück Butter mussten sie jetzt in den Supermarkt fahren, der einige Kilometer entfernt lag. Sogar zur Schule musste sie meilenweit fahren mit so einem ollen Schulbus. Daheim waren es nur zehn Minuten Fußweg bis zur Schule gewesen, und unterwegs hatte sie ihre Freundinnen Vivien und Julia abgeholt.
Alex vermisste jetzt schon ihre Freundinnen, mit denen sie sich nach der Schule am Einkaufszentrum getroffen und stundenlang gequatscht hatte. Sie waren durch die Einkaufspassagen und über den Alexanderplatz gestromert, hatten mit Jungs geflirtet, heimlich geraucht, in der Drogerie Parfüm probiert, sich die neusten Klamotten angesehen und waren ins Kino gegangen. Und ausgerechnet jetzt, wo sie bald vierzehn wurde und endlich in die besseren Filme und Diskotheken hineindurfte, zog sie weg! Was sollte sie hier in der Einöde machen? Zwar gab es eine Busanbindung in die nächstgrößere Stadt, aber da musste sie einmal umsteigen und war über eine Stunde unterwegs. Außerdem fuhr der Bus nur dreimal am Tag. Und überhaupt, was sollte sie da? Sie kannte doch keinen in Erfurt. Pah, so ein Provinzstädtchen! Sollte eher Erfurz heißen! Ja, Erfurz, haha!
Alex seufzte resigniert. Hoffentlich gab es in diesem Dorf wenigstens ein paar hübsche Jungs. Hoffentlich gab es hier überhaupt Menschen! Vorsichtig folgte sie ihrer Mutter zum Haus.
Alexandra war einigermaßen schockiert über den Zustand des Vorgartens und der Fassade. Sie bemühte sich sehr, die Fassung zu bewahren, aber sie war im Moment nicht weniger mutlos als ihre Tochter und sehnte sich angesichts des Zerfalls und der Einsamkeit hier schmerzlich zurück in ihr vertrautes Zuhause und in ihr gewohntes Leben. Dieses winzige Dörfchen war so ganz anders als die lebendige, wimmelnde Großstadt, in der sie sich zu Hause fühlte. Solche Dörfchen sah man manchmal im Fernsehen und dachte: „Ach, wie idyllisch!“, dann schaltete man auf einen anderen Kanal um. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, einfach alle Zelte abzubrechen und hierher zu kommen – mit der Absicht, zu bleiben! Wie sollte sie das aushalten? Ihr Enthusiasmus, der sie seit dem Entschluss, Stefan zu verlassen, beflügelte, drohte zu verblassen.
Aber sie konnte nicht zurück, das ging auf gar keinen Fall. Gerade vorhin hatte Stefan angerufen und ihr gedroht, das alleinige Sorgerecht für Alex zu beantragen, falls sie nicht wieder zurückkäme. Und sie bräuchte sich nicht einbilden, dass sie jetzt, da sie ein Haus besäße, nicht mehr von ihm abhängig sei. Sie würde schon merken, dass sie ohne ihn nicht zurechtkäme. Alexandra wusste nicht, ob sie amüsiert oder wütend sein sollte. Das alleinige Sorgerecht, ha, einfach lächerlich! Sie wussten beide, dass er angesichts seiner Alkoholsucht froh sein durfte, wenn er ein Besuchsrecht erhielt. Dachte er wirklich, dass er sie damit beeindrucken konnte? Hielt er sie wirklich für so dumm, auf so eine plumpe Drohung hereinzufallen? Es war fies und typisch für Stefan, ihre Schwachstelle ausnutzen zu wollen. Was wollte er denn mit dem Sorgerecht? Er kümmerte sich sowieso nicht um Alex. Seine Frau brauchte er, und zwar zum Putzen, Bügeln und Kochen! Er war ein egoistischer Idiot, weiter nichts. Das hatte sie ihm auch klipp und klar gesagt, bevor sie das Handy ausschaltete. Von ihm abhängig, von wegen! Mit solchen Sprüchen bestärkte er sie nur in ihrem Entschluss, ihn endgültig zu verlassen, so weh es auch tat. Und ganz gleich, was für eine Bruchbude das hier war, sie mussten hier bleiben, wenigstens vorerst. Sie hatten nichts anderes.
Bemüht, sich vor ihrer Tochter nichts anmerken zu lassen, stemmte Alexandra resolut die Fäuste in die Seiten und marschierte ein paar Schritte nach links, dann ein paar Schritte nach rechts, die Fassade betrachtend.
„Sieh nur, was für eine Menge Platz wir jetzt hier haben! Da kannst du ein ganzes Zimmer nur für deine Malutensilien bekommen und musst abends nichts wegräumen! Ist das nicht toll?“ Dabei stolperte sie über eine Dornenranke und wäre beinahe gestürzt.
„Es wäre aber auch schön, wenn es Strom und fließend Wasser gäbe!“, erwiderte Alex trocken, während sie durch eines der Fenster spähte und schaudernd die dunklen, rissigen Tapeten und die niedrigen, durchhängenden Decken betrachtete.
„Sei nicht albern, natürlich hat es Strom und Wasser“, erwiderte ihre Mutter. „Kann sein, dass die Leitungen ein wenig veraltet sind, aber sonst ist das Haus doch noch ganz gut in Schuss. Das Dach müsste vielleicht geflickt werden und durch die Fenster könnte es ein wenig ziehen, aber das ist doch nicht so schlimm! Du bist eben verwöhnt, das ist alles.“
Tatsächlich gehörte das ganze Gemäuer abgerissen und entsorgt, fand Alex. Sie fragte hoffnungsvoll: „Warum verkaufen wir diese alte Bude nicht und kaufen von dem Geld ein ordentliches Haus? Eins, wo es nicht zieht und reinregnet?“ Dabei stupste sie mit dem Finger gegen eine lockere Stelle am Putz, worauf ein großer Fladen desselben abfiel.
„Sei nicht naiv. Wer soll denn so ein altes Haus kaufen, in dieser Lage? Hier stehen viele Häuser leer. Außerdem...“ Alexandra warf einen Blick auf ihre Tochter und beschloss, ihre Strategie zu ändern. „...Außerdem sollten wir stolz darauf sein, dass wir jetzt so ein wundervolles altes Haus haben. Das ist doch wie in einem Abenteuerfilm, findest du nicht?“
„Gruselfilm trifft‘s eher“, murmelte Alex, aber ihre Mutter beachtete den Einwurf nicht. Sie hatte sich in Rage geredet und erklärte enthusiastisch: „Ich meine...das ist doch mein Erbe, meine Vergangenheit! Und auch deine, wenn ich dich daran erinnern darf! Hier darf niemand Fremdes einziehen! Man verkauft doch nicht einfach Grund und Boden, das ist doch dumm. Woanders musst du Miete zahlen, hier so gut wie gar nichts. Außerdem hast du Platz hier, hinten gibt es noch einen Stall und einen Garten! Es muss wunderbar sein, hier zu leben!“
Ihre gespielte Begeisterung verflog, als Alex leise fragte: „Und warum wollte Oma dann nicht hier leben?“
Zum Glück musste Alexandra nicht antworten, denn eben kam ein Mann auf einem Fahrrad angefahren, bremste scharf vor ihrer Gartentür und stieg ab. Er wollte das Fahrrad an den Zaun lehnen, überlegte es sich angesichts des morschen Holzes aber anders und stellte es auf den Seitenständer.
„Na, hallo und herzlich willkommen, ihr müsst doch die Winklers sein!“, rief er und kam mit ausgebreiteten Armen auf die beiden Frauen zu. „Karge mein Name. Karl Karge. Freut mich, euch zu sehen! Ich habe gehört, dass ihr angekommen seid und wollte nur gleich mal den Schlüssel bringen, nicht wahr?“
Er war ein beweglicher, kleiner Mann um die sechzig, der eine gesunde Gesichtsfarbe hatte und eine Schiebermütze auf seiner Glatze trug. Er hatte einen blauen, ausgewaschenen Arbeitskittel an und trug darüber eine kurze Jacke. Alexandra musterte ihn verblüfft. Das sollte der Bürgermeister sein?
Als er ihr gegenüberstand, weiteten sich seine Augen. „Na, da muss man aber keinen Ausweis verlangen, um zu sehen, dass du eine waschechte Sebach bist! Und du...“, er wandte sich Alex zu. „...und du genauso! Nicht zu fassen. Ja, das ist schön, dass ihr euch endlich mal hier blicken lasst und nach dem Haus schaut. Wie geht es denn der Adele? Alles gesund, alles munter?“
Alexandra, die sich von dem lebhaften Mann und vor allem von dem vertraulichen „Du“ etwas überrumpelt fühlte, antwortete: „Sie ist gestorben. Vor drei Wochen. Es war Gebärmutterhalskrebs, es ging am Ende ganz schnell.“
Der Mann wirkte ehrlich betroffen. „Ach. Ach je. Das ist ja... also das ist wirklich schlimm. Ich kannte sie gut, die Adele. Gebärmutterhalskrebs, sagst du. Ach je.“ Er rieb sich mit der Hand über sein stoppeliges Kinn, dass es raschelte.
Alexandra unterbrach ihn: „Sie kannten doch bestimmt auch meine Tante Anna gut?“
Eigentlich wollte sie ihn auch duzen, aber es kam ihr einfach nicht über die Lippen. Den Mann schien das nicht im Geringsten zu stören. Er vertauschte seinen betroffenen Gesichtsausdruck augenblicklich gegen ein freundliches Lächeln und erwiderte eifrig: „Natürlich, natürlich. Man kennt ja jeden hier, nicht wahr. Hatte es auch nicht leicht, die Anna, hatte Depressionen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man sich mal um sie gekümmert hätte. Ich meine, nicht dass ich jemandem einen Vorwurf machen würde, aber sie war schon sehr einsam, die Gute.“
Jetzt war es an Alexandra, betroffen zu sein. „Entschuldigen Sie, aber Sie verstehen nicht... ich kannte meine Tante gar nicht. Ich habe erst am Todestag meiner Mutter erfahren, dass es sie gab. Sie... und das Haus hier.“
Karl Karge fuhr überrascht zurück. „Was, das ist doch nicht möglich! Warum hat dir denn Adele nichts von ihrer Schwester erzählt?“
Alexandra zuckte nur stumm und entschuldigend mit den Schultern.
Herr Karge wirkte einen Moment verwirrt, dann fasste er sich und lächelte: „Nun ja. Nun ist es eben so. Kommt erst mal herein!“
Mit diesen Worten holte er einen großen Schlüsselbund aus seiner Jackentasche und schritt forsch auf die Haustür zu, welche aus massivem Holz gefertigt und noch in recht gutem Zustand war, sah man über die abblätternde Farbe einmal hinweg. Während er am Schloss hantierte, erzählte er über das Haus: Dass er im ersten Winter, den es leer stand, veranlasst hatte, die Leitungen leer laufen zu lassen, damit sie nicht einfrören, dass es leider durchs Dach regnete und dass die Ofenheizung noch intakt sein müsste.
Alexandra folgte ihm zerstreut. Sie musste immerzu an ihre Tante denken und nahm sich vor, in den nächsten Wochen mehr über sie herauszufinden. Sie würde einfach die Leute hier ein bisschen ausfragen. Wenn es hier überhaupt Leute gab! Sie hatte in diesem ausgestorbenen Ort noch niemanden gesehen und wunderte sich, wie der Mann, der sich Bürgermeister nannte, überhaupt von ihrer Ankunft erfahren hatte. Es kam ihr alles sehr seltsam vor.
Alexandra hatte keine Ahnung, dass die beiden Fremden längst bei allen Einwohnern das Gesprächsthema Nummer eins waren. Karl Karge, dem sich Alexandra vor drei Wochen angekündigt hatte, erzählte dies seiner Frau, die erzählte es drei Nachbarinnen, diese ihren Verwandten und Freunden und im Nu war es im ganzen Dorf herum. Man hatte die Ankunft von Annas Nichte schon neugierig erwartet. Als sie dann da war und freundlicherweise im ganzen Dorf in allen Gassen herumfuhr, um das richtige Haus zu finden, sahen sie etliche neugierige Augen und so manche Hand griff zum Telefonhörer. In den Gärten beugten sich die Nachbarn über den Zaun, um sich die Neuigkeit zu erzählen, auf der Straße wurde miteinander geschwatzt. Bald wusste es jedes Schulkind: Die Sebachs sind da!
Alexandra, die der Meinung war, sie käme anonym und unbemerkt an diesen Ort, war in Wirklichkeit bekannt wie ein bunter Hund. Jeder zweite hatte die auffälligen Großstädter schon gesehen. Aber Alexandra wusste es nicht, und das war vielleicht auch besser so. Sie winkte ihrer Tochter, die schlecht gelaunt am Zaun stand. Alex holte seufzend ihren Laptop aus dem Auto und folgte ihrer Mutter und dem Bürgermeister ins Haus.
„Sieh nur, die hübschen Blumen!“, sagte Alexandra über die Schulter zu Alex. Es sollte aufmunternd klingen. Alex, die missmutig hinter ihr her trottete, wandte den Kopf und konnte zwischen den wuchernden Ranken eines Brombeerstrauches, der sich des halben Gartens bemächtigt hatte, ein paar lila Krokusse ausmachen, die sich durch die Dornen quälten. Aus irgendeinem Grund konnte sie ungefähr verstehen, wie sich diese Blüten fühlen mochten.
Inzwischen war es Karl Karge gelungen, das alte Türschloss zu öffnen. Es war glücklicherweise nicht eingerostet. Mit einem Knarren schwang die Tür auf und der Bürgermeister trat zur Seite, um den neuen Besitzern Platz zu machen. Mutter und Tochter blieben auf der Schwelle stehen und erblickten einen breiten, mit schwarzweißen Fliesen gekachelten Flur und den angrenzenden Raum, dessen Tür offen stand. Sonnenlicht fiel gedämpft durch die verschmutzten Scheiben und machte den durch ihr Eindringen aufgewirbelten Staub sichtbar. Ein muffiger Geruch nach Schmutz und alten Möbeln lag in der Luft und vermischte sich nur widerwillig mit der klaren Frühlingsluft, die von draußen hereinströmte. Von der Decke hingen, Girlanden gleich, Spinnenweben herab, deren Bewohner sich erschreckt in die Zimmerecken zurückzogen. Rechts war eine Treppe zu sehen, deren Stufen sich in einer halben Drehung zum Obergeschoss wanden. Am Handlauf war ein Stück abgebrochen. Oberhalb der Treppe war eine Bewegung auszumachen, schnelle Trippelschritte von kleinen Füßchen verrieten, dass das Haus gar nicht so unbewohnt war, wie es schien.
Alex und Alexandra sahen sich an.
„Na siehst du“, meinte Alexandra und rang sich ein Lächeln ab. „Es ist doch ganz hübsch hier!“
5
Sie folgten Karl Karge durch den Flur. Links neben der Eingangstür befand sich die Küche, dahinter ein weiterer Raum. Rechts lag das Wohnzimmer, das die gesamte Tiefe des Hauses einnahm und mit altmodischen Möbeln vollgestopft war.
Alexandras erster Eindruck, dass das Haus praktisch unbewohnbar sei, verflüchtigte sich allmählich und machte einer unbestimmten Freude Platz: Das alles hier war ihr Eigentum! Was mochte sie hier vorfinden, welche Schätze gab es zu entdecken? Ganz sicher mussten hier viele Hinweise auf ihre Tante zu finden sein, denn die hatte ja hier gelebt und das Haus und dessen Inhalt war seit ihrem Tod praktisch nicht angerührt worden.
Allerdings war das seltsam. Warum hatte sich ihre Mutter nicht um das Haus gekümmert? Warum hatte sie nicht wenigstens einen Räumdienst beauftragt oder eine Putzkolonne? Man hätte es verkaufen oder doch wenigstens leerräumen können? Aber nein, ihre Mutter hatte einfach so getan, als ginge sie dieses Haus nichts an.
„Komisch“, dachte Alexandra. „Das sah ihr gar nicht ähnlich.“
Herr Karge zeigte ihnen alles und erklärte dabei eifrig. Er schien mit den Räumlichkeiten sehr vertraut zu sein, anscheinend war er in seinem Leben schon oft hier gewesen. Außerdem hatte er sie gleich geduzt. War das hier üblich? Wie gut hatte dieser kleine Mann wohl ihre Mutter gekannt? Nachdenklich betrachtete Alexandra den Bürgermeister von der Seite. Er war ein kleingewachsener Mann, ihre Mutter war groß gewesen. Sie selbst, Alexandra, war auch eher klein…
Schnell verwarf sie diesen Gedanken. Ja, sie wollte ihren Vater finden, aber nicht jetzt sofort. Es wäre auch ein unwahrscheinlicher Zufall, wenn es der erstbeste Mann wäre, dem sie hier begegnete. Nein, erst einmal wollte sie sich das Haus ansehen und hier heimisch werden, um die anderen Fragen konnte sie sich später immer noch kümmern.
In der Küche stand ein kleiner Holzofen, in den anderen beiden Räumen befanden sich Umluftöfen. Die Lichtschalter und Steckdosen waren große, klobige Ungetüme, man konnte sich kaum vorstellen, dass hier noch Strom floss. Aber Karl Karge betätigte ohne Zögern einen der Schalter und an der Decke des Flures ging eine trübe Glühlampe an, die in einem staubigen Lampenschirm undefinierbarer Farbe steckte.
Hinter der Treppe gab es eine Toilette mit Dusche, deren schmales Fenster zum Garten hinausging. Neben dem Bad führte eine Tür in den Hinterhof, der mit holprigen Steinen gepflastert war und von einem uralten Fliederbusch überschattet wurde. Rechts lag der Stall, links bildete eine dichte Hecke einen Sichtschutz zum Nachbargrundstück. Wenn man den Müll, der hier herumlag, wegräumte, könnte hier eine schöne Sitzecke sein, fand Alexandra.
Weiter hinten lag ein großer Garten, wo früher einmal Beete gewesen sein mochten, von denen allerdings kaum noch etwas zu sehen war – nur das Gras wuchs hier weniger dicht. Eine Streuobstwiese mit Apfel-, Pflaumen- und Kirschbäumen schloss den Garten ab, hinter dem ein Wiesenweg entlangführte. Der hintere Zaun war besser in Schuss als der vordere, allerdings hing die Tür schief in den Angeln, halb zugewachsen von mehreren Holunderbüschen, die sich zu einer wilden Hecke vereinigt hatten. Zum Nachbargrundstück hin gab es auch einen Holzlattenzaun, es fehlte jedoch ein komplettes Zaunfeld. Durch die Lücke führten Reifenspuren. Anscheinend hatte jemand, während das Haus unbewohnt war, das Obst geerntet und abgefahren. Karl Karge hatte dies, wie er ihr erklärte, den Nachbarn auf deren Anfrage hin gestattet und freute sich, dass Alexandra das in Ordnung fand.
Die hatte ein seltsames Gefühl, als sie vorbei an den Büschen und Bäumen zurück zum Haus gingen. Hatte sie das alles nicht schon einmal gesehen? Kam ihr das nicht bekannt vor? Irgendetwas in ihrem Kopf griff mit zaghaften Fingern nach einem Erinnerungsfetzen, konnte ihn aber nicht ganz erhaschen. Nach einem Moment war dieses Gefühl vorbei.
Nach der kurzen Gartenbesichtigung, während der sich Alex gelangweilt an ihrem Handy zu schaffen gemacht hatte, öffnete Herr Karge noch den Haupthahn der Wasserleitung, wobei er Alexandra gleich die Wasseruhr zeigte, und machte sie darauf aufmerksam, dass erst einmal nur braunes Wasser durch die Leitungen kommen würde. Danach entschuldigte er sich mit wichtigen Terminen und verschwand auf seinem Fahrrad. Vorher hatte er noch einmal die Gelegenheit gehabt, seinen Gesichtsausdruck zu ändern, als ihm nämlich Alexandra mitgeteilt hatte, dass sie ab jetzt hier wohnen würden.
Alexandra ging nachdenklich wieder ins Haus zurück. Alex hockte griesgrämig auf einem Holzstapel und bockte. Die Mutter beschloss, ihre Tochter und deren schlechte Laune ganz bewusst zu ignorieren und sich allein die oberen Räume anzusehen.
Vorsichtig stieg sie die knarrenden, staubigen Stufen hinauf, fast damit rechnend, durch eine der Stufen durchzubrechen und mit gewaltigem Getöse in einer Wolke aus Schutt und Staub im Keller zu verschwinden. Doch die Treppe war stabil und Alexandra rief sich zur Vernunft. Schließlich war sie hier nicht in einem Horrorfilm und außerdem gab es in diesem Haus gar keinen Keller.
„Mein Haus!“, dachte Alexandra und spürte, wie ihr Enthusiasmus zurückkehrte. „Das hier ist alles meins! Ich besitze ein ganzes Haus mit Garten!“ Sie fühlte sich plötzlich beschwingt und voller Tatendrang und hoffte, dass dieser Zustand eine Weile anhalten möge.
Oben gab es zwei kleine und ein größeres Schlafzimmer, in die sie nur von der Tür aus einen kurzen Blick warf. Alexandra fand sie muffig, eng und befremdlich und sie kam sich vor wie ein Eindringling, der in der Privatsphäre fremder Menschen herumschnüffelt. Dieses Gefühl musste sie abschütteln, schließlich gehörte das alles jetzt ihr. Trotzdem ging sie erst einmal wieder nach unten und trat in die Küche ein. Die war eigentlich recht hübsch. Das Fenster mit dem breiten Fensterbrett ging zur Gasse hinaus, man konnte den Vorgarten und ein gutes Stück der Straße überblicken. Ein massiver, rustikaler Holztisch und vier Stühle standen mitten im Zimmer. Zwar war die Tischoberfläche mit Schnitten und Kerben übersät, doch mit Hilfe von etwas Sandpapier und Möbelpolitur könnte sie ihn sicherlich wieder ganz passabel herrichten. Direkt neben der Tür stand ein kleiner Kanonenofen, dessen Abzugsrohr in den dahinterliegenden Schornstein führte. Auf dem Öfchen war so etwas wie eine runde Herdplatte eingelassen, wo man sicherlich Wasser erhitzen konnte. „Wie praktisch!“, dachte Alexandra. Der Elektrokocher, der daneben auf dem Schrank stand, sah allerdings nicht vertrauenerweckend aus. Er hatte zwei verrostete Platten und eine mit Stoff überzogene, schadhafte Strippe mit einem ebenfalls verrosteten Stecker daran, den Alexandra ganz sicher nicht in eine der vorsintflutlichen Steckdosen stecken würde. Sie sah sich weiter um. Die hellgelben Küchenschränke stammten allem Anschein nach aus den frühen siebziger Jahren, sie hatten abgerundete Ecken und rundliche Griffe. Als Alexandra einen der Schränke öffnete, stellte sie fest, dass sich tatsächlich noch Tüten und Gläser darin befanden.
„Das darf doch nicht wahr sein!“, murmelte sie, vorsichtig den Innenraum beäugend. Hier hatte wirklich niemand irgendetwas angerührt, seit Tante Anna gestorben war.
„Ich hab hier nicht mal Empfang!“, jammerte Alex draußen und trampelte mit ihrem Handy die Treppe hoch, um es oben zu versuchen.
Alexandra seufzte, klappte die Schranktür wieder zu und nahm Zettel und Stift aus ihrer Handtasche, um aufzuschreiben, was sie besorgen musste.
Große Mülltüten, stand als erstes auf der Liste. Sie mochte gar nicht daran denken, was ihr beim Ausräumen der Küchenschränke alles entgegen kommen mochte.
Handschuhe, schrieb sie auf, undLappen.
Hatte sie nicht draußen unter der Treppe eine kleine Tür gesehen? Sicherlich gab es dort einen Abstellraum mit Putzgeräten. Sie schaute nach. Ja, Eimer und Besen, alles da. Sogar eine Flasche mit zähflüssigem Spülmittel fand sie.
„