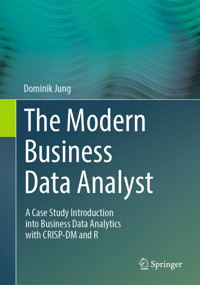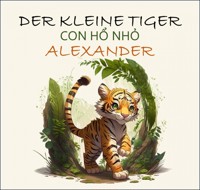10,99 €
Mehr erfahren.
Es ist Small-Talk-Thema Nummer eins und der kleinste gemeinsame Nenner jeder Gesellschaft: das Wetter. Doch obwohl es uns alle täglich betrifft, herrscht über seine Hintergründe meist nur Halbwissen vor. Wo liegt der Unterschied zwischen einem Zyklon und einem Hurrikan? Oder zwischen Graupel und Hagel? Entsprach der Traum von weißen Weihnachten je der Realität? Kann Wetter uns krank machen? Wie beeinflussen globale Phänomene, etwa Jetstream und Polarwirbel, unser mitteleuropäisches Wetter? Haben die alten Wetterregeln tatsächlich einen wahren Kern – und sind sie angesichts des Klimawandels noch verlässlich? In seinem Buch eröffnet uns Wetterexperte Dominik Jung die spannende Welt der Meteorologie auf leicht verständliche und überaus kurzweilige Weise. Hier erfährt man alles Wissenswerte über die Ursachen des Wetters sowie seine Vorhersage – und kann obendrein faszinierende Phänomene wie Brockengespenst oder Staubteufel entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Dominik Jung
Alles, was du übers Wetterwissen musst
Die wichtigsten Wetterphänomene leicht und verständlich erklärt
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und [email protected]
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2025
© 2025 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Hanna Wild
Umschlaggestaltung: Karina Braun
Umschlagabbildung: Adobe Stock/Asyam Design, kotoffei; Patrick Pannek
Layout: Karina Braun, unter Verwendung von AdobeStock/Asyam Design, kotoffei
Illustrationen: Sabrina Pronold, unter Verwendung von AdobeStock/robert6666, Asyam Design, kurdanfell; Shutterstock/Nora Hachio, Cezar911, bsd studio, Panda Vector, Pyty
Satz: Müjde Puzziferri, MP Medien, München, mp-medien-muenchen.de
eBook: ePUBoo.com
ISBN druck 978-3-7423-2848-9
ISBN ebook (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2636-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Nicht zu verwechseln
Wetter und Klima
Hagel und Graupel
Hurrikan, Taifun, Zyklon und Orkan – die großen Stürme der Erde
Tornado oder Downburst? Das ist hier die Frage
Regen und Regenschauer – nicht dasselbe?
Wolken und Nebel
Die Jahreszeiten – meteorologisch versus kalendarisch
Wetterscheiden versus Wettergrenzen
Raureif und Frost
Kleines Einmaleins des Wetters
Wie entsteht Wind – und welchen Nutzen hat er?
In welche Richtung ziehen eigentlich Wolken?
Der Föhn – ein gigantisches Warmluftgebläse
Wie entstehen Hochs und Tiefs – und wie kommen sie zu ihren Namen?
Der Regenbogen – farbenprächtiges Schauspiel mit nur zwei Komponenten
Die Gezeiten
Die Sonnenfinsternis – kein alltägliches Phänomen
Mondfinsternis und Blutmond
Schnee – ein zunehmend seltenes Idyll
Gefühlte Temperatur und Windchill
Wetterregeln und -mythen
Die Siebenschläferregel – sieben Wochen lang das gleiche Wetter?
Altweibersommer – was hat Wetter mit älteren Damen zu tun?
Die »2-Grad-Regel« – steuert der September unseren Winter?
Abendrot, Schönwetterbot, Morgenrot, schlecht Wetter droht
Mittagshitze – ist es wirklich zur Mittagszeit am wärmsten?
Gewitter – allen Bäumen sollst du weichen!
Das Biowetter – kann das Wetter uns wirklich krankmachen?
Chemtrails oder doch nur Kondensstreifen?
Der »100-jährige Kalender« – Wettervorhersage aus dem 17. Jahrhundert?
Der Einfluss des Mondes auf unser Wetter
Weiße Weihnachten – die große Sehnsucht vieler Menschen
Unwetter und Katastrophen
Wie Gewitter entstehen – und weshalb das »Nowcasting« besonders wichtig ist
Die Vb-Wetterlage – brandgefährliches Tiefdruckgebiet
Wie entsteht Hochwasser?
Die Ahrtalflut 2021 – Entstehung und Warnmanagement
Wie entstehen Sturmfluten?
El Niño und La Niña – drastisches Wetter mit klangvollem Namen
Wie Vulkanausbrüche Wetter und Klima verändern können
Lawinen – lauernde Gefahr im Winteridyll
Der Blizzard – Schneesturm der Extraklasse
Glatteis – Entstehung und Gefahren
Klima und globale Phänomene
Wie ist die Atmosphäre aufgebaut – und wo spielt sich unser Wetter ab?
Die »atmosphärischen Flüsse« – Himmelsströme mit Klimawirkung
Der Jetstream – Schnellstraße in luftigen Höhen
Die Passatwinde – ein globales Windsystem
Der Polarwirbel – und sein Einfluss aufs Winterwetter
Geoengineering – Lässt sich das Wetter steuern?
Die Sonne – Leben spendend und zerstörend
Nicht bloß heiße Luft – wie Hitze das Wetter beeinflusst
Der Treibhauseffekt und sein Einfluss aufs Klima
Ozon – oben hui, unten pfui
Die Wissenschaft des Wetters
Wie wird man Meteorologe?
Wettermodelle – Grundstein der Wettervorhersage
Was macht ein Wetterdienst?
Mit welchen Geräten misst man das Wetter?
Wie genau sind eigentlich Wettervorhersagen?
Sind Langfristprognosen seriös?
Was misst man mit der Beaufortskala?
Das Regenradar – im Alltag unentbehrlich
Die faszinierenden Ursprünge des »Wetterfroschs«
Wetterwissen für Angeber
Gibt es Wetter auch auf anderen Planeten oder im Weltall?
Wie viel wiegt eigentlich eine Wolke?
Die Omega-Wetterlage – wenn nichts mehr geht
Nebel, Hochnebel, Dunst – wie die Inversion die Wettervorhersage vermiest
Saharastaub und Blutregen – Grüße aus der Wüste
Feinstaub und Wetter
Böhmischer Wind – Wetter aus Tschechien
Industrieschnee – weiße Pracht von Menschenhand
»Staubteufel« – harmlose Poltergeister
Halos und Glorien – überirdische Lichteffekte
Das Elmsfeuer – leuchtender Spuk in großen Höhen
Über den Autor
Nicht zuverwechseln
Wetter und Klima
Wetter und Klima – das sind zwei Begriffe, die im Alltag gern mal durcheinandergebracht werden. Viele Menschen sagen zum Beispiel: »Dieses Jahr ist der Sommer so heiß, das muss am Klimawandel liegen.« Oder wenn ein besonders kalter Winter kommt: »Da sieht man, dass es doch keine Erderwärmung gibt.« Doch so einfach ist das nicht. Wetter und Klima sind zwei sehr unterschiedliche Dinge und es ist wichtig, sie auseinanderzuhalten. Lass uns das mal ganz locker und verständlich erklären.
Fangen wir mit dem Wetter an. Das Wetter beschreibt die momentanen Bedingungen, die wir täglich erleben: Regen, Sonnenschein, Wind, Schnee oder auch Temperaturen. Es ändert sich ständig. Heute ist es vielleicht warm und sonnig, morgen kann es schon wieder regnen und kühl sein. Wettervorhersagen sagen uns, was in den nächsten Stunden oder Tagen passieren wird. Dabei geht es um kurzfristige Phänomene, die stark schwanken können. Du kennst das sicherlich: Man schaut morgens aus dem Fenster, sieht blauen Himmel, und am Nachmittag zieht dann plötzlich eine dicke Wolke auf und es regnet. Das ist das Wetter – launisch und schwer vorherzusagen.
Das Klima hingegen ist etwas ganz anderes. Das Klima beschreibt den Durchschnitt des Wetters über einen langen Zeitraum, meistens über 30 Jahre oder mehr. Es geht also nicht darum, wie das Wetter an einem bestimmten Tag oder in einer bestimmten Woche ist, sondern darum, welche typischen Wetterbedingungen in einer bestimmten Region über viele Jahre hinweg herrschen. Zum Beispiel ist das Klima in der Sahara heiß und trocken, während das Klima in Mitteleuropa gemäßigt ist, mit warmen Sommern und kühlen Wintern.
Jetzt stellt sich die Frage: Warum darf man Wetter und Klima nicht gleichsetzen? Ein heißer Sommer oder ein besonders kalter Winter bedeutet noch lange nicht, dass sich das Klima grundsätzlich verändert hat. Ein einzelner Sommer oder Winter ist nur ein kleiner Ausschnitt des Wetters. Das Klima wird erst über lange Zeiträume und durch viele Daten bestimmt. Auch in einer Phase der globalen Erwärmung können daher kalte Winter auftreten oder heiße Sommer innerhalb einer kühlen Klimazone. Diese kurzfristigen Schwankungen sind typisch für das Wetter, nicht für das Klima.
Ein heißer Sommer oder ein kalter Winter sagt also nichts darüber aus, ob sich das Klima verändert. Es ist ein bisschen so, als würdest du versuchen, den Zustand eines ganzen Sees zu beschreiben, indem du nur auf eine einzige Welle schaust. Diese Welle gibt dir keine Information darüber, wie der gesamte See aussieht. Genauso gibt ein einzelner extrem heißer Tag keinen Aufschluss darüber, wie sich das Klima insgesamt entwickelt.
Warum sollte man dann auch nicht jedes extreme Wetterereignis, wie ein Hochwasser oder einen schweren Sturm, direkt dem Klimawandel zuschreiben? Ganz einfach: Extremwetter hat es schon immer gegeben. Auch vor dem Beginn der industriellen Revolution, als der Mensch noch nicht in großem Maßstab CO₂ in die Atmosphäre freigesetzt hat, gab es schwere Stürme, Dürren oder Überschwemmungen. Wetterextreme können durch viele verschiedene Faktoren ausgelöst werden, zum Beispiel durch natürliche Klimaschwankungen wie El Niño oder Vulkanausbrüche.
Das heißt aber nicht, dass der Klimawandel keine Rolle spielt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Klimawandel die Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen verstärkt. Das bedeutet, dass Hitzewellen häufiger und intensiver werden und starke Regenfälle zunehmen. Doch um festzustellen, ob ein bestimmtes Wetterereignis direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt, braucht es eine sorgfältige Analyse durch Klimaforscher. Sie vergleichen dabei historische Wetterdaten, Modelle und viele andere Faktoren, um zu verstehen, ob der Klimawandel bei einem Ereignis eine Rolle gespielt hat oder nicht.
Worauf kommt es also an, wenn wir über den Klimawandel sprechen? Es ist wichtig, nicht nur auf einzelne Wetterereignisse zu schauen, sondern das große Ganze zu betrachten. Der Klimawandel zeigt sich vor allem in langfristigen Trends: anhaltende Erwärmung, steigende Meeresspiegel, Gletscherschmelze und veränderte Niederschlagsmuster über viele Jahrzehnte. Einzelne Hitzewellen oder Stürme können Hinweise darauf sein, dass sich das Klima verändert, aber erst über viele Jahre und durch die Analyse globaler Daten lässt sich klar sagen, in welche Richtung sich das Klima entwickelt.
Zusammengefasst: Das Wetter ist das, was wir täglich erleben – mal regnet es, mal scheint die Sonne. Das Klima hingegen ist das durchschnittliche Wetter über viele Jahre. Ein heißer Sommer oder ein kalter Winter bedeutet nicht gleich eine Trendwende beim Klima, und auch nicht jedes Unwetter kann man direkt dem Klimawandel zuschreiben. Um den Klimawandel zu verstehen, müssen wir langfristige Entwicklungen beobachten und nicht nur auf kurzfristige Wetterereignisse schauen.
Hagel und Graupel
Hagel und Graupel sind beides Formen von gefrorenem Niederschlag, die sich auf den ersten Blick ähnlich sehen, aber dennoch unterschiedliche Eigenschaften haben und sich auf verschiedene Weise bilden. Um diese beiden Phänomene besser zu verstehen, lohnt sich ein genauerer Blick auf ihre Entstehung.
Hagel besteht aus meist größeren Eiskugeln, die typischerweise bei Gewittern entstehen. Der Entstehungsprozess von Hagel ist eng mit den Luftströmungen in Gewitterwolken verbunden. Innerhalb dieser Wolken gibt es starke Auf- und Abwinde, die Wassertropfen immer wieder in die höheren, kälteren Bereiche der Atmosphäre schleudern. Dort gefrieren die Tropfen zu kleinen Eiskugeln. Wenn diese gefrorenen Tropfen wieder nach unten fallen, nehmen sie neue Wassertröpfchen auf. Gelangen diese Tröpfchen wieder in die kalten Bereiche der Wolke, gefrieren sie erneut. Dieser Prozess kann sich mehrfach wiederholen, sodass die Hagelkörner Schicht für Schicht größer werden, bis sie schließlich zu schwer sind, um weiterhin von den Aufwinden in der Wolke gehalten zu werden. Sobald das geschieht, fallen die Hagelkörner zu Boden.
Hagelkörner können sehr unterschiedliche Größen haben. Sie reichen von Kügelchen bis hin zu großen Klumpen, die mehrere Zentimeter Durchmesser erreichen können. Die Struktur von Hagelkörnern ist hart und besteht oft aus mehreren klar abgegrenzten Schichten, die durch den wiederholten Gefrierprozess entstehen. Solche Hagelkörner können beträchtliche Schäden anrichten, insbesondere, wenn sie groß sind und mit hoher Geschwindigkeit zu Boden prasseln. Schäden an Autos, Gebäuden, Pflanzen oder sogar Menschen sind keine Seltenheit, wenn es zu starkem Hagel kommt. Besonders in den Sommermonaten, wenn Gewitter häufiger sind, tritt Hagel vermehrt auf.
Im Gegensatz dazu ist Graupel eine viel weichere und weniger gefährliche Form von gefrorenem Niederschlag. Graupel entsteht, wenn unterkühlte Wassertropfen – das sind Tropfen, die noch flüssig sind, obwohl sie sich unterhalb des Gefrierpunkts befinden – auf Schneeflocken treffen. Diese unterkühlten Tropfen gefrieren sofort, sobald sie die Schneeflocke berühren, und umhüllen sie mit einer Eisschicht. Das Ergebnis ist eine Art Eiskugel, die weniger kompakt ist als Hagel. Graupelkörner sind typischerweise nur ein paar Millimeter groß und zerfallen leicht, wenn man sie in die Hand nimmt. Ihre Struktur ist eher körnig und undurchsichtig, und sie unterscheiden sich deutlich von den klar geschichteten Hagelkörnern.
Graupel tritt oft bei kühleren Temperaturen auf, vor allem im Frühling, Herbst oder Winter, und ist häufig in Verbindung mit Schneeschauern oder kalten Regenfällen zu beobachten. Graupel sieht oft aus wie viele kleine Styroporkügelchen und verursacht keine nennenswerten Schäden. Hagel und Graupel sind Formen gefrorenen Niederschlags und sehen auf den ersten Blick ähnlich aus, unterscheiden sich aber signifikant voneinander. Wenn du das nächste Mal gefrorenen Niederschlag beobachtest, achte auf die Größe, Härte und Struktur: Große, harte Klumpen sind wahrscheinlich Hagel, während kleine, weiche Körnchen eher Graupel sein dürften.
Hurrikan, Taifun, Zyklon und Orkan – die großen Stürme der Erde
Die Erde wird regelmäßig von mächtigen Stürmen heimgesucht, die je nach Region und Art unterschiedliche Namen tragen: Hurrikan, Taifun, Zyklon und Orkan. Diese Stürme entstehen alle auf ähnliche Weise. Grundsätzlich sind Hurrikane, Taifune und Zyklone tropische Wirbelstürme, die sich über warmen Ozeanen bilden. Die Voraussetzungen für ihre Entstehung sind klar: Es muss genügend warme Meeresoberfläche vorhanden sein, damit sich die notwendige Energie aufbauen kann. Die Meerestemperaturen müssen dabei mindestens 26,5 °C betragen. Wenn warme, feuchte Luft über dem Ozean aufsteigt, kühlt sie sich ab und kondensiert, was gewaltige Mengen an Energie freisetzt. Diese Energie treibt den Sturm an und lässt ihn rotieren. Durch die Corioliskraft, die durch die Erdrotation verursacht wird, beginnt der Sturm sich zu drehen, wobei die Rotation auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn und auf der Südhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn erfolgt.
Hurrikane, Taifune und Zyklone sind im Wesentlichen dasselbe Phänomen, sie unterscheiden sich lediglich durch die Region, in der sie auftreten. Hurrikane entstehen im Atlantik und im Nordostpazifik, Taifune treten im Nordwestpazifik auf, also in der Nähe von Asien, und Zyklone entstehen im Indischen Ozean und im Südpazifik. Ein Orkan hingegen ist eine sehr starke Winderscheinung, die in Europa und im Nordatlantik vorkommt. Während Hurrikane, Taifune und Zyklone tropische Stürme sind, die mit starken Regenfällen, Flutwellen und extremen Windgeschwindigkeiten einhergehen, bezieht sich der Begriff Orkan auf stürmische Winde, die vor allem durch Tiefdruckgebiete hervorgerufen werden.
Die Windgeschwindigkeiten dieser Stürme können enorm sein. Hurrikane und Taifune erreichen in extremen Fällen Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 km/h. Der Durchmesser eines solchen Sturms kann bis zu 1000 Kilometer betragen, wobei das Auge des Sturms, also das windstille Zentrum, in der Regel einen Durchmesser von 20 bis 50 Kilometern hat. Zu den gewaltigsten Stürmen zählt der Taifun Haiyan, der 2013 die Philippinen verwüstete. Seine Windgeschwindigkeiten betrugen bis zu 315 km/h. Ein weiterer verheerender Sturm war der Hurrikan Katrina, der 2005 große Teile der Südküste der USA, insbesondere New Orleans, zerstörte. Neben den Verwüstungen durch den Wind selbst sind es oft die heftigen Regenfälle und Flutwellen, die die Hauptgefahr dieser Stürme darstellen. Bei Hurrikan Katrina zum Beispiel verursachte der Anstieg des Wasserspiegels verheerende Überschwemmungen. Städte und Siedlungen, die in Küstennähe liegen, sind besonders anfällig für Sturmfluten. Hinzu kommen oft tagelange Regenfälle, die zu Erdrutschen und Überschwemmungen im Inland führen. Orkane können durch starke Winde und Regenfälle ähnliche Schäden hervorrufen, vor allem in dicht besiedelten Gebieten wie Westeuropa, wo die Infrastrukturen oft nicht auf solch extreme Wetterereignisse ausgelegt sind.
Der Unterschied zwischen Hurrikan, Taifun und Zyklon ist also weniger meteorologischer Natur, sondern hängt vor allem von der geografischen Lage ab. Orkane sind hingegen nicht mit tropischen Wirbelstürmen gleichzusetzen, da sie oft über kühleren Gewässern oder Landmassen entstehen und durch große Temperaturunterschiede in der Atmosphäre verursacht werden. Orkane können ebenfalls hohe Windgeschwindigkeiten erreichen, aber sie sind in der Regel mit Kaltfronten und starken Druckunterschieden verbunden, anstatt durch die warme Energie tropischer Gewässer angetrieben zu werden.
In den letzten Jahren hat die Häufigkeit und Intensität dieser Stürme zugenommen, was viele Forscher auf den Klimawandel zurückführen. Die steigenden globalen Temperaturen haben wärmere Meere zur Folge, was wiederum die Entstehung und Stärke von Wirbelstürmen fördert. Zwar gibt es natürliche Schwankungen in der Häufigkeit von Stürmen, doch die Klimamodelle zeigen, dass mit der Erwärmung der Erde auch die Intensität der Stürme zunimmt. Tropische Wirbelstürme sind daher nicht unbedingt häufiger geworden, aber sie werden tendenziell stärker und verursachen mehr Zerstörungen, da die steigenden Meeresspiegel und wärmeren Ozeane stärkere Flutwellen und intensivere Regenfälle begünstigen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hurrikane, Taifune, Zyklone und Orkane gewaltige Naturereignisse sind, die durch eine Kombination aus warmen Meeren, aufsteigender feuchter Luft und der Erdrotation entstehen. Der Klimawandel spielt dabei eine immer größere Rolle. Diese Wetterphänomene könnten in Zukunft noch intensiver und gefährlicher werden. Es bleibt daher wichtig, sich auf solche Stürme vorzubereiten und den Klimawandel ernst zu nehmen, um die Häufigkeit und Stärke dieser Naturkatastrophen zu minimieren.
Tornado oder Downburst? Das ist hier die Frage
Ein Tornado ist ein stark rotierender Luftwirbel, der sich aus Gewittern herausbilden kann. Diese Wirbelwinde entstehen, wenn kalte und warme Luftmassen aufeinandertreffen und die Luft schnell aufsteigt. Dabei dreht sich die Luft in einem engen Kreis und kann immense Zerstörungen anrichten. Tornados können innerhalb von Minuten entstehen und erreichen oft Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h, manchmal sogar mehr als 400 km/h.
In Deutschland gibt es Tornados schon seit vielen Jahrhunderten. Aufzeichnungen darüber reichen bis ins Mittelalter zurück. Früher wurden Tornados oft als »Wetterteufel« bezeichnet. Heute wissen wir mehr über diese Naturphänomene und können sie besser beobachten. Pro Jahr registrieren wir in Deutschland zwischen 20 und 60 bestätigte Tornados. Ob es mehr Tornados gibt als in der Vergangenheit, lässt sich schwer sagen, da wir heute durch moderne Technik mehr Fälle erkennen. Früher blieben viele Tornados unbemerkt, vor allem in spärlich bewohnten Gegenden.
Ein Tornado-Verdachtsfall wird gemeldet, wenn es Hinweise auf einen Tornado gibt wie Berichte von Augenzeugen oder Radaraufnahmen, aber der Tornado gilt damit noch nicht als bestätigt. Bestätigte Tornadofälle werden dann dokumentiert, wenn klare Beweise wie Fotos, Videos oder eindeutige Schäden existieren.
Im Vergleich zu den USA treten in Deutschland deutlich weniger Tornados auf, und sie sind in der Regel schwächer. Im Mittleren Westen der USA gibt es eine Region, die als »Tornado Alley« bekannt ist. Dort entstehen Tornados besonders häufig, weil die klimatischen Bedingungen ideal sind. Heiße Luftmassen aus dem Süden treffen auf kühle Luft aus dem Norden, was die Bildung von Tornados begünstigt. In Deutschland sind die Wetterbedingungen gemäßigter.
Der stärkste bekannte Tornado in Deutschland ereignete sich 1968 in Pforzheim. Dieser Tornado wurde auf der sogenannten Fujita-Skala als F4 eingestuft. Die Fujita-Skala misst die Stärke von Tornados anhand der Schäden, die sie verursachen. Ein F4-Tornado hat Windgeschwindigkeiten zwischen 330 und 417 km/h und kann massive Zerstörungen hinterlassen. Es gibt auch Tornados der Stärke F5, aber solche extremen Fälle sind sehr selten.
Die Stärke eines Tornados kann heute auch mit modernen Radarsystemen, wie dem Dopplerradar, gemessen werden. Diese Technologie kann Tornados aufspüren, indem sie die Geschwindigkeit von Luftmassen misst, die sich auf uns zu- oder von uns wegbewegen. Damit lassen sich Tornados oft frühzeitig erkennen. Allerdings ist es immer noch schwer, Tornados genau vorherzusagen, da sie oft sehr plötzlich entstehen.
Zur Entstehung eines Tornados braucht es in der Regel ein starkes Gewitter. Besonders wichtig ist eine sogenannte Superzelle, eine spezielle Art von Gewitter, die durch eine rotierende Aufwärtsströmung gekennzeichnet ist. Tornados bilden sich selten bei Schauern ohne Gewitter, da die kräftigen Aufwinde und die Rotation meist nur bei starken Gewittern vorhanden sind.
Wenn man einem Tornado begegnet, sollte man keinesfalls stehenbleiben, um Fotos oder Videos zu machen. Tornados können sich überraschend schnell bewegen, oft mit 30 bis 70 km/h, und die Richtung wechseln. Die beste Schutzmaßnahme besteht darin, sich in ein festes Gebäude zu begeben, am besten in einen Keller oder einen Raum ohne Fenster. Wenn man im Freien ist und keine Schutzmöglichkeit hat, sollte man sich in eine Mulde legen und tief am Boden bleiben, um vor umherfliegenden Trümmern möglichst sicher zu sein.
Die Schneise, die ein Tornado hinterlässt, kann sehr unterschiedlich breit sein. Kleinere Tornados hinterlassen Schneisen von wenigen Meter Breite, während besonders starke Tornados Schneisen von bis zu einem Kilometer hinterlassen können.
Ein Phänomen, das oft mit Tornados verwechselt wird, ist der sogenannte Downburst. Ein Downburst ist ein starker Abwind aus einem Gewitter, der auf den Boden trifft und sich dann in alle Richtungen ausbreitet. Auch ein Downburst kann große Schäden verursachen, indem er Bäume umwirft und Dächer abdeckt, aber er dreht sich nicht wie ein Tornado. Der Unterschied liegt also in der Art der Winde: Während ein Tornado rotierende Winde hat, handelt es sich bei einem Downburst um lineare Winde, die in eine Richtung wehen.
Kurz: Ein Tornado ist ein rotierender Luftwirbel, der durch Gewitter entsteht und schwere Schäden anrichten kann. In Deutschland treten sie seltener und meist schwächer auf als in den USA. Es ist wichtig, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen und keinesfalls in der Nähe zu bleiben, um zu fotografieren. Tornados bewegen sich schnell und hinterlassen breite Schneisen der Zerstörung. Ein Downburst dagegen ist ein starker Abwind ohne Rotation, der oft mit einem Tornado verwechselt wird.
Regen und Regenschauer – nicht dasselbe?
Regen ist Regen, oder? Nicht ganz! In der Meteorologie gibt es nämlich einen Unterschied zwischen »Regen« und »Schauer«, und der ist gar nicht so kompliziert, wie es vielleicht klingt.
Regen ist das, was wir kennen, wenn es über einen längeren Zeitraum kontinuierlich und oft gleichmäßig vom Himmel tröpfelt. Es regnet mal stärker, mal schwächer, aber meistens hört es nicht so schnell wieder auf. Wenn im Wetterbericht von Regen die Rede ist, dann bedeutet das, dass es eine ausgedehnte Wolkenformation gibt, die konstanten Niederschlag bringt. Solcher Regen kann über Stunden anhalten und verteilt sich großflächig.
Ein Schauer hingegen ist etwas anders. Auch ein Schauer ist natürlich Regen, aber er kommt oft ohne Vorwarnung und dauert in der Regel nur kurz. Du kennst das sicher: Es scheint die Sonne, dann zieht plötzlich eine dunkle Wolke auf, es schüttet für ein paar Minuten und dann ist es auch schon wieder vorbei. Das ist typisch für einen Schauer. Solche Schauer entstehen oft durch Wolken, die sich schnell entwickeln, zum Beispiel durch aufsteigende warme Luft, die sich rasch abkühlt.