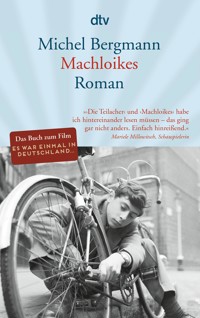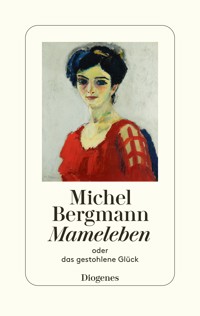8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Kind in uns, das niemals alt wird Ein alter Mann beobachtet heimlich ein Kind. Wie der Zehnjährige morgens zur Schule geht, wie er zu Hause am Bett des kranken Vaters sitzt, der das KZ überlebt hat. Wie der Junge ›Moby Dick‹ liest, am Zeitungsstand neben ›Quick‹ und ›Revue‹ die Comics entdeckt, im Café Kranzler Kakao trinkt. Wie die Jahre vergehen, das Kind zum Mann wird und gegen die übermächtige Mutter aufbegehrt, während das Land sich allmählich verändert und doch stets mit seiner dunklen Vergangenheit wird leben müssen. Wer ist der Alte, der so viel über das Leben des Jungen weiß? Eine Geschichte voller Magie über eine Jugend in Deutschland nach dem Krieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ein alter Mann beobachtet heimlich ein Kind. Wie der Zehnjährige morgens zur Schule geht, wie er zu Hause am Bett des kranken Vaters sitzt, der trotz schwerster Misshandlungen das KZ überlebt hat. Wie der Junge ›Moby Dick‹ liest, am Zeitungsstand neben der ›Quick‹ und ›Revue‹ die Comics entdeckt, im Café Kranzler Kakao trinkt und aus dem Klassenzimmer auf die Werbung für »Creme Mouson« schaut, daneben Frankfurt am Main in Trümmern. Wie die Jahre vergehen, das Kind zum Mann wird und gegen die übermächtige Mutter aufbegehrt, während das Land sich allmählich verändert und doch stets mit seiner dunklen Vergangenheit wird leben müssen. Wer ist der Alte, der so viel über das Leben des Jungen weiß? Michel Bergmann erzählt eine berührende Geschichte voller Magie über eine Jugend im Nachkriegsdeutschland und über das Kind in uns, das nie alt wird.
Von Michel Bergmann sind bei dtv außerdem lieferbar:
Die Teilacher
Machloikes
Herr Klee und Herr Feld
Michel Bergmann
Alles was war
Erzählung
Für Marian, den wiedergefundenen Freund.
Lech Lecha – Gehe hin!
Der Herr aber sprach zu Abraham: Gehe hin aus deinem Vaterland und von deinen Freunden und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und rufe deine Mutter an!
Genesis
Eine letzte lieblose Anmutung von Bauhaus. Mit weichen Kanten, quadratischen Sprossenfenstern und breiten Simsen. Dazu bereits das Aufkommende, das Derbe, Völkische, der Rauputz. Das mächtige Schieferdach mit seinen zu winzigen Gauben. Ein schmutzgelblicher Siedlungsbau aus den frühen Dreißigern. An der Wand des Souterrains noch die weißliche, verwitterte Handschrift des Kriegs. Ein Pfeil und LSK , Luftschutzkeller. In der Ecke neben den Mülleimern ein Emailleschild: Gasschleuse. Zutritt für Unbefugte verboten! Gasschleuse! Ausgerechnet. Daneben die rotbraune schwerfällige Haustür. Noch ist sie geschlossen. Es ist Viertel nach sieben, seine Zeit. Er wird gleich herauskommen.
Die Reise an diesen Ort ist mir schwergefallen. Nicht nur mental. Alles ist anstrengend, wenn man älter wird. Sind Sie okay, fragt eine junge Frau, als ich mich auf das Mäuerchen gegenüber setze. Ja, danke, sage ich erstaunt, alles in Ordnung. Wirklich? Wirklich. Ich wundere mich über die Höflichkeit. Selten heute, wo sich Menschen beim Gähnen nicht mehr die Hand vor den Mund halten.
Ich schaue ihr hinterher, wie sie rasch über die Straße läuft. Unsicher, mit ihren hohen Absätzen auf dem Kopfsteinpflaster. Wie alt mag sie sein? Zwanzig, dreißig, vierzig? Mit zunehmendem Alter fällt es mir schwer, Personen einzuschätzen.
Menschen, die man liebt, werden nicht älter. Im Gesicht meiner Frau sehe ich immer noch die junge Frau mit ihrem kindlichen Lächeln und ihrem klaren, neugierigen Blick. Schöne Augen, weiße Zähne, eine weiche Haut. Und ihre Haltung! Aufrecht. Würdevoll. Ja, das ist das passende Wort. Würdevoll. Unvergessen der Moment, als sie leichtfüßig die Treppe herunterkommt, in diesem umgebauten Fabrikgebäude. Und wie ich es mir so sehr wünsche, sie kennenzulernen, und wie mir dann der Zufall in die Hände spielt und sie mich irgendwann in der Kneipe anspricht und nach irgendetwas fragt und wie ich mich aufspiele und beinah alles verpatze, aus Verlegenheit. Aber die kann sie nicht erkennen, noch nicht. Sie, größer als ich, sieht lediglich diesen kleinen Wichtigtuer mit seinem bunten Schal um den Hals und seinem roten Alfa Romeo vor der Tür, wie sie später gern Freunden erzählt, wenn die fragen: Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ja, wilde Zeiten haben wir durchlebt, in jeder Form. Haben uns und andere nicht geschont. Verrückte Dinge getan und nicht an morgen gedacht. Heute, sähe sie mich hier, würde sie sagen: Was sitzt du auf der kalten Mauer? Spitzwegerich! Das klingt für mich nach Biedermeier.
Heute trinke ich diesen Tee beinah jeden Tag. Pass auf dich auf, ruft sie mir jedes Mal nach, wenn ich die Wohnung verlasse. Wenn ich meine Frau nicht hätte, würde ich bei Eis und Schnee ohne Mütze, Schal und Handschuhe auf die Straße gehen. Ich kann (oder will) mich nicht daran gewöhnen, alt zu sein. Alt zu werden ist nicht das Problem, sondern nicht mehr jung zu sein, heißt es bei Lichtenberg.
Die Haustür wird geöffnet. Mit dem sperrigen, ledernen Schulranzen auf den schmalen Schultern läuft er aus dem Haus. Er trägt ein kariertes, kurzärmeliges Hemd, eine khakifarbene kurze Hose, Ringelsocken und Sandalen. Für seine zehn Jahre ist er etwas klein. Durch den Vorgarten auf dem Bürgersteig angekommen, rennt er los. Ins Leben. Unbeschwert. Es ist sein Tag! Wie jeder Tag sein Tag ist.
Der Junge sieht sich nicht um, kann nicht bemerken, dass sich eine Tüllgardine hinter einem Fenster im ersten Stock bewegt. Die Mutter. Sie schaut ihm besorgt nach. Sie ist immer besorgt. Sie ist misstrauisch, waidwund. Alle Menschen, die im Lager waren, haben seelische Defekte. Man nennt sie heute Traumata. Sie ist eine späte Mutter und deshalb besonders besitzergreifend. Fürsorgliche Belagerung. Du bist das Wichtigste, was ich habe. Wenn es dich nicht gäbe, für wen sollte ich dann leben? Das sagt sie zu dem Kind, selbst im Beisein des Vaters. Das macht die Last auf den schmalen Schultern nicht leichter.
Der Sohn wird Arzt, das hat sie entschieden. Und er bekommt Klavierunterricht. Ich wäre froh gewesen, ich hätte Klavierunterricht gehabt. In unserem Stetl gab’s ein Klavier? Du weißt nicht, wie gut du es hast. Für wen habe ich das alles durchgemacht? Für dich! Damit du es einmal besser haben sollst. Und was ist der Dank? Ein »ausreichend« im Schönschreiben und ein »mangelhaft« in Ordnung! Im Rechnen könnte sich Ihr Sohn noch etwas anstrengen, stand im Herbstzeugnis. Stell dir vor! So eine Schande. Alle können rechnen, nur meiner nicht! Von wem hast du das? Ich unterschreibe das Zeugnis nicht. Geh zu deinem Vater. Mit dem kannst du es ja machen. An all das denkt sie nicht, als sie aus dem Fenster blickt auf ihren Sohn, ihr Alles, das sich jetzt auf den Schulweg begibt. Sie hat nur einen Wunsch: Er soll gesund zurückkommen. Aus dem Schlafzimmer hört sie leise den Vater rufen.
Der Vater. Ein pergamentener, hagerer, schwächlicher Mann mit schütterem Haar. Wochenlang liegt er im Bett, dann kommen wieder Tage, an denen er sich besser fühlt. Dann steht er auf, zieht seinen grauen Zweireiher an, der ihm inzwischen zu groß ist. Er geht in sein Geschäft. Aber er kommt wie ein Tourist. Sein Bruder kümmert sich. Es läuft so lala. Die Mutter ist unzufrieden und behauptet, deine Teilacher bescheißen dich von vorn bis hinten. Rumänen, Ungarn, Bukowiner! Was kann man da erwarten? Und dein Bruder merkt es nicht, das Schlamassel.
Er will nichts Abfälliges hören über den Bruder. Es war für ihn ein Wunder, dass sie sich wiedergefunden haben nach dem Krieg. Außerdem spendet er ihm alle vier Wochen Blut. Man kann es auch übertreiben mit der Dankbarkeit, meint die Mutter. Der Vater ist darüber enttäuscht, wie mitleidlos seine Frau sein kann. Er hält es nicht lang aus im Geschäft, die Schmerzen. Er nimmt ein Pyramidon und geht zur Hauptwache, ins Kranzler. Er liebt Cafés, er ist insgeheim ein Flaneur. Wenn er sich zu schwach fühlt, holt ihn sein Bruder mit dem vollgequalmten Opel Olympia ab. Sie gehen in einen Club am Roßmarkt und spielen Karten und trinken Tee mit gequetschter Zitrone. Wenn er nach Hause kommt, will sein Sohn wissen, ob er gewonnen hat. Ja, sagt er. Die Mutter verdreht die Augen. Meiner, der große Gewinner, denkt sie.
Im Club fragen die Freunde, wie’s ihm geht. Es ist a Hin und a Her, sagt er. Was heißt, du siehst doch unberufen blendend aus, sagen sie, das blühende Leben! Hinter seinem Rücken flüstern sie: Nebbich, der macht nicht mehr lang. Das weiß er. Er hat sich abgeschrieben, er ist todkrank, er wird die Bar-Mizwa seines Sohnes nicht mehr erleben. Darüber wird nicht gesprochen, aber jeder Tag ist eine Zugabe. Er kämpft einen letzten Kampf: Entschädigungsprozess gegen die Bundesrepublik Deutschland. Sie nennen es euphemistisch Wiedergutmachung. Er will am liebsten aufgeben, aber sein Anwalt, der dicke Lubinski, gibt keine Ruhe.
Wir werden sie »zutrennen«, hört ihn der Junge einmal flüstern, was immer das bedeutet. Doch der Prozess ist mühsam und schmerzlich. Der Vater steht im düsteren Gerichtssaal. Krallt sich am Holzgeländer fest, schaut auf mürrische Männer in schwarzen Roben, kann sich kaum auf den Beinen halten und muss beweisen, dass er im KZ auf die Milz geschlagen wurde. So, auf die Milz! Sieh mal einer an! Sind Sie sicher, dass es nicht die Leber war? Oder vielleicht die Niere? Von wem sind Sie angeblich geschlagen worden? Wo? Mit was? Können Sie Namen nennen? Wann? Wie oft? Wie fest? Morgens? Abends? Gibt es Zeugen? Aha, Sie erinnern sich nicht! Wollen Sie uns das wirklich weismachen, mein Herr? An so etwas erinnert man sich doch! So reden die neuen alten deutschen Richter und Staatsanwälte mit den Juden. Genau so, wie sie früher mit ihnen geredet haben, nur dass sie sie jetzt siezen müssen.
Ehrlich gesagt, ist der Junge gar nicht unglücklich, wenn der Vater nicht aufstehen kann. Er sitzt gern an seinem Bett, liest ihm aus der Illustrierten vor oder aus einem Buch. Der Vater kennt sich aus in der Literatur. Zurzeit ist es Moby Dick von Melville. Der Vater kennt es bereits, für den Jungen ist es neu. Das beste Buch, das er je gelesen hat. Kapitän Ahab ist kein sympathischer Mann, das kann man wahrlich nicht behaupten, aber er ist aufrecht und hart gegen sich selbst.
Er hat ein Ziel, sagt der Vater, und das ist wichtig im Leben, du verstehst? Ein Mensch muss ein Ziel haben! Was war dein Ziel, fragt der Sohn den Vater. Mein Ziel ist gewesen, eine Frau zu finden und Kinder zu haben und ein Geschäft, das uns ernährt, und zu sehen, dass alle glücklich sind. Und? Hast du dein Ziel erreicht? Der Vater will etwas sagen, aber er kann es nicht. Der Vater hat Tränen in den Augen. Er weint oft. Das kommt vom Hirnschlag, sagt der Doktor Wolf. Da weint man gern.
Am schönsten ist es am Samstagmorgen. Dann kommt Frau Eberlein, die Masseuse, ins Haus. Das bissel Luxus, sagt die Mutter, das gönn ich uns. Im Doppelbett sitzt der Junge zwischen den Eltern, die von der resoluten, knochigen Frau durchgeknetet werden, oft unter Ahs und Ojs. Wenn der Vater sich nicht gut fühlt, ist es nur die Mutter, die bearbeitet wird. Frau Eberlein ist etwa dreißig, hat blonde störrische Locken und spricht heftigstes Frankfurterisch, in einem atemberaubenden Tempo:
Also, Sie sinn ja total verspannt, gell. Die Krankheit is kaa Ausred! Im Gecheteil. Grad Sie müsse was für Ihrn schwache Körper mache, gell. Ich hab Ihne schon hunnertma gesacht, Sie müsse auch unner de Woch mal e paar Kniebeuche mache. Und Rumpfbeuche. Unn mit der Arm schwinge, gell. Unn raus an die frisch Luft! Net denke, am Samstag kommt ja die Eberlein, die tut des schon mache. Selber aktiv sein, des isses! Des is wichtich, auch fürn Kopp, gell. Aber es hört ja kaaner uff mich. Ihr denkt, lass die nur babbele, die alt Schabrack!
Am Schluss versucht sie immer, sich den Jungen zu schnappen, um auch ihn durchzukneten, aber kreischend befreit er sich. Ein erwartetes und heißgeliebtes Ritual. Kinder verlangen stets nach Wiederholungen. Dieselben Spiele, dieselben Märchen, die gleichen Speisen. Kinder sind ja so konservativ.
Im Nebenhaus gibt es seit ein paar Monaten etwas Exotisches: ein China-Restaurant. Das erste in Frankfurt. Es heißt Shanghai und der Besitzer heißt Wang. Die Mutter rümpft die Nase, wenn der Onkel vorschlägt, da mal hinzugehen. Auch der Vater ist vorsichtig. Man kann ja nie wissen. Aber der Onkel ist abenteuerlustig. Er hat den Krieg in der französischen Fremdenlegion verbracht und schon Hammelhoden gegessen. Der Junge bewundert seinen Onkel. Nicht wegen der Hammelhoden, sondern weil er völlig angstfrei ist. Er ist auf einem Kamel geritten, hat bei El-Alamein auf Deutsche geschossen und stand, wie er lachend sagt, auf der richtigen Seite des Gewehrs. Vor allem aber hat er keine Angst vor Hunden, was bei Juden unüblich ist. Apropos Hunde. Natürlich kursieren über das Restaurant Shanghai die bizarrsten Gerüchte. Jeder verschwundene Hund wird in der Küche des China-Restaurants vermutet. Da kann Familie Wang noch so unterwürfig grüßen, wenn man vorbeigeht. Sie grüßen selbst Kinder. Das macht sie verdächtig.
Über dem China-Restaurant, im ersten Stock, wohnt Marie-Louise mit ihren Eltern. Sie ist so alt wie der Junge und nicht unhübsch, trotz der Zahnspange. Sie ist sogar humorvoll und kann Witze machen. Auch über sich selbst, obwohl sie an spinaler Kinderlähmung leidet, wie viele Kinder in diesen Jahren. Marie-Louise mag den Jungen. Manchmal besucht er das Nachbarmädchen, um mit ihm zu spielen. Die Mutter zwingt ihn dazu, weil sich das angeblich gehört. Du wirst rübergehen. Sei froh und dankbar, dass du gesund bist. Die kann nicht schön spielen, quengelt der Junge. Aber es sind nicht die Beinschienen, die das gemeinsame Spielen schwermachen, es sind die unterschiedlichen Welten, in denen kleine Mädchen und kleine Jungen leben. Mädchen wollen immer Vater-Mutter-Kind spielen, Jungen Hoppalong Cassidy. Das geht schwer zusammen. Ein Cowboy als Familienvater? Undenkbar. Und doch geschieht immer wieder ein kleines Wunder. Der Junge als Papa, Marie-Louise als Mama und der Teddy als Kind, und die Zeit verfliegt und die Mutter muss irgendwann anrufen, damit der Herr Sohn sich bequemt, endlich nach Hause zu kommen.
Die nächste Seitenstraße ist Einbahnstraße. Er schaut nach rechts, kein Auto zu sehen. In wenigen Schritten ist er auf der anderen Seite. An dem großen Postgebäude vorbei und zum Zeitungsstand. Hier bleibt er stehen. Die Quick oder die Revue interessieren ihn nicht. Es sind die Comics, die ihn magisch anziehen.
Donnerstags kommt die Lesemappe ins Haus. Dann beginnt die Jagd. Der Vater Spiegel, die Mutter Film und Frau. Der Junge schnappt sich Das Sternchen (»Kinder haben Sternchen gern, Sternchen ist das Kind vom Stern«) und rennt aufs Klo. Hier hat er Ruhe, kann »Jimmy das Gummipferd« anschauen und »Reinhold, das Nashorn« von Loriot. Oder Rätsel lösen. Wie heißt die Hauptstadt von Honduras? Tegucigalpa!
Manchmal kauft ihm der Vater ein Tarzan-Heftchen oder Phantom, wenn sie am Sonntagmorgen ins Café Kranzler kommen und sich einen Platz am Fenster suchen. Das Kranzler hat einen eigenen Zeitungskiosk im Pullmanwagen-Stil und eine Mamsell läuft mit einem Zigaretten-Bauchladen herum.
Betritt man das Kranzler, kommt man in eine andere Welt. Sie ist warm, riecht nach Kaffee und Zigarettenrauch. Im großen Saal spielt ein Caféhaus-Orchester. Das K.-u.-k.-Quartett, wie der Vater es ironisch nennt. Klavier, Kontrabass, Schlagzeug und dazu der feiste Ferenc, der ungarische Teufelsgeiger. Er hat gelacktes, schwarzes Haar und ein Menjoubärtchen. Regelmäßig verlässt er das Podest und geht dann auf seiner Fidel schabend von Tisch zu Tisch. Das ist dem Jungen immer peinlich. Er wird rot, wenn der Mann ihn anspielt und angrinst. Alle Augen sind dann auf ihn gerichtet. Alle erwarten, dass der Vater erst ihm und anschließend er dem Musiker Geld zusteckt. Wie im Zoo, mit den Erdnüssen am Elefantengehege, wenn sich die Rüssel fordernd nähern.
Aber der Vater überlässt den Sohn seinem Schicksal und verschwindet hinter einer Zeitung. Er spricht nicht nett über die Ungarn. Alles Nazis, sagt er. Noch kurz vor Kriegsende haben sie die Juden in die Donau getrieben. Tausende. Meinst du, der war dabei, will der Junge wissen. Ist mir egal, sagt der Vater. Er sieht jedenfalls aus wie ein Pfeilkreuzler! Klasse, denkt der Junge, Pfeilkreuzler! Er stellt sich Tempelritter vor, auf gepanzerten Pferden.