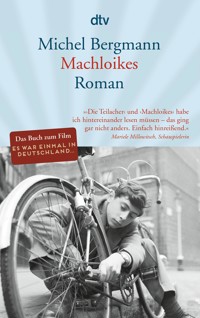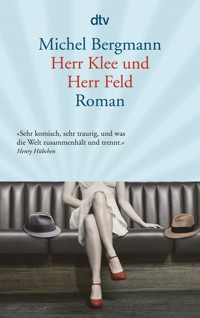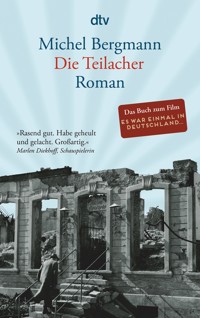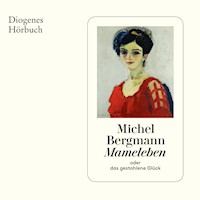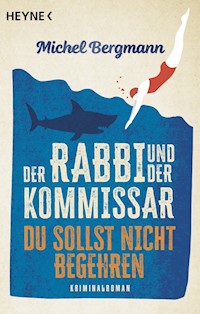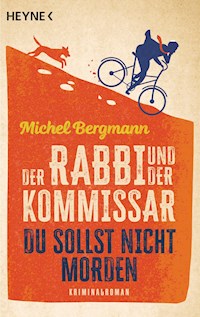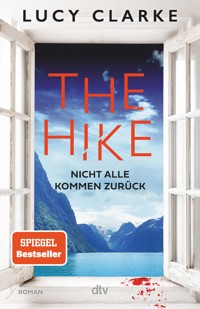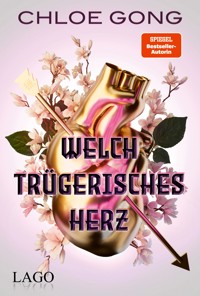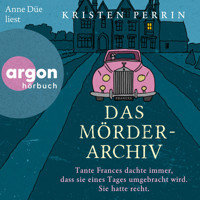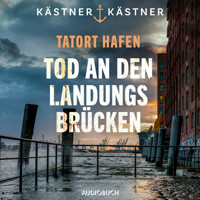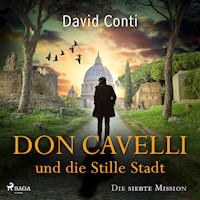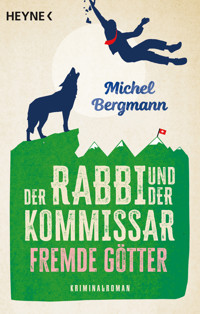
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Rabbi-und-Kommissar-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Glaub nicht alles, was du zu glauben glaubst
Man sieht den Leuten ihre Vergangenheit nicht an der Nasenspitze an. Als Rabbi Henry Silber¬baum erfährt, dass ein Mitglied seiner Gemeinde einst Anhänger einer Sekte im Jura war, reist er selbst dorthin, um mehr über die Hintergründe zu erfahren. In den luftigen Höhen der Schweizer Alpen trifft er auf den selbst ernannten Guru. Die beiden Männer liefern sich einen heftigen Schlagabtausch über Gott. Ausschließlich ver¬bal natürlich, doch kurz darauf wird der Guru tot aufgefunden – und plötzlich ist Henry Hauptver¬dächtiger in einem Mordfall …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Ähnliche
Das Buch
Man sieht den Leuten ihre Vergangenheit nicht an der Nasenspitze an. Als Rabbi Henry Silberbaum erfährt, dass ein Mitglied seiner Gemeinde einst Anhänger einer Sekte im Jura war, reist er selbst dorthin, um mehr über die Hintergründe zu erfahren. In den luftigen Höhen der Schweizer Alpen trifft er auf den selbst ernannten Guru. Die beiden Männer liefern sich einen heftigen Schlagabtausch über Gott. Ausschließlich verbal natürlich, doch kurz darauf wird der Guru tot aufgefunden – und plötzlich ist Henry Hauptverdächtiger in einem Mordfall …
Der Autor
Michel Bergmann, geboren in Basel, Kinderjahre in Paris, Jugendjahre in Frankfurt am Main, lebt heute in Berlin. Nach Studium und Job bei der »Frankfurter Rundschau« landete er beim Film: zuerst als Producer, dann als Regisseur, zuletzt als Drehbuchautor u.a. »Otto –Der Katastrofenfilm«, »Es war einmal in Deutschland«. Seit ٢٠١٠ ist er auch Romanautor: u.a. »Die Teilacher«, »Herr Klee und Herr Feld«, »Weinhebers Koffer«. Mit der Reihe um den ermittelnden Rabbi Henry Silberbaum tritt er erstmals als Krimiautor in Erscheinung.
Lieferbare TitelDer Rabbi und der Kommissar:Du sollst nicht morden (1)Du sollst nicht begehren (2)Fremde Götter (3)
Michel Bergmann
Kriminalroman
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 12/2023Copyright © 2023 by Michel Bergmann
Copyright © 2023 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Joscha Faralisch
Umschlaggestaltung: Martine Eisele, München, unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock.com (Joel Masson, Benguhan)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-30898-8V001
www.heyne.de
Ihr werdet sein wie der Herr und wissen, was gut und böse ist.
(1. Buch Moses 3,5)
1
Die Westend-Synagoge in Frankfurt am Main leuchtet in der Morgensonne. Im Jahr 1910 eingeweiht, entspricht sie dem damaligen Zeitgeschmack des assimilierten jüdischen deutschen Bürgertums. In den prosperierenden Gemeinden der aufstrebenden Metropolen der Kaiserzeit wurden zahlreiche prächtige Synagogen, oft auch in den Zentren der Städte, errichtet. Mit der Emanzipation der Juden wuchs ein gesundes Selbstbewusstsein. Viele Architekten der wilhelminischen Epoche orientierten sich an den Kriterien des aufkommenden Jugendstils, der maurischen Kultur oder, wie bei der hiesigen Synagoge zu besichtigen, an der assyrisch-ägyptischen Bauweise. Die Pläne der Westend-Synagoge stammen von einem deutschen Architekten, der ironischerweise später NSDAP-Mitglied wurde. In der Reichspogromnacht wurde das mächtige Gebäude lediglich gering beschädigt, denn für ein Niederbrennen war die Nähe zu den umliegenden Wohnhäusern hinderlich. Es ist allerdings exemplarisch, dass bis heute vor den Synagogen, wie vor den meisten jüdischen Einrichtungen in Deutschland, Polizisten mit Maschinenpistolen patrouillieren müssen, um Menschen und Gebäude zu schützen.
An der Straßenecke vor der Westend-Synagoge steht zusätzlich eine Schildwache. Die Straße ist durch Betonpoller eingeengt. Am Straßenrand steht ein Polizeifahrzeug.
Aus dem Gebäude ist Gesang zu hören.
Es ist der Vormittag des Schabbat, und die Synagoge ist gut besucht. Mit den letzten Zeilen eines gesungenen Tora-Verses stellt der junge Rabbiner Henry Silberbaum die Tora zurück in den Schrein, schließt danach die Tür und zieht den reich bestickten Samtvorhang davor. Anschließend begibt er sich hinter das Rednerpult, um mit seiner Predigt zu beginnen. Die Gemeinde ist wie immer in freudiger Erwartung, denn die Vorträge des Rabbis sind nicht nur klug, sondern auch unterhaltsam. Außerdem ist er ein gut aussehender Mann, der vor allem beim weiblichen Publikum gern gesehen und gehört ist. Er ist so wohltuend anders als sein Mitstreiter Rabbiner Gad Aronsohn, der sich der älteren Generation zugehörig und somit mehr der orthodoxen, konservativen Tradition verpflichtet fühlt. Die beiden festangestellten Rabbiner lösen sich turnusmäßig ab, und man kann bereits anhand der Besucherzahl in der Synagoge erkennen, wer die meisten Fans hat.
Das gilt gleichermaßen für die Schulklassen, die beide betreuen. Der Unterricht des Rabbis Silberbaum artet nicht selten in regelrechte Shows aus, was nicht nur zu Eifersüchteleien seines Kollegen führt, sondern auch zu Konsequenzen vonseiten des Gemeindedirektors Dr. Avram Friedländer.
Der ist im Übrigen kein Freund des jungen Rabbiners und sucht schon seit Langem nach einer Gelegenheit, ihn loszuwerden. Deshalb nutzt er die Leidenschaft des Rabbis, Kriminalfälle zu lösen und Verbrechen innerhalb der Gemeinde aufzuklären, um ihn abzumahnen.
Der Rabbi ist gewarnt: Noch ein Kriminalfall, und er ist seinen Job los.
Doch dieser ist ohnehin heute gefährdet, denn zu Beginn des Gottesdienstes kommt es zu einer Art religiöser Revolution, ja, fast zu Häresie, als der Rabbi vorab auf die bima tritt und verkündet: »Liebe Freundinnen und Freunde! Heute ist der Weltfrauentag, und zu diesem Anlass habe ich Ihnen etwas mitzuteilen: Wir werden ab jetzt mit der jahrhundertealten Tradition der Geschlechtertrennung in der Synagoge aufhören, jedenfalls in meinem Gottesdienst. Es ist meiner Meinung nach nicht nur nicht mehr zeitgemäß, sondern auch eine Form von Diskriminierung der weiblichen Gemeindemitgliederinnen, wenn wir weiter die strikte Geschlechtertrennung beibehalten. Also, ich biete Ihnen allen, Frauen, Männern und Kindern, an, sich in der kommenden Viertelstunde hinzusetzen, wo immer Sie es wollen. Auf geht’s!«
Zuerst liegt eine Art von Schockstarre über dem großen Betsaal, aber dann kommt Bewegung in die Menge. Frauen erheben sich auf der Galerie und streben ins Erdgeschoss. Ebenso gibt es Herren, die einmal die Welt aus der Perspektive der Frauen, also von der Galerie aus erleben möchten. Nach einer guten Viertelstunde hat sich eine erkleckliche Anzahl von Frauen unter die Männer gemischt, und der Rabbi geht sichtlich aufgekratzt zu seinem Rednerpult.
Auf dem Weg dorthin muss er an seinem Chef vorbei, der sich empört erhoben hat, ihn grob am Ärmel packt, zu sich zieht und ihm aggressiv zuflüstert: »Das wird Konsequenzen haben, das verspreche ich Ihnen!«
Der Rabbi schaut seinen Chef unschuldig an und flüstert ihm zu: »Zeigen Sie mir die Stelle in der Tora in der die Trennung von Frauen und Männern im Gottesdienst vorgeschrieben wird.«
Friedländer ist sprachlos. Als er sich setzen will, hat inzwischen Adele Mandel, die Vorsitzende des Gemeinderats, seinen Platz eingenommen und lächelt ihm frech zu. Ausgerechnet die Mandel, die jede Zurechtweisung oder Abmahnung des Rabbis torpediert und von ihm besessen zu sein scheint. Friedländer lächelt süßsauer zurück und sucht sich einen anderen Platz.
Henry Silberbaum ist inzwischen am Pult angekommen und klopft gegen das Mikrofon.
Der Rabbi blickt zu seinen Zuhörern im Saal. Dazwischen seine Mutter, die sich ebenfalls nach unten gesetzt hat. Die wie immer overdressed, mit ihrem türkisen Glitzerturban gut sichtbar, in der Mitte einer Reihe thront.
Daneben seine Sekretärin, die schlaue, vorlaute, kleine Frau Kimmel mit ihrer silberfarbenen Kurzhaarfrisur.
Zwischen zwei Herren sitzt Esther Simon, die hochgewachsene, attraktive Leiterin des Seniorenstiftes, deren Charme sich der Rabbi nur schwer entziehen kann. Ziemlich weit vorn, nah an der bima, sitzt Jossi Singer, sein Freund der Buchhändler, sein Schachpartner und Renaissance Man. Der Mann, der ein universelles Wissen besitzt und es trefflich versteht, auch immer darauf hinzuweisen. Einer seiner vielen Lieblingssprüche lautet: »Wir sollten mal wieder ausführlich über meine Bescheidenheit sprechen.« Henry sieht Herrn Axelrath, dessen Frau seinerzeit auf mysteriöse Weise starb. Es war der Rabbi, der den Mord aufklärte. Ebenso war er es, der sich ein Jahr später nicht mit dem Verschwinden der Olympiaschwimmerin Galina Bubka abfinden wollte und deren Ehemann Semjon Gurewitz als Verbrecher entlarvte. Galinas Mutter kann er ebenfalls im Publikum entdecken.
»Liebe Freundinnen und Freunde«, beginnt der Rabbi mit seiner Predigt …
Etwa dreißig Minuten später, nachdem der Rabbi seine Ansprache und das Schlussgebet beendet hat, läuft er aus dem Aufenthaltsraum abseits des großen Betsaals und rennt förmlich in Abi Sternlieb hinein, der ihn offensichtlich abfangen will. Der lange, asketische, etwa fünfzig Jahre alte Mann steht verlegen auf dem Flur herum.
Henry begrüßt den Friedhofsgärtner. »Herr Sternlieb, Schabbat Schalom!«
»Gut Schabbes, Herr Rabbiner. Haben Sie eine Minute?«
Henry schaut auf seine Uhr und sagt dann freundlich:
»Okay, eine Minute. Muss zum kiddusch. Genau wie Sie!«
Herr Sternlieb wirkt verunsichert.
»Es ist so, Sie hatten mir doch zugesagt, dass Sie …«
»… und ich habe es nicht vergessen. Ich kümmere mich, bestimmt. Ich habe sogar einen Bekannten, Kommissar Berking von der Kripo, gebeten, etwas herauszufinden. Ich werde ihn noch mal erinnern.«
Er geht langsam los.
Herr Sternlieb folgt ihm.
»Ich will Sie nicht drängen«, hört man ihn sagen, »aber es bereitet mir nach wie vor schlaflose Nächte. Und je länger es dauert, umso mehr beginne ich meine Frau zu verabscheuen. Sie ist eine Betrügerin.«
Der Rabbi bleibt stehen und schaut Sternlieb mit einem ernsten Gesichtsausdruck an.
»Das ist sie nicht, und das wissen Sie. Sie war jung und unerfahren und ist offensichtlich auf jemanden reingefallen.«
Wieder will der Rabbi losgehen, aber Sternlieb hält ihn zurück.
»Warum hat sie mir nie die Wahrheit gesagt? Damals nicht und heute nicht. Warum schiebt sie mir einfach das fremde Kind unter wie ein Kuckucksei?«
Henry legt dem Mann die Hand auf die Schulter.
»Weil Sie vermutlich vor zwanzig Jahren nicht die Größe gehabt hätten, ihr zu verzeihen und sie trotzdem zu heiraten. Aber inzwischen haben Sie Camilla großgezogen, und sie ist ein wunderbares Mädchen geworden, das Sie liebt. Sie ist Ihre Tochter. Das alleine zählt.«
Sternlieb scheint betroffen. Der Rabbi sagt leise: »Ich sage Ihnen etwas, was uns allen das Leben leichter machen würde: Sie sollten Ihre Frau einfach fragen, geradeheraus.«
Damit ist das Gespräch für den Rabbi beendet, aber Sternlieb reagiert verschnupft.
»Ich habe Ihnen bereits erklärt, warum das unmöglich ist.«
»Wissen Sie, die Wahrheit zu ertragen ist zwar schwer, aber das einzig Sinnvolle. Denn die Lüge ist noch schwerer zu ertragen. Das spüren Sie doch täglich, oder?«
Sternlieb bleibt stehen.
Er sagt jetzt, fast verzweifelt:
»Bitte Rabbi, lassen Sie mich nicht im Stich. Sie sind meine einzige Hoffnung.«
Der Rabbi nimmt Sternliebs Hand in seine beiden Hände.
Der verzweifelte Mann ist den Tränen nah.
»Ich habe es Ihnen zugesagt, und dabei bleibt es. Aber geben Sie mir noch ein wenig Zeit.«
»Danke. Ich weiß, Sie sind ein guter Mensch.«
»Gutmütigkeit ist ein Stück Dummheit«, bemerkt der Rabbi und lächelt. »Sagt meine Mutter immer. Bis gleich.«
Im Vorraum der Synagoge, dort, wo sich auch die Garderobe befindet, ist ein langer Tapetentisch aufgebaut und mit einer weißen Papierdecke bedeckt. Darauf Wassergläser, in die aber auch Rotwein eingeschenkt wird. Dazu reicht man lejkach, eine Art Sandkuchen, eine stets trockene Angelegenheit. Sehr oft geht so ein Empfang, so ein kiddusch, auf die Einladung einer Familie zurück, die einen Grund zum Feiern hat.
Heute sind es die Lazars, die den kiddusch finanzieren, denn ihr Sohn Benny und seine junge Frau Camilla, geborene Sternlieb, sind Eltern geworden. Die junge Mutter hält das schlafende Baby im Arm. Eine jüdische Pietà.
Der Rabbi hat den baumlangen Benny in der Menge ausgemacht und geht auf die Familie Lazar zu. Nachdem er alle begrüßt hat, gesellt sich auch Stella Sternlieb dazu und hakt sich kokett bei ihrer Tochter unter.
»Rabbi Silberbaum«, gurrt sie, »wie finden Sie das?« Dabei zeigt sie auf das kleine Mädchen.
»Kol hakawot! Unberufen!«, merkt der Rabbi an. »Wie heißt sie denn, die neue kleine Erdenbürgerin?«
»Rachel«, sagt Camilla stolz.
»Nach der Mutter meines Mannes«, fügt Frau Sternlieb an.
»Danke für den kiddusch«, sagt Henry, und Herr Lazar nickt gönnerhaft.
»Ist doch selbstverständlich.«
»Bei so einer simcha«, fügt die kleine, runde Frau Lazar an und küsst ihre Schwiegertochter auf die Wange, um sich dann umzublicken und anzufügen: »Wo bleibt denn Abi?«
»Papa hat sich nicht wohlgefühlt«, sagt Camilla rasch. »Er wollte lieber nach Hause.«
»Was Ernstes?«, fragt Lazar.
»Ach was! Er ist in letzter Zeit a kallike«, meint Stella Sternlieb scherzhaft.
Der Rabbi lächelt. Eher in sich hinein, denn er weiß ja genau, weshalb sich Abi Sternlieb in den letzten Monaten von seiner Frau fernhält.
Zehn Minuten später steht der Rabbi neben Frau Mandel, zwei weiteren Damen und seiner Mutter, die ihn alle noch einmal zu seiner Aktion beglückwünschen.
»Das war toll, Rabbi. Es wertet uns Frauen ungeheuer auf, keine Frage«, meint Adele Mandel, »aber ich befürchte, es war eine einmalige Aktion zum Frauentag.«
»Nein«, meint Henry, »das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen.«
»Ich bin ziemlich sicher«, sagt die Vorsitzende des Gemeinderats, »dass Doktor Friedländer darauf bestehen wird, den alten Ritus beizubehalten. Männer geben ihre Privilegien doch nur unwillig ab, oder?«
Der Rabbi denkt einen Augenblick nach, dann sagt er: »Das stimmt, aber irgendwann müssen sie darauf verzichten. Sonst rollt die Zeit über sie hinweg. Wenn schon Privilegien, dann für jeden.«
»Ach Cilly«, sagt eine der Frauen zu Henrys Mutter, »wenn doch nur alle Männer so wären wie Ihr Sohn!«
Cilly Silberbaum lächelt verschmitzt: »Simone, Sie kennen ihn nur als Rabbiner. Ich kenne ihn als Sohn!«
Alle lachen.
Ein trüber Montagmorgen. Der Rabbi hat sein Rennrad am Gitter des Gemeindezentrums angeschlossen, nimmt flott die wenigen Stufen, die zum Eingang führen und wird prompt von Ron, einem der israelischen Security-Männer, vor der Schleuse aufgehalten. Der drückt ihm stumm einen Zettel in die Hand.
Wie zu befürchten war, wird Henry, bevor seine Schulstunde beginnt, von Friedländer einbestellt. Als der Rabbi das Büro seines Chefs betritt, sitzt der dreiundsechzigjährige Rabbiner Gad Aronsohn bereits vor dem Schreibtisch des Chefs und schaut seinen jungen Kollegen missmutig an.
Bevor Henry etwas sagen kann, legt Friedländer los: »Was erlauben Sie sich? Für wen halten Sie sich? Für einen Revolutionär? Für Che Guevara? Wieso maßen Sie sich an, Jahrhunderte gültige religiöse Regeln zu ignorieren? Mit welcher chuzpe setzen Sie sich über die Tradition hinweg? Wollen Sie sich bei den Frauen beliebt machen? Vor Ihren ›Groupies‹ glänzen?«
Als der Rabbi antworten will, mischt sich Aronsohn ein: »Es gibt keinen Grund, mit der Tradition zu brechen. Ich sage das nicht, weil ich gegen Frauen bin, sondern im Gegenteil. Ich habe ja selbst eine. Henry, es hat mit religiösen Werten zu tun. Das findet im Übrigen auch meine Frau. Es sind Leitplanken, sozusagen, an die sich eine Gemeinde halten muss, ja, halten will, verstehst du? Du verunsicherst die Menschen, indem du Regeln brichst. Sie brauchen Gesetze, Orientierung und Rituale, die Hunderte von Jahren ihre Wirkung hatten. Mit dem gleichen Recht könntest du den Ablauf des Seder ändern oder am Jom Kippur das Essen erlauben.«
Als Friedländer wieder lospoltern will, meldet sich nun der Rabbi gelassen zu Wort:
»Einspruch, Euer Ehren! Seder oder Jom Kippur rütteln nicht an der Ungleichheit aller Menschen. Da sind alle gleich. Aber bei der Sitzordnung deklariere ich Frauen zu Menschen zweiter Klasse. Es gibt ja Synagogen, in denen Frauen förmlich versteckt sind und durch ein Gitter sehen müssen. Wie unter einer Burka.«
»Unsinn!«, kann man jetzt Friedländer vernehmen, »das ist ja in unserer Synagoge nicht der Fall. Da sitzen die Frauen auf der Galerie und können jeden sehen und von jedem gesehen werden. Deshalb wurde die Synagoge so gebaut, wie sie gebaut wurde.«
»Okay«, sagt Henry, »nennen Sie mir einen Grund, warum Frauen von Männern getrennt sitzen sollen.«
»Ursprünglich war die Befürchtung, dass Frauen die Ernsthaftigkeit stören und Männer ablenken könnten …«, meint Aronsohn.
»Ja, die Frauen sind nur in der Welt, um die Männer zu verführen! Genau aus dem Grund tragen Frauen in Mea Shearim Perücken oder Musliminnen Hijab. Wollen wir das? Im Gegenteil. Wir modernen Männer sollten dafür kämpfen, dass Frauen wie wir behandelt werden und nicht als minderwertig. Wieso maßen wir Männer uns an, Regeln aufzustellen, die die Hälfte der Menschheit diskreditieren. Und deshalb sitzen sie in Zukunft bei mir gemeinsam mit den Männern.
Und Gad, du kannst das gern vom Beth-Din überprüfen lassen. Es gibt kein Gebot, gegen das ich verstoße.« Friedländer und Aronsohn bleiben stumm, und der Rabbi geht ab, mit den Worten: »So, ich habe Unterricht. In meiner gemischten Klasse! Regt sich auch keiner drüber auf, oder?«
Vor wenigen Sekunden noch war es im Klassenzimmer unerträglich lebhaft und laut, aber nun, seitdem Rabbi Silberbaum den Raum betreten und seine lederne abgegrabbelte Aktentasche auf den Tisch geworfen hat, ist es mit einem Schlag still.
»So, Leute«, sagt er ruhig, »wir müssen heute über Chanukka sprechen. Nachdem ich mich zusammen mit Frau Kimmel vergebens um diverse Aufführungsrechte bemüht habe und wir feststellen mussten, dass da Mondpreise aufgerufen werden, habe ich mich entschlossen, mit euch gemeinsam ein Stück für Chanukka zu entwickeln.«
Die Kinder klopfen ausgelassen auf die Tischplatten.
»Moment«, unterbricht Henry den Jubel, »das heißt aber nicht, dass wir unseren regulären Unterricht vernachlässigen. Wir werden hier über Ideen reden, aber die Proben finden dann am Nachmittag im Gemeindesaal statt. Damit das klar ist.«
Felix Heumacher, der größte nudnik, die Nervensäge in seiner Klasse, meldet sich zu Wort.
»Herr Silberbaum, mit Verlaub, das ist harte Arbeit: Texte entwerfen, Proben, vermutlich mit Musik und Tanz. Dann habe ich noch Bar-mizwa-Unterricht. Wie soll ich das packen?«
»Du musst ja beim Theaterstück nicht mitmachen. Es zwingt dich keiner«, sagt der Rabbi lächelnd.
Die Kinder lachen. Ilana Leibowitz ruft: »Wär sogar besser!«
Mit einer Geste sorgt der Rabbi wieder für Ruhe.
»Scheket! Ich wollte es nur mal ankündigen. Wie wir das dann regeln, können wir immer noch klären. Jetzt gilt es erst mal, dass wir den Vorstand von der Idee überzeugen, denn dafür brauchen wir einen Etat. Ich möchte, dass sich jeder von euch Gedanken macht, wie so ein Stück aussehen könnte.«
Die Kinder haben verstanden.
»Ach, und noch etwas«, fügt der Rabbi an, »bitte kein Historiendrama mit Seleukiden und Makkabäern und falschen Bärten und Kostümen, das kostet nur Geld. Modern, heutig, kapiert?«
Miriam Willner meldet sich. »Wie wäre es mit einem Musical, so einer Art von Revue?«
»Revue finde ich topp!«, meint der Rabbi, und die Kinder klopfen auf ihre Tische. »Wer spielt ein Instrument?«
Einige Hände gehen hoch.
»Was ist mit dir, Eli, du spielst doch Klavier, wenn ich mich recht erinnere?«, fragt der Rabbi einen der Jungen.
Eli druckst herum. »Ja, schon. Aber wenn ich Sie höre, habe ich das Gefühl, dass ich nichts kann.«
»Quatsch«, meint Henry, »erstens bin ich dreimal so alt wie du und spiele dreimal so lang und zweitens ist das euer Stück und euer Ding, und ich werde keine Taste anschlagen, versprochen. In der Probe ja, aber nicht in der Show. So weit käme es noch.«
Die Kinder schauen ihn erstaunt an.
»Wo waren wir stehen geblieben?«
»Du sollst keine fremden Götter haben neben mir«, ruft einer.
»Sehr schön«, meint der Rabbi, »ein Gebot, das leicht zu verstehen ist. Wer möchte etwas dazu sagen?«
Ein Mädchen, Rifka Wahrmann, meldet sich. »Ich glaube, dass man dieses Gebot heute auch als Metapher sehen kann. Für viele ist Reichtum göttlich, also ein schickes Auto oder ein Haus. So könnte das auch gemeint sein, oder?«
»Sehr richtig, Rifka«, meint der Rabbi, »du sollst keine fremden Götter haben bedeutet aber auch vom Weg abkommen, Gott die Existenz abzusprechen.«
»Und sich neue Götter suchen. Zum Beispiel im Internet oder im Kino«, ruft einer.
»Oder in der Politik«, eine andere.
Felix Heumacher meldet sich zu Wort: »Es fällt den Menschen leichter, sich selbst einen Gott zu schaffen, den man anbeten kann.«
Er ist zwar fraglos ein nudnik, aber er hat was drauf, denkt Henry.
2
Das Nordend ist ein ehemals kleinbürgerliches Viertel, vor dem die Gentrifizierung nicht haltgemacht hat. So sind in den letzten Jahren ganze Straßenzüge von Investoren aufgekauft und saniert worden. Viele der Altbauwohnungen sind dadurch in Eigentum umgewandelt worden, und nicht wenige Altmieter wurden vertrieben. Das hat zu Spannungen geführt, und es gab einige Demos bürgernaher Initiativen, die sich die Verteidigung des Viertels auf die Fahnen und Transparente geschrieben haben. Dass selbst linke und rechte Gruppierungen gemeinsam gegen »das Kapital« demonstrieren, ist keine gute Voraussetzung für eine Deeskalation.
Seit drei Jahren lebt das israelische Ehepaar Chava und Nissim Doran in Frankfurt. Es investierte sein Geld und einen hohen Bankkredit in das Restaurant Shuk, um Gästen gehobene israelische Küche zu bieten. Was zuerst in der nachbarschaftlichen Umgebung begrüßt wurde, ist in den letzten Monaten zu einem ernsthaften Problem geworden. Alteingesessene Bewohner machen neuerdings vor allem das Restaurant für die Gentrifizierung verantwortlich.
Zuerst waren es hasserfüllte, anonyme Schreiben oder Einträge bei Facebook, dann gefakte miese Bewertungen, dann wurden die Fenster des Restaurants nachts eingeworfen. Es war sogar ein Bericht darüber im Fernsehen, in den Regionalnachrichten.
All das erzählt der Wirt Nissim seinen beiden Gästen, dem Rabbi und seinem Freund, dem Hauptkommissar Robert Berking von der Mordkommission, die sich an diesem fast sommerlichen Abend im April einen Platz an einem Zweiertisch auf dem Bürgersteig unter der Markise erobern konnten.
Der Wirt hat die Bestellung aufgenommen und geht.
»Ich bin davon überzeugt«, sagt der Kommissar, »dass die Gentrifizierung und die sogenannte Vertreibung nur vorgeschoben sind und es schlicht um blanken Antisemitismus geht.«
»Da könntest du recht haben«, meint der Rabbi, »aber das Motiv zu kennen löst ja nicht das Problem der Wirtsleute.«
Der Rabbi denkt einen Moment nach und sagt dann:
»Er hat doch vorhin von irgendeinem Typen gesprochen, der sich als Provokateur besonders hervorgetan hat.« Berking schaut auf seinen Notizblock.
»Wernicke, Finn Wernicke«, vermutet der Kommissar, »ein altlinker Rocker. Eine bekannte Figur hier im Viertel. Er sucht sich immer einen Grund zum Stänkern. Er hat sich wohl ein paarmal vor dem Laden aufgebaut und rumgepöbelt. Wäre gut, jemand würde das nächste Mal ein Video machen, wenn er wieder auftaucht.«
Der Rabbi nickt. Dann sagt er nach einer kurzen Pause: »Okay, nun zu uns. Was hast du rausgefunden in der Sache Sternlieb?«
Der Kommissar blättert wieder in seinem Notizblock.
»Stella Sternlieb ist eine geborene Posner. Sie hat in der Elisabethenschule 2002 ihr Abitur gemacht und sich an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg beworben. Sie wurde aufgenommen und sollte im Herbst mit einem Kunststudium beginnen. Aber es wurde nichts daraus, denn …«
Der Rabbi unterbricht und zeigt mit dem Finger auf sein Gegenüber: »Sie wurde schwanger und hat Abi Sternlieb geheiratet. Das wissen wir.«
»Vielleicht darf ich weitersprechen?«, erwidert der Kommissar nicht unfreundlich. »Sie ist im Sommer mit einer Freundin zu einer längeren Reise aufgebrochen und befand sich in der Schweiz, bevor sie nach Frankfurt zurückkehrte. Laut Hotelmelderegister übernachteten sie zuletzt im Hotel du Lac in Nyon. Das ist erst einmal alles, bis jetzt.«
»Weiß man, wie die Freundin hieß?«, fragt Henry.
»Natalie Fuhrmann. Sie waren Klassenkameradinnen.«
»Vermutlich heißt sie heute nicht mehr Fuhrmann«, meint der Rabbi, »aber ich kriege das raus. Sonst noch was?«
»Es gab in dieser Zeit eine Art Sekte. Spirituell, Öko. Die schien anziehend zu sein für junge Leute. Mein Schweizer Kollege Utz Gerber hat davon berichtet. Über ihn werde ich sicher noch ein paar Infos bekommen. Also keine offizielle Amtshilfe, sondern alles am Rande der Illegalität. Das schmeckt ihm gar nicht.«
Wie aufs Stichwort kommt die Wirtin mit dem Essen.
Es ist fast Mitternacht. Der Rabbi sitzt im Eintracht-Trikot mit Boxershorts in seinem Schlafzimmer an seinem Rechner und hat die letzten dringenden Überweisungen per Onlinebanking erledigt. Er schaut auf die Uhr. Jeden Augenblick wird sich seine Freundin Zoe Schwarz aus New York per Zoom melden, dann ist es dort 18 Uhr, und sie kommt von der Arbeit nach Hause. Zoe! Wie lange führen sie nun schon eine Fernbeziehung? Mehr als vier Jahre ist es her, dass Henry aus den USA wieder zurück nach Frankfurt gekommen ist. Seinerzeit hatten sie sich auf der Jewish Academy in Brooklyn kennengelernt, wo Henry für ein Gastsemester als Dozent für mittelalterliches Judentum der sogenannten SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz tätig war. Es waren weltweit die herausragenden jüdischen geistigen Zentren zu dieser Zeit. Die hübsche, stupsnasige, agile, rothaarige, sommersprossige Zoe war eine Gasthörerin, und das auch nur, weil ihre Familie väterlicherseits aus Mainz stammt. Ihr Großvater Pinkas Schwarz konnte 1939 noch mit einem der letzten Flüchtlingsschiffe Deutschland verlassen und ging zuerst nach England. Ihr Vater Harold wurde bereits in den USA geboren und hat den Deutschenhass seines Vaters an seine Tochter Zoe weitervererbt. So kommt es, dass Henrys »Verrat« (O-Ton Zoe), ausgerechnet im Land der Täter zu leben und dort Rabbiner zu sein, ein Dauerthema ist, und deshalb ist nicht daran zu denken, dass Zoe und er je hier in Frankfurt zusammenleben würden.
Bereits ein Kurzbesuch in Deutschland ist für die dreißigjährige Frau eine wahre Zumutung. Aber nach langem Zureden scheint sie nun weichgeklopft zu sein.
Henry vernimmt ein Signal auf seinem Notebook und läuft zu seinem Schreibtisch. Die ewige Verlobte des Rabbis ist auf dem Bildschirm per Zoom zu sehen.
»Hi, sweetie!«
»And? What’s up, Rabbi? Bist du immer noch mit den Jugendsünden von Frau Sternberg beschäftigt?«
»Lieb! Sternlieb!«
»Anstatt deinen Job zu machen?«
»Zoe, darling, du übertreibst mal wieder. So sehr beschäftigt mich das auch wieder nicht. Es gibt Wichtigeres. Uns zum Beispiel. Hast du dir was überlegt?«
»Ich könnte in der season rüberkommen, wenn du magst. Schweren Herzens.«
»Super. Und dann bleibst du über new year’s eve!«
»Mein Dad darf das nie erfahren.«
Der Rabbi ironisch: »Und wenn, vergisst er es doch gleich wieder.«
»Very funny! Du weißt, das ist nicht leicht für mich, Neujahr in diesem verschissenen Land zu verbringen. Alles nur wegen dir. Die Leute sind dermaßen unfreundlich, it’s outrageous.«
Der Rabbi widerspricht.
»Manchmal frage ich mich, was ehrlicher ist? Die Muffigkeit oder die unaufrichtige Freundlichkeit.«
»Das ist doch keine Frage. Lieber unaufrichtig freundlich als ehrlich unhöflich und abweisend.«
»Wenn du meinst. Ich freue mich jedenfalls riesig, dass du dieses Jahr kommst. Und meine Freude ist ehrlich.«
»Ich muss ja kommen, um auf dich aufzupassen …«
Ein sonniger Morgen. Der Rabbi auf seinem Rennrad. Geschickt, wie ein Slalomspezialist, schlängelt er sich durch den Großstadtverkehr, während er telefoniert.
»Natalie Fuhrmann. Sagt Ihnen das was?«
Am anderen Ende der Leitung verneint Herr Sternlieb.
»Sie war eine Freundin Ihrer Frau. Sie waren in derselben Klasse und haben nach dem Abitur gemeinsam eine Reise gemacht. Unter anderem in die Schweiz.«
»Ja. Sie hat mir erzählt, dass sie in der Schweiz war. Bei einem Malkurs. Hat das was mit der – Sache – zu tun?«
Der Rabbi kommt vor dem Gemeindezentrum an.
»Keine Ahnung. Ich lasse Sie es wissen, wenn ich etwas rausgefunden habe. Machen Sie’s gut.«
Die kleine Gittertür öffnet sich automatisch. Der Rabbi schiebt sein Rad auf den Hof, schließt es am massiven Gitter ab und geht ins Haus. Hier wird er sofort von Ilan, einem der bulligen israelischen Security-Männer, angehalten. Henry weiß, ohne Witz kommt er an Ilan nicht vorbei.
»Okay, hier ist der Witz des Tages: Der Rabbi liegt im Krankenhaus. Da kommt der Synagogendiener mit Blumen zu ihm ins Zimmer und sagt: ›Lieber Rabbi, der Gemeinderat wünscht Ihnen baldige, gute Genesung. Dieser Beschluss wurde mit sieben zu fünf Stimmen gefasst‹.«
Ilan lacht, der Rabbi geht durch die Schleuse.
Der Rabbi sitzt auf dem Schreibtisch seiner Sekretärin und lässt die Beine baumeln, während Frau Kimmel hinter ihrem PC sitzt und mit ihm »Termine macht«.
»Herr Aronsohn ist ab dem Zwölften eine Woche weg. Dann haben Sie ›Notdienst‹.«
»Was ist mit seiner Klasse?«
»Am Vierzehnten Ausflug ins Museum Judengasse.«
»Okay. Es gibt Schlimmeres. Dann nehme ich meine Kids auch mit. Ein Abwasch. Weiter.«
»Ihr Artikel für die Allgemeine. Deadline am Zwanzigsten.«
»Um was geht es?«
»Ihr Lieblingsthema.«
»Antisemitismus. Weiter.«
»Bar-Mizwa-Unterricht Felix Heumacher.«
»Machen Sie was aus. Das wissen Sie besser.«
»Ach, Frau Simon kommt gleich.«
»Jetzt? Warum?«
»Sie sagten, wenn sie im Haus ist, soll sie reinschauen.«
»Stimmt.«
Er steht auf und nimmt sich noch einen Kaffee. In diesem Moment kommt die attraktive Heimleiterin ins Büro des Rabbis.
Esther Simon hat ihre langen Beine übergeschlagen, nippt an ihrem Kaffee und sitzt entspannt auf der Couch, während Henry im Büro hin und her geht und dabei doziert: »Ich kann dir nicht sagen, um was es geht, dafür ist die Angelegenheit zu delikat. Aber ich möchte, dass du mit dieser Legende in die Elisabethenschule gehst und überzeugend rüberkommst.«
»Das werde ich wohl schaffen.«
»Hast du dir die Namen gemerkt?«
»Klar, Chef! Natalie Fuhrmann und Stella Posner.«
»Sehr gut.«
»Wann machen wir mit meinem Religionsunterricht weiter?«
»Ich muss mit meinen Kids ein Chanukka-Stück einüben und habe einen Bar-mizwa-Jungen. Ich melde mich bei dir, außerdem weißt du ja schon fast alles.«
»Eben. Fast.«
Das Handy des Rabbis klingelt.
»Ja, Mom?« Pause. »Was?!«
Der Rabbi, beladen mit zwei prall gefüllten Einkaufstüten, schließt die Wohnungstür seiner Mutter auf. Von innen hört er die schwache Stimme seiner Mom: »Bubele? Bist du’s?«
»Nein, der Prophet Elijahu!«
Er geht in die Küche und verstaut seine Einkäufe im Kühlschrank und in einer Speisekammer.
»Kann ich dir was machen?«
»Nein, danke. Frau Löffler war hier und hat mir einen Tee gemacht.«
Der Rabbi geht jetzt ins Schlafzimmer, wo seine Mutter mit zwei Kissen im Rücken im Bett thront.
»Komm mir nicht so nah.«
»Ich hatte nicht die Absicht.«
»Vielleicht habe ich die Grippe.«
»Bestimmt hast du die Grippe. Oder Schlimmeres.«
»Danke für deine aufmunternden Worte, mein lieber Sohn.«
Henry setzt sich auf das Fußende des Bettes.
»Erzähl deiner alten Mutter. Was gibt es?«
»Nichts. Alles unverändert. Sagt dir der Name Fuhrmann etwas?«
»Fuhrmann? Fuhrmann? Es gab mal ein Wollgeschäft Fuhrmann hinter der Katharinenkirche. Warum?«
»Nur so. Jemand aus der Gemeinde wollte was wissen.«
»Du kannst doch deinen alten Buddy Jossi Singer fragen, der weiß doch alles über jeden.«
»Ja, aber dann weiß es auch gleich jeder. Es ist nicht wichtig, wirklich nicht. Was sagt der Arzt?«